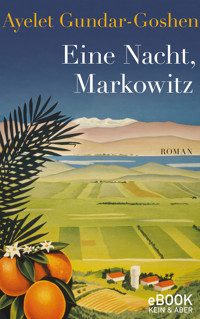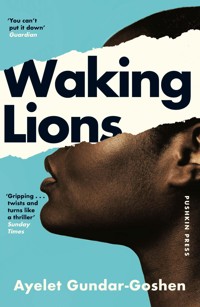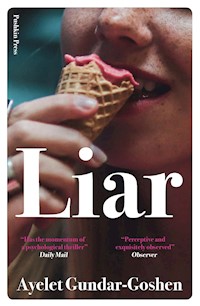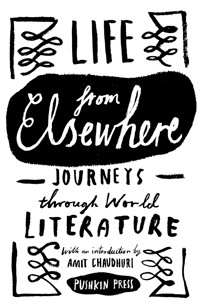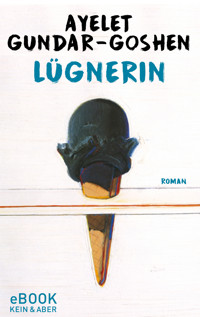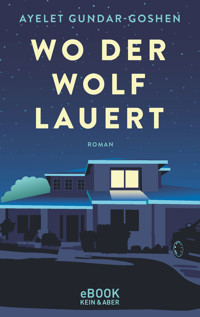
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lilach Schuster hat alles: ein Haus mit Pool im Herzen des Silicon Valley, einen erfolgreichen Ehemann und das Gefühl, angekommen zu sein in einem Land, in dem man sich nicht in ständiger Gefahr wähnen muss wie in ihrer Heimat Israel. Doch dann stirbt auf einer Party ein Mitschüler ihres Sohnes Adam. Je mehr Lilach über die Umstände des Todes erfährt, desto größer wird ihr Unbehagen: Ist es möglich, dass Adam irgendwie damit in Verbindung steht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
AYELET GUNDAR-GOSHEN, geboren 1982, studierte Psychologie in Tel Aviv, später Film und Drehbuch in Jerusalem. Ihrem ersten Roman Eine Nacht, Markowitz (2013) wurde der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt zugesprochen, 2015 folgte mit Löwen wecken ihr zweiter Roman, der international für Furore sorgte und zurzeit als TV-Serie verfilmt wird. Lügnerin, ihr dritter Roman, erschien 2017. Nachdem sie mit ihrer Familie einige Zeit in Kalifornien wohnte, lebt sie nun wieder in Tel Aviv.
ÜBER DAS BUCH
Lilach Schuster hat alles: ein Haus mit Pool im Herzen des Silicon Valley, einen erfolgreichen Ehemann und das Gefühl, angekommen zu sein in einem Land, in dem man sich nicht in ständiger Gefahr wähnen muss wie in ihrer Heimat Israel. Doch dann stirbt auf einer Party ein Mitschüler ihres Sohnes Adam. Je mehr Lilach über die Umstände des Todes erfährt, desto größer wird ihr Unbehagen: Ist es möglich, dass Adam irgendwie damit in Verbindung steht?
Für meine Mutter
und für Yoav
Erster Teil
RELOCATION
1
Ich sehe im Geist diese winzigen Fingerchen, die eines Neugeborenen, und versuche zu begreifen, wie sie zu den Fingern eines Mörders heranwachsen konnten. Der tote Junge heißt Jamal Jones. Auf dem Bild in der Zeitung sind seine Augen samtschwarz. Mein Junge heißt Adam Schuster. Seine Augen sind blau wie das Meer von Tel Aviv. Es heißt, er habe ihn umgebracht. Aber das stimmt nicht.
2
Ich heiße nicht Lila. Die Amerikaner haben Mühe, Lilach zu sagen, deshalb nennen mich hier alle Lila. Aber ich heiße nicht Lila.
Mit Michael ist es leicht. Sie sprechen seinen Namen einfach Maikel aus. Er korrigiert sie nie. Das wäre unhöflich. Und während ich mich immer mit »Lilach« vorstelle und die neue Bekanntschaft vom Zweifel profitieren lasse, ob sie mich in Lila verwandelt – was ich zwar ohne Protest hinnehme, aber nicht unterstütze –, sagt Michael längst »Maikel«. Er behauptet, das sei egal, beinahe dasselbe. Doch in meiner Fantasie hat, als sie ihn viereinhalb Monate nach Jamals Tod an den Polygrafen anschlossen und nach seinem Vornamen fragten, bei der Antwort »Maikel« die Nadel gezittert.
Wenn wir miteinander schlafen, nenne ich ihn Michael. Einmal habe ich ihn Maikel genannt, und das fühlte sich an, wie mit einem anderen zu schlafen.
Als Adam geboren wurde, bekam er einen neutralen Namen. Einen, der auf Hebräisch und Englisch funktioniert. Einen Namen, der den Amerikanern durch die Kehle rinnt wie guter kalifornischer Wein, ihnen nicht im Hals stecken bleibt wie Lilach und Michael, die gleich beim ersten Hören signalisieren: nicht von hier. Wir haben ein Kind in den USA großgezogen. Haben seine israelische Identität im Schrank verstaut, zusammen mit den Fußballpokalen, die Michael vom Gymnasium aufbewahrt – zur Erinnerung, nicht weil sie irgendeinen Nutzen hätten. Wir haben ein amerikanisches Kind großgezogen, das mit amerikanischen Kindern in die Highschool geht, und jetzt soll es ein anderes amerikanisches Kind umgebracht haben.
3
Jamal Jones. Dein Gesicht sieht gutmütig aus, aber deine Größe wirkt bedrohlich. Deine Schultern sind breit, dermaßen breit, dass sie dich womöglich selbst überrascht haben. Vielleicht ist es schnell gekommen, ein sommerlicher Wachstumsschub, bei dem du dich, ohne Vorwarnung, von einem schmalen, kleinen Jungen zu einem großen, breiten Teenie entwickelt hast. Aber das Gesicht hat das Tempo nicht mithalten können, der Körper ist in die Länge und Breite gewachsen, doch die Augen sind noch die eines Kindes – genauso wie die Lippen, ohne den geringsten Bartansatz, ein bisschen vorgeschoben, kindlich süß irgendwie.
Nachts auf der Straße hätte ich Angst vor dir gehabt. Hätte nicht innegehalten, um in deine Augen zu schauen, die mir jetzt, auf dem Zeitungsfoto, gütig und sympathisch vorkommen. Wahrscheinlich wäre ich einen Schritt schneller gegangen. Hätte die Hand in die Tasche gesteckt, um mich zu vergewissern, dass das Telefon da ist, für alle Fälle. Ich wäre auf die besser beleuchtete Straßenseite gewechselt und hätte abgewartet, bis du – ein breitschultriger Schwarzer – um die nächste Ecke verschwunden wärst.
Und hätte ich Adam dabeigehabt, wäre ich doppelt nervös gewesen. Nicht nur eine Frau auf der Straße und ein schwarzer Mann hinter ihr, sondern eine Frau mit einem Kind, das beschützt werden muss. Dass ihr im gleichen Alter wart, spielt keine Rolle. Du warst ein Mann, Jamal, und Adam ist ein Kind. Klein und schmächtig und die Schultern ein bisschen hängend, wie ein Vogeljunges, das noch nicht flügge ist. Und deshalb verstehe ich es nicht. Dein Foto in der Zeitung. Die gutmütigen Augen. Die breiten Schultern. Kaum vorstellbar, dass ich die ganze Zeit Angst vor dir hatte, wo du vielleicht Angst vor mir hättest haben sollen, vor dem, was ich hatte gebären können.
Jetzt habe ich ständig Angst, Jamal. Angst vor allem. Damals habe ich mich noch nicht so viel gefürchtet, nur selten mal. Ich erinnere mich: Jeden Abend zogen wir drei die Hausschuhe aus, stellten sie auf den Parkettboden und gingen schlafen. Im Doppelbett las ich am Smartphone Nachrichten aus Israel, bis Michael »Es ist schon spät« sagte und per Knopfdruck die Läden runterließ. Jenseits der Läden lag das Grundstück, das zum Haus gehört, und dahinter eine ruhige, grüne Weite, die an eine ruhige, grüne Avenue reichte, in einer der ruhigsten, grünsten und sichersten Städte der Vereinigten Staaten von Amerika.
4
Am Abend des jüdischen Neujahrsfestes betrat ein Mann mit einer Machete eine Reformsynagoge in einer der ruhigsten, grünsten und sichersten Städte der Vereinigten Staaten. In der Synagoge befanden sich zweihundertzwanzig Betende und fünfzehn Angestellte der Cateringfirma. Im Gemeindesaal, der sonst für Bar-Mizwa-Feiern diente, standen weiß eingedeckte Tische für den Neujahrs-Kiddusch. An den Wänden reihten sich Hochstühle für Kleinkinder, denn zu den regulären Betern dieser Synagoge, die zumeist das Rentenalter erreicht hatten, gesellten sich an den Hohen Feiertagen auch deren Kinder, Enkel und Urenkel. Der Gottesdienst im oberen Stockwerk war gerade zu Ende, und die Besucher strömten die Treppe herab. Unten im Gemeindesaal trugen die Angestellten Schalen mit Äpfeln und Gläser mit israelischem Honig auf.
In den Nachrichten hieß es später, sie hätten noch Glück gehabt: Der Attentäter in der Synagoge von Pittsburgh war mit einem halb automatischen Gewehr bewaffnet gewesen und hatte elf Betende erschossen, bevor er festgenommen wurde. Hier in Palo Alto waren vier Frauen verletzt und nur eine getötet worden. Ich verstand, was sie in den Nachrichten meinten, wusste jedoch, dass die Eltern von Leah Weinstein es gewiss nicht als Glück empfanden. Ihre Tochter hatte an der Tür gestanden, als der Kerl mit der Machete hineingestürmt war.
Im Fernsehen wirkte sie jünger als ihre neunzehn Lebensjahre. Vielleicht wegen des Make-ups. Sie hatte ein rundes Gesicht mit sanften, braunen Augen, und das Make-up machte sie nicht etwa älter, sondern unterstrich noch ihre jugendliche Ungeübtheit. Auf Fotos, die kurz vor dem Anschlag aufgenommen worden waren, stand sie im weißen Festkleid am Eingang der Synagoge. Sie hatte die Arme um den Leib geschlungen, wie jemand, der sich eigentlich nicht gern fotografieren lässt, es jedoch hinnimmt, weil die Familie es wünscht. Ein wohlerzogenes Kind. Aber als jener Mann mit der Machete in die Synagoge rannte, verhielt sich Leah Weinstein nicht wie ein Kind. Sie drängte ihre Großmutter nach hinten und sprang vor sie, und das war das Letzte, was sie tat.
In den Tagen nach dem Anschlag sah ich mir das Video mehrmals an. Die mollige junge Frau im weißen Kleid steht am Eingang, neben ihren Großeltern. Im Hintergrund singt der Synagogenchor ein Potpourri von Festtagsliedern. Es ist schwer, den genauen Moment zu erfassen, wo das fröhliche Singen und Plaudern in Schreckensschreie umschlägt. Zuerst hört man Geräusche von draußen, kann aber noch nichts sagen, denn es ist Mädchenkreischen, und manchmal lässt sich zwischen Lachen und Schrecken schwer unterscheiden. Doch schlagartig ist jeder Irrtum ausgeschlossen: Das Lächeln schwindet von den Gesichtern, Menschen suchen Deckung. Der Mann mit dem Kapuzenpulli stürmt herein, und alle fliehen vor ihm, rennen einander um, außer Leah Weinstein, die, statt die Flucht zu ergreifen, ihre Großmutter nach hinten stößt, und vielleicht hat dieses abweichende Verhalten die Aufmerksamkeit des Mannes auf sie gelenkt. In dem Video beugt er sich einen Moment über sie, nur ganz kurz, und läuft dann mit gezücktem Messer in den Synagogenraum weiter. Der Gottesdienstbesucher, der das alles von der Galerie gefilmt hatte, war dem Attentäter mit der Kamera gefolgt, und deshalb sah man nicht, was mit Leah in den folgenden Sekunden geschah, hörte aber die Schreie ihrer Großeltern und auch die eines kleinen Kindes neben ihnen, das Leah gar nicht gekannt hatte, das junge Mädchen in Weiß aber blutüberströmt zusammenbrechen sah. Als die Notfallsanitäter ankamen, hatte Leah schon so viel Blut verloren, dass sie ihr nicht mehr helfen konnten.
Wir waren zu Hause, als von dem Anschlag berichtet wurde. Ich weiß noch, wo jeder von uns gestanden hat: Michael draußen am Grill, mit seinem Bruder Assi, der gerade erst mit Yael und den Zwillingen aus Israel auf Besuch gekommen war, Adam hinten am Pool, mit Tamir und Aviv, Yael und ich in der Küche, bei dem Versuch, einen verunglückten Honigkuchen zu retten. Plötzlich kam Michael mit dem Telefon vom Garten herein und sagte, »Es hat einen Anschlag gegeben«, und als Yael besorgt fragte, »Wo? In Haifa? In Tel Aviv?«, schüttelte er den Kopf und sagte: »Nicht in Israel, hier.«
Wir verfolgten die Nachrichten beim Abendessen. Nach dem Dessert gingen die Jungen rauf, sich was am Computer angucken, und wir saßen im Wohnzimmer und sahen uns die Debatten im Fernsehen an. Spät in der Nacht, als wir im Bett lagen, schickte uns jemand über WhatsApp das Video aus der Synagoge. Ich wusste nicht, ob wir es anschauen sollten, meinte, vielleicht sei das respektlos gegenüber den Leuten, die dabei gewesen waren. Es war schließlich kein Actionfilm. Das Leben echter Menschen war in jenem Moment zerstört worden. Aber Michael wollte es unbedingt sehen. Das sei wichtig, sagte er: »Wir schauen es uns ja nicht zum Vergnügen an, sondern um zu verstehen, was dort geschehen ist, und zu überlegen, wie wir damit umgehen, falls es wieder passieren sollte.« Wir sahen uns das Video einmal an. Dann noch mal. Und als Michael es erneut anklickte, sagte ich, das reicht.
Spät in der Nacht rief meine Mutter aus Israel an und wollte weitere Einzelheiten hören. Die Nachricht, die ich ihr gleich nach dem Anschlag geschickt hatte, genügte ihr nicht. Ich versicherte ihr erneut, dass wir alle unversehrt waren, erzählte ihr, was man hier wusste.
»Bei uns in den Nachrichten hieß es, es sei ein Schwarzer gewesen. Seit wann greifen Schwarze denn Juden an? Das war doch sonst immer was für Weiße. Ein Anschlag genau am Neujahrsabend, das heißt, er hatte das geplant«, sagte sie, fügte hinzu, sie habe heute ein Geschenk für Adam zur Post gebracht, sicher bekäme er es in ein paar Tagen, und fragte dann: »Hast du das Video aus der Synagoge gesehen?«
»Ja«, sagte ich, »das ist furchtbar.«
Meine Mutter seufzte am Telefon. »Sag mir jetzt bloß nicht mehr, bei euch dort sei es leichter, Kinder großzuziehen.«
In der Nacht hatte ich Albträume, an die ich mich beim Aufwachen nicht mehr im Einzelnen erinnern konnte, doch die junge Frau aus der Synagoge war darin vorgekommen, so viel wusste ich. Am Morgen bat ich Adam, sich das Video nicht anzuschauen, falls jemand es ihm schicken sollte. Er fragte, ob Michael und ich es angesehen hätten. Ich verneinte.
Am Morgen der Beerdigung brachten Michael und ich Adam in die Schule und fuhren dann weiter zum Friedhof. Wir kannten die Familie nicht und gehörten auch nicht der Reformsynagoge an, wollten uns jedoch solidarisch zeigen. Auf dem Parkplatz trafen wir weitere Israelis, die zur Unterstützung gekommen waren. Jemand erzählte uns, dass Leah Weinstein vor zwei Jahren die Highschool beendet hatte, die auch Adam besuchte, und danach zum Studium nach Boston gezogen war. Die Eltern hatten ihr das Flugticket gekauft, damit sie zum Fest heimkommen konnte. Die Israelis versammelten sich und sprachen leise Hebräisch, in der Nähe standen die amerikanischen Juden und unterhielten sich ebenso leise auf Englisch, und beide Gruppen sagten dasselbe: Unfassbar, dass so was in Palo Alto geschehen war. Danach gingen wir auf den Friedhof. Leah Weinsteins Eltern weinten bitterlich. Sie war ihr einziges Kind gewesen.
Am Nachmittag holten wir Adam von der Schule ab und fuhren alle zu der Synagoge, wo es passiert war, um auf dem Bürgersteig davor eine Kerze anzuzünden und eine Blume niederzulegen. Auf dem Vorplatz hatten sich bereits zahlreiche Menschen und auch einige Nachrichtenteams versammelt. Eine Fernsehreporterin mit blondem Pagenkopf sprach mit ernstem Blick in die Kamera. Wir alle lauschten ihr, als sei diese fremde Frau befugt, uns zu erzählen, wer wir waren und was uns zugestoßen war. »Paul Reed ist in East Palo Alto geboren und aufgewachsen. Als sein Wohnviertel von Hightech-Leuten aus dem Silicon Valley überschwemmt wurde, stiegen die Mieten so sehr, dass die Familie nach Oakland übersiedeln musste. Rund eine Stunde bevor er sich mit der Machete in der Tasche zum Bus nach Palo Alto aufmachte, verfasste er einen antisemitischen Post auf Facebook. Gemäß seinen Eltern habe sich sein psychischer Zustand in den letzten Wochen verschlechtert. Früher sei er wiederholt in einer Klinik für Geisteskranke gewesen.«
»Der ist nicht geisteskrank, der ist ein Scheißantisemit und Terrorist«, schimpfte Assi leise. »Die wollen ihn ja nur in einen unzurechnungsfähigen Irren verwandeln und freilassen.«
»Kein Mensch wird ihn freilassen«, erwiderte Michael, »aber man muss in Betracht ziehen, dass der Mann mehrmals in der Klinik gewesen ist. Möglich, dass er statt der Synagoge genauso gut eine Moschee hätte überfallen können oder eine Bank, und dann wäre es kein antisemitischer Akt.«
Assi winkte ab. »Wenn eure Irren in Amerika jeden anderen Ort angreifen können, warum landen sie dann letzten Endes immer in einer Synagoge?«
Die Reporterin lauschte einer Durchsage in den Kopfhörern und wandte sich dann wieder mit ernstem Blick der Kamera zu. »Augenzeugen in der Synagoge von Palo Alto behaupten, vor dem Anschlag zwei weitere verdächtige Männer in der Nähe gesehen zu haben. Die Polizei ermittelt vor Ort. Laut FBI sei noch unklar, ob Reed einer Gruppierung angehört hat, die erneut angreifen könnte.«
Der letzte Satz löste Getuschel unter den Umstehenden aus. Yael und Assi wechselten Blicke. Adam sagte: »Mama, wenn es eine Gruppierung ist, die Juden hasst, wäre es doch am logischsten für sie, gleich herzukommen, um noch einen Anschlag zu verüben, denn momentan sind haufenweise Juden auf der Straße.« Michael legte ihm die Hand auf die Schulter. »Das ist nur Panikmache. Ich sage dir, in neunundneunzig Prozent der Fälle sind die Menschen, die solche Anschläge verüben, einfach geisteskranke Einzeltäter.«
»Das können wir nicht mit Sicherheit wissen«, sagte ich und sah in den Augen der Umstehenden das gleiche Fragezeichen. Die Reihe der brennenden Kerzen grenzte uns von der Straße ab. Polizeigitter trennten uns vom zweiten Teil des Rasens. Angespannt auf jedes Geräusch horchend und nach allen Seiten schauend drängten wir uns auf der Wiese zusammen wie Schafe bei Nacht.
5
Die Furcht, die an jenem Abend aufgekommen war, steigerte sich in den nächsten Tagen. Auch als das FBI zu der Erkenntnis gelangte, dass Paul Reed tatsächlich ein Einzeltäter war, wollte die jüdische Gemeinde in Palo Alto sich nicht beruhigen. Vielleicht weil in diesem Fall nicht nur Panik mitspielte, sondern auch Demütigung: Die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigte Reed durch den Vorhof der Synagoge stürmen, wo mindestens zehn Männer ihm untätig zusahen, zu schreckgelähmt, um einzugreifen. Weitere Videos von Kameras aus den Innenräumen zeigten die Käppchen tragenden Betenden zurückweichen und Reed schreiend vorwärtsrennen, ein einzelner Mann, der dort ungehindert wütete.
Vielleicht fand deshalb einer der israelischen Väter großen Anklang mit seiner Idee, einen Selbstverteidigungskurs für Jugendliche anzubieten. Einat Grienbaum erzählte mir drei Tage nach dem Anschlag von diesem Kurs, als wir die Kinder von der Schule abholten: »Es ist der Vater eines Mädchens aus der anderen Junior High, er hat Erfahrung mit Krav Maga und hat sich bereit erklärt, die Kinder zu trainieren.«
Als Adam ins Auto stieg, erzählte ich ihm begeistert von dem Kurs. Er winkte sofort ab. Das überraschte mich nicht. Solche Dinge hatte er noch nie gemocht. Eine Mutter hatte mir mal gesagt, die Welt teile sich in zwei Sorten von Jungen: Die einen gingen in den Karatekurs, die anderen zur Schach-AG. Adam spielte Schach, und ich war recht froh darüber. Aber nach Rosch Haschana, nach dem Video mit Leah Weinstein, bedauerte ich plötzlich, dass er nie richtig gelernt hatte, Schläge auszuteilen. »Der Kurs umfasst nur drei Treffen und vermittelt Wissen fürs ganze Leben«, erklärte ich Adam. Er blieb auf der Heimfahrt bei seiner Weigerung, verbat sich jedes Drängen. Ich wusste, dass der beste Weg, einem Kind etwas zu vergällen, darin bestand, darauf zu beharren, und beließ es dabei. Aber die Bilder aus der Synagoge verfolgten mich. Die Möglichkeit, dass es Adam treffen könnte, ließ mir keine Ruhe. Klar hatte Michael recht damit, dass es einfach Panikmache war, und doch wollte ich Adam in diesen Kurs schicken, genau wie ich gewollt hatte, dass er gegen Hepatitis geimpft wurde, nicht weil die Krankheit stark verbreitet gewesen wäre, sondern rein zur Sicherheit.
»Tu es für mich, um mich zu beruhigen«, sagte ich, als wir in unsere Straße einbogen. »Du zwingst mich richtiggehend, das ist unfair«, konterte er. »Überleg es dir wenigstens«, bat ich und hasste ihn im Stillen dafür, dass ich betteln musste. »Okay, ich denk drüber nach«, sagte er, als wir vor der Haustür parkten.
Am Abend saßen wir Erwachsenen wieder vorm Fernseher. Anders als sonst, setzte Adam sich dazu. Auf CNN liefen die Videos aus den Überwachungskameras der Synagoge.
Assi sah hin und zischte leise: »Wieso hat keiner ihn aufgehalten?«
»Es ist nicht so leicht, einen wie den aufzuhalten«, wandte ich ein und stellte eine Schüssel Sonnenblumenkerne auf den Tisch. Bei jedem Besuch schleppte Assi drei Kilo davon an und überreichte sie uns mit dem Stolz eines Arztes, der den Angehörigen eines entlegenen Stammes Antibiotika überbringt.
Adam saß neben mir auf dem Sofa und blickte von mir zu seinem Onkel und zurück. Die Tür des Gästezimmers oben flog auf, Tamir und Aviv stürmten heraus. Ich hörte ihre festen, sicheren Schritte auf der Treppe und wusste, dass Adam im Leben nicht so frei durch ein fremdes Haus toben würde. Sie setzten sich zu Adam, vertieft in ihre Telefone. Ich dachte, sie hörten gar nicht hin, aber ein paar Minuten später hob Tamir den Kopf und deutete auf den Fernseher: »In Israel wäre das nicht passiert.«
»Aber in Israel gibt es auch Anschläge«, wandte Adam ein.
»Schon«, erwiderte Tamir, »aber es ist undenkbar, dass ein Terrorist irgendwo reinläuft und keiner wenigstens versucht, ihn aufzuhalten.«
Ich wollte etwas von dem Kurs sagen, hielt aber an mich. Ich bestellte uns indisches Essen. Dachte, wir würden lange aufbleiben, aber um neun Uhr abends waren sie schon erledigt und erklärten, sie würden schlafen gehen. »Die Jungs sind Frühaufsteher«, erklärte Assi stolz.
Tamir und Aviv trainierten für die Auswahlverfahren der Sajeret Matkal, der Elitetruppe des Generalstabschefs. Jeden Morgen machten sie ihren Dauerlauf, eine Stunde bevor wir alle aufwachten. Wenn Adam aufstand und im Trainingsanzug runterging, fand er sie verschwitzt und atemlos in der Küche, damit beschäftigt, sich einen Proteinshake zu mixen. Mit den Sportlern in seiner Schule, die auf dem Footballfeld übereinander herfielen, hatte er rein gar nichts am Hut. Er betrachtete sie, als wären sie Grizzlybären, fremdartige Kreaturen. Tamir und Aviv jedoch waren seine Cousins. Jeden Morgen sah er Szenen eines Lebens, das seines hätte sein können. Ihr Schweißgeruch nach dem Training hing noch ein Weilchen in der Küche, wenn sie bereits gegangen waren. Bei den gemeinsamen Abendmahlzeiten fragten sie Michael über die Elitetruppe aus. Seine knappen Antworten reizten sie nur noch mehr. Irgendwann begann auch Adam zu fragen. Früher hatte er sich nie dafür interessiert.
In den nächsten Tagen füllten die Zwillinge das Haus, stark und braun gebrannt und laut und frech, und mein Kind dackelte hinterher wie ein Hund, der nicht recht weiß, ob er dazugehört oder nicht. Sie ließen ihn mitlaufen, ohne ihn je ausdrücklich einzuladen. Er bewunderte sie. Trank durstig jeden Satz, der ihnen über die Lippen kam, in einem Hebräisch, das er nicht immer verstand. Sie mochten ihn, meine ich, behandelten ihn von Anfang an wie einen alten Bekannten. Statt Adam nannten sie ihn Adamama. Das fanden wir alle lustig.
Vor ihrer Ankunft hatte ich befürchtet, Adam könnte außen vor bleiben. Wie bei ihrem Besuch vor zwei Jahren, als die Zwillinge in ihrer eigenen privaten Welt lebten, unaufhörlich miteinander lachten und tuschelten, in einem Slang, den Adam kaum verstand, denn obwohl wir zu Hause nur Hebräisch sprachen, war unser Wortschatz unbemerkt veraltet. Tamir und Aviv redeten wie sechzehnjährige Israelis, und mein Sohn sprach wie seine vierzigjährigen Eltern. Auch – aber nicht nur – deswegen wirkte Adam während ihres ganzen Besuchs wie ein Fremder in seinem eigenen Wohnzimmer. Dieses Jahr hatte ich mich geistig darauf vorbereitet: Eine andere Familie würde zwei Wochen lang bei uns im Haus wohnen. Sie würden sehen, was wir im Kühlschrank hatten, nach uns die Toilette benutzen und sich die Haare mit unserem Shampoo waschen, sodass wir bald alle gleich rochen. Sie würden die kleinen Spannungen in unserem Trio erkennen und wir die Risse in ihrem Quartett. Ehestreitigkeiten würden in gedämpftem Ton, Streit zwischen Eltern und Kindern lauthals ausgetragen werden, andere Konflikte gar nicht. So wappnete ich mich für alle Eventualitäten, außer für das abwegigste Szenario, einen Anschlag, der unsere Familien zusammenschweißte, denn uns war zwar nichts passiert – wir waren ja zu Hause gewesen –, wir hatten aber doch etwas gemeinsam durchgemacht.
»Ich denke, wir können ihn wieder auf diesen Kurs ansprechen«, meinte Michael nach einigen Tagen, an denen Adam die Abendstunden mit Tamir und Aviv verbracht hatte. Ich wollte, dass Adam Selbstverteidigung lernte, aber wohl aus anderen Gründen als Michael. Als wir ins Bett gingen, sagte er: »Vielleicht ist er jetzt endlich bereit zu etwas Sport. Das könnte ihm guttun, körperlich und gesellschaftlich.« Ich verkrampfte mich. Erstmals sprach Michael über Adam, als stimmte etwas nicht mit ihm, als gehörte etwas korrigiert. Das war nur wegen Tamir und Aviv, dachte ich. Ihr aufrechter Gang, der gar nicht aufrecht war – beide schlurften und ließen fast betont die Schultern hängen –, gerade dieses Beharren des Körpers auf bequemer Nachlässigkeit zeugte von einer aufrechten inneren Haltung. Michael erkannte das an Assis Kindern, es war ja auch unübersehbar. Vor dreißig Jahren hatten Assi und er gemeinsam auf den Rasen im Kibbuz gepinkelt und gewetteifert, wer weiter pisste. Und länger anhaltend. Wer die Büsche traf. Wie sie damals ihre Pimmel verglichen hatten, verglichen sie nun ihre Söhne. Und Michael, der bedachte, starke, kluge Mann, zog dabei den Kürzeren.
6
Ich konnte nie genau sagen, wann dieser Zaun hochgegangen war – Michael und ich auf der einen Seite, Assi und Yael auf der anderen –, aber eindeutig bestand er aus Geld. Irgendwann war das Geld, das Michael und ich hatten, zu einem Thema geworden, über das man nicht sprach. Und sobald etwas nicht mehr angesprochen wird, versteht man, dass es wichtig ist. In unserer ersten Zeit in Amerika, vor Michaels Aufstieg im Unternehmen, hatten wir mit Assi und Yael freimütig über Geld geredet: Ich hatte ihnen von den irren Preisen der Kindergärten in den USA vorgejammert, und sie hatten über die enormen Hypothekenzinsen der israelischen Banken geklagt. Doch als die Schere aufging, mied man das Thema.
Am schlimmsten wurde es, als Assi Michael seine Idee für ein Start-up vorstellen wollte. Er redete hell begeistert, blickte sich ständig um, als könnte ihm einer seine geniale Erfindung wegschnappen. Michael hörte zu. Stellte ein oder zwei Fragen. Aus Höflichkeit, schien mir, aber für Assi waren Michaels Fragen Öl ins Feuer seiner Hoffnungen. Er stand sofort in Flammen, redete wild gestikulierend, plante die Präsentation, die sie beide den potenziellen Investoren vorführen sollten.
Der jährliche Besuch ging schnell vorüber. Morgens bereiteten wir tolle Schakschukas zum Frühstück zu. Am späten Nachmittag holten wir Adam von der Schule ab – Tamir und Aviv staunten, wie ernst man hier den Unterricht nahm –, und danach fuhren wir zum Abendessen in die besten Restaurants. Wenn die Rechnung kam, zückte Michael rasch seine Kreditkarte und sagte: »Das regle ich.« Die Absicht war gut, aber mir scheint, so eine Geste richtet Schaden an. Das Geld, das Michael Assi einige Jahre zuvor geliehen hatte, lag zwischen uns, unerwähnt. Fünfzigtausend Dollar als Startkapital für sein bombensicheres Unternehmen. Als alles kollabierte, zahlte Assi zurück, was er konnte. Er wollte noch mehr abstottern, aber Michael sagte, lass, nicht nötig. In jenem Moment hatte ich gedacht, Assi würde Michael deshalb ewig lieben. Aber anscheinend wird er ihn deswegen auch ewig ein wenig hassen.
Trotz dem geliehenen Geld und dem Konkurs gingen unsere alljährlichen wechselseitigen Besuche zu festen Zeiten weiter: die jüdischen Herbstfeiertage bei uns, Pessach bei ihnen. Der jetzige Aufenthalt hätte nicht anders verlaufen sollen als sonst, aber der Anschlag am Neujahrsabend überschattete alles. Assi redete dauernd darüber. Sagte bei jeder Gelegenheit, aus seiner Sicht sei das erst der Anfang, der Antisemitismus in Amerika sei im Kommen. Auch Tamirs und Avivs Einberufung am Ende des Jahres war ein Dauerthema: Wie viele Liegestütze sie machten. Wie viele Kilometer sie rannten. An dem Samstag, als sie ihre Koffer für den Rückflug nach Israel packten, ihre massenweisen Einkäufe verstauten, staunte ich selbst, wie ungeheuer erleichtert ich war.
Am nächsten Morgen weckte ich Adam früh fürs erste Kurstreffen. Er hatte tief geschlafen und wollte nicht aus den Federn. Gähnend und mürrisch ließ er sich von Michael zur Halle fahren, und zwei Stunden später holte ich ihn wieder ab. Beim Warten auf dem Parkplatz fürchtete ich, er würde gleich beim Einsteigen erklären, dass er nie wieder hingehen wollte, aber als er die Tür aufmachte, war er überraschend lebendig. Der verschlafene Junge, der am Morgen in den Kurs gegangen war, kam mit einem spektakulären Traum wieder heraus: Ein Terrorist würde in die Synagoge stürmen, und er wäre derjenige, der ihn stoppen könnte.
Zum zweiten Treffen brauchte ich Adam nicht mehr zu wecken. Er kam selbst zurecht. Als ich ihn abholte, sah ich die Jugendlichen zusammen aus der Halle strömen, lebhaft auf Englisch quatschen, Schulter an Schulter zum Parkplatz marschieren. Vielleicht erfasste ich da erst, dass ich meinen Sohn noch nie als Teil einer Gruppe gesehen hatte. Über die Jahre hatte er Freunde gehabt, nicht viele, aber immerhin. Ruhige, höfliche Jungs. Seit jeher wusste ich, dass dies nicht die Jugend war, die er sich ersehnte, sah, wie sehr sie sich von dem Bild unterschied, das uns im Fernsehen vorgeführt wurde. Aber ich hatte mir keine Sorgen gemacht. Die Oberschulzeit mag einem endlos erscheinen, solange man drinsteckt, ist tatsächlich aber sehr kurz. Und danach kommt das ganze Leben. Erst als alles schieflief, begriff ich meinen Irrtum. Ich hatte nicht erfasst, wie wichtig ihm dieses Zusammensein in einer lärmenden Gruppe war, wo jedes Mitglied Kraft aus der Gemeinschaft schöpft.
Es lag am Trainer. Er ließ den Kindern nicht die natürliche, unangefochtene Einteilung durchgehen – in eine Kerngruppe, umringt von Außenseitern und Flüchtlingen. Schon beim ersten Treffen sagte er ihnen, es interessiere ihn nicht die Bohne, wer beliebt oder unbeliebt, populär oder unpopulär sei. Falls jemand sie angreifen sollte, seien sie die einzige Hoffnung füreinander. Sie müssten vereint sein, denn morgen früh könnte noch so ein Scheißkerl wie Paul Reed auftauchen, und der ließe sich nur gemeinsam stoppen. Adam erzählte mir das mit leuchtenden Augen. Es klang mir ein bisschen pathetisch, wie die Ansprache eines Kommandeurs im Offizierslehrgang, aber ich behielt meinen Zynismus für mich. Dieser Kurs konnte Adam und die anderen Kinder vor einem neuen Gemetzel in der Synagoge schützen. Sie waren mit Feuer und Flamme dabei. Und als die drei Treffen zu Ende waren, wollten sie mehr davon haben.
»Hat er denn noch mehr Übungen für euch auf Lager?«, fragte ich. »Klar«, sagte Adam, »außer Selbstverteidigung lernen wir auch Nahkampf, Angriff, Navigation im Gelände.« Ohne den Anschlag in der Synagoge hätte ich vielleicht die Brauen gehoben, hätte gesagt, das klänge mir schon eher nach Grundausbildung der Givati-Brigade. Aber die Angst saß mir noch in den Knochen. Es beruhigte mich, dass Adam mit dem Kurs weitermachte. Es freute mich, ihn unter anderen Jungen zu sehen. Es gefiel mir, dass der Trainer sie auf Hebräisch unterrichtete. Als Adam sagte, er brauche fürs nächste Treffen einen Kompass, lächelte ich und bestellte sofort einen. Es machte Spaß, ihn endlich aufblühen zu sehen, als Teil von etwas Größerem. Ich hatte befürchtet, nach ein oder zwei weiteren Stunden würde er den Kurs schmeißen und sich wieder abschotten, die Trägheit eines Sechzehnjährigen würde mein Kind erneut zu Hause an den Computer fesseln, zumal es mit dem Rad zwanzig Minuten bis zur Sporthalle waren. Überrascht vermerkte ich, dass er trotz der Entfernung durchhielt. Früher hatte er ganze Nachmittage im »Labor für junge Chemiker« verbracht, das er sich in unserer Garage eingerichtet hatte. Jetzt nutzte er es kaum noch. Verschwitzt kehrte er heim, mit roten Wangen und glühenden Augen. Und ich wusste, es kam nicht nur vom Radfahren, sein ganzer Körper war angeregt, anders als früher.
Erst nach dem Tod von Jamal Jones erfuhr ich, dass sie eine recht große Gruppe waren. Zehn Jugendliche. Sie trafen sich jeden Sonntagmittag. Unter der sanften Sonne Kaliforniens übten sie sich im Navigieren und Tarnen und Anstürmen und Unschädlichmachen, und danach kehrten sie heim, um Schnitzel zu essen und für den Mathematiktest zu büffeln. An einem trüben Sonntag kam Adam völlig durchnässt nach Hause. »Du hättest anrufen sollen, dann hätte ich dich abgeholt.« Er lachte. »Wir haben das ganze Training im Regen absolviert. Uri sagt, im Krieg gibt es keine Schirme.« Da erst achtete ich erstmals auf den Namen – Uri – und darauf, wie Adam ihn aussprach. Mit großer Hochachtung, fast ehrfürchtig, als sei allein schon das Nennen beim Vornamen ein großes Privileg. »Nicht, dass du dich erkältest«, sagte ich, doch er versicherte mir, es sei ihm keinen Augenblick kalt gewesen. Auch zu Hause hatte er es nicht eilig, die nassen Klamotten auszuziehen. Der Stolz wärmte ihn.
In den nächsten Wochen hörten Michael und ich immer mehr über Uri. Er schmückte jeden zweiten Satz von Adam. Das Gerücht besagte, Uri sei in der Sajeret Matkal gewesen. Die Jungen im Kurs behaupteten, nach seiner Wehrentlassung habe Uri beim Mossad angeheuert. Uri selbst rede nicht darüber und beantworte auch keine Fragen. Ich kannte diese Bescheidenheit ehemaliger Elitesoldaten, die stille Art, in der sie durch die Welt wandelten, mit dem Stolz der Demut. Und tatsächlich, je mehr Uri mit Informationen geizte, desto attraktiver wurde er für die Kinder. »Vielleicht dient Uri immer noch im Mossad«, erklärte Adam uns eines Abends. An diesem Punkt griff Michael ein. Er presste gerade Orangensaft für uns alle aus, während ich Pancakes briet und Adam den Tisch deckte. Adam mutmaßte, vielleicht sei Uris ganzer Aufenthalt in den Vereinigten Staaten Teil einer Geheimmission, worauf Michael mit seinem ironischen kleinen Lächeln fragte: »Meinst du, er rekrutiert die neue Generation von Geheimagenten?« Adam verstummte. Michael halbierte forsch eine weitere Orange mit dem Messer und fuhr im gleichen Ton fort: »Womöglich ist dieser ganze Kurs nur ein Cover. Vielleicht schickt er euch beim nächsten Treffen in die Muir Woods, um einen Hamas-Führer zu kidnappen, der nach San Francisco gereist ist.« Ich dachte, Adam würde lachen oder etwas erwidern. Nichts hatte uns auf das beleidigte Schweigen vorbereitet, in das er für den Rest der Mahlzeit verfiel.
Erst später, als die menschlichen Stimmen im Fernsehen Adams brütende Stille überdeckten und Chandler and Joey uns an den Händen zum Schlafen geleiteten, wir uns zugedeckt und uns einen Gutenachtkuss gegeben hatten, da erst sagte Michael mit schläfriger Stimme: »Ich glaub, ich kenne ihn.«
»Wen?«
»Diesen Uri. Er müsste drei Jahrgänge unter mir gewesen sein.«
»Und wie war er?«
Michael schwieg. Ich dachte, er sei eingeschlafen. »Brillant. Es hieß, er würde mal Generalstabschef werden.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Na, schau mal einer an, und nun ist er Krav-Maga-Trainer im Silicon Valley.«
Michael strich mir mit seiner schweren, warmen Hand über den Oberschenkel. »Du meinst – Mossad-Agent in Kalifornien.« Im Dunkel des Zimmers hörte ich das Lächeln in seiner Stimme, und da musste auch ich lächeln. Und mit diesem Lächeln schliefen wir ein.
7
Ich meinte, sie am Obstregal wiederzuerkennen, war mir aber nicht sicher. Sie beugte sich über die Auslagen, und ihre Hände hielten den zur Hälfte gefüllten Einkaufswagen. Erst als sie das Gesicht hob, bekam ich Gewissheit. Ihre Augen waren stark gerötet, die Pupillen zur Größe von Heidelbeeren erweitert. Leahs Mutter bemerkte meinen Blick. Wandte sich rasch ab. Ich steuerte meinen Einkaufswagen in den Gang zu den Milchprodukten, als ich sie hinter mir hörte.
»Verzeihung«, sagte sie mit dünner Stimme, »darf ich Sie um Hilfe bitten?«
Ich drehte mich um. Sagte, »selbstverständlich«. Unschlüssig, ob ich ihr verraten sollte, dass ich sie erkannt hatte. Dass ich auf der Beerdigung gewesen war. Dass es mir leidtat wegen ihrer Tochter.
»Mir ist einfach etwas schwindlig, könnten Sie mir zu den Bänken draußen helfen?«
Jetzt erst bemerkte ich, wie fest ihre Finger den Griff des Einkaufswagens umklammerten. Sie lief nicht die Obstregale ab, sondern hielt sich am Wagen fest, um nicht umzukippen. Ich ließ meinen Wagen stehen und eilte zu ihr. »Kommen Sie mit.«
Sie zögerte, als sei sie auch, nachdem sie meine Hilfe erbeten hatte, noch unsicher, ob sie sie wirklich brauchte, ob ihr eine fremde Frau im Supermarkt beim Gehen helfen musste. Aber dann griff sie doch nach mir, ihre kühle Hand landete auf meiner ausgestreckten. »Ich habe eine Tablette genommen«, sagte sie, als wir durch die Gänge zu den Glastüren schlichen. »Ich hatte gedacht, sie würde mir nur ein paar Stunden Schlaf gewähren, aber anscheinend bin ich immer noch etwas benommen.« Sie merkte wohl gar nicht, dass sie sich im Gehen auf mich stützte. »Ich muss nämlich einen Kuchen backen. Heute Abend kommt eine Journalistin zu uns. Ich wollte ihr den Kuchen vorsetzen, den sich meine Tochter immer wünscht, wenn sie vom College heimkehrt.«
»Was für ein Kuchen ist das?«
»Blueberry Pie. Ich bin keine besonders gute Köchin, aber diesen Kuchen krieg ich großartig hin.«
Die Glastüren öffneten sich. Ich half Leahs Mutter auf eine Bank. Eilte hinein und bat um einen Plastikbecher Wasser.
»Ich bin nicht sicher, ob Sie sich jetzt ans Steuer setzen sollten.«
Sie trank das Wasser in kleinen Schlucken. »Wenn ich Auto fahre, wünsche ich mir manchmal einen Unfall herbei. Meine Tochter ist vor einundfünfzig Tagen gestorben.«
»Ich weiß, ich war auf der Beerdigung«, sagte ich. »Wir sind aus Israel.«
Sie blickte mich an. »Das ist nett von Ihnen. Israelis kommen fast nie in unsere Synagoge, das ist schön, dass ihr zur Beerdigung gekommen seid.« Sie drückte mir die Hand mit ihrer, die immer noch kühl war, und trank einen weiteren Schluck Wasser. »Nicht, dass ich denke, ich würde sie wiedersehen, wenn ich bei einem Unfall umkäme, ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die ans Paradies glauben. Ich hoffe einfach, dass es mir dann nicht mehr wehtun wird.«
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Holte ihr lieber noch etwas Wasser. Leahs Mutter hielt den Becher in der Hand, trank jedoch nicht. »Möchten Sie, dass ich Sie nach Hause fahre?«
»Unser Rabbi sagt, Pete und ich sollten anfangen, ein wenig das Haus zu verlassen. Ich habe ihm erzählt, dass ich dauernd an Leahs Kleidern rieche. Ich gehe in ihr Zimmer, mache den Schrank auf und schnuppere an den Sachen.«
Ich überlegte, ob ich Pete anrufen sollte, damit er sie abholte. Ich wusste nicht, welche Tablette Leahs Mutter genommen hatte, aber sie sah definitiv nicht aus wie eine, die heute noch einen Kuchen backen würde. »Vielleicht möchten Sie mit Ihrem Mann sprechen?«
»Warum nicht.« Aber sie regte sich nicht. Ihre Handtasche hatte sie über der Schulter hängen, doch sie griff nicht hinein. »Ihr Geruch verfliegt.«
Eine rothaarige Frau, die gerade den Supermarkt ansteuerte, beäugte uns interessiert. Ich wusste nicht, ob sie Leahs Mutter persönlich kannte oder nur aus den Nachrichten. Ich hoffte, sie seien befreundet, und die Fremde würde herkommen und sich mit auf die Bank setzen, damit ich abhauen könnte. Doch sie strebte hinein, genauso wie die anderen Leute, die zwar zu uns herüberblickten, aber nicht stehen blieben. Schließlich zog Leahs Mutter das Telefon aus der Handtasche und rief ihren Ehemann an, der sofort zu kommen versprach. Das Gespräch mit ihm schien sie etwas aufgemuntert zu haben. Sie fragte mich nun nach meinem Namen und dem meines Mannes, erkundigte sich, seit wann wir in Amerika waren. »Und haben Sie Kinder?«
»Ja«, sagte ich, »einen Sohn.« Ich wartete darauf, dass sie fragte, wie er heiße, aber sie fragte nicht. Wir unterhielten uns noch ein paar Minuten. Sie sah jetzt besser aus.
Ein metallicblauer Jeep bog in den Parkplatz ein, und sie richtete sich auf und sagte: »Da ist Pete.« Und auch: »Ich kann Ihnen gar nicht genug danken.« Und dann noch: »Wissen Sie, manchmal tut es so weh, dass ich schon denke, sie wäre besser nie geboren worden.«
Adam saß im Wohnzimmer, als ich eintrat. Er fragte, warum ich so lange gebraucht hatte. Ich verriet ihm nichts von der Begegnung mit Leahs Mutter, aber am Abend erzählte ich es Michael, der seufzte und »die Ärmste« sagte. »Ich hoffe, sie haben das Treffen mit der Journalistin verschoben«, erwiderte ich, »ich glaube, sie ist momentan wirklich nicht in der Lage, Interviews zu geben.«
Doch Susan und Pete Weinstein hatten den Besuch der Journalistin mit dem blonden Pagenkopf nicht aufgeschoben. Ihre Tochter sollte nicht in Vergessenheit geraten. Sie fanden es ungerecht, dass Leahs Gesicht so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden war. Sie hatten viel über sie zu erzählen. So klug war sie gewesen. Und lieb. Hatte ihre Oma gerettet. Die beiden hatten gedacht, die Reporterin wolle all diese Dinge hören, aber die wollte lieber über Paul Reed reden. Der Mörder interessierte sie weit mehr als das Opfer. Und am schmerzlichsten für Susan Weinstein war vielleicht der Umstand, dass die Journalistin auch Paul Reed für eine Art Opfer hielt. Er war aus seinem alten Wohnviertel in East Palo Alto verdrängt worden. Im Alter von sieben Jahren hatte er gesehen, dass Weiße für wenig Geld sein Geburtshaus erwarben und es dann für einen höheren Preis an andere vermieteten. In Oakland war der Junge mit Drogenhändlern in Berührung gekommen, die ihn auf die schiefe Bahn brachten, und als das Zusammenwirken von Drogen und schlechten Genen eine Geisteskrankheit auslöste, erhielt Reed nicht die Behandlung, die ihn vielleicht wieder ins Lot gebracht hätte, denn die war zu teuer. Als die Reporterin Leahs Eltern auf diese Dinge ansprach, explodierte Susan Weinstein. »Es ist nicht meine Schuld, wenn junge Schwarze sich lieber volldröhnen, als hart zu arbeiten wie andere Leute. Die Juden haben gearbeitet, um Erfolg in diesem Land zu haben. Unser Haus in Palo Alto haben wir zum vollen Preis erworben. Wir sind ganz und gar keine Rassisten. Mein Vater ist mit Martin Luther King marschiert, und glauben Sie mir, Martin Luther King würde sich schämen, wenn er hörte, dass ein Schwarzer mit einer Machete in eine Synagoge stürmt wie ein Raubtier im Dschungel.«
Das Interview kam in den Nachrichten. Der Dschungel-Satz wurde ausgiebig zitiert. Zwei Verbände forderten Susan Weinstein auf, sich für ihre rassistische Bemerkung zu entschuldigen. Michael und ich saßen im Wohnzimmer und sahen Leahs Mutter in die Kamera sprechen, mit Schweiß auf der Stirn und geweiteten Pupillen.
In den folgenden Wochen dachte ich bei jedem Einkauf im Supermarkt nervös an die Möglichkeit, sie dort anzutreffen. Aber ich sah sie nie wieder. Es hieß, sie verlasse das Haus nicht mehr.
8
Wie lange haben wir geschlafen? Wie lange gingen, arbeiteten, redeten wir in großer Lethargie? Das Grauen, das der Anschlag erregt hatte, ließ nach und versank im Alltagsleben. Paul Reed und Leah Weinstein wurden gelegentlich noch im Fernsehen erwähnt, die zwei Konterfeis nebeneinander, aber es geschahen weitere schreckliche Dinge – in Florida verschwand ein Kleinkind mitten im Urlaub, in Wisconsin erschoss ein Polizist einen schwarzen Jogger –, und diese Ereignisse verdrängten langsam den Anschlag in der Synagoge, bis er schließlich gar nicht mehr auftauchte. Der jüdische Neujahrsabend rückte in die Ferne.
Jeden Tag fuhr ich Adam morgens zur Schule und holte ihn nachmittags wieder ab. Früher hatte ich noch jeden Abend gefragt, wie es gewesen sei, war jedoch irgendwann an eine Mauer geprallt, hatte nur noch Achselzucken geerntet. Aber Mutterschaft ist eine lange Klettertour diese Mauer hoch. Statt direkt zu fragen, tat ich es auf Umwegen: Was hast du Neues gelernt, mit wem hast du geredet, was hat Spaß gemacht, was hat genervt – Fragen, die ich in Elternforen gefunden hatte, formuliert von gepflegten Psychologinnen, deren strahlende Gesichter links oben am Bildschirmrand erschienen, zusammen mit einer Telefonnummer. Wie beim sorgfältigen Durchleuchten auf dem Ben-Gurion-Flughafen, wo eine harmlos aussehende Reisetasche auf verborgenen Sprengstoff geprüft wird, suchte ich seine Gesichtszüge allabendlich nach einem Hinweis ab. Geht es dir gut, Kind? Was hast du in den letzten Stunden, als wir getrennt waren, erlebt? Hat dich jemand verspottet, Kind? Dir wehgetan? All das bemühte ich mich an seinem Gesicht abzulesen, wünschte mir so dringend Antworten auf diese Fragen, doch kein einziges Mal fragte ich: Und du, Junge, hast du jemanden verspottet? Jemandem wehgetan?
Und irgendwann versiegten auch diese Fragen. Ich fuhr ihn weiterhin morgens in die Schule und holte ihn nachmittags wieder ab, versuchte aber nicht mehr zu ergründen, was er dazwischen erlebt hatte. Das brachte auch Erleichterung. Nicht dauernd gegen die Fremdheit ankämpfen. Ihn aufwachsen lassen. Wenn ich nicht ständig wissen, entdecken, verstehen und spionieren wollte, konnte ich die gemeinsame Zeit im Auto einfach genießen. Mich auf dem Fahrersitz zurücklehnen und Musik hören – er bestimmte die Auswahl auf der Hinfahrt, ich auf der Rückfahrt –, mich über die Derbheiten des Hip-Hops ereifern, nicht weil sie mich tatsächlich grausten, sondern um ihm den Sieg der Jugend über die altmodische Mutter zu gönnen. Auf dem Rückweg wählte ich die Beatles aus, Pink Floyd. David Bowie. Ich dachte viel über die Songs nach, die ich ihm vorspielte – was ihn ansprechen, was er mögen könnte. Alles, was ich ihm sagen wollte, sagte ich in diesen Songs. Und er hörte zu, auch wenn er nicht immer verstand. Und als er einmal Zeuge eines Streits zwischen Michael und mir geworden war, schmuggelte er auf der Hinfahrt die Ballade Life on Mars zwischen seine Hip-Hop-Stücke. David Bowie sang im Auto, und ich wusste, dass er das für mich ausgesucht hatte, um mir eine Freude zu machen, war gerührt hinter meiner Sonnenbrille.
So lief es: Hin Hip-Hop, zurück Beatles und dazwischen Öde. Er war in der Schule. Ich im Haus. Michael bei der Arbeit. Drei getrennte Flüsse, die erst am Abend wieder zusammenflossen, zum Abendessen, das mal laut, mal leise verlief, aber unweigerlich in großer Lethargie. Einer Lethargie, aus der wir schlagartig erwachten, als Adam an einem Donnerstagabend um elf Uhr Michael anrief und mit bebender Stimme sagte: »Papa, kannst du mich abholen? Hier ist jemand gestorben.«
9
Bei seinem Anruf sahen wir gerade eine Episode der Simpsons. Sie war nicht besonders gut, aber keiner von uns beiden dachte ans Umschalten. Wir hatten schon so viele Stunden mit Marge und Homer verbracht, als gehörten sie zu unserem Bekanntenkreis, und man wirft ja kein befreundetes Ehepaar aus dem Wohnzimmer, nur weil sie diesen Abend mal weniger lustig und anregend sind als sonst. Und da war noch ein Grund: Hinter den Dialogen von Marge und Homer lauerte ein großes, finsteres Schweigen, wie ein Panther, der einen aus der Dunkelheit beobachtet. Wir hatten kein Wort miteinander gewechselt, seit Adam zwei Stunden zuvor das Haus verlassen und wütend die Tür hinter sich zugemacht hatte (nicht zugeknallt – mein Sohn knallte nie mit Türen. Und trotzdem war es eine zornige Geste gewesen, die einen Moment vor dem Zuknallen abbremste und einen lauten, aber beherrschten Ton erzeugte, eine Art Mini-Rebellion).
Er hatte nicht hingehen wollen zu dieser Party. Michael hatte ihn dazu gedrängt. Adam sollte mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Mit der Teilnahme am Kurs hatte er sich mehr Ansehen verschafft, aber die meisten Jungen dort waren jünger als er, und Michael genügte das wohl nicht. Sobald er von der Party hörte, hatte er Adam bestochen. Hatte ihm Anreize geboten, wie seinen Mitarbeitern in der Firma. »Ich weiß, du hast keinen großen Bock drauf, also sagen wir mal, du ziehst das heute durch, und morgen unternehmen wir was richtig Tolles, vielleicht einen Ausflug nach Bear Valley?« Mir gefiel nicht, wie Michael versuchte, das Verhalten seiner Mitmenschen zu manipulieren. Sein System der Leistungsanreize erinnerte mich eher an den Umgang mit Seehunden als mit Menschen. Aber Michael beharrte, die gesamte amerikanische Wirtschaft arbeite nach diesem Prinzip, und es bestehe kein Grund, warum das nicht auch bei unserem Sohn, dem Stubenhocker, funktionieren sollte.
Von der Party hatte ich zufällig erfahren. Beim Einkaufen im Supermarkt hatte ich Ashleys Mutter getroffen. Sie fragte, ob wir die Kinder hinbringen wollten, dann würden sie sie wieder abholen. »Wohin denn?«, fragte ich und sah ihre Augen vor Staunen weit werden. »Zu Joshs Party. Hat Adam dir nichts davon erzählt? Alle aus Biologie sind eingeladen. Ich bin sicher, dass der ganze Kurs eingeladen ist.« Wir standen an den Kassen. Je mehr sie wiederholte, alle Biologieschüler seien eingeladen, desto klarer wurde mir, dass sie sich bei Adam nicht mehr so sicher war. Aber als ich ihn zu Hause fragte, sagte er: »Ja, bei Josh. Alle aus Bio sind eingeladen.«
»Na, und gehst du hin?«
»Keine Lust.«
»Warum? Es wird sicher nett.«
»Warum bist du da sicher?«
Sein Blick hatte etwas Feindseliges, aber auch eine Spur Neugier, als wolle etwas in ihm wirklich hören, warum es nach meiner Ansicht nett werden würde. Hier fuhr Michael dazwischen. Mit fester Stimme, in seinem Managerton, der mich immer abstieß, verkuppelte er Adams Partygang heute Abend mit dem Ausflug nach Bear Valley am Wochenende.
Die nächsten Stunden verbrachte Adam in seinem Zimmer, am Computer, hörte Hip-Hop hinter geschlossener Tür. Dann ging er joggen, wie jeden Abend seit Beginn des Selbstverteidigungskurses. Ich hörte Kelev an der Tür jaulen und war Adam böse, weil er ihn nicht mitgenommen hatte. Ich zog den Mantel an, legte unserem begeisterten Hund die Leine um den Hals und ging hinaus in die Kälte. Ich hoffte, Adam auf seiner Runde anzutreffen, hatte mir schon eine Standpauke bereitgelegt (wenn du ein Haustier haben willst, musst du Verantwortung übernehmen – solche Muttersätze), aber er war nicht draußen. Auf dem Rückweg sah ich ein fahles Licht im Garagenfenster brennen und trat ein. Adam stand gebeugt in seinem kleinen Chemielabor, an dem Schränkchen, und fuhr abrupt hoch, als er mich sah. Ich fragte ihn, warum er Kelev nicht Gassi geführt habe. Sagte ihm, er müsse lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen, mir sei kalt, es passe mir nicht, bei diesen Temperaturen draußen rumzulaufen, nur weil er sich nicht um seinen Hund kümmere. Er murmelte eine Entschuldigung. Ich sah zum ersten Mal echte Besorgnis in seiner Miene und sagte mir, dass ich es wohl übertrieben hatte. Keinen Augenblick erwog ich, dass er vielleicht gar nicht wegen meiner Rüge so besorgt sein könnte, sondern wegen des Schranks und dessen Inhalt. Erst als die Polizisten ein paar Wochen später bei uns an die Tür klopften, gingen mir schlagartig die Augen auf. Erst da fragte ich mich: Was hast du an dem Abend in der Garage getan, Adam? Was war dort im Schrank?
10
Achtundzwanzig Minuten vergingen von Adams Anruf bis zu unserem reifenquietschenden Halt vor dem Haus der Harts. Wir waren nicht allein. Die anderen Eltern hatten ähnliche Meldungen von ihren Kindern erhalten. »Mama, Papa, hier ist einer tot zusammengebrochen.« Jeden Augenblick traf ein weiteres Auto ein. Immer mehr bekannte Gesichter stiegen aus. Besorgte Mütter. Besorgte Väter. Es war noch nicht lange her, dass ein junges Mädchen in unserer Stadt ermordet worden war, und die Nachricht von einem weiteren toten Jugendlichen war bei den Eltern auf blanke Nerven gestoßen. Ashley saß auf dem Zaun, im Mantel ihrer Mutter, die mir zunickte, aber bei ihrer Tochter stehen blieb. Einige von Adams Mitschülerinnen, die ich kannte, standen weinend auf dem Zugangsweg zum Haus. Das Make-up verlief auf ihren jungen Gesichtern. Sie trugen Miniröcke, trotz der Kälte. Hatten ja vorgehabt, den Abend in dem mit bunten Partylichtern erleuchteten Haus zu verbringen, im Wohnzimmer zu tanzen oder in der Küche zu trinken oder auf dem Bett von Joshs Eltern zu lagern, die übers lange Wochenende weggefahren waren, oder im Zimmer des großen Bruders, der im College war, oder auf Joshs eigenem Bett. Sie hatten schmusen, knutschen, vielleicht jemandem einen blasen wollen, hatten vorgehabt, sich zu betrinken, auf der Toilette oder im Badezimmer oder notfalls in einen Blumentopf zu kotzen, hatten aber keinen Augenblick daran gedacht, draußen im eisigen Wind zu stehen, während drinnen im Wohnzimmer eine Leiche lag.
Ein paar Jungen scharten sich um eine nahe Bank. Sie stanken penetrant nach Zigaretten und Alkohol. Einige weinten – nicht freiheraus wie die Mädchen, sondern verhalten, verlegen, wischten sich immer wieder mit der Hand übers Gesicht. Andere standen auf der Bank, auf Zehenspitzen, in der klaren, unverhohlenen Absicht, einen Blick in das Wohnzimmer zu erhaschen.