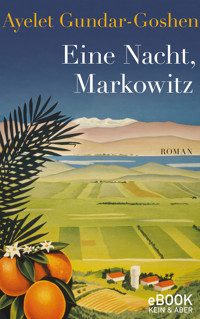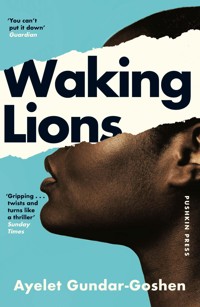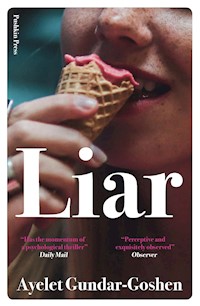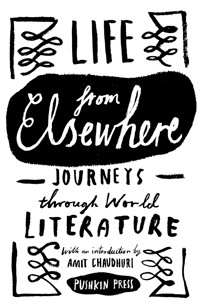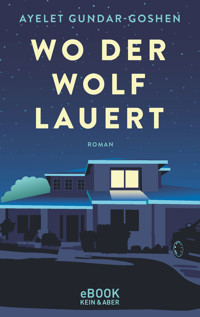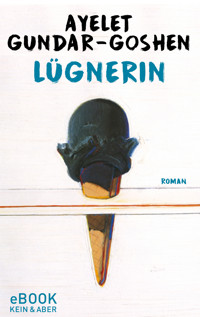18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ayelet Gundar-Goshen inszeniert einen inneren Konflikt, der die Figuren und Lesenden gleichermaßen in seinen Bann zieht. Und sie schafft davon ausgehend ein packendes Psychodrama über Schuld und Rache, über die Flucht vor Verantwortung und über Mitgefühl, das sich an unerwarteten Orten zeigt.
Naomi ist nicht begeistert, als sie sich allein mit ihrem einjährigen Sohn Uri und einem arabischen Handwerker in ihrer Wohnung in Tel Aviv wiederfindet. Ihr Mann Juval hat ihn mit der Renovierung ihres Balkons beauftragt, während er selbst bei der Arbeit ist. Sie fühlt sich unwohl in der Präsenz des fremden Mannes, zumal Uri eigentlich seinen Vormittagsschlaf halten sollte und allmählich quengelig wird. Während sie Kaffee zubereitet, entsteht plötzlich auf der Gasse vor dem Haus ein Aufruhr, ein Teenager ist von einem herabstürzenden Hammer erschlagen worden. Naomi wird schnell klar, dass ihr Sohn den Hammer in einem unbeaufsichtigten Moment vom Balkon gestoßen haben muss. Doch der Verdacht fällt nicht auf die israelische Familie, sondern auf den arabischen Arbeiter. Als er wenig später zum Verhör abgeführt wird, ist Naomi wie gelähmt, es gelingt ihr nicht, die Wahrheit zu sagen.
Eine Geschichte, die mit einer harmlosen Tasse Kaffee beginnt, wird zu einer gefährlichen Tour zwischen Stadt und Dorf, bei der keiner der Beteiligten so bleibt, wie er war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, studierte Psychologie in Tel Aviv, später Film und Drehbuch in Jerusalem. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman Eine Nacht, Markowitz (2013) wurde mit dem renommierten Sapir-Preis ausgezeichnet, 2015 folgte der Bestseller Löwen wecken, für den, genauso wie für Lügnerin (2017), Filmrechte optioniert sind. Zuletzt erschien bei Kein & Aber Wo der Wolf lauert (2021). Ayelet Gundar-Goshen lebt in Tel Aviv.
ÜBER DAS BUCH
Nur einen Moment lang hat Naomi nicht auf ihren einjährigen Sohn Uri aufgepasst, und schon hört sie Geschrei unten auf der Straße, ein Teenager ist von einem herabstürzenden Hammer erschlagen worden. Schnell begreift sie, dass ihr Sohn den Hammer des anwesenden arabischen Handwerkers vom Balkon gestoßen haben muss. Sofort wird dieser verdächtigt, und als Naomi das Missverständnis nicht gleich auflöst und später in der Hoffnung, die Schuldgefühle loszuwerden, mit ihrer Familie von Tel Aviv nach Lagos zieht, entspinnt sich ein immer dichteres Netz aus Unwahrheiten und Unausgesprochenem.
1. Teil
GASTFREUNDSCHAFT
1
»Wie alt ist sie?«
Der Arbeiter steckte den Zeigefinger in das weiche Bäckchen des Kleinen, und Naomi unterdrückte den Impuls, ihm das Baby wegzureißen. »Es ist ein Junge. Er heißt Uri.« Und kurz darauf, als sie merkte, dass sie seine Frage nicht beantwortet hatte: »Er ist vierzehn Monate alt.«
Der Arbeiter nickte. Sie war nicht sicher, ob er das Gesagte verstanden hatte. In den anderthalb Stunden, seit sie aus der Grünanlage zurückgekommen war und ihn hier beim Streichen vorgefunden hatte, waren nur wenige Worte zwischen ihnen gefallen.
Aber der Mann hatte verstanden. »Schalom Uri«, sagte er, verhakte seine fleischigen Daumen und schwenkte die Hände wie Vogelflügel vor dem Gesicht ihres sichtlich faszinierten Sohns.
»Ich habe eine Tochter. Anderthalb. Sagt den ganzen Tag, ›will nicht‹.«
Naomi lächelte, verkrampfte sich jedoch innerlich. Jedes weitere Wort von ihm zeigte ihr nur, wie gut sein Hebräisch war. Dann hatte er sicher auch verstanden, was sie Juval am Telefon vorgeworfen hatte, als sie den Handwerker bei der Heimkehr vom Spielplatz in der Wohnung vorfand: »Wie kannst du einen arabischen Arbeiter in die Wohnung lassen, wenn ich mit Uri allein zu Hause bin.« Sie hatte Juval aus einem anderen Zimmer angerufen und leise gesprochen, aber als sie dem Arbeiter jetzt im Wohnzimmer gegenüberstand, fürchtete sie, er könnte doch mitgehört haben. Als sie sich nach dem Gespräch mit seiner Anwesenheit abzufinden versuchte, hatte sie ihm Kaffee angeboten und auf sein Ja kurz gezögert, ehe sie eine lila Kapsel aus der Box nahm, in die Maschine steckte und einen Teller mit Keksen dazustellte, die er, wie sie jetzt sah, nicht angerührt hatte.
»Essen Sie nichts?«
Der Arbeiter deutete auf die Balkonbrüstung, die zur Hälfte mit einer ersten Farbschicht bedeckt war. »Wenn man mit dem Streichen fertig ist, isst man Kekse.« Auch sie schloss solche Händel mit sich selbst. Während der Vorbereitung auf ihre Anwaltsprüfung hatte sie sich einen kleinen Preis für jeden Abschnitt versprochen, den sie durchgenommen hatte. Steuerrecht – eine Waffel. Verleumdung – noch eine Waffel. Schadenersatzrecht – zwei Waffeln. Der Arbeiter wandte sich wieder der Brüstung zu, was Uris lauten Protest auslöste. Der Mann drehte sich erneut um und schnalzte mit der Zunge – tack-tack-tack –, wie man es bei Pferden tut, um sie zu beruhigen, und Uri strahlte. Naomi merkte sich diesen Laut – tack-tack-tack –, verschob ihn mental in den Ordner »Dinge, um Uri zu beruhigen, wenn er schreit«, ein Ordner, dessen volle und geheime Bezeichnung lautete: »Dinge, mit denen fremde Menschen Uri eventuell beruhigen können, während er bei mir nur noch heftiger schreit.«
Der Arbeiter ging wieder an die Arbeit. Sie beobachtete ihn, als er sich zu Eimer und Spachtel bückte, direkt neben dem Bougainvillea-Kübel. Kleine Kalkspritzer saßen auf den violetten Blättern, wie von einem Milchregen. Er schaute in den Eimer und rührte die Tünche um. Uri rangelte, um sich ihren Armen zu entwinden. Naomi setzte ihn ab, und schon strebte er eilig zum Balkon. »Nein, Schatz, dahin jetzt nicht.« Sie schnappte ihn im letzten Moment, bevor er die Schiene der Schiebejalousie überquerte, die Wohnzimmer von Balkon trennte, spürte seinen Protestschrei den Bruchteil einer Sekunde, bevor er erklang. »Luli, wir gehen jetzt nicht dorthin, erst wenn der fleißige Mann fertig ist.« Uris Geschrei steigerte sich zu ungeahnten Höhen, und wie gewohnt verwandelte sich ihr Groll auf ihn in Groll auf Juval (seit Uris Geburt hatte sie einen Schalter im Kopf, der ihren Unmut vom Sohn auf den Ehemann ableitete, eine Erdung für Feindseligkeit). Der Kleine sollte jetzt eigentlich sein Morgenschläfchen halten. Sonst verwandelt er sich in ein Nervenbündel. Jeden Tag um elf Uhr – wenn man ihn da nicht hinlegt, mutiert das liebe Engelchen zum garstigen Teufelchen. Juval weiß das, und doch hat er gerade jetzt einen Handwerker bestellt. Zur Zeit des Schlafenlegens.
Dann leg ihn doch schlafen. Wer hindert dich dran. Juvals ruhige Stimme dröhnte ihr im Kopf. Sie brauchte ihn nicht bei der Arbeit anzurufen, um zu wissen, dass er genau das sagen würde.
Vielleicht ist es mir unangenehm, mit freien Nippeln dazusitzen, wenn ich mit einem arabischen Arbeiter allein zu Hause bin.
Vielleicht wird es Zeit, ihn nicht mehr an den Nippeln zum Schlafen zu bringen. Der Junge ist schon ein Jahr und zwei Monate alt.
Gerade deswegen schwang sie das jammernde Baby nun mit einer entschiedenen Bewegung hoch, ging ins Schlafzimmer und knöpfte mit flinken Fingern die Bluse auf. Ihre Brüste waren groß und schwer, voll mit Milch. Um die Nippel entstand ein feiner Stromkreis, wie immer, wenn sie stillen wollte. Uri hörte auf zu weinen und schenkte ihr den sehnsüchtigen Blick, den sie liebte. Sie setzte sich zum Stillen auf den Sessel, sprang jedoch gleich wieder auf und schloss die Tür ab. Der Kleine protestierte mit herrischem Wutgeschrei gegen die Verzögerung, und Naomi setzte sich rasch wieder hin, geschmeichelt und genervt zugleich. Sie öffnete den BH, und Uri stürzte sich gierig auf ihre Brust.
Sie lehnte sich entspannt auf dem Sessel zurück. Wie viele Stunden hat sie seit seiner Geburt hier verbracht, in den Banden der Mutterschaft. Juval hat recht, sie muss aufhören, ihn an der Brust einschlafen zu lassen. Uri trinkt ja selbst schon lieber aus dem Fläschchen. Aber dieses Wort – Entwöhnung … Die irre Überfülle ihrer anschwellenden Brüste, diese Üppigkeit, von der keiner mehr würde trinken wollen, die Milch in ihrer Brust, die mangels Nachfrage sauer werden und versiegen würde. Naomi schloss die Augen und ließ Uri saugen, vielleicht ja zum letzten Mal. Dieser Gedanke hatte etwas Angenehmes, Trauriges und Wunderbares. Heute werde ich ihn entwöhnen. Seine Lippen berühren zum letzten Mal meine Nippel. Das ist das letzte Mal, dass er von mir trinkt. Sie schwamm in der Vorstellung wie in einem dicken Brei und wusste, sie würde niemals schöner sein als jetzt.
Das Klopfen an der Tür erschreckte sie. Und schlimmer noch, es weckte Uri. Seine Augen waren schon zugefallen, und nun riss er sie wieder auf. Kurz vergaß sie, wo sie war, wo die anderen waren. So viele Tage hatte sie allein mit dem Baby im Haus verbracht, immer zu zweit in Stille gehüllt wie in eine Blase. Die Außenwelt, die Nachrichtensprecher, alles nur ferne Klänge aus den Fernsehern der Nachbarwohnungen, die verstummten, sobald sie die Jalousien zuschob.
Und nun dieses Klopfen, das ihre Finger veranlasste, rasch die Bluse wieder zuzuknöpfen, ein Tropfen Milch nässte den Büstenhalter. Das ist der arabische Arbeiter, begriff sie leicht verzögert, der arabische Arbeiter klopft an die Tür. Und obwohl er ihr bisher keinen Grund gegeben hat, sich vor ihm zu fürchten, ist sie erschrocken, trotz des Tack-tack-tack, das er zuvor mit der Zunge gemacht, trotz des Vogels, den er Uri mit den Fingern geformt hat. Wer ist denn dieser Mann, den Juval in ihre Wohnung gelassen hat. Und wieso hat Juval nicht darauf bestanden, dass der Bauunternehmer, der das Gebäude renoviert, seinen Arbeiter begleitet und beaufsichtigt.
»Verzeihung, darf ich stören?«
Mach ihm nicht auf. Ruf Juval an und sag ihm, er solle jetzt – jetzt gleich – den Bauunternehmer telefonisch herbeordern. Oder selbst kommen. Wenn wir im ersten Obergeschoss wohnen würden, könnte man vielleicht noch aus dem Fenster entkommen. Aber im fünften Stock wäre das gefährlich. Die Stimme des Arbeiters hinter der Tür hat Uri vollständig aufgeweckt. Er rangelt mit den Ärmchen – Himmel, wie sie dieses Rangeln hasst, diesen verzweifelten Kampf seines Körpers, sich ihren Armen zu entwinden –, und als sie ihn auf den Boden setzt, krabbelt er rasch zur Tür. Gerade diese Sehnsucht ihres Sohns nach dem Arbeiter – selten hat sie ihn so begeistert von einem Fremden gesehen –, gerade sie veranlasst Naomi aufzustehen und die Tür zu öffnen.
»Verzeihung, ich war eingeschlafen«, sagte sie und musterte sein Gesicht, um zu sehen, ob er ahnte, ob er begriff, dass sie Angst vor ihm hatte.
»Ah, Entschuldigung, Verzeihung.«
Die panische Miene des Arbeiters machte sie verlegen. Er hat Angst, ich könnte mich über ihn beschweren, begriff sie, könnte dem Boss sagen, er hätte mich im Schlaf gestört. Doch die Macht, die sie offenbar über ihn besaß, beruhigte sie nicht etwa, sondern beschämte sie. Deshalb beantwortete sie seine Ansage, »der Eimer ist umgekippt, und ich wollte nach einem Putztuch fragen«, rasch mit »macht nichts, schon okay«, seltsam froh darüber, dass er ihr endlich die Gelegenheit bot, ihre Weitherzigkeit zu demonstrieren. Im Gänsemarsch trabten sie ins Wohnzimmer – der Arbeiter voraus, Naomi hinterher, der watschelnde Uri als Nachhut. Der Eimer mit der Tünche lag auf dem Balkon, eine weiße Lache hatte sich neben der Bougainvillea gesammelt und rann langsam am Rand der neuen Fliesen entlang.
»Ich hole einen Lappen«, sagte sie und ging in die Küche. Der Arbeiter wartete draußen. Uri zögerte auf halbem Weg und krabbelte dann entschieden weiter auf den Mann zu, der ihm den Weg zu dem schmutzigen Bereich verstellte und wieder mit der Zunge schnalzte: tack-tack-tack.
»Hier«, sagte sie, als sie mit dem Lappen zurückkam, und bückte sich zum Aufwischen. »Nein, ich mach das sauber«, sagte der Arbeiter, beugte sich vor, um ihr den Lappen abzunehmen, und die körperliche Nähe – er ist in meinem Alter, erfasste sie endlich – beschleunigte ihren Atem. Sie ging auf Abstand, war sich plötzlich des einen Blusenknopfes bewusst, den sie beim Aufstehen nicht mehr zugekriegt hatte.
Sie hastete in den leeren Flur, um ihre Bluse zu ordnen. Der Klang zerspringenden Glases hinter ihr schreckte sie auf. Seit sie mit dem Buggy nach Hause gekommen war und den Arbeiter dort vorgefunden hatte, hatte sie genau auf dieses Geräusch gewartet. Sie fuhr herum und sah den Kleinen neben dem zerbrochenen Keksteller.
»Uri! Nein!«
Ihr Aufschrei erschreckte den Jungen. Er brach in Tränen aus, umringt von Glasscherben. »Aber ich hatte den Teller oben auf den Tisch gestellt«, würde sie Juval am Abend sagen, »hatte nicht gedacht, dass er mit der Hand so hoch raufreichen würde.« »Klar, man kann nicht alles voraussehen«, würde Juval erwidern, und beide würden wissen, dass bei ihm so was nicht passiert wäre.
Uri ging auf alle viere, wollte weinend zu ihr krabbeln, seine Händchen inmitten der Scherben. Sie spurtete los, in der klaren Einsicht, nicht rechtzeitig zu kommen: Er würde sich an den Scherben verletzen, ehe sie ihn hochreißen könnte.
Tack-tack-tack.
Der Arbeiter stand auf dem Balkon hinter Uri und schnalzte laut mit der Zunge. Der Kleine blickte hoch, um zu sehen, wo das Geräusch herkam. Das hielt ihn genau die eine Sekunde auf, die Naomi brauchte. »Da hab ich dich!«, rief sie, schwang ihn in die Höhe, und Uri vergaß augenblicklich seine Schmach und Pein, jauchzte vielmehr überrascht bei seinem Höhenflug. Der Arbeiter sah auf die Glasscherben und fragte, wo er einen Besen fände. Naomi zögerte kurz, sagte »Moment« und ging ihn selbst holen, mit Uri unterm Arm, denn wie sollte sie den Kleinen auf den scherbenbedeckten Wohnzimmerboden absetzen, und ihn dem Arbeiter zu übergeben, war ihr unangenehm. Sie holte Besen und Kehrschaufel, beide unter einem Arm, das Kind unterm anderen. Der Arbeiter trat auf sie zu, sagte beharrlich: »Bitte, lassen Sie mich helfen«, streckte die Hand aus – nach dem Besen? Nach Uri? Und Uri reckte ihm seine drallen Ärmchen entgegen.
Naomi bückte sich, um die Tellerscherben zusammenzukehren. Hob die Kekse auf, die heil geblieben waren, und warf sie in den Mülleimer. Danach fegte sie den Wohnzimmerboden zwei Mal nacheinander, bückte sich, um unter Sofa und Sessel zu schauen, zog unter dem Tisch eine Glasscherbe hervor und fegte ein drittes Mal. Die ganze Zeit war Uri auf dem Arm des fremden Mannes, und als sie den großen Staubsauger holte, schmiegte der Junge sich in dem Lärm an ihn, ohne zu weinen.
»Fertig, danke, er kann wieder runter.« Der Arbeiter hielt kurz inne, ehe er Uri losließ. Ein fleischiger Daumen mit weißen Kalkspritzern streichelte das Bäckchen ihres Sohns, das so weich war, dass Naomi sich kaum vorstellen konnte, dass eines Tages die Bartstoppeln eines Soldaten darauf sprießen würden. Nun setzte der Arbeiter Uri ab, der augenblicklich die Blumenkübel auf dem Balkon ansteuerte.
»Uri! Nein!«
Sie hasste ihre Stimme dabei – laut, streng –, eine Mütterstimme. »Er wirft dauernd was um«, sagte sie entschuldigend zum Arbeiter, »man kann ihn keine Sekunde allein lassen.«
»Genau wie Nasrin«, sagte er, und sie wollte gerade fragen, wer Nasrin sei, als sie begriff, dass er seine Tochter meinte, die Anderthalbjährige. Nun bedauerte sie, sich nicht eher, aus eigenem Antrieb, nach ihrem Namen erkundigt zu haben, und vielleicht als Ersatz für die versäumte Frage sagte sie: »Ich hole einen neuen Teller Kekse.«
Sie gab Uri Spielsachen aus der Kommode, in der Hoffnung, er würde sich wenigstens die paar Minuten damit beschäftigen, bis sie das Wohnzimmer wieder aufgeräumt hätte. Aber der Junge hatte die ärgerliche Angewohnheit, Spielzeug liegenzulassen und sich lieber anderen Dingen zuzuwenden. Vor zwei Tagen hatte er an der Tischdecke gezerrt und dabei ihre Lieblingsvase zertrümmert. Nur durch ein Wunder war das Ding auf dem Boden und nicht auf seinem Kopf gelandet. Aus dem Augenwinkel sah Naomi den Arbeiter auf dem Balkon einen Hammer aus seinem Werkzeugkasten ziehen und damit einen widerspenstigen Nagel aus der Brüstung schlagen. Der Anblick seiner großen Hand mit dem Hammer trieb sie erschrocken in die Küche. Sie richtete einen neuen Keksteller für den schuftenden Mann auf dem Balkon. Warum hast du Angst vor ihm, warum schreckst du immer noch zurück? Sie beäugte ihn verstohlen. Die Muskeln schwollen unter seinem staubigen Hemd. Die Schultern waren zu breit, die Daumen zu fleischig. Sie beschloss, Juval per SMS sofort nach Hause zu zitieren. Schließlich ist sie jetzt Mutter, nicht einfach bloß eine Frau, und eine Mutter trägt Verantwortung für ihr Kind. Auch wenn dieser Arbeiter ihr wie ein guter Mensch vorkommt, muss sie ihr Kind vor allem bewahren, was ihm in dieser verrückten Welt im Allgemeinen und in diesem verrückten Land im Besonderen zustoßen könnte.
Juval würde ungehalten reagieren, so viel war klar. Aber Freunde und Verwandte würden ihr recht geben. Seit der Geburt hatte sie kaum mal das Haus verlassen, der morgendliche Spaziergang zur Grünanlage und fertig. Die Nächte verliefen schlaflos, in einer Abfolge von Aufstehen und Stillen. Die Tage spielten sich zwischen Küche und Wohnzimmer ab, mit Muttermilch, Früchtebrei und Babycreme. Sie las keine Nachrichten und sah möglichst wenig fern. Wollte sich und Uri mit einer Milchblase umgeben. Aber eines wusste sie noch: Es war nicht die richtige Zeit, eine Frau und ihr Baby mit einem arabischen Arbeiter, der einen Hammer schwang, allein in der Wohnung zu lassen.
Als sie den letzten Keks auf den neuen Teller gelegt hatte, steckte der Arbeiter den Kopf vom Balkon herein und fragte, ob er die Toilette benutzen dürfe. »Ja, natürlich«, sagte sie. Er stellte den Eimer mit dem Spachtel auf die Brüstung. Sie zog sich in die Küche zurück, wählte mit bebender Hand eine neue Kapsel, diesmal in Gold, für einen weiteren Kaffee, den sie ihm machen wollte. Aus der Toilette kamen peinliche Geräusche. Er pisst nicht bloß, begriff sie, er kackt hier in deinem Haus. Sie warf einen Blick auf die Putzmittel unter der Spüle. Sobald er weg wäre, würde sie loslegen – weiße Handschuhe, Chlorbleiche mit Zitronenduft. Sie konnte es kaum abwarten, die Toilette von seinen Spuren zu reinigen, seinem Geruch, seinem Arsch auf ihrer Klobrille. Unwillkürlich stellte sie sich ihn dort vor. Gestern hatte sie ein neues Stück Seife mit Lavendelduft in die Toilette gelegt. Als sie die weiße Seife aus der Papierhülle schälte, hatte sie an Uris Haut gedacht, nachdem sie ihm das Badehandtuch abgenommen hätte. Auch ein Fläschchen mit einer Vanillestange hatte sie gestern in die Toilette gestellt. Und ein weißes Handtuch hingehängt, das sie letztes Mal bei Ikea gekauft hatten. Die Kaffeemaschine brummte in rhythmischem Ton, der die Klogeräusche übertönte. Der Espresso füllte das gläserne Tässchen. Naomi schob hastig eine weitere Kapsel nach, um die Maschine in Gang zu halten, damit sie bloß nicht sein Kacken hörte. Das gleichmäßige Brummen des Geräts betäubte ihre Ohren, ließ sie darin versinken. Erst mit einiger Verspätung erfasste sie, dass Uri auf dem Balkon plärrte.
Sie hastete zu ihm. In ihrer Abwesenheit war er auf den Bougainvillea-Kübel geklettert und hatte sich über die Brüstung gelehnt. Sie erschauerte am ganzen Körper bei dem Gedanken, was hätte passieren können. Der Eimer mit der Tünche war auf den Balkonboden gefallen, hatte eine weitere weiße Lache auf die Fliesen gekippt und die Hose des schluchzenden Kindes nass gemacht. Auf die violetten Blätter war ein neuer Milchregen niedergegangen.
»Uri! Nein!«
Er brüllte und heulte, das rote Mündchen weit aufgerissen, sabberte Speichelfäden. Sein Geschrei gellte ihr in den Ohren, doch dann hörte sie plötzlich noch andere Schreie. Sie packte das tobende Kind fester und blickte über die Brüstung.
Ein Mann lag bäuchlings unten vor dem Haus, das Gesicht auf dem Gehsteig. Ein roter Fleck hatte sich um seinen Kopf gebildet. Passanten umringten ihn. Eine alte Frau schrie: »Ruft einen Krankenwagen!«
Naomi rannte zum Telefon, das auf der Arbeitsfläche in der Küche stand. Die Laute klangen weiter über die Brüstung – die heisere Stimme des Nachbarn von unten: Man hat ihm einen Hammer an den Kopf geworfen! Die Stimme der Alten von gegenüber: Araber renovieren im fünften Stock! Eine unbekannte Stimme schrie: »Ruft die Polizei, das ist ein Anschlag!«
Sie erstarrte, den Hörer in der einen Hand, den rangelnden Uri unter dem anderen Arm. Nun stellte sie ihn auf den Boden, immer noch schluchzend, und kniete sich zu ihm nieder, strich ihm mechanisch über den Rücken, bis er sich beruhigte. Aus der Toilette hörte sie die Wasserspülung rauschen. Die Tür ging auf, und der Arbeiter kam heraus, stellte die lärmende Belüftung ab. Leichte Schamröte stieg ihm ins Gesicht, weil sie ihn gehört hatte.
Naomi drehte sich zur Spüle, kehrte ihm den Rücken und spülte mit bebenden Händen Geschirr. Du wusstest, dass Uri dauernd Sachen umwirft, wusstest, dass ein Hammer auf dem Balkon lag. Und doch hast du den Kleinen allein gelassen. Sträfliche Fahrlässigkeit, Naomi, oder nach der roten Lache um den Kopf des Mannes unten zu urteilen, fahrlässige Tötung. Drei Jahre Gefängnis. Zwei Waffeln.
»Da sind Kaffee und Kekse«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, hörte den arabischen Arbeiter ihr danken und spürte, dass er kurz zögerte, denn er war ja noch nicht fertig mit dem Tünchen der Brüstung draußen, wollte andererseits die Hausherrin nicht kränken, die ihm zum zweiten Mal Gebäck anbot.
Also blieb er stehen – sie hatte ihm ja keinen Stuhl angeboten –, biss in einen Butterkeks, trank einen Schluck Espresso. So stand er noch da, als die Martinshörner draußen heulten, schwere Schritte und dann ein heftiges Klopfen an der Tür zu hören waren. Als die Polizisten ihn abführten – zu überrumpelt, um zu protestieren, erst als sie ihn unten in den Einsatzwagen stießen, hörte sie ihn schreien: »Aber warum? Was habe ich denn getan?« –, watschelte Uri zur offenen Tür, deutete mit seinem drallen Händchen auf ihn und winkte ihm zum Abschied.
2
Zwei Monate vor den Wahlen hatte der Mann vom Lebensmittelladen Avram Wadadscha zu sich gerufen und ihn gefragt, ob er arbeiten wolle. Avram war nicht gleich hingelaufen, denn beim letzten Mal hatte der Händler ihn am Kragen gepackt und ihm gesagt, wenn er hier noch mal seine Scheißfeuerzeuge verkaufe, würde er ihn in hohem Bogen nach Äthiopien zurückkicken. Aber diesmal war der Mann gar nicht böse. Er fragte Avram lächelnd, wie alt er sei, und als Avram fünfzehn antwortete, sagte er mit noch breiterem Lächeln, dann sei es ja sogar legal. Das stimmte nicht hundertprozentig, denn Avram war noch nicht ganz fünfzehn, aber Madonna hatte gemeint, er müsse lernen, ein bisschen zu lügen, zumindest was weiße Lügen anginge, und dies kam ihm wie eine weiße Lüge vor.
Auf Avrams Ansage, dass er fünfzehn war und arbeiten wollte, nahm der Händler ihn mit ins Warenlager. Zwischen Waffelkisten und Zigarettenschachteln lagen die Plakate des Kandidaten. »Weißt du, wer das ist?«, fragte er. Avram dachte an Madonna und wollte bejahen, spürte aber im letzten Moment dieses Jucken in den Kniekehlen und schüttelte den Kopf. »Das ist der Mann, der diesen Staat retten wird. Unser Kandidat für das Ministerpräsidentenamt.«
Avram betrachtete »unseren Kandidaten« fürs Ministerpräsidentenamt: Er hatte große blaue Augen und eine hohe Stirn mit einer Furche. Hatte einen tipptopp gepflegten Bart und ein weißes Hemd. Hatte dicke Brauen mit Abstand dazwischen, nicht wie bei Avram. Ihm hatte Madonna versprochen, eines Nachts, wenn er schliefe, mit der Pinzette anzutanzen, um seine Brauen endlich voneinander zu trennen, und seitdem wartete Avram sie.
»Der wird aufräumen in unserem Staat«, sagte der Lebensmittelhändler, »all diese arabischen Maniacs rausschmeißen und die Scheißheinis aus Afrika gleich mit. Nicht euch«, beschwichtigte er, »nur die anderen, die illegalen Migranten. Die Nichtjuden.«
Der Händler blickte Avram an und wartete darauf, dass er »ja, ich verstehe« mit dem Kopf machte. Also tat Avram ihm den Gefallen.
»Da hast du Leim«, sagte der Mann und deutete in eine Ecke. »Du nimmst die Plakate und klebst sie hin, wo du kannst – an Anschlagtafeln, Bushaltestellen, Mauern. Aber tus bei Nacht, ha, damit sie dir nicht was von wegen erlaubt oder verboten vorquatschen.«
Avram nickte wieder, und der Lebensmittelhändler lächelte aufs Neue. »Vierzehn Schekel pro Stunde. Sagen wir, fünf Stunden pro Nacht. Das macht …« »490 Schekel die Woche«, sagte Avram, und der Händler blickte ihn kurz an, bevor er einen Taschenrechner hervorzog und checkte und sagte, »walla, stimmt. Und wenn du nach dem Kleben Lust auf einen Eisriegel hast, kannst du dir einen nehmen. Aber nur einen pro Nacht, ja?«
Dann hob der Ladenbesitzer den Arm, um Avram ein Eis aus dem großen Kühlschrank zu holen, und dabei roch es aus seiner Achselhöhle, und Avram dachte, dass Madonna sich irrte mit ihrer Behauptung, Russen würden nach Fisch stinken. Der Händler stank nach hundsgewöhnlichem Schweiß.
Am Abend rief er Madonna an und sagte es ihr.
»Quatsch«, meinte sie. »Du hast nicht richtig geschnuppert. Wenn du ganz dicht rangegangen wärst, hättest du’s sofort gemerkt. Russen sagen immer, Äthiopier würden stinken, dabei stinken sie selbst nach vergammeltem Fisch.«
Avram wollte nicht mit Madonna streiten und schwieg lieber, blieb jedoch bei seiner Meinung. Sie versteifte sich immer auf alles. Deshalb hatten sie Madonna auf ein Internat für auffällige Kinder geschickt. Hatten behauptet, sie hätte eine Verhaltensstörung, weil sie ständig mit allen in Streit geriet.
»Das ist bloß, weil ich nicht will, dass sie mich Esther nennen«, hatte sie einen Tag vor ihrer Abfahrt ins Internat behauptet, und vielleicht stimmte das, denn tatsächlich hatte keiner was von Internat gesagt bis zu dem Tag, als sie mit der Lehrerin über den Vornamen gestritten hatte. Die Lehrerin hatte die Namen verlesen und war bei Madonnas hängengeblieben, der damals noch Tigist lautete. »Das kann man ja nicht aussprechen«, hatte die Lehrerin gefaucht, »das ist kein Hebräisch.«
»Stimmt«, erwiderte Madonna, »aber so heiße ich.«
»Dann heißt du von jetzt an Esther.«
Kein Mensch sonst regte sich darüber auf. Die Hälfte der Mädchen in der Klasse hatte man schon in Esther umbenannt, genau wie die Hälfte der Jungen bereits Avram hieß. Aber Tigist sprang auf und schimpfte, wieso man ihr plötzlich einen anderen Namen geben wollte, noch dazu einen uralten aus der Bibel. Die Lehrerin bemühte sich sogar, nett zu sein, erklärte, Esther sei jetzt sehr angesagt. Sogar die Sängerin Madonna habe diesen Namen zusätzlich angenommen, als sie sich für die Kabbala zu interessieren begann. Darauf hatte Tigist laut losgeprustet – dann sollten sie sie ab jetzt halt einfach Madonna nennen.
Eine Woche später war sie schon im Internat. Als Avram zum Abschied kam und sie mit »Schalom Tigist« begrüßte, korrigierte sie: »Madonna. Du nennst mich Madonna. Und du rufst mich jeden Tag an, und wir bleiben gute Freunde.« Und so geschah es.
Nachdem Avram den Auftrag erhalten hatte, die Plakate des Kandidaten zu kleben, konnte er Madonna nicht mehr jeden Tag anrufen. In ihrem Internat durften sie nur von neun bis zehn Uhr abends telefonieren, und um diese Zeit arbeitete Avram. Zuerst war Madonna deshalb ein bisschen böse gewesen, hatte dann aber Verständnis gezeigt, besonders, als er ihr von dem Eisriegel erzählte, den er sich jeweils nach der Arbeit nehmen durfte.
»Geh nachts hin und nimm haufenweise«, sagte sie, als sie am Schabbat sprachen, »dann kannst du sie im Viertel verkaufen.« Avram meinte, das ginge nicht, und sie sagte, er sei bloß ein Angsthase.
»Ich bin kein Angsthase«, gab Avram zurück, »ich will einfach nicht, dass er fragt, wohin so viele Eisriegel verschwinden, denn darauf wüsste ich keine Antwort.«
»Sag ihm, es hätte einen Stromausfall gegeben, und alles sei verdorben«, erklärte Madonna, »das ist eine weiße Lüge.«
»Das ist keine weiße Lüge, Madonna.«
»Es ist eine Lüge, die du einem Weißen erzählst, oder? Dann ist es eine weiße Lüge.«
Avram lachte, und Madonna lachte auch, und das war großartig, denn ihre Telefongespräche waren schon seit Längerem etwas seltsam, als hätten sie sich nicht mehr viel zu sagen.
Als Avram noch lachte, fragte Madonna ihn, wie viel zwölf mal elf einviertel seien, und als er hundertfünfunddreißig sagte, lachte sie noch mehr.
»Und siebzehn mal fünfeinhalb?«
»Dreiundneunzig Komma fünf.«
»Weißt du was, nimm wenigstens zwei Eisriegel statt einem, nur um zu wissen, dass du’s kannst.«
Und als Avram wieder Nein sagte, ergänzte Madonna: »Einen für mich. Nimm einen zweiten für mich, als würde ich ihn mit dir auf der Bank schlecken«, und da wusste Avram, dass er es tun musste.
Aber als er bei Nacht ankam, um Plakate und Leim und zwei Eisriegel statt einem zu holen, fixierte der Kandidat fürs Ministerpräsidentenamt ihn mit einem Blick, der es ihm versagte. Die ganze Nacht strich Avram Leim und klebte Plakate, und die ganze Nacht sah der Kandidat ihn zufrieden an. Jeden Tag bemerkte Avram weitere Dinge an ihm, die ihm gefielen. Seine Lippen zum Beispiel – wenn man sie von Nahem betrachtete, erkannte man, dass sie ein bisschen lächelten. Oder seine Ohren, die nicht genau gleich groß waren und ihn deshalb plötzlich netter wirken ließen. Alle paar Tage trafen neue Plakate ein, und wenn Avram ins Lager kam, entdeckte er, dass der Kandidat das Hemd gewechselt oder sich mit verschränkten Armen hinter den Schreibtisch gesetzt oder eine Flagge in die Hand genommen hatte. Aber egal, was er tat, er sah immer ernsthaft aus, und ein bisschen froh, und völlig im Recht.
»Ich kanns nicht glauben, dass du die Nacht lieber mit Fotos von diesem Nazi verbringst, als mit mir zu reden«, sagte Madonna, und Avram war verärgert.
»Warum Nazi?«
»Liest du keine Zeitungen? Uns geben sie hier welche. Damit wir wissen, was im Land geschieht. Und ich sage dir, dein Kandidat ist total durchgeknallt.«
»Zeitungen sind allesamt große Scheiße«, gab Avram zurück. Der Ladenbesitzer sagte diesen Satz häufig, und er hörte sich richtig an.
»Okay, wen scherts. Hast du ein Eis für mich gegessen?«
Avram bejahte, obwohl es nicht stimmte, und sagte sich dann noch hundertmal, dass Madonna selbst gemeint hatte, er müsste lügen lernen, zumindest, wenn es um weiße Lügen ging.
Am Morgen sagte der Lebensmittelhändler, es sei losgegangen. »Ich habe auf dem Herweg Plakate der Schlampe gesehen«, erklärte er. Die »Schlampe« war Kandidatin der Gegenpartei. Der Händler nannte sie nie bei ihrem Namen. Avram fand das ein bisschen komisch.
»Sicher hat man ihr erzählt, dass unsere ganze Stadt mit Plakaten des Kandidaten vollgeklebt ist, und nun will sie auch. Aber wir werden sie ficken, was, Junge?«
Avram nickte.
Also ging Avram von nun an zusammen mit dem Lebensmittelhändler – Stas hieß er – auf Tour. Avram klebte Plakate des Kandidaten, und Stas riss Plakate der Schlampe ab. Mal redete Stas über den Kandidaten und wie er im Staat aufräumen würde, und manchmal schwiegen sie.
Einmal wollte Stas von Avram wissen, ob er eine Freundin habe, worauf Avram antwortete, nicht direkt, aber er hätte Madonna, und da lachte Stas und haute ihm auf die Schulter, aber nicht zum Wehtun, nur unter Freunden, und Avram grinste.
3
Ihr schien, es seien Stunden seit der Festnahme des Arbeiters vergangen, als Juval eintraf. Sie hatte ihn nicht angerufen. Vielleicht ein Nachbar, vielleicht jemand von der Polizei. Sie saß im Wohnzimmer und stillte Uri, bis er einschlief. Auch danach verharrte sie auf dem blauen Sofa. Fast täglich blieb sie wie versteinert dort sitzen, das Kind an der Brust, damit der Kleine nicht aufwachte und zu schreien begann, aber jetzt tat sie es auch, um nicht selbst loszuschreien, als diene die starre Haltung weniger Uris Schlaf als ihrer eigenen Seelenverfassung.
Vom Sofa hörte sie laute Schritte im Treppenhaus, ein hysterisches Rennen, ganz anders als der gemächliche, fast träge Gang, mit dem Juval sonst abends heimkam. Die Wohnungstür öffnete sich – vielleicht hätte sie sie hinter den Polizisten abschließen sollen, aber das Schloss lag, wie alle anderen Gegenstände in der Wohnung, gegenwärtig außerhalb ihres Gedankenbereichs –, und als die Tür aufging, kam ihr Mann schnaufend und blass hereingestürzt.
»Bist du okay?«
Seine Augen überflogen den Wohnraum, suchten vielleicht Spuren, die der Terrorist hinterlassen haben mochte. Sein tiefblauer Blick war verstörter, als sie ihn je gesehen hatte. Juval war ja sonst unerschütterlich. Nichts auf der Welt konnte ihn aus der Ruhe bringen.
»Naomi, bist du okay?!«
Sie nickte langsam, meinte, bei einer zu heftigen Regung ihren Kopf vom Körper fallen und über den Boden rollen zu sehen. »Hat er dir was getan?« Sie schüttelte verneinend den Kopf. Gegenüber der Couch hing ein Schwarz-Weiß-Foto der Stadt New York. Die Gebäude dort kamen ihr zu hoch vor. Juval stand zwischen ihr und dem Bild. Als er sich zu ihr hinkniete, sah sie hinter ihm den Rand des Rahmens. »Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich um euch gesorgt habe«, sagte er. Mit einem Schlag, als wären monatelange Streitigkeiten und langsam angestaute Wut wie weggeblasen, nahm er sie in die Arme. Seine Finger waren überraschend zärtlich. Seine Erleichterung strömte auf sie über. Ihr gellten noch die Schreie und Martinshörner in den Ohren, aber anderswo, unter der Haut, breitete sich ein warmes, fast vergessenes Empfinden aus, das Gefühl, geliebt zu werden.
»Wenn euch was passiert wäre, hätte ich es mir nie verziehen.« Juval beugte sich über den schlafenden Kleinen und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Sie war sicher, dass es ihn wecken würde, Uris Schlaf war sehr leicht, aber diesmal schlief der Junge weiter. Vielleicht hatte der Tumult von vorher ihn erschöpft – Polizisten, Geheimdienstleute und zwei Nachbarn, die durch die Wohnung liefen und alle Zimmer absuchten. Nur um sicherzugehen, dass der Terrorist hier nichts versteckt habe, behaupteten sie. Obwohl Naomi sehr wohl wusste, dass der Arbeiter nichts hinterlassen hatte, beobachtete sie konzentriert, wie die Leute die Wohnung nach einem Sprengsatz absuchten. Sie zogen die Spielzeugschubladen auf, tasteten mit derben Händen die Fächer ab, in denen Uris Kleidung zusammengefaltet lag, stöberten im Kühlschrank, in den Schränken und Kommoden. Als sie endlich gingen, war das Haus voll von Fingerabdrücken fremder Menschen. Vielleicht hätte sie ihnen Tee anbieten sollen, oder Kaffee aus der Maschine. Schließlich hatten sie so schwer für sie gearbeitet, um zu garantieren, dass sie in Sicherheit war.
»Vielleicht legen wir ihn ins Bett?«
An jedem anderen Tag hätte sie Juval abgewiesen, aus Angst, Uri könnte aufwachen, sobald er ihn von ihrem Körper löste und in sein Bettchen legte, und all ihre Mühen könnten umsonst gewesen sein. Aber jetzt lastete das Kind schwer auf ihr. Sie bekam kaum Luft und gab Juval mit den Augen grünes Licht. Er nahm ihr den Kleinen behutsam ab und brachte ihn ins Schlafzimmer. Das Gewicht des Kindes war weg, und dennoch blieben ihre Atembeschwerden. Er legte Uri ins Bett, auf den Rücken, doch sobald er ihn losließ, drehte sich der Kleine auf den Bauch. Im Schlaf ballte er die Fäustchen und brachte sie nah an seinen Kopf, und so lag er dann da, in derselben Position, die Juval mit seinen Soldaten übte, um sich gegen eine Handgranate zu schützen. Er nahm die blaue Decke und breitete sie über den kleinen Körper. Dann fuhr er ihm mit bebender Hand durch die goldenen Löckchen.
Wenn der Junge heranwuchs, würde sein Haar sicher nachdunkeln, wie bei seinen Eltern. In einem alten Fotoalbum war Juval mit hellem Haar zu sehen, und nun war es dicht und dunkel. Noch konnte man nicht sagen, wie das Kind einmal aussehen würde. Die Zeit ist eine Unbekannte. Und eines Tages würden sie ihm erzählen müssen, was heute Morgen hier geschehen war, welche Gefahr er überstanden hatte. Ein frommer Mann wäre jetzt sicher in die Synagoge gegangen, um den Segensspruch über die Errettung aus Gefahr zu sprechen, aber Juval war nicht religiös. Er kniete sich vor dem Kinderbett auf den Boden, küsste die kleinen Hände, das Näschen, das wie die Nase eines Häschens zitterte. Er hätte auch seine Wimpern geküsst, fürchtete jedoch, ihn damit zu wecken. Er stand auf und schöpfte wieder Atem.
Die kurze Distanz zwischen Schlafzimmer und Wohnraum durchmaß er ruhigen Schritts. Im Gehen blickte er an die Zimmerwände, als könnte jeden Moment ein bewaffneter Terrorist aus einer Geheimtür springen. »Was war ich bloß für ein Idiot«, sagte er und kniete erneut vor ihr nieder, »wer holt denn einen arabischen Arbeiter ins Haus und lässt seine Frau mit ihm allein.« Naomi schüttelte verneinend den Kopf, mit Tränen in den Augen. Er wusste ihre Beherrschung zu schätzen, dass sie ihm partout keine Vorwürfe machte, zumal sie ihn in den letzten Monaten, seit Uris Geburt, praktisch für alles beschuldigte. Die Tatsache, dass er sie um ein Haar verloren hätte, erhöhte ihre Schönheit. Vielleicht haben die Menschen deswegen lieber echte Blumen als welche aus Plastik. Plastik ist unverwüstlich und muss daher nicht geschützt werden. Was zunächst als Vorteil erscheint, ist nichts als ein großer Nachteil: Was nicht schutzbedürftig ist, regt uns nicht zur Liebe an.
Naomis Körper war rund und schön. Seit der Geburt klagte sie unaufhörlich über ihre Gewichtszunahme. Er begriff das nicht. Er fand sie wunderschön. Aber sie glaubte ihm nicht, und er war es müde, Dinge zu sagen, die keinen Glauben fanden. Jetzt blickte er sie an, als sie auf dem Sofa saß wie eine zerbrechliche Puppe. Nicht auszudenken, dass sie erst vor einer Stunde hier allein mit einem anderen Mann gewesen war und dass dieser ihr was hätte antun können. Sicher hatte doch auch er, der andere, ihre Nippel gegen die Stoffbluse drücken gesehen, auch er ihre vollen, geschmeidigen Oberschenkel bemerkt.
Gänsehaut überlief seinen ganzen Körper, wenn er daran dachte, was dieser Terrorist ihr hätte antun können. Den Hammer, den er vom Balkon geworfen hatte, hätte er ja genauso gut ihr auf den Kopf hauen können, oder Uri. Vieles hätte er tun können. Und schon sah er ihn Naomis Blusenknöpfe aufreißen, ihre zarte weiße Haut entblößen, die er früher unaufhörlich gestreichelt hatte und die sie ihm nun seit Monaten meistens verweigerte. Sah ihr Haar, das sie seit Uris Geburt stets aufgesteckt trug, damit es sich ja nicht in den Händen des Kindes verfing, nun wirr und zerzaust zurückgebunden, sah es und erbebte, sah es und geriet in Erregung.
Er neigte sich zu ihr und küsste sie auf die Wangen. Sie atmete schwer. Seine Lippen suchten ihre. Sie wandte den Kopf nicht ab. Blieb zwar immer noch eiskalt unter seinem Streicheln, aber die Starre war nicht feindlich, nicht gegen ihn gerichtet, sondern gegen jenen anderen, der zuvor hier gewesen war. Er schlang wieder die Arme um sie, entschlossen, sie aufzutauen, ihr neues Leben einzuhauchen, denn die langen Monate, in denen sie einander ferngeblieben waren, schienen ihm jetzt mit ihrer Angst vor dem fremden Mann zusammenzuhängen, und nun war ihm klar, was er zu tun hatte, wie er sie aus dieser milchigen Lethargie herausholen konnte. Er griff nach ihrer Bluse und knöpfte sie auf. Mit Leichtigkeit löste er die Knöpfe, hätte sie jedoch am liebsten mit einem Schwung abgerissen, allein der Gedanke daran machte ihn an. Ihre Brüste waren groß und voll. Seit der Geburt des Kindes hatte sie sie ihm die meisten Tage versagt, aber jetzt entzog sie sich nicht. Seine Lippen wanderten über ihre Haut. Ihr Atem wurde noch schwerer. Er legte sich aufs Sofa und zog ihren Slip herunter. Wollte, dass sie ihm die Hose abstreifte, aber sie rührte sich nicht. Er stellte fest, dass sie sehr feucht war, befreite sich aus Hose und Unterhose und wollte schon in sie eindringen, hielt jedoch inne, drehte sie mit einem Handgriff auf den Bauch auf dem blauen Sofa und drang nun in sie ein, hörte ihre Ächzer auf dem Sofakissen, kurze Atemstöße, ihre Hand langte über ihren Rücken, wollte ihm vielleicht etwas signalisieren, vielleicht tat er ihr weh, er wusste es nicht, hielt nicht inne, bewegte sich nur schneller, heftiger in ihr, stieß seinen Leib auf ihren, und die ganze Zeit meinte er, beobachtet zu werden. Er versank noch und noch in Naomis Körper, spürte jedoch weiterhin, dass sie nicht ein und nicht zwei, sondern drei waren. Er schloss die Augen, um das Gefühl zu vertreiben, aber die geschlossenen Lider verstärkten es nur noch. Er schlug die Augen auf, löste mit schneller Hand das Gummi aus Naomis Haaren, verstreute es über ihre Schultern, nahm es in die Hand, seidenweich, zerrte es zurück, ihr Hals beugte sich, ihm zu.
Und immer noch diese zusätzliche Präsenz.
Unwillkürlich blickte er sich um. Ein Augenpaar starrte ihn von der Wohnungstür an.
4
Eines Nachts brachte Stas seinen Sohn mit, der so groß wie Avram war und ein Nike-Sweatshirt und weiße Nike-Sneaker trug. Stas sagte, sein Sohn sei zum Helfen gekommen, aber es war klar, dass man ihn gezwungen hatte, denn er klebte keine Plakate des Kandidaten und riss keine Plakate der Schlampe ab, sondern stand nur dabei und schaute auf seine weißen Turnschuhe.
Stas redete von dem Kandidaten und darüber, wie er im Staat aufräumen würde, aber sein Sohn blickte nur weiter auf seine weißen Nikes und nickte nicht mal. Avram nickte viel, und nach und nach hörte Stas auf, auf seinen Sohn einzureden, und wandte sich mehr an Avram. Und das war schön. Auf dem Rückweg fragte Stas seinen Sohn, ob er nächste Nacht wieder mitkommen wolle. »Auf keinen Fall, geh mit dem Schwachkopf.«
Danach herrschte lastendes Schweigen im Auto. Es lastete, weil es Stas unangenehm war. Das sah man ihm an. Avram machte sich nichts draus. Es war nicht das erste Mal, dass man ihn einen Schwachkopf nannte. Er schwieg viel, und deshalb dachten die Leute manchmal, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Madonna meinte, es sei völlig in Ordnung, dass Avram nicht viel sagte, er solle nur so viel reden, wie er Lust habe, er hätte andere gute Eigenschaften.
»Welche?«
»Dass du Dinge siehst, die andere nicht sehen. Deshalb bist du doch heute gekommen, oder nicht?«
Sie hatte ihm das am Tag vor ihrer Abreise ins Internat für auffällige Kinder gesagt, als er sie zu Hause besuchte, obwohl sie alle gebeten hatte, wegzubleiben, sie müsse packen. Er war trotzdem gekommen und hatte festgestellt, dass sie gar nicht packen musste, was gabs schon groß zu packen. Sie hatte einfach nicht alle sehen wollen, weil sie fürchtete, dann loszuheulen, und sie heulte doch nie.
Er blieb bis wirklich spät bei ihr. Sie redete viel und er wenig, bis er um zwei Uhr nachts »Schalom Tigrit« sagte und sie »nenn mich Madonna« erwiderte. Und: »Eines Nachts komm ich mit der Pinzette und trenn dir die Augenbrauen.«
Auch Avram hatten sie ins Internat schicken wollen, aber in ein anderes. Die Rechenlehrerin hatte mit der Direktorin und die wiederum mit Avrams Mutter gesprochen und ihr gesagt, sie hätte einen hochbegabten Sohn. Es wäre schade, eine solche Gabe zu vergeuden. In Tel Aviv gebe es ein eigenes Internat für solche Kinder, damit ihr Potenzial nicht im Provinzstaub versande.
Aber Avram dachte an Madonna, die sich mit der Pinzette durchs Fenster einschleichen und sein Zimmer leer vorfinden würde. Er hatte eine Woche nach ihrer Abreise zum Internat ja auch in ihr Zimmerfenster gespäht, obwohl er wusste, dass sie nicht da sein würde, nur um zu sehen, ob vielleicht doch. Und als er im Geist Madonna mit der Pinzette in seinem leeren Zimmer stehen sah, machte ihn das so traurig, dass er seiner Mutter sagte, er wolle dableiben. Seine Mutter willigte ein. Möglich, dass auch sie ihn gern dahaben wollte, obwohl sie das Gegenteil behauptete. Vielleicht beharrte sie deshalb nicht darauf.