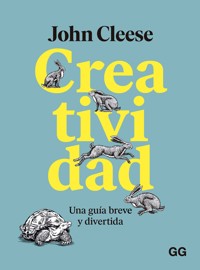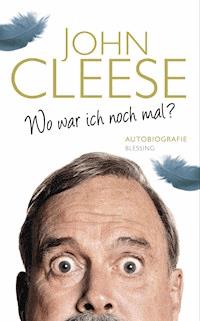
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„And now for something completely different!“
Als im September 1969 die ersten Folge von Monty Python’s Flying Circus gedreht wurde, war John Cleese knapp dreißig Jahre alt. Bis zu diesem Moment hatte das Leben bereits schwerwiegende Fragen aufgeworfen. Hatten die Deutschen kurz nach seiner Geburt sein unbedeutendes englisches Heimatdorf tatsächlich nur bombardiert, um zu beweisen, dass sie doch Sinn für Humor besaßen? Würde er sich je wieder von dem Trauma erholen, als Kleinkind von einem Kaninchen gebissen worden zu sein? Warum hatte man ihn für seinen ersten ernsthaften Bühnenauftritt als Luzifer ausgerechnet in Strumpfhosen gesteckt? In seiner Autobiografie zeichnet Weltstar John Cleese ein Porträt des Künstlers als junger Mann bis zur Gründung von Monty Python, um diesen und vielen anderen Fragen auf den Grund zu gehen.
"Wo war ich noch mal?" erzählt den Lebensweg eines schüchternen englischen Schlaks zum gefeierten Komödianten, der den Humor ganzer Generationen prägen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Als im September 1969 die ersten Folge von Monty Python’s Flying Circus gedreht wurde, war John Cleese knapp dreißig Jahre alt. Bis zu diesem Moment hatte das Leben bereits schwerwiegende Fragen aufgeworfen. Hatten die Deutschen kurz nach seiner Geburt sein unbedeutendes englisches Heimatdorf tatsächlich nur bombardiert, um zu beweisen, dass sie doch Sinn für Humor besaßen? Würde er sich je wieder von dem Trauma erholen, als Kleinkind von einem Kaninchen gebissen worden zu sein? Warum hatte man ihn für seinen ersten ernsthaften Bühnenauftritt als Luzifer ausgerechnet in Strumpfhosen gesteckt? In seiner Autobiografie zeichnet Weltstar John Cleese ein Porträt des Künstlers als junger Mann bis zur Gründung von Monty Python, um diesen und vielen anderen Fragen auf den Grund zu gehen.
Wo war ich noch mal? erzählt den Lebensweg eines schüchternen englischen Schlaks zum gefeierten Komödianten, der den Humor ganzer Generationen prägen sollte.
Zum Autor
John Marwood Cleese, geboren 1939 in Weston-super-Mare, England, schloss sein Jura-Studium am Downing College in Cambridge mit Promotion ab, bevor er mit seinem Talent als Texter Karriere machte. Als Drehbuchautor und Schauspieler war er für namhafte Preise nominiert – vom Emmy- über den Edgar-Allen-Poe-Award bis zum Oscar. Mit Drehbüchern und Hauptrollen reüssierte er auch in Hollywood, seine Gastauftritte bereicherten so diverse Filmserien wie James Bond, Harry Potter und Shrek. Heute lebt John Cleese in London.
JOHN
CLEESE
AUTOBIOGRAFIE
Aus dem Englischen
von Yvonne Badal
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Titel der Originalausgabe: So, Anyway …
Originalverlag: Random House Books, London
1. Auflage
Copyright © 2014 der Originalausgabe by John Cleese
Copyright © 2015 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München,
nach einer Vorlage von Richard Ogle
Foto: Andy Gotts/Celebrity Pictures
Titel Kalligrafie: Stephen Raw
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-12337-6V002
www.blessing-verlag.de
Für Dad und Fish
DANK
Mein verbindlicher Dank an Jim Curtis für seine außerordentliche Bildung, konstante Unterstützung und Fähigkeit, von jetzt auf gleich Chronologien zu klären; an Howard Johnson, der Mengen an guten Dokumentationen über At Last the 1948 Show anschleppte; an meine Verleger auf beiden Seiten des Atlantiks sowie vor allem an Susan Sandon, nicht zuletzt Kevin Doughten, und meine Presseagentin Charlotte Bush.
Ich würde gerne allen Menschen danken, die ein Teil meines Lebens waren und mir insofern geholfen haben, dieses Buch zu schreiben. Ich möchte sie aber nicht namentlich anführen, weil es ziemlich viele sind, und falls ich zwei von ihnen vergesse, werden sie sehr aufgebracht sein und niemals wieder mit mir reden wollen. Das will ich nicht riskieren.
Schließlich noch eine Warnung bezüglich meines Lektors Nigel »Spats« Wilcockson, der versuchen wird, die ganze Urheberschaft für dieses Buch zu beanspruchen, obwohl ihm nur Dreiviertel davon gebühren.
Und … drei Katzen und ein Fisch, die es mit mir ausgehalten haben, derweil ich usw. usw.
1. KAPITEL
Mein erster öffentlicher Auftritt fand am 13. September 1948 auf den Stufen zum Schwesternzimmer der St. Peter’s Preparatory School in Weston-super-Mare, Somerset, England, statt. Ich war achtfünfsechstel und mein Publikum ein Haufen Neunjähriger, die mir höhnisch »Chee-eese! Chee-eese!« zugrölten. Ich stieg die Treppen hoch, erniedrigt, verängstigt und vor allem fassungslos. Wie war es mir bloß gelungen, so viel Aufmerksamkeit zu erregen? Was hatte ich getan, um solche Aggressionen auszulösen? Und … wie in aller Welt konnten die wissen, dass mein Familienname eigentlich Cheese ist?
Während die Hausmutter »Fishy« Findlater an mir die übliche Musterung vornahm, die jeder neue Schüler über sich ergehen lassen musste, versuchte ich meine Gedanken zu ordnen. Meine Eltern hatten mir immer eingebläut, mich von »garstigen bösen Jungs« fernzuhalten. Was machten die dann an einer freundlichen Schule wie St. Peter’s? Und wie sollte ich mich hier von ihnen fernhalten?
Entscheidenden Anteil an meinem Dilemma hatte die Tatsache, dass ich nicht nur ein kleiner Junge, sondern ein sehr großer kleiner Junge war. Ich war ein Meter sechzig, und es wurde erwartet, dass ich noch vor meinem zwölften Geburtstag die Einsachtzigermarke überspringen würde. Es fiel mir also einigermaßen schwer, mich in den Hintergrund zu verdrücken, wie ich es mir so oft wünschte – vor allem später, als ich schon größer war als jeder Lehrer. Da war es dann auch nicht besonders hilfreich, dass einer von ihnen, Mr. Bartlett, mich immer als einen »herausragenden Bürger« bezeichnete.
Hinzu kam, dass ich meiner überbordenden Größe wegen »über meine Kräfte hinausgewachsen« war und diese physische Schwäche für so unkoordinierte und ungeschickte Bewegungen sorgte, dass mich mein Sportlehrer Captain Lancaster ein paar Jahre später als »hundertachtzig Zentimeter durchgekauter Bindfaden« bezeichnete. Addiert man noch hinzu, dass ich über keinerlei Erfahrungen mit der wölfischen Natur von Knaben-Gangs verfügte, wird man sofort verstehen, weshalb meine Miene augenblicklich die Memme in mir verriet, als »Fishy« die Tür öffnete und mich zu meinem zweiten öffentlichen Auftritt hinausbugsierte.
»Keine Sorge«, sagte sie, »ist nur Gebell.« Welcher Trost sollte das wohl sein? Hätte man in Nürnberg auch sagen können. Aber wenigstens hatten sie zu skandieren aufgehört. Als ich mich die Treppe runterzwang, herrschte erwartungsvolle Stille. Dann …
»Bist du ein Roundhead oder Cavalier?«
»Was?«
Gesichter, die gespannt auf Antwort lauerten, drängten sich mir entgegen: »Roundhead oder Cavalier?« Wovon sprachen die?
Hätte ich die Frage so verstanden, wie sie gemeint war, wäre ich sehr wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, kleines zartes Pflänzchen, das ich war. (Vielleicht sollte ich an dieser Stelle den behutsamer aufgewachsenen Lesern erklären, dass ich hier nicht etwa aufgefordert worden war, meine wohlbedachten Ansichten über die jeweiligen Meriten der gegnerischen Parteien im englischen Bürgerkrieg 1642–49 kundzutun, sondern vielmehr offenzulegen, ob ich beschnitten war oder nicht.) Letztlich war mein erster Tag an der Prep School dann aber doch kein Totalausfall gewesen. Als ich abends nach Hause kam, hatte ich die tiefere Bedeutung zweier neuer Wörter gelernt – pathetic (mickrig) und wet (feucht hinter den Ohren/Heulsuse). Sissy (Schwuchtel, Weichei) musste ich allerdings in Dads Wörterbuch nachschlagen.
Warum war ich so … unbeholfen? Nun, fangen wir doch bei meinen Anfängen an. Geboren wurde ich am 27. Oktober 1939 in Uphill, einem kleinen Dorf südlich von Weston-super-Mare beziehungsweise von diesem nur durch die Breite der Straße getrennt, die von der Küste vor Weston ins Landesinnere führte. Meine früheste Erinnerung gilt jedoch nicht Uphill, sondern einem Baum in dem Dorf Brent Knoll ein paar Meilen entfernt. Ich liege darunter und blicke durch die Äste in einen strahlend blauen Himmel. Die Sonnenstrahlen fallen in unterschiedlichen Winkeln auf die Blätter, weshalb mein Blick zwischen flimmernden Farbflecken hin und her flackert und die opulent grünen Nuancen des opulenten Blattwerks wahrnimmt (ich dachte, ich sollte hier mal »opulent« und »Nuancen« und »Blattwerk« in einem Satz hinkriegen, weil meine Lehrer immer meinten, so etwas sei ein Zeichen von schöpferischem Talent. Allerdings hätte ich »opulent« wohl nicht gleich doppelt verwenden sollen).
Natürlich bin ich mir nicht gewiss, dass das meine früheste Erinnerung ist, aber mit Gewissheit habe ich das immer geglaubt, und es gefällt mir, das zu denken, weil es sinnig scheint: Baby-Ich liegt im Kinderwagen und beobachtet zufrieden das Zusammenspiel des flimmernden opulent grünen Blattwerks in seinen schönsten Nuancen.
Eines weiß ich jedoch sicher, nämlich dass die Deutschen kurz vor dieser Begebenheit mit dem Baum Weston-super-Mare bombardiert hatten. Ich will das nur noch mal festhalten …
Am 14. August 1940 warfen deutsche Flieger ihre Bomben auf Weston-super-Mare ab. Das ist nachweisbar. Es stand in allen Zeitungen, besonders ausführlich im Weston Mercury. Die meisten Westoner waren überzeugt, dass das ein Versehen sein musste. Immerhin waren die Deutschen berühmt für ihre Effizienz, warum also sollten sie völlig einwandfreie Bomben auf Weston-super-Mare abwerfen, wo es in Weston-super-Mare doch nichts gab, was eine Bombe zerstören konnte, das auch nur annähernd so wertvoll gewesen wäre wie die Bombe, die es zerstörte? Das würde bedeuten, dass jede Explosion bei uns ein winziges Loch in die deutsche Kriegskasse gerissen hat.
Aber die Deutschen kamen wieder, mehrfach sogar, was allen ein Rätsel war. Gleichwohl geht mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass es den Westonern ziemlich gut gefiel, bombardiert zu werden. Es verlieh ihnen eine Bedeutung, an der es ihrem Leben ansonsten mangelte. Doch das beantwortet noch nicht die Frage, warum sich The Hun diese Mühe machte. War das teutonische Joie de vivre? Haben die Luftwaffenpiloten die Weston Seafront mit der Westfront verwechselt? Ich habe ältere Westoner mit vollem Ernst sagen hören, dass das auf Veranlassung von William Joyce geschehen sei, dem berüchtigten »Lord Haw-Haw«, den die Briten 1946 als Landesverräter hängten, weil er sie im Krieg mit Nazi-Radiopropaganda genervt hatte. Als ich diese Hobbyhistoriker später fragte, warum ein Mann irischer Abstammung aus Brooklyn, New York, einen solchen Animus gegen Weston gehegt haben soll, dass er Hitler am Schlafittchen packte und auf die Bombardierung unseres Städtchens festnagelte, wurden sie still. (Ich glaube ja eher, dass Reichsmarschall Hermann Göring nachtragend war wegen eines unappetitlichen Vorfalls, der sich in den 1920er-Jahren unter der vermutlichen Beteiligung von Noël Coward and Terence Rattigan am Weston-Pier zugetragen hatte.)
Am sinnvollsten scheint mir die Erklärung meines Vaters zu sein: Die Deutschen haben Weston bombardiert, um zu beweisen, dass sie nicht so humorlos sind, wie man es ihnen nachsagt.
Was immer der wahre Grund dafür gewesen sein mag, jedenfalls übersiedelten wir zwei Tage nach dem ersten Fliegerangriff in ein idyllisches Dörfchen in Somerset namens Brent Knoll. Dad hatte seit seinen vier Jahren in den Schützengräben von Frankreich die Nase ziemlich voll gehabt von Big Bangs, und da er in Weston gerade nichts weiter vorhatte, das entscheidend zum Ausgang des Krieges hätte beitragen können, verbrachte er den Tag nach dem ersten Angriff im Auto und fuhr die Gegend ab, bis er den kleinen Hof von Mr. und Mrs. Raffle entdeckte, die sich bereit erklärten, die Cleese-Familie als zahlende Gäste aufzunehmen. Ich liebe ihn dafür, dass er da nicht lange gefackelt hat: Wir waren dann mal weg! Typisch für ihn auch, dass er so smart gewesen war, uns in dieser Zeit strikter Rationierungen eine Farm zu suchen, wo durchaus mal ein Ei oder ein Huhn oder sogar ein Ferkel abhandenkommen konnte, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen.
Mutter erzählte mir, dass Dad dieses sofortigen Rückzugs wegen von so manchem Westoner hinter vorgehaltener Hand kritisiert wurde. Offenbar hätten sie es würdevoller gefunden, hätten wir noch eine Woche gewartet, bevor wir davonliefen. Meiner Meinung nach haben sie dabei das Wesentliche des Davonlaufens nicht begriffen. Nur ein zwanghafter Zauderer käme auf die Idee, »Rennt nächsten Mittwochnachmittag um euer Leben!« zu kreischen.
Aber zurück zum Baum. Viele Jahre später habe ich die Farm noch einmal besucht, und gerade so, wie ich es in Erinnerung zu haben glaubte, stand da mitten im Vorgarten ein riesiger Kastanienbaum. Unter dem hätte mein Kinderwagen gut geparkt worden sein können. 1940 war das Haus eines von mehreren mittelgroßen Gebäuden gewesen, die sich mit Blick auf die gegenüberliegenden Felder die Straße entlangreihten. Von der Frontseite betrachtet, sah es nicht sehr bäuerlich aus, aber wenn man die Auffahrt hinauf zum hinteren Teil lief, stand man in einem richtigen Bauernhof samt Matsch und Hühnern und rostigen Geräten und Frettchen in Käfigen und Kaninchen in Holzverschlägen.
Und genau dieser Anblick deckt sich mit meiner zweiten Erinnerung (diese Begebenheit muss nach der ersten stattgefunden haben, denn nun stehe ich bereits): Ich werde von einem Kaninchen gebissen.
Oder vielmehr, ein Kaninchen hat an mir geknabbert, doch weil ich ein so spilleriger, verzärtelter Schlappschwanz war, reagierte ich darauf, als hätte es mir ganze Gliedmaße abgebissen. Es war die schiere Ungerechtigkeit dieses Vorgangs, die mich so aufbrachte. Gerade eben sagte ich noch, »Hello, Mr. Bunny!« und hatte in sein süßes Gesichtchen und über seine lustigen Schlappohren gelacht. Im nächsten Moment fällt dieses Mistvieh über mich her. Völlig grundlos. Was, frage ich mich, hatte ich dem Kaninchen getan, um so eine psychotische Reaktion auszulösen?
Die relevantere Frage wäre allerdings: Wieso war ich so eine Memme? Die naheliegende Antwort darauf lautet: weil ich das einzige Kind von älteren, überfürsorglichen Eltern war. Auch dafür habe ich eine Erinnerung parat (Nummer 3). Jetzt bin ich ungefähr drei und gerade im Red Cow Inn, dem Hauptumschlagplatz und pulsierenden Herzen von Brent Knoll. Irgendwie schaffe ich es, mir die Hand zu stoßen. Noch bevor ich in Tränen ausbreche, halte ich sie zu meinem Vater hoch und jaule: »Daddy, schau! Ich hab mir an meinem kostbaren Daumen wehgetan!« Zu meinem großen Erstaunen ernte ich damit einen Riesenlacher. Ja ist denn mein Daumen nicht kostbar, frage ich mich? Dad jedenfalls hält ihn mit Sicherheit dafür. Denn wann immer es die Umstände erfordern, sagt er: »Oh, hast du dir an deinem kostbaren [bitte maßgeblichen Körperteil eintragen] wehgetan?!«
Ich zögere, meinen Dad zu kritisieren, denn was immer ich an Zurechnungsfähigkeit besitze, verdanke ich seiner liebevollen Güte. Aber es besteht kein Zweifel, dass er mich verhätschelte und dass dieses Verzärteln von Kindesbeinen an einer der Gründe war, weshalb ich mein Leben als Waschlappen begann. Nicht einmal als Schüler habe ich mich je besonders mannhaft oder draufgängerisch oder stark oder kernig oder auf gesunde Weise aggressiv gefühlt. Schulhofgangs habe ich immer gemieden, weil ich nie verstand, warum irgendwer auf ein solches Verhalten Lust haben sollte. Ich liebte Ballspiele, fühlte mich aber immer von brutalen Körpereinsätzen wie zum Beispiel beim Rugby abgestoßen, weshalb ich mich sogar als Mitspieler immer auf sichere Distanz zum Geschehen hielt. Als ich siebzehn und am Clifton College war, nahm mich mein stellvertretender Heimleiter Alec MacDonald zur Brust, weil ich vor jedem Tackling kniff. Erst bezeichnete er das, was ich auf dem Spielfeld tat, als »das Herumgetanze einer behinderten Schwuchtel«, dann befahl er mir, ihm bei der Demonstration eines richtigen Tacklings zuzusehen. Dazu bat er Tony Rogers, einen Spieler aus der Start-Mannschaft unserer Schule, auf ihn loszustürmen, ging auf Tuchfühlung mit ihm und dann hart an den Mann, gerade als Rogers ihm ausweichen wollte. Das Ergebnis war, dass Mr. MacDonalds Kopf heftigen Kontakt zu Rogers rechter Hüfte aufnahm. Mr. MacDonald stand für den Unterricht am Nachmittag nicht zur Verfügung, tatsächlich tauchte er sogar achtundvierzig Stunden lang nicht wieder auf. Und als er dann wieder unterrichtete, war ich zu feige, ihm seine Erklärung »Wenn du hart an den Mann gehst, wirst du nie verletzt werden« um die Ohren zu hauen. Wann immer ich dem Gerempel internationaler Rugby-Teams im Twickenham-Stadion zusehe, bin ich zwar von Ehrfurcht ergriffen, fühle mich aber genetisch völlig abgekoppelt von ihnen. Ich wurde nicht geboren, ein ganzer Kerl zu sein, und habe klaglos akzeptiert, dass mir von Geburt an jeglicher Machismo abgeht. Außerdem habe ich den Eindruck, dass es sehr selten Feiglinge sind, die Unannehmlichkeiten bereiten, was dann vermutlich auch der Grund sein dürfte, dass meist sie es sind, die von Leuten erschossen werden, die mit Unannehmlichkeiten keine Probleme haben.1
Übrigens will ich meiner kindlichen Memmenhaftigkeit wirklich nichts Bewundernswertes andichten. Ich war ganz unbestreitbar ein hasenherziger kleiner Hänfling, aber das hatte durchaus einen Vorteil: Ich brauchte gar nicht erst zu versuchen, diese notorisch hirnlose Aggression so mancher Knaben aufzubieten. Besser eine Memme als ein Psycho, sage ich immer, und ich bin stolz, verkünden zu dürfen, dass ich es niemals über mich gebracht habe, bei so etwas wie Cage Fighting auch nur zuzusehen.
Ein gewisser Teil meiner Beklommenheit ist also den Verzärtelungen meines Vaters anzulasten, ein größerer Teil lässt sich auf die komplizierte Beziehung zu meiner Mutter zurückführen. In diesem Zusammenhang fällt mir eine andere frühe Erinnerung ein. Ich liege im Bett, bin fast schon eingeschlafen, da veranlasst mich ein Geräusch, den Kopf zu drehen. Schatten bewegen sich vor der halb geöffneten Tür des Kinderzimmers. Es sind die meiner miteinander ringenden Eltern. Dad war in mein Zimmer gekommen, und Mum deshalb über ihn hergefallen, um dann ein Gestöber an Schlägen, denen er auszuweichen versucht, auf ihn niederprasseln zu lassen. Kein Laut ist zu hören – ich nehme an, dass beide versuchen, mich nicht zu wecken. Diese Erinnerung ist mit keinem Gefühl verbunden, wiewohl sie sich mir so glasklar eingeprägt hat. Sie besteht nur aus diesen beiden Schatten, die ich ein paar Sekunden lang sehe, und dann … Stille. Während ich dies niederschreibe, schnürt es mir ein wenig die Kehle zu. Das Maß an Gewalt, von dem ich hier berichte, ist gering. Da gibt es von keinem Prügelstock und auch von keiner Kettensäge zu erzählen, nur von kleinbürgerlichen Schlägen ohne jede Gefahr der schweren Körperverletzung im Sinne des englischen Gesetzes. Dennoch, mein geliebter Dad, ein liebenswürdiger und anständiger Mensch, wird von dieser unbegreiflichen Kreatur, die allen Gerüchten nach meine Mutter sein soll, verprügelt.
Kleine Kinder verfügen über so wenig Lebenserfahrung, dass sie unweigerlich glauben, alles, was um sie und mit ihnen geschieht, sei die Norm. Ich erinnere mich, dass meine Tochter Cynthia, da war sie noch sehr klein, völlig überrascht gewesen war, als sie entdeckte, dass einige Väter ihrer Freunde nicht beim Fernsehen arbeiteten. Im selben Sinne wäre es mir schwergefallen, meine Beziehung zur Mutter als problematisch zu bezeichnen, denn ich hatte ja keine Vorstellung, was der Begriff »mütterlich« für die meisten anderen Menschen bedeutet. Dad hatte mir erzählt, dass er einmal einen verwundeten Soldaten im Schützengraben nach seiner Mutter hatte rufen hören. »Warum um alles in der Welt sollte er nach ihr rufen?«, fragte ich mich verwundert. Und als ich dann im Laufe der Jahre von Freunden hörte, dass ihre Mütter die besten Freundinnen und die Personen waren, bei denen sie sich seelische Unterstützung holten, dachte ich nur: »Das muss wunderbar sein …«
Abb. 1: Mutter (links) und ich.
Man möge nun aber bitte nicht glauben, dass ich sie leichthin als »schlechte Mutter« abstemple. In vieler Hinsicht war sie eine gute, manchmal eine sehr gute Mutter. Sie war außerordentlich sorgsam in Alltagsdingen, kochte gut, kümmerte sich darum, dass ich angemessen und immer warm und trocken gekleidet und beschuht war, hielt das Haus peinlich sauber und beschützte mich aufs Grimmigste. Einmal erinnerte ich mich unter einer leichten Hypnose an einen deutschen Luftangriff. Kaum war das Dröhnen der Bomber zu hören, kroch meine Mutter mit mir unter den großen Küchentisch und warf sich schützend über mich. Falls mich die Erinnerung hier trügen sollte, wäre es dennoch genau das gewesen, was sie getan hätte.
Faktisch war sie demnach also makellos. Aber sie war ichbesessen und unsicher, und das konnte das Leben mit ihr wirklich ungemütlich machen.
Ein Indiz für diese Ichbesessenheit war aus meiner Sicht ihre außerordentlich geringe Allgemeinbildung. Bei einem ihrer Besuche in London in den späten Achtzigerjahren setzten wir ihr zum Lunch einen Salat mit Wachteleiern vor. Sie fragte, was das für Eier seien, und ich erklärte ihr, dass es sich um Maulwurfseier handle und wir immer frühmorgens nach Hampstead Heath raufliefen, weil die Maulwürfe sie nachts vor den Eingängen ihrer Erdgänge ablegten, und dann noch am selben Tag zu essen pflegten, bevor die Maulwurfsküken Zeit zum Schlüpfen hatten. Meiner Familie fiel die Klappe runter, aber Mutter hörte sehr aufmerksam zu und sagte dann, sie fände sie »köstlich«. Später am Tag fiel der Name Maria Stuart. Den hatte sie schon mal gehört, fragte mich aber, wer das sei. Und da ich gerade ein familiäres Publikum hatte, beschloss ich das Ganze etwas zu würzen und erklärte ihr, dass es sich um eine Darts-Meisterin aus Glasgow handelte, die im Blitzkrieg ums Leben gekommen sei. »So eine Schande!«, sagte sie.
Natürlich war das etwas ungezogen von mir, aber ich wollte meiner Familie beweisen, dass ich nicht übertrieben hatte mit einem Kommentar über meine Mutter, den sie mir schlicht nicht abgenommen hatten, nämlich, dass sie keinerlei Kenntnisse von irgendwas besaß, das nicht in unmittelbarer Zukunft unmittelbar ihr eigenes Leben betreffen konnte, was zugleich bedeutete, dass sie überhaupt keine Allgemeinbildung besaß – und wenn ich keine sage, dann meine ich damit nicht sehr, sehr wenig. Das hatten sie natürlich für mächtig übertrieben gehalten.
Der Grund für dieses Manko war nicht etwa, dass sie nicht intelligent genug gewesen wäre, sondern dass sie in einem konstanten, intensiven Angstzustand lebte, in einer Art von permanent aufkommender Panik, die dafür sorgte, dass sie sich nur auf Dinge konzentrieren konnte, die sich möglicherweise gleich direkt auf sie auswirken würden. Da versteht es sich von selbst, dass sie unter allen nur denkbaren landläufigen Phobien litt, plus noch einigen ungewöhnlicheren (wie zum Beispiel der panischen Angst vor Albinos und Leuten mit Augenklappen). Aber sie warf ihre Netze noch sehr viel weiter aus. Ich pflegte immer zu witzeln, dass sie unter einer Omniphobie litt – denken Sie sich etwas aus, sie hatte krankhafte Furcht davor. Es stimmt, dass ich sie nie von einem Laib Brot oder einem Cardigan oder einem Stuhl in Panik versetzt sah, aber alles ab einer bestimmten Größe, das sich ein bisschen bewegen konnte, war eine Gefahr, und jeder halbwegs hörbare Laut schreckte sie über jedes Maß hinaus auf. Ich hatte mal eine Liste von den Umständen und Vorgängen zusammengestellt, die ihr eine Heidenangst einjagten, und die war ziemlich lang: lautes Schnarchen, niedrig fliegende Flugzeuge, Kirchenglocken, Feuerwehrsirenen, Züge, Busse, Lastwagen, Donner, lautes Rufen, große Limousinen, Mittelklassewagen, ratternde Kleinwagen, Alarmanlagen, Feuerwerke und besonders Knallfrösche, laute Radios, bellende Hunde, wiehernde Pferde, still stehende stille Pferde, Kühe im Allgemeinen, Megafone, Schafe, das Ploppen von Sektkorken, Motorräder und Mopeds, platzende Luftballone, Staubsauger (exklusive des von ihr selbst benutzten), Dinge, die jemand fallen lässt, Dinner-Gongs, Papageienkäfige, Furzkissen, Türglocken, Hammerschläge, Bomben, Hupen, altmodische Wecker, Pressluftbohrer, Haartrockner (inklusive des von ihr selbst benutzten).
Kurzum, Mutter erlebte den Kosmos als eine einzige riesige Sprengfalle.
Folglich war es ihr auch nie möglich, sich wirklich zu entspannen, ausgenommen vielleicht während der Zeit, in der sie auf dem Sofa strickte, während Dad und ich vor dem Fernseher saßen. Doch selbst das tat sie aktivistisch, denn sie strickte immer gegen die Uhr. Mir fiel schon vor Jahren auf, dass ängstliche Menschen (ich selbst definitiv eingeschlossen) dazu tendieren, sich mit unbedeutenden Dingen zu beschäftigen, um sich von ihren steten Angstgefühlen abzulenken und diese somit zu reduzieren. Stillstand bedeutet Angst maximalster Intensität, also fummelt man herum und tut ständig etwas, so als leide man unter unerklärlicher Zeitnot. Doch Mutters Ängste konnten selbst durch ihre ebenso zahllosen wie sinnlosen Tätigkeiten nicht gemildert werden. Sie war durchdrungen von der Vorstellung, dass sie all die unmittelbar bevorstehenden, namenlosen Katastrophen nur abwenden könne, indem sie permanent auf der Hut vor ihnen war. Eine Sekunde der Unaufmerksamkeit, und schon würden sie auf sie einstürzen. Einmal schlug ich Dad vor, ein lebensgroßes Hamsterrad für sie zu bauen, damit sie es einfacher hätte, den ganzen Tag aktiv zu bleiben, und sich nicht mehr andauernd solche unsinnigen Aktivitäten wie das Polieren von Erbsendosen, Stapeln von Tassen, Umsticken von Taschentüchern, Auskochen von Stricknadeln oder Auskämmen von Teppichfransen ausdenken müsste.
Sie selbst ging die Sache anders an, nämlich indem sie ihre Ängste auf ein Blatt Papier schrieb, auf dass sie keine vergessen konnte und die Katastrophe dann nicht rechtzeitig auf sich zukommen sehen würde. Nachdem Dad gestorben war, pflegte ich öfter runter nach Weston zu fahren und sie zu besuchen. Jedes Mal begrüßte sie mich mit einer Tasse Kaffee und einer sehr langen Sorgenliste, die sie in den Wochen zwischendurch geschrieben hatte. Und jedes Mal saßen wir dann zusammen und debattierten in einiger Länge und Breite über jede Angst: Worum ging es dabei; warum spielte sie eine so große Rolle; wie wahrscheinlich war es, dass sie sich bewahrheitete; was konnte sie tun, um zu verhindern, dass sie sich bewahrheitete; was konnten wir tun, wenn es tatsächlich geschah; und was würden wir tun, wenn es nicht geschah …? Wenn wir dann rund sechs Ängste abgearbeitet hatten, machte sie frischen Kaffee, dann ging es weiter, bis es an der Zeit war, ins Bett zu gehen. Falls wir bis dahin nicht alle geschafft hatten, hoben wir uns die restlichen zum Frühstück auf. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich begriff, dass die Analyse ihrer Ängste diese nicht abgemildert hatte, sondern sie durch den kontinuierlichen Kontakt mit einem anderen Menschen einfach etwas ruhiger geworden war.
Warum Mutter dermaßen verängstigt war, weiß ich schlicht nicht, ich kenne nur das Endergebnis: Sie war schwierig. »Schwierig« ist eigentlich nicht ganz zutreffend. Es gab letzthin nur eine einzige Sache, die sie wirklich wollte. Nur eine. Aber das war, die Dinge auf ihre Art durchzusetzen. Und wenn sie ihren Willen nicht bekam, dann war sie verärgert. Und sie war ziemlich schnell aufgebracht. Tatsächlich kann ich wohl sagen, dass das ihre besondere Begabung war. Und wenn sie etwas aufbrachte – es gab ein sehr kleines Aufgebot an Dingen, die das in letzter Konsequenz nicht taten –, dann flippte sie aus, dann bekam sie einen Wutanfall nach dem anderen, und die waren von derart unvorstellbaren Lautstärken und derart aktivistisch, dass es Zeiten gegeben haben muss, in denen Dad sich nach der relativen Beschaulichkeit der Schützengräben in Frankreich zurücksehnte.
Doch Mutter hätte sich selbst nie als eine Tyrannin gesehen. Ihr Trick war Herrschaft durch Schwäche. Während Dad es vorzog, bei offenem Fenster zu schlafen, musste es bei Mutter geschlossen sein, weil sie die Alternative einfach nicht verkraftete. Betrüblicherweise war damit grundsätzlich jede Wahl verbaut, weshalb Verhandlungen auch nie eine Option waren. Einmal vertraute Dad mir an, dass sie vor ihrer Heirat sehr viel flexibler gewesen sei.
Erst in späteren Jahren begann ich zu erkennen, wie alarmiert Dad von ihren Ausrastern wirklich war. Zwar sagte er gelegentlich so etwas wie dass man »die kleine Lady auf ebenem Kiel halten« müsse, doch in Wahrheit wollte er mit seiner gespielt amüsierten Gelassenheit seine eigene Angst verbergen. Denn wenn Mutter die Beherrschung verlor, dann drehte sie wirklich durch: Rage füllte ihr ganzes Inneres aus, bis dort kein Raum mehr für die anderen Aspekte ihrer Persönlichkeit war. Sie mussten Platz machen, bis sich wieder alles ein wenig beruhigt hatte. Die Redensart »außer sich vor Wut« könnte in Weston-super-Mare erfunden worden sein.
Mutter konnte auch ziemlich charmant und heiter und amüsant sein, aber nur, wenn Besuch da war. Kaum war er gegangen, schwand ihre Geselligkeit dahin. Das heißt, es herrschte praktisch immer Spannung im Hause Cleese, denn wenn Mutter gerade einmal nicht zornig war, dann nur, weil sie noch nicht wieder zornig war. Dad und ich wussten, dass der winzigste Anlass – praktisch jeder – zum Auslöser eines neuen Ausbruchs werden konnte, ergo lautete die Devise: Verhalte dich immer unauffällig und friedliebend.
Es kann kein Zufall sein, dass ich einen so großen Teil meines Lebens mit irgendeiner Art von Therapie verbrachte und die überwältigende Mehrheit meiner Probleme etwas mit meinen Beziehungen zu Frauen zu tun hatte. Die tief eingefleischte Angewohnheit, in Gegenwart meiner Mutter wie auf Eiern zu gehen, beherrschte meine romantischen Liaisonen viele Jahre lang, folglich hatten Frauen mich immer ausgesprochen fade gefunden, bis sich das allmählich zu ändern begann. Der mir eigene Cocktail aus übermäßiger Höflichkeit, unendlicher Beflissenheit und der Angst, irgendwelche Kontroversen vom Zaun zu brechen, machte mich total unsexy. Sehr, sehr nette Männer machen keinen Spaß. Ich schrieb einmal einen Sketch, der auf meinem jüngeren Ich basierte (1968, für das US-Special How to Irritate People), weil ich zeigen wollte, wie vertrackt der ständige Versuch eines friedfertigen Verhaltens sein kann:
John Cleese: Ich fürchte, ich bin heute Abend keine sehr angenehme Gesellschaft.
Connie Booth: Nein, es ist meine Schuld. Ich bin nervös.
JC: Nein, nein, nein, du bist wundervoll, wirklich, super! Es ist meine Schuld.
CB: Ach, Schwamm drüber.
JC: Ich bin keine angenehme Gesellschaft.
CB: Doch, bist du.
JC: Bin ich nicht. Ich töte dir den letzten Nerv.
CB: Ist schon in Ordnung.
JC: Ich habe dir immer den letzten Nerv getötet. Es ist meine eigene Schuld, du hast mir ja schon das letzte Mal gesagt, dass ich dir zu oft auf die Nerven gehe.
CB: Bitte!
JC: Sag doch, gehe ich dir zu sehr auf die Nerven?
CB: Ein wenig.
Obwohl wir uns nur selten unsere wahren Gefühle zeigten, gab es doch Momente der Nähe zwischen meiner Mutter und mir. Fast immer, wenn wir gemeinsam lachten. Sie hatte einen ziemlich schrillen Sinn für Humor, und als ich älter wurde, entdeckte ich zu meiner Überraschung, dass sie sogar über hintergründige, ja ziemlich schwarze Witze lachen konnte. Einmal, ich erinnere mich noch gut, listete sie gerade methodisch alle Gründe auf, weshalb sie nicht mehr weiterleben wollte, während ich mich angesichts meiner Machtlosigkeit, ihr zu helfen, wie üblich deprimiert und als Versager fühlte. Plötzlich hörte ich mich sagen: »Mutter, ich habe eine Idee.«
»Ach ja? Und wie sieht die aus?«
»Ich kenne einen kleinen Mann, der lebt in Fulham. Mit dem könnte ich mal reden, und wenn du dich nächste Woche immer noch so fühlst – aber nur, wenn du das willst –, könnte er nach Weston kommen und dich umbringen.«
Stille.
»O Gott, ich bin zu weit gegangen«, dachte ich. Und dann fing sie laut gackernd an zu lachen. Ich glaube, ich habe sie nie so sehr geliebt wie in diesem Moment.
Wo war ich noch mal? Ach ja, wir waren im Haus der Raffles untergekommen, wo wir einigermaßen sicher vor deutschen Bomben waren und einen Logenplatz mit vorzüglichem Blick auf das bäuerliche Leben in Somerset hatten: Kühe melken, Schweine mästen, Hühner exekutieren. Es war ein sehr kleiner Hof, und das einzig wirklich Überraschende war, dass Mr. und Mrs. Raffle kein Englisch sprachen. Ich meine damit nicht, dass sie eine andere Sprache gesprochen hätten, sondern dass sie gar nichts sagten, was Ähnlichkeit mit einer Sprache hatte. Allerdings schienen sie ihre Laute untereinander zu verstehen, und da sie sich nicht besonders mochten, begannen wir zu ahnen, dass es ihr begrenztes Vokabular war, das jede unnötige Auseinandersetzung verhinderte. Wie Dad es geschafft hatte, mit Mr. Raffle unsere Miete auszuhandeln, weiß ich nicht. Vermutlich hatte er dazu Kieselsteine benutzt, möglich aber auch, dass sich der kleine Sohn der Raffles, der gerade etwas Englisch im Kindergarten aufschnappte, als Übersetzer angeboten hatte.
Mr. Raffle besaß zwei Hütehunde, deshalb waren wir ein wenig überrascht, als wir entdeckten, dass er keine Schafe hatte. Dad meinte, dass er sich die Hunde zugelegt hatte, damit die Leute glaubten, er besäße Schafe; Mutter meinte, dass es sich vermutlich um Kuhhunde handelte. Ich mochte sie – sie waren freundlicher als die Kaninchen und verbrachten viel Zeit damit, in deren Verschlag zu starren. Was die Kaninchen betrifft, ist mir übrigens nie klar geworden, warum sich die Raffles die Mühe machten, sie im Käfig zu halten, denn sie hatten ja Frettchen, die sie in den Feldern jagten. Ich nehme mal an, dass sie sie einfach gerne frisch in der Nähe halten wollten für den Fall, dass sie Lust auf einen kleinen Snack bekamen. Das könnte auch erklären, warum mein Angreifer seine Reißzähne in mich geschlagen hat: Er wollte nicht einfach still abtreten.
Bedauerlicherweise zog die Familie Cleese gerade dann, als ich allen Tieren Namen zu geben und das kleine Brent Knoll ein wenig kennenzulernen begonnen hatte, nach Totnes in Devon in ein kleines Cottage um. Dann ging es ohne jeden ersichtlichen Grund wieder zurück zu den Raffles, dann wieder nach Devon (nach Horrabridge, wo ich eine Spinne sah, die so groß war, dass ich sie laufen hören konnte), dann wieder zurück nach Brent Knoll, dann unmittelbar nach dem Tag der Befreiung nach Burnham-on-Sea, wo wir im Laufe von drei Jahren drei verschiedene Häuser bezogen, bevor wir 1948 schließlich wieder in Weston-super-Mare eintrafen, damit ich dort die St. Peter’s Preparatory School besuchen konnte. Alles in allem zogen wir in meinen ersten acht Lebensjahren acht Mal um.
Da ich noch zu klein war, um in die Gespräche über dieses Thema einbezogen zu werden, kann ich nur raten, warum dem so war. Praktische Probleme ergaben sich durch diese ständigen Standortwechsel kaum, weil Dad ihretwegen nie seine Stelle wechseln musste. Als Versicherungsvertreter der Guardian Assurance Company war er für eine Region im West Country zuständig, durch die er ständig seine Runden fuhr, um den Bauern Lebensversicherungen und eine Menge Elementarschadenversicherungen zu verkaufen. Und weil er den Ruf hatte, ein anständiger Kerl zu sein, wurden ihm auch viele Versicherungskunden durch die persönlichen Empfehlungen von Bank-Zweigstellenleitern und Anwälten in Somerset vermittelt. Sie wussten, dass er kompetent und ehrlich war und nicht versuchen würde, ihren Klienten unnötig hohe Deckungen anzudrehen. Auf diese Weise verkaufte er mehr Lebensversicherungen als jeder andere Vertreter der Guardian, wiewohl er das Ganze ziemlich gemächlich anging. Er verließ das Haus nie vor halb zehn morgens und kehrte nie später als um halb fünf am Nachmittag zurück. Sein Geheimnis war, dass er seiner guten Kontakte wegen nie »Klinkenputzen« musste und es völlig egal war, wo er wohnte, vorausgesetzt es war irgendwo mitten in Somerset, weil seine Wegstrecken dort von überall kurz waren.
Die Anforderungen, die der Job an Dad stellte, können also nicht als Erklärung für die ständigen Umzüge herhalten, aber vielleicht seine Geldsorgen. Als Versicherungsvertreter verdiente er in den frühen Fünfzigerjahren 30 Pfund die Woche. Verglichen mit dem Einkommen von Bergmännern und den meisten Fußballern, die im Schnitt zehn Pfund die Woche bekamen, war das nicht schlecht, und mir ist auch nie aufgefallen, dass es uns an irgendwas gefehlt hätte. Allerdings wäre in der Cleese-Familie auch keiner auf die Idee gekommen, irgendwas »Teures« zu kaufen. So etwas hatten wir nicht auf dem Radar. Mir wäre beispielsweise nie auch nur in den Sinn gekommen, dass wir unsere Ferien auch mal im Ausland verbringen oder ein neues Auto kaufen oder zum Weihnachtslunch etwas anderes als Hähnchen essen könnten.
Meinem Vater hingegen müssen solche abwegigen Ideen durchaus im Kopf gespukt haben, denn er war ein gütiger und großzügiger Mensch und hätte uns liebend gern einen eleganteren Lebensstil geboten, ähnlich dem, den er Anfang der Zwanzigerjahre in Indien, Hongkong und China geführt hatte. Doch mit 1500 Pfund im Jahr konnte man keine großen Sprünge machen, und wiewohl er seine Geldsorgen gut zu verbergen wusste, begann mir doch aufzufallen, dass er hie und da unter großen Anstrengungen Geld für eine Anschaffung beiseitelegte. Das fiel auch Mutter auf, und dann pflegten wir uns immer diesen gewissen Blick zuzuwerfen, wenn er wieder einmal mit »überraschend preiswerten« Sportjacken aus Jugoslawien oder libanesischen Spitzenklasseschuhen oder einem erstklassigen albanischen Schinken ankam, die er allesamt im vollen Wissen erstanden hatte, dass sie bald ihre Form verlieren oder auseinanderfallen oder höchst seltsam schmecken würden. So gesehen liegt der Gedanke nicht wirklich fern, dass die meisten unserer Umzüge von der Wahnvorstellung motiviert waren, dass sich damit Kosten einsparen ließen.
Abb. 2: Vater (rechts) mit kleinem Kind
Diese Umzüge könnten aber auch einen unbeabsichtigten Nebeneffekt gehabt haben: Die Forschung hat nachgewiesen, dass zwischen ständigen Wohnortwechseln in der Kindheit und einer besonders ausgeprägten Kreativität ein Zusammenhang besteht. Wie es scheint, entzündet sich der schöpferische Funke oft an der Notwendigkeit, gegensätzliche Weltanschauungen in Einklang bringen zu müssen. Wenn man umzieht, beginnt man ein etwas anderes Leben zu führen als zuvor und den neuen mit dem vorangegangenen Lebensabschnitt zu vergleichen, dadurch Unterschiede und Ähnlichkeiten festzustellen und zu erkennen, was einem besser gefällt und was man vermisst. Und derweil das geschieht, wird der Geist flexibler und immer geübter, Gedanken und Ideen auf neue Weisen zu kombinieren. Eine andere Möglichkeit, Kreativität zu entwickeln, ergibt sich, wenn wichtige Menschen im eigenen Leben, vor allem die Eltern, die Welt auf unterschiedliche Weisen sehen. Denn dann ist man herauszufinden versucht, was sie neben dem, das sie unterscheidet, gemein haben, da man sich nur so einen Reim auf diese Paarung von Gegensätzlichkeiten machen kann. Führen die Eltern hingegen eine harmonische Beziehung und wächst man an ein und demselben Ort auf, wo jeder die gleichen Einstellungen hat wie der andere, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man innovativ zu denken beginnt oder auch nur sein möchte. Ich bezweifle, dass es an der Iowa State University einen besonderen Hang zu Kreativität gibt.
Was die anbelangt, war ich also doppelt gesegnet: permanente Standortwechsel und elterliche Disharmonie. Addiert man zu diesen beiden Geschenken noch die wohlbekannte Tatsache, dass viele der größten künstlerischen und wissenschaftlichen Geister der Welt die Produkte schwerwiegender Mütterdeprivationen waren, dann zwingt mich das geradewegs zu der Schlussfolgerung, dass ich ein GIGANT hätte werden können, wäre meine Mutter emotional nur noch ein klein wenig unzureichender gewesen. Ich hätte ein begnadeter Musiker, begabter bildender Künstler, herausragender Tänzer, Erfinder oder viel verlegter Dichter werden können, anstatt innerhalb sehr begrenzter Parameter nur gut im Schreiben und Darstellen von Comedy zu sein. Hach ja.
Obwohl ich in meinen frühen Jahren also durch das ganze West Country gejagt wurde, blieben mir außer von der Farm der Raffles und der Spinne von Horrabridge nur einige vereinzelte Erinnerungen erhalten. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich einmal während eines Spaziergangs mit Dad ein Dröhnen hörte, in den Himmel hochblickte und sah, dass er angefüllt war mit großen Flugzeugen, die Richtung Kontinent flogen. »Das ist einer unserer Angriffe auf Sicht«, erklärte Dad. Wir waren gerade dabei, den Krieg zu gewinnen, deshalb mussten wir nicht mehr nachts fliegen. Einmal redeten Dad und ich mit einem netten, jungen amerikanischen Piloten, der mich in seinen Jeep klettern ließ, wobei ich mir meinen kostbaren Knöchel zerkratzte. Ein andermal fuhr Dad mit uns in die Hügel hinter Weston, wo wir ein deutsches Flugzeug betrachteten, das in ein Feld gestürzt war. Es war kleiner, als ich erwartet hatte, und es standen eine Menge Gaffer drum herum, aber sie waren sehr still.
Am schönsten waren die Sonntage, wenn Dad mich zum Bahnhof von Brent Knoll mitnahm, wo wir ins Signalhäuschen rauf durften und der Bahnwärter mich die großen Hebel bedienen ließ, die die Weichen stellten. Dann gingen wir runter auf den Bahnsteig, wo immer ein Deckelkorb voller Wettflugtauben stand, den mich der Stationsmeister dann öffnen ließ, um die Tauben fliegen zu lassen. Zuerst stiegen sie im engen Verbund hoch in den Himmel auf, wo sie dann drei Mal im Kreis flogen – immer drei Mal –, bevor sie sich Richtung Norden in ihre Heimat nach Widnes und Warrington und Wigan aufmachten. Es war das aufregendste, schönste Erlebnis, das man sich denken kann.
Die einzige unmittelbare Auswirkung des Krieges auf unser Leben traf mit der Information ein, dass unsere Möbel vernichtet worden waren. Am Tag, an dem wir zum ersten Mal bei den Raffles eingezogen waren, hatten meine Eltern sie in einem Lagerhaus untergestellt, das dem bekannten Westoner Auktionshaus Lalande gehörte und wo sie nun von einer Brandbombe gut durchgebraten worden waren. Es waren keine besonders eleganten Möbel gewesen, natürlich, und in gewisser Weise hatten Les Boches uns damit sogar einen Gefallen getan, denn nun konnten wir wesentlich unbeschwerter und relativ unbelastet von eigenem Hab und Gut von einer möblierten Unterkunft in die andere wechseln.
Ich merke, dass eine Menge meiner frühesten Erinnerungen etwas mit dem Krieg zu tun haben, aber gewiss nur deshalb, weil solche Momente in einem starken Kontrast zu meinen Alltagserlebnissen standen. Auf dem Land in Somerset und Devon konnten Monate vergehen, ohne dass ich mir des Krieges auch nur im Geringsten bewusst gewesen wäre. Tatsächlich realisiere ich erst jetzt, wie viel Glück ich hatte, dass ich in kleinen Dörfern im kleinen West Country, umgeben von opulentem Blattwerk in smaragdgrünen Nuancen aufwuchs. Ich verbinde diese Zeit mit einer stillen Zufriedenheit und seelenruhig gelassenen Aufmerksamkeit, die ich mir in Städten nur selten zurückerobern kann. Vor Jahren las ich einmal, was der Psychologe Abraham Maslow über »Gipfelerfahrungen« schrieb, und begriff, dass solche Momente fast ausschließlich im Zustand der Ruhe und inneren Gelassenheit auftreten. Und in meinem Fall sind sie zudem niemals mit Arbeit verbunden. Wordsworth schrieb über seine Lieblingsblumen:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils.2
Erinnere ich mich an Momente eines perfekten, zeitlosen Glücklichseins, dann lümmle ich zum Beispiel im Liegestuhl im Garten meines Hauses in Holland Park und beobachte die kabarettistische Vorstellung zweier Burma-Kätzchen oder betrachte in Den Haag Vermeers Gemälde von Delft, spiele in Sydney mit einem Kängurubaby, lausche John Williams’ Gitarrenspiel, schippere Moselwein trinkend auf dem Rhein, esse mit meiner Frau (so wie vor zwei Abenden) Fish and Chips bei Geale’s oder liege auf der Wiese in der Sonne und sehe vor meinem inneren Auge Dick Cheney, der einer Waterboarding-Folter unterzogen wird. Nichts davon hat auf irgendeine Weise etwas mit Arbeit oder überhaupt mit irgendeinem Streben zu tun. Das erkläre mal einer Terry Gilliam.
1 Die scharfsinnigste Definition eines Feiglings stammt vom amerikanischen Schriftsteller Ambrose Bierce: Ein Feigling ist »einer, der in einer gefährlichen Notlage mit den Beinen denkt«. Mir scheint dieser Charakterzug eine sehr kluge Reaktion auf eine Gefahrenlage zu sein. Allein dass es sie als Möglichkeit gibt, erklärt, warum Generäle Feiglinge am liebsten tot sehen – weil die Idee, weglaufen zu können, anderenfalls derart schnell Schule machen würde, dass die Lamettahengste über Nacht arbeitslos wären oder zumindest selbst einmal etwas kämpfen müssten, was in ihrer Dienstbeschreibung jedoch nicht vorgesehen ist.
2 Anm. d. Übers.: William Wordsworth, aus: I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils): »Oft, wenn ich auf der Couch verweil’,/Gedankenvoll oder müßig müde,/Bieten sie sich dem Inn’ren feil./Das sind die Wonnen der Solitüde./Dann ist im Herzen frohes Wissen/Um seinen Tanz mit den Narzissen« (übertragen von Yvonne Badal).
2. KAPITEL
Meine letzte Erinnerung an unsere Zeit in Brent Knoll gilt dem Besuch eines ziemlich kleinwüchsigen, leisen, älteren Mannes namens John Cheese. Er war Dads Dad und hatte den Ruf des weißen Schafes unter den schwarzen seiner Familie. Offenbar hatte er so wenig von seinem Vater und seinen Brüdern gehalten, dass er das Haus verließ, sobald es ihm möglich gewesen war, und meilenweit weg bis nach Bristol zog, um sich von ihnen zu distanzieren. Was seine Familie angestellt hatte, kam nie zur Sprache. Ich glaube, sie waren Bäcker, aber das könnte auch eine Cover Story gewesen sein, damit sie sich die ganze Nacht außer Haus rumtreiben konnten.
Mein Großvater muss in seinen Siebzigern gewesen sein, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. In jenen Tagen war das ein beträchtliches Alter gewesen. Ich erinnere mich auch, dass er einen Stock brauchte, um ziemlich langsam neben Mutter und mir über die Wege von Somerset zu spazieren. Er war ein sehr formeller Mann – zurückhaltend, bedächtig, gesetzt –, strahlte aber etwas Freundliches, Sanftmütiges aus. Eigentlich sah er aus wie Doktor Dolittle, doch obwohl ich gerne um ihn war und mich auch noch entsinne, wie angenehm zuvorkommend er und Dad miteinander umgingen, erinnere ich mich nicht daran, wirklich je Spaß mit ihm gehabt zu haben. Er hatte einen einzigen kleinen Witz im Repertoire: Ein Pfauenhahn, der als Haustier gehalten wird, fliegt über die Mauer in Nachbars Garten und legt dort ein Ei. Gehört das Ei dem Besitzer oder dem Nachbarn? Hatten wir dann lange genug herumgerätselt, machte er uns darauf aufmerksam, dass ein Pfauenhahn keine Eier legt. Das war nicht unbedingt die Art von Dick-und-Doof-Witz, die ein Kind zum Lachen bringt, deshalb hat es mich auch nicht überrascht, als ich später erfuhr, dass er sein ganzes Leben lang Kanzlist in einer Anwaltssozietät geblieben war.
Grandpa war der einzige noch Lebende unter meinen Großeltern. Die Mutter meiner Mum war schon viele Jahre zuvor gestorben. Anhand der Fotos beurteilt, war sie eine ältere, eher ätherische Version von Virginia Woolf gewesen. Ihr Mann Marwood Cross wirkte hingegen so durchgeistigt wie ein Warzenschwein: ein plumper, reizbarer, selbstgerechter, ungehobelter kleiner Mann, der zu seiner Zeit offenbar einer der »gefeiertsten« Auktionatoren von Weston-super-Mare war. (Westoner hatten von jeher den Hang, sich gegenseitig zu überhöhen: Die Namen von Ärzten wurden nur in ehrfürchtig gedämpftem Ton ausgesprochen, Chirurgen und Architekten waren unweigerlich »herausragend«, Rechtsanwälte »bedeutend«, Unternehmer »einflussreich«, Schulleiter »angesehen«, Geschäfte »renommiert« und Trafikanten »namhaft«.) Nun, es gab ein halbes Dutzend Auktionatoren in Weston, und sie waren alle prominent, namhaft und schwer von sich selbst beeindruckt. Als meine Eltern meine Taufnamen wählten, entschieden sie sich für Grandpas John und für das Marwood vom Einfaltspinsel. Mutter meinte, dass Leute, die künftig nach meinem Namen fragen und hören würden, dass ich John Marwood Cleese heiße, überrascht hochblicken und fragen würden: »Oh! Sind Sie zufällig mit Marwood Cross, dem Auktionator verwandt?« Hier eine Multiple-Choice-Frage für Sie, lieber Leser: Wie oft ist das während meiner siebzig-plus Jahre auf diesem Planeten geschehen? A: fünftausend Mal. B: zwei Mal. C: Nie.
Marwood Cross war ein umjubelter rotgesichtiger Tyrann, der seinen Laden fest im Griff hatte. Auf dem gedeckten Esstisch lag neben seinem Teller ein Rohrstock, damit er auf seine Kinder eindreschen konnte, falls ihre Tischmanieren zu wünschen übrig ließen. Er selbst war ein herausragender Feigling: Als man einmal einen Einbrecher im Keller wähnte, erschien er mit einer Tischglocke in der Hand auf der Balustrade vor seinem Schlafzimmer im zweiten Stock und befahl seinen Kindern und dem Hausmädchen nachzusehen. Sein Lieblingshobby war das Verfassen von Drohbriefen, die er dann meinem Vater gab, damit er sie bei einer seiner Verkaufstouren in irgendeinem obskuren, abgelegenen Dorf in Somerset aufgeben konnte. Marwood war auch ein Altmeister der Auktionskunst. Wenn er Gefallen an einem Gegenstand fand, den er versteigern sollte, pflegte er vor Abgabe der ersten Gebote schnell einen Käufer zu erfinden, der den äußersten Preis dafür zu zahlen bereit war, und seinen Opfern dann halsabschneiderische Summen abzuknöpfen, derweil er selbst sich den Ruf einer Stütze der Gesellschaft wahrte. Ich möchte hiermit öffentlich Abbitte leisten, weil in meinem Körper auch einige seiner Gene vorhanden sind. Ich werde dafür sorgen, dass man sie zur Strecke bringt, sobald die nötige Technik dafür vorhanden ist.
Abb. 3: Marwood Cross, berühmter Auktionator
Der noch unerwähnte Großelternteil ist Dads Mutter. Sie starb in den frühen Zwanzigerjahren, und ich weiß praktisch nichts über sie, weil, wie mir heute klar ist, Dad so bestürzt von ihrem Tod war, dass er sich sogar viele Jahre später noch weigerte, über sie zu sprechen. Ich hatte das durch Zufall herausgefunden. Ich muss ungefähr vierzehn gewesen sein, als ich in dem winzigen alten Koffer herumwühlte, in dem Dad alle alten Familienunterlagen aufbewahrte, und einen Brief fand, den sie ihm kurz vor ihrem Tod geschrieben hatte. Als ich ihn Dad zeigte, huschte ein seltsamer Ausdruck über sein Gesicht, dann erzählte er, dass er ihn seit damals nie wieder gelesen habe. Er entfaltete ihn, Sekunden später begann er zu schluchzen. Es war das einzige Mal, dass ich Dad weinen sah. Später erklärte er mir, dass ihm die Tränen nicht nur wegen der Erinnerung an seinen Verlust gekommen seien, sondern vor allem, weil er sich so schrecklich schuldig fühlte, dass er die letzten vier Jahre ihres Lebens so weit weg in Indien und Fernost verbracht hatte. Die Kommunikations- und Reisemöglichkeiten waren damals noch so kompliziert, dass er es nicht geschafft hatte, rechtzeitig zurückzukehren, um sich von ihr zu verabschieden. Er glaubte, sie im Stich gelassen zu haben, und war sich sicher, dass sie sich zutiefst von ihm verlassen gefühlt habe. Er zeigte mir die letzte Seite dieses letzten Briefes und deutete auf die Unterschrift, die sich in einer langen, zittrigen dünnen Linie am unteren Rand des Blatts verlor. Für ihn bedeutete das, dass sie »aufgegeben« hatte. Selbst damals, so jung ich noch war, wurde mir bewusst, dass er diesen Kummer nun fast dreißig Jahre lang in seinem tiefsten Inneren mit sich herumgeschleppt hatte und dies der Grund gewesen war, weshalb er und Mutter den Namen meiner Großmutter niemals erwähnten.
Aber ich habe Dad nicht nur niemals wieder weinen gesehen, ich habe ihn auch niemals zornig die Stimme erheben oder jemals fuck sagen gehört. Er war ein Gentleman im besten Sinne des Wortes, nicht durch Erziehung, natürlich, sondern weil er sich selbst das Verhalten beigebracht hatte, das den von ihm bewunderten Werten entsprach – denen des »englischen Gentleman«. Während seiner Zeit in der Armee und anschließend in Indien und Fernost hatte er einige der offenbar besten Vertreter dieser Spezies beobachten können und war so beeindruckt gewesen von deren Höflichkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Gutmütigkeit, Tapferkeit, Aufrichtigkeit und konstanter Weigerung, andere mit ihren Problemen zu behelligen, dass er beschloss, sich diese Haltung zum Vorbild zu nehmen.
Abb. 4: Seltsame Auswahl von Brent-Knoll-Bewohnern: Grandpa Cheese ganz rechts, Mutter (mit Schulterpolstern) und ich (mit Brechstange)
Aber das war eindeutig Zukunftsmusik gewesen, als er 1893 in eine Familie hineingeboren wurde, die ohne Frage der unteren Mittelschicht von Bristol angehörte. Der kleine Reggie besuchte das katholische St. Brendan’s College, nicht weil die Cheeses Katholiken gewesen wären, sondern weil der Schulleiter ein guter Freund seines Vaters gewesen war. Reggie war intelligent und verfügte über eine schnelle Auffassungsgabe, aber nicht die geringsten akademischen Interessen, also verließ er die Schule frühzeitig und nahm einen Job in einem Versicherungsbüro an. Einer seiner liebenswertesten Charakterzüge war dieser völlige Mangel an Ehrgeiz, was eine Menge beiträgt, um zu erklären, warum er sein ganzes Leben lang dem Versicherungsgewerbe treu blieb. Ein anderer Grund dafür war gewiss, dass er sehr gut mit Zahlen umgehen und ziemlich komplizierte Kopfrechnungen machen konnte. Es war so selbstverständlich für ihn, dass er deshalb sogar bei seinem Mathematiklehrer in St. Brendan’s in Ungnade gefallen war, weil dieser ihn aufgefordert hatte, ihm vorzuführen, wie er seine Berechnungen anstellte, Reggie aber nicht eingesehen hatte, wozu das gut sein sollte.
Ich bin mir sicher, dass Dad der Versicherung ein nützlicher Mitarbeiter war. Angesichts seiner Rechenbegabung, seiner erlesenen Manieren und seinem vorzüglichen Gespür für Menschen kann es gar nicht anders gewesen sein. Außerdem war es nicht seine Art, Geld einzustecken, ohne den vollen Gegenwert dafür zu liefern. Und er verstand seine Gewissenhaftigkeit immer mit unbeschwerter Gutherzigkeit zu verbinden. Das Leben, das er führte, war angereichert mit Streichen, Scherzen und Juxereien, die er und seine Spezis sich ausdachten und die direkt seinem Lieblingsroman Drei Mann in einem Boot hätten entsprungen sein können. Sogar mit den Kunden im Versicherungsbüro trieben er und seine Freunde ihre Scherze, beispielsweise wenn sie den Knauf des Spazierstocks eines Gastes mit Sirup einschmierten, sodass der hilfreiche Geist, der ihn für den Besucher aus dem Stockständer holte, daran kleben blieb. Außerhalb des Büros waren sie noch um einiges ausgelassener, doch niemals auf eine unangenehme, geschweige denn brachiale Art. Oft war das Seebad Weston die Kulisse für ihre Mätzchen, etwa wenn sie Eselreiten gingen, jeder in eine andere Richtung davonhoppelte und die Esel dann in Privatgärten zurückließ, wo sie sich an den Blumen delektierten. Ihr spektakulärstes Ding drehten sie im Wintergarten. Zuerst hatten sie bei einem Fleischer ein paar kleine Hühner geklaut, diese dann in ihren Anzügen versteckt auf die Empore des Wintergartens geschmuggelt und dort aufs Stichwort hoch in die Luft geschleudert, sodass sie aufs Orchester niederflatterten, das gerade den Nachmittagstee der feinen Leute musikalisch untermalte.
Dad wohnte bei seinen Eltern, bis er zweiundzwanzig war. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Spätsommer 1914 wollte er sich freiwillig melden, wurde aber ausgemustert, weil er bei der Augenprüfung die vierte Zeile von unten nicht hatte lesen können. Im Verlauf des Krieges wurde die Armee dann weniger pingelig, aber Dad hatte es bereits vor der Lockerung ihrer Regeln noch einmal versucht. Und dieses Mal hatte er den Mann, der vor ihm in der Schlange stand, gebeten, sich die Zeile zu merken, die er nicht hatte lesen können, und sie ihm beim Hinausgehen vorzusagen. Diese List ermöglichte ihm dann die Teilnahme am Blutbad in Frankreich, verbunden mit einer Namensänderung. Er hatte es dick gehabt, ständig als fermentierter Quark aufgezogen zu werden, also hatte er kurz entschlossen das h gegen ein l eingetauscht. Ich habe nie begriffen, was er sich davon versprach, denn ich wurde trotz meinem l grundsätzlich vom Augenblick an, wenn ich eine Schule betrat, Cheese genannt. Vielleicht hatte seinem Regiment, den Gloucesters, schlicht die Phantasie für diese Ableitung gefehlt.
Nach der Grundausbildung wurde er Leutnant, der niedrigste Offiziersrang in der britischen Armeehierarchie. Er erfuhr nie, weshalb man ihn zum Offizier erkoren hatte, nahm aber an, dass er es seinem grammatikalisch korrekten Englisch zu verdanken hatte. Er traf 1915 in Frankreich ein und war binnen Wochen verwundet (Granatsplitter im Rücken und in den Schultern, deren Narben noch mehr als dreißig Jahre später zu sehen waren). Also schrieb er ein höfliches Gesuch an seinen kommandierenden Offizier (die Armee jener Tage war noch eine sehr ritterliche Angelegenheit gewesen) und kehrte nach England zurück, um sich auszukurieren. Kaum war er genesen, verpflichtete er sich erneut, diesmal jedoch als Gefreiter. Als man in der Armee herausfand, dass er bereits als Offizier gedient hatte, löste das ein ziemliches Gebrüll aus, aber schließlich beruhigte man sich wieder und ließ ihn als einfachen Hauptgefreiten wieder nach Frankreich ziehen. Ich hatte das immer für eine liebenswerte Exzentrik von Dad gehalten, und so typisch für sein Desinteresse an irgendeiner Karriere, bis ich Jahre später herausfand, dass die Lebenserwartung eines Soldaten im niedrigsten Offiziersrang an der Westfront … sechs Wochen betrug. Denn wenn ein Offizier seinen Männern voran aus dem Graben stürmte, pickten sich die Deutschen den Mann mit dem Revolver und der Trillerpfeife heraus und erschossen ihn als Ersten.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahm mich Vater manchmal auf seine Versicherungstouren mit. Dann erzählte er mir im Auto nicht nur von seinen Kriegserlebnissen, sondern auch lustige und faszinierende Geschichten aus der Zeit danach. Nachdem 1918 der Waffenstillstand unterzeichnet worden war, hatte ihn sein kommandierender Offizier offenbar gefragt, was er nun, da der Krieg vorbei war, tun würde. Dad antwortete, dass er nach Bristol zurückzukehren plante und weiterhin Versicherungen verkaufen wollte. »Nein! Nein!«, empörte sich da der Oberst, »Sie müssen los und sich das Empire ansehen, junger Mann!« Prompt setzte er sich hin und begann ein paar Einführungs- und Empfehlungsschreiben zu verfassen. So kam es, dass Dad sich nur wenige Wochen später auf einem Schiff nach Bombay wiederfand, wo dank der Kontakte des Oberst bereits ein Job als Marineversicherer bei einer großen britischen Gesellschaft namens Union of Canton auf ihn wartete. Und dort führte er nun mit einem Mal ein ziemlich nobles Leben. Er war nicht mehr bloß Versicherungsvertreter, er war Zeichner der Seeversicherungsgesellschaft, und da er sehr präsentabel aussah, den richtigen Akzent hatte, über ausgezeichnete Manieren verfügte und geistreich und amüsant war, begann er sich unter den Mittel-Mittelklasseleuten zu bewegen, die »gute« Privatschulen besucht hatten, gelegentlich sogar unter den wirklich feinen Pinkeln, die sich dann häufig als ausgesprochen freundlich und gutmütig und kultiviert erwiesen. Aber nicht zu vergessen, diese Leute hatten auch allen Grund, frohgemut zu sein, denn sie lebten wie Kleinfürsten. Als Dad ein Haus fand, das er sich zur Hälfte teilen konnte, stellte er fest, dass ein fester Stab von vierzehn Dienern dazugehörte; und als er den Vorschlag machte, diese ungewöhnlich hohe Zahl doch etwas zu reduzieren, erklärten ihm die Inder charmant ihr Bedauern. Dazu sei er nicht befugt, es sei seine Pflicht als englischer Gentleman, wenigstens diese Zahl an Dienstboten zu beschäftigen.
Der Typ, mit dem Dad das Haus teilte, hieß Wodehouse und stellte sich als Bruder des Schriftstellers Sir Pelham Grenville (PG) Wodehouse heraus. Dad fand ihn ganz ungemein sympathisch, charmant, wunderbar umgänglich und rücksichtsvoll, seltsamerweise jedoch offenbar völlig humorlos und, was er noch eigenartiger fand, ungemein naiv. Er war wie Dad Mitte zwanzig, doch erst als er einmal einen Arzt in Bombay aufsuchen musste, fand er heraus, dass sich seine Vorhaut zurückziehen ließ. Kaum zu glauben, dass ein Bursche zwei Dekaden durchstehen konnte, ohne über diese Tatsache (immerhin hinsichtlich eines Körperteils, der für die meisten männlichen Wesen von beträchtlichem Interesse ist) zu stolpern. Ich finde, dass das auch ein ziemlich erhellendes Licht auf das Humoristische von PG wirft. Denn wenn der eigene Bruder derart naiv war, wäre es doch denkbar, dass auch PG selbst eine gewisse Weltfremdheit zu eigen war und es auch ihm an den Alltagserfahrungen eines durchschnittlichen Lebemannes beziehungsweise an einem gelebten gewöhnlichen savoir faire gemangelt hatte? Und wenn dem so war, könnte es dann nicht auch sein, dass ebendiese treuherzige Naivität in der ziemlich simplifizierten Psychologie von PGs Figuren zum Ausdruck kam, jenem Umstand, der mich zwingt, ihn als einen sehr guten, aber keinen großartigen Humoristen zu betrachten?
Nicht, dass ich irgendwas gegen Naivität per se hätte. Jeder Mensch, den ich wirklich mag, hat einen gewissen Hang dazu, und Alleswisser waren mir schon immer zuwider. Doch da gibt es einen Punkt am entfernteren Ende des Naivitätskontinuums, wo das Naive ununterscheidbar wird von gewöhnlicher Feld-, Wald- und Wiesenhirnlosigkeit. Die Frage, die man sich in PGs Fall stellen muss, lautet ergo: Ist es wahrscheinlicher, dass ein Mensch AUS VERSEHEN Radiopropaganda für die Nazis macht (wie er es für sich in Anspruch genommen hatte), wenn er sich seine Gene mit einem Mann teilt, der nicht wusste, dass sich seine Vorhaut zurückziehen lässt? Ich für meinen Teil halte ein schallendes JA! für die einzig mögliche Antwort darauf.
Alles in allem hatte Dad eine herrliche Zeit in Indien (nicht zuletzt dank der Tatsache, dass er bei Wodehouses Moment der Offenbarung nicht anwesend gewesen war), er sollte auch sein Leben lang mit großer Zuneigung von den Indern sprechen. Aber natürlich gibt es gar keinen Zweifel, dass es sich dabei um koloniale Herr-Diener-Beziehungen gehandelt hatte. Dad sprach etwas Hindi, gestand aber einmal, dass die einzige grammatikalische Form, in der er Hindi-Verben kannte, der Imperativ war. Er und seine Kumpane waren ein ausgelassener Haufen – was angesichts des schrecklichen Krieges, den sie gerade überstanden hatten, kaum überraschen kann. (Um das jedoch in die richtige Perspektive zu rücken: Es heißt, dass die frisch von der Front nach Cambridge zurückgekehrten Studenten bei ihren überschwänglichen Feiern in der Guy Fawkes Night 1945 mehr Schaden an Gebäuden angerichtet hätten als sämtliche deutsche Bomber im ganzen Zweiten Weltkrieg.) Man könnte auch sagen, sie hatten einen Hang zu dem traditionellen Benehmen von Rugby-Teams am Samstagabend, das heißt, waren in der Regel eher Rowdys als Randalierer. Allerdings war Dad ein Tag in Erinnerung geblieben, an dem das Ganze etwas aus dem Ruder gelaufen war. Offenbar hatte ihn ein Waliser Freund namens Davies eines Sonntagnachmittags zu einer Spritztour in seinem Cabriolet eingeladen. Als Dad auf den Rücksitz hinter dem Chauffeur kletterte, sah er überrascht, dass dort ein kleiner Stapel Ziegelsteine lag. Er machte Davies darauf aufmerksam, der ihm dann antwortete, es würde sich ihm schon noch erklären. Zehn Minuten später griff er nach einem Stein und schleuderte ihn ins Schaufenster eines Geschäfts, an dem sie gerade vorbeifuhren. Der indische Chauffeur fand das ebenso lustig wie sein Brötchengeber. Dad war erstaunt und einigermaßen erleichtert, dass es wenigstens an einem Sonntag geschah, als der Laden geschlossen war.
Dads eigenes schlechtes Benehmen war relativ maßvoll. Er hatte ein Schreiben von einem berühmten Hotel im Bombay aufbewahrt, das er wie einen Schatz hütete. Darin wurde ihm untersagt, jemals wieder das Hotelgelände zu betreten, beigefügt eine lange Liste seiner Schandtaten – irgendwas, das er mit Butterdosen angestellt hatte oder mit Platten voller Kedgeree, diesem angloindischen Reis-Fisch-Eier-Gericht, oder mit dem Abschuss von essbaren Projektilen. Doch als er dann Mitglied des Royal Bombay Yacht Club wurde, dürfte sich sein Benehmen wohl verbessert haben, denn er genoss es, sich unter echten Gentlemen zu bewegen und, wie ich heute weiß, deren Gebaren und Gewohnheiten so genau zu studieren, dass er sie problemlos nachahmen und einiges davon auch mich lehren konnte, als ihm das geboten schien: »Schau nie überrascht drein, mein Junge. Bewege dich langsam. Wenn jemand etwas fallen lässt und du willst hinsehen, warte ein paar Sekunden, erst dann drehe dich gemächlich um und wirf einen kurzen Blick drauf. Starre niemals.«
Der einzige Wermutstropfen auf Dads Aufenthalt in Indien war die Malaria, die er sich dort einfing und die ihm noch jahrelang zu schaffen machen sollte. Wenn sie ihn wieder einmal überfiel, konnte er nichts anderes tun als sich einige Tage lang ins Bett zurückziehen, wo er dann zitternd und schwitzend und zähneklappernd dalag und so schwach wurde, dass er nur noch geduldig ein Kilo nach dem anderen verlieren konnte.