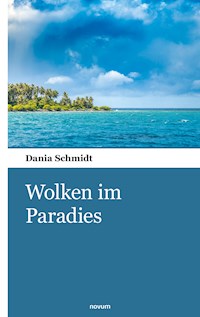
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pocket Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Anfang 20 verlässt Dania Deutschland und zieht nach Mexiko. In der traumhaften Karibik lebt sie schließlich ihren Traum. Die junge Deutsche verdient ihr Geld als Abenteuer-Tour-Guide und führt Urlauber in die bezaubernde und magische Welt der Mayas, schwimmt durch Tropfsteinhöhlen und schnorchelt mit dem größten Fisch der Welt. Sie lernt Luis kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Alles scheint perfekt. Sie bekommen einen Sohn, dann eine Tochter. Doch immer mehr graue Wolken erscheinen am Horizont. Der Alkohol hat Luis fest im Griff. Und seine Auswirkungen bekommt sie am ganzen Leib zu spüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Impressum 6
Widmung 7
I 8
1 8
2 15
3 22
4 25
5 27
6 40
7 47
8 57
9 60
10 65
11 69
12 71
13 78
14 83
15 87
16 90
17 93
18 100
19 104
20 109
21 114
22 120
23 123
24 127
25 130
26 137
27 140
28 142
29 146
II 149
1 149
2 160
3 165
4 169
5 173
6 181
7 183
8 187
9 192
10 195
11 197
12 200
13 204
14 206
15 209
16 214
17 217
18 220
19 224
20 234
21 238
22 246
23 250
24 254
25 257
26 262
27 275
28 280
29 285
30 290
31 292
32 294
33 296
34 301
35 303
36 306
37 314
38 320
39 323
40 326
41 328
42 331
43 334
44 338
45 340
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99010-991-5
ISBN e-book: 978-3-903382-52-7
Umschlagfoto:Flowersofsunny | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Für Flynn und Keyla
I
1
Der Wecker klingelt. Im Dunkeln ertaste ich ihn und blicke mit halb geöffneten Augen auf die Zeiger. Halb vier. Alles ist still. Nur der Ventilator an der Decke summt leise vor sich hin. Carlos schläft tief und fest. Leise schleiche ich mich aus dem Bett. Es ist warm, aber die Müdigkeit lässt mich frösteln und ich stelle mich unter die Dusche. Lasse lauwarmes Wasser an meinem müden Körper herunterprasseln.
Ich ziehe meinen pinkfarbenen Bikini an, darüber einen kurzen schwarzen Rock. Streife ein hellblaues Polohemd über, auf dem das Firmenlogo der Agentur abgebildet ist, für die ich arbeite: ein Walhai.
In der Küche beiße ich in eine Banane. Für unterwegs schmiere ich mir ein Brot.
Leise schließe ich die Wohnungstür hinter mir und gehe hinaus in die Dunkelheit. Schwach schimmern die Laternen und tauchen die Straße in ein gelbliches Licht. Auf der anderen Straßenseite stehen keine Häuser, nur das dunkle dichtbewachsene Grün des Urwaldes.
Mit meinem Rucksack auf dem Rücken und der Schnorchelausrüstung, die ich mir in einer großen Tasche um die Schulter hänge, gehe ich den kleinen gepflasterten Weg am Haus entlang bis zum schwarzen Gartentor.
Vor dem Tor am Straßenrand wartet schon ein glänzend weißer Toyota-Kleinbus auf mich. Alles ist ruhig. Der Fahrer hat es sich auf dem Sitz bequem gemacht und sich mit geschlossenen Augen leicht zurückgelehnt. Er wartet sicher schon seit einigen Minuten.
Ich steige auf den Beifahrersitz und begrüße ihn, wir haben schon viele Male zusammen gearbeitet. Er heißt Victor. Victor ist Mexikaner und kommt aus Veracruz, einer Hafenstadt am Golf von Mexiko. Der Tourismus-Boom hat ihn vor zehn Jahren in die mexikanische Karibik getrieben. Seither hat er sich ein anständiges Transportunternehmen mit inzwischen sieben Kleinbussen aufgebaut. Einen fährt er selber, für die anderen hat er Fahrer angestellt. Er bietet Transfers vom Hotel zum Flughafen an und vermietet seine Busse an Agenturen für Tagesausflüge. Essen ist seine Leidenschaft, und das sieht man ihm auch an. Kaum Platz bleibt zwischen seinem Bauch und dem Steuer.
Victor dreht den Schlüssel im Zündschloss herum und der Motor springt an. Der typische Geruch eines Neuwagens dringt in meine Nase. Mit dem laufenden Motor beginnt auch sofort die Klimaanlage auf Hochtouren zu arbeiten und lässt mich frösteln. Ich drehe das Gebläse von mir weg. Langsam fährt Victor die ruhige Straße entlang und biegt ab auf die Hauptstraße. Dann geht es auf der Autobahn Richtung Süden. Die einzige Straße, die den Norden mit dem Süden verbindet. Immer parallel zur Küste, mitten durch den fast undurchdringlichen Dschungel. Hier wachsen viele Edelhölzer wie die Mahagonibäume und der berühmte Chicozapote, der schon vor mehr als hundertfünfzig Jahren den Gummisaft für die Herstellung des Kaugummis lieferte. Damals wurde das geschmackloseChicle, wie es auch noch heute in Mexiko genannt wird, von den Ureinwohnern des Urwaldes gekaut. Ein Amerikaner hat es beobachtet, ihm Geschmack gegeben, und das Kaugummi ging um die Welt. Uralte Legenden des Urvolkes dieser Region, der Mayas, machen den Urwald zu einem mystischen Ort. So wird erzählt, dass es vor Tausenden von Jahren zwei Krieger gab, die in die gleiche Frau verliebt waren. Der eine repräsentierte das Licht, der andere die Dunkelheit. Sie bekriegten sich, bis sie letztendlich beide starben, ohne jedoch mit der Geliebten zusammen gewesen zu sein. Um zurückkehren zu können auf die Erde, baten sie die Götter im Jenseits um Vergebung und wurden alsChechénundChacá,Bäumen dieser Region, wiedergeboren. Der schwarze dickflüssige Saft desChechén, der sich unter der Baumrinde befindet, ist giftig und ätzend. Bei Hautkontakt entstehen innerhalb weniger Stunden Verbrennungen zweiten Grades. Der Nektar desChacádagegen neutralisiert das Gift und wird auf die verbrannte Haut als Heilmittel aufgetragen. Beide Bäume befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, meistens beträgt der Abstand zwischen ihnen nicht einmal einen Meter. Da derChacáeine rötliche Baumrinde besitzt, die sich ständig pellt, nennen wir Reiseleiter ihn auch den Touristenbaum. Die krebsroten, von der Sonne verbrannten Urlauber amüsieren sich jedes Mal köstlich über den Vergleich.
Ich entspanne mich mit geschlossenen Augen und genieße die Ruhe. Aus dem Radio ertönt mexikanischer Pop. Sehr schnulzig, aber so mag es Victor halt. So wie wir sind in den frühen Morgenstunden viele Kleinbusse unterwegs auf dem Weg zu den Hotelanlagen, um die Urlauber zu ihren Ausflügen abzuholen oder Abreisende zum Flughafen zu bringen. Der Tourismus boomt. Fast alle Menschen die hier leben, haben direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun. Nicht ohne Grund zählt diese Region zu den wohlhabendsten Mexikos. Was natürlich nicht bedeutet, dass es hier keine Armut gibt. Die gibt es. Obwohl sie den Touristen meist verborgen bleibt.
Auf der Seite des karibischen Meeres wird der dichte Dschungel immer wieder unterbrochen und monströse, palastähnliche Einfahrten kommen zum Vorschein. Sie führen in die luxuriösen, teils gigantisch großen, Hotelanlagen.
Nach fast dreißig Minuten Fahrt erscheint auf einem großen grünen Autobahnschild über der Fahrbahn der Name des Hotels, in dem wir heute Gäste abholen. Victor verlangsamt den Bus und setzt den Blinker. Am Hoteleingang hält er vor einer großen Schranke, und ein Wachmann tritt aus seinem kleinen Häuschen heraus. Wir zeigen ihm unsere Liste mit den Gästenamen. Nach einem kurzen Blick darauf lässt er uns passieren. Die Schranke geht hoch.
Diese Hotelanlage ist eine der größten in der Gegend. Insgesamt fünf Lobbys verteilen sich auf einer gigantisch großen Fläche, die durch Straßen miteinander verbunden sind. Sobald Victor Gas gibt, erscheint einTopeauf der Straße und er wird gezwungen zu bremsen. Langsam fährt er über ihn rüber bis schon kurz darauf der nächste folgt. Der Grund für die Beschleunigungsbremsen sind neben den Fußgänger auch die Tiere, die hier leben, wie Leguane und Nasenbären. DieCoatissehen aus wie eine Mischung zwischen Hund und Affe, habe eine spitze, lange Nase, einen langen Schwanz und kurze Beine. Da sie so gut wie alles fressen und kaum Angst vor Menschen haben, fühlen sie sich in den Hotelanlagen pudelwohl. Zu dieser frühen Stunde habe ich auch schonMazamasim Dunkeln am Straßenrand entdeckt. Das Wort kommt aus dem Nahuatl, der meistgesprochenen indigenen Sprache Nord- und Mittelamerikas. Es bedeutet Hirsch.
Alles in der großen Hotelanlage ist unglaublich schön hergerichtet. Hohe Kokospalmen und duftende Orchideen schmücken den Straßenrand. Am Wegrand ein englischer Rasen. Nirgends auch nur eine Spur von Abfall, Dreck oder Armut. An der Hotellobby werden wir erneut von einem Wachmann kontrolliert. Victor fährt die breite pompöse Auffahrt hoch und hält direkt vor der offenen Eingangshalle an.
Wir sind früh dran. Über den hellen, glänzenden Marmorboden schlendere ich durch den stillen Eingangsbereich. Ein herrlicher Blumenduft umhüllt mich. Er kommt von dem großen, bunten Blumenstrauß aus exotischen Blumen, der in einer gläsernen Vase auf einem runden Tisch mitten in der Halle steht. Selbst auf den Toiletten duftet es herrlich nach Jasmin. Alles ist penibel sauber und glänzt im hellen Licht. Im Spiegel blicke ich auf mein sonnengebräuntes Gesicht und meine von Salzwasser und Sonne ausgeblichenen blonden Haare. Ich befeuchte mein Gesicht mit kaltem Wasser aus dem Wasserhahn um die Müdigkeit zu vertreiben und gehe langsam zurück zum Bus, wo sich inzwischen auch schon meine ersten Gäste eingefunden haben.
Es ist nun kurz nach Sechs und der Himmel färbt sich rosarot. Die Sonne steigt schnell empor, und schon nach kurzer Zeit brennt sie gnadenlos vom wolkenlosen Himmel. In unserem klimatisierten Bus ist von der tropischen Hitze jedoch nichts zu spüren. Der Verkehr auf der Autobahn wird dichter, je weiter wir Richtung Norden fahren. Ein großes Windrad erscheint am Straßenrand und kurz dahinter die Abfahrt zum Flughafen. Wir fahren weiter geradeaus, und plötzlich staut sich der Verkehr bis er komplett zum stehen kommt. Der Grund ist ein Kontrollpunkt des mexikanischen Militärs. Langsam fährt Victor wieder an und im Schritttempo geht es an schwerbewaffneten Soldaten vorbei, die mit einschüchternden Gesichtsausdrücken jeden Autofahrer ganz genau anschauen, bevor sie ihn mit einer Handbewegung zum Weiterfahren auffordern. Nach Waffen und Drogen suchen sie. Touristenbusse sind nicht interessant und Victor darf weiterfahren.
Der dichte immergrüne Dschungel verschwindet nach und nach. Riesige moderne Einkaufszentren und private Universitäten mit ihren grünen Fußballplätzen davor machen sich am Straßenrad breit. Hinter großen, verschlossenen Eisentoren lassen sich teure Wohnanlagen erahnen. Ein mehrspuriger Kreisverkehr erscheint vor uns. Als Victor kurz abbremst, beginnt sofort ein nervtötendes Hupkonzert. Wer schneller ist, hat Vorfahrt. Es ist kurz nach Sieben, die Zeit, in der die meisten Schulen beginnen. Hier ist es üblich, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen, bis sie erwachsen sind und selber fahren können. Dementsprechend viele Autos sind daher schon in diesen frühen Morgenstunden unterwegs. Ein öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen gibt es schon. Sie sind billig und fahren durch so gut wie alle Stadtteile. Doch einen Fahrplan gibt es nicht. Kein System. Hier und da eine Bushaltestelle, an der man warten und auf der Windschutzscheibe desCombisdie Endhaltestelle ablesen kann. Irgendwann kommt dann ein überfüllter, dreckiger und lauter Kleinbus vorbei. Oft hinterlässt er eine schwarze, stinkende Rauchwolke. Die Fahrer fahren ohne Rücksicht auf die Fahrgäste wild durch die Stadt. Raubüberfälle und Entführungen sind keine Seltenheit. Wer sogar das Fahrrad nimmt, ist entweder verrückt oder lebensmüde. Oder beides. Selbst Moped zu fahren ist hier in der Stadt eine gefährliche Angelegenheit, da unter den Verkehrsteilnehmern kaum Rücksicht genommen wird. Ständig scheppert es.
Langsam bahnen wir uns unseren Weg quer durch die Stadt. Von Süden nach Norden. Nachdem wir an einem großen eleganten Einkaufszentrum vorbeifahren, verändert sich das Stadtbild. An den Hausfassaden bröckelt die Farbe ab, und am Straßenrand sammelt sich weggeschmissener Plastikmüll. Ich drehe mich um und blicke in zwölf müde Gesichter. Auf englisch erkläre ich den Urlaubern, was sie heute erwarten. Sie hören mir aufmerksam zu und ich sehe, wie langsam wieder Leben in ihre müden Körper kommt. Einige von ihnen werden nervös.
Seit mehreren Jahren arbeite ich nun schon als Reiseleiterin für Tagesausflüge in der mexikanischen Riviera Maya. AlsTour-Guidefür Abenteuerausflüge durchquerte ich mit meinen Gästen, in einem schweißtreibenden Fußmarsch, den dichten Dschungel und ließ sie die Pyramiden besteigen. Wir seilten uns an steilen Kalksteinabhängen ab, bis wir in ein Wasserloch gelangten und glitten an einem Drahtseil über eine Lagune, während uns Krokodile dabei von unten interessiert zuschauten. Doch heute ist alles anders. Kein Dschungel wird durchquert und keine Pyramide erklommen.
2
Das Meer. Das Festland haben wir schon seit über einer Stunde nicht mehr erblicken können. Das zunächst leuchtende Türkis des karibischen Meeres schimmert nun in einem einheitlichen dunklen Blau. Grelle Sonnenstrahlen glitzern auf der Oberfläche. Und dann entdecken wir sie. Haifischflossen. Es müssen Hunderte sein. Friedlich ziehen sie behutsam durch das Wasser. Walhaie. Die größten Fische der Welt. Mit Walen haben sie trotz des Namens nichts zu tun. Außer vielleicht, dass sie sich ebenfalls von Plankton ernähren, untypisch für einen Hai. Im karibischen Sommer wird das Meer so warm, dass es viel Plankton gibt und die Walhaie in die Region zieht. Ein Festmahl.
Leicht schwankt unser modernes Schnellboot hin und her. Heute ist ein relativ ruhiger Tag und die Wellen sind klein. Trotzdem muss ich mich gut festhalten, um nicht umzufallen. Meine Gäste sitzen gespannt auf den Bänken im hinteren Bereich des Bootes. Überwältigt vom majestätischen Anblick der friedlichen Riesen machen sie Foto nach Foto.
Und dann kann es endlich losgehen. Zehn Gäste habe ich bei mir im kleinen Boot, und pärchenweise dürfen sie nun ins Wasser, um neben den Walhaien zu schwimmen. Damit sie dabei auch gut vorankommen, bekommt jeder Flossen von mir. Durch die Taucherbrille und den Schnorchel können sie während des Schwimmens den Walhai unter Wasser beobachten.
Ich springe ins Wasser. Meine Gäste folgen mir. Das Meer ist erfrischend und gleichzeitig erstaunlich warm. Über meinen Bikini trage ich lediglich ein langärmliges Schwimmshirt als Schutz vor der starken Tropensonne. Irgendetwas pikt an meiner Haut unter der Wasseroberfläche. Vielleicht ist es das Plankton, die pelagischen Minitiere. Es ist zwar etwas unangenehm, jedoch nur von kurzer Dauer.
Nachdem ich mich kurz im Wasser orientiere, setze ich mir die Taucherbrille auf und tauche in die faszinierende blaue Welt ein. Bis auf ein knisterndes Geräusch herrscht komplette Stille. Das Wasser ist erstaunlich klar und ich kann viele Meter weit schauen. Den Meeresgrund erkenne ich dennoch nicht. Ein Schwarm grauer Stachelrochen gleitet tief unter mir vorbei. Dann erscheint ein langsam schwimmender Walhai vor meiner Taucherbrille. Noch ist er einige Meter von mir entfernt, und doch kann ich gut seinen grauen Rücken mit den vielen weißen Flecken und Streifen erkennen. Jeder Walhai hat dabei ein ganz individuelles Muster. Seine winzigen Augen sind kaum zu erkennen. Das Tier ist langsam und bewegt kraftvoll seine große Schwanzflosse hin und her. Wir müssen Abstand halten, um nicht verletzt zu werden, schwimmen daher im vorderen Bereich der Tiere an der Seite mit. Dem friedlichen Riesen scheint unsere Anwesenheit nichts auszumachen. Er zeigt weder Scheu noch Neugier. Nach einer Weile halte ich mit meinen Gästen an und das schöne Tier verschwindet langsam aus unserem Blickfeld.
Plötzlich taucht ein riesiger schwarzer Teufelsrochen vor mir auf. Ich schätze die Spannweite derMantaauf sieben Meter. Zügig schwimmt sie auf mich zu. Der Teufelsrochen ist jedoch, wie der Walhai, ein friedlicher Planktonfresser. Dann dreht er ab. Tief beeindruckt schaue ich ihm hinterher bis er in den blauen Tiefen verschwindet.
Erschöpft und glücklich klettern die Urlauber über die wackelige Leiter zurück ins Boot. Überwältigt von dem besonderen Erlebnis haben die meisten ein großes Lächeln im Gesicht. Zwei Gäste können es jedoch kaum erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, und schauen gequält drein. Haifischfütterung nennen wir das, unter Kollegen. Sie opfern ihr Frühstück den Meeresbewohnern. Andere nennen es einfach Seekrankheit. Es vergeht kein Tag, an dem nicht zumindest einer von meinen Gästen darunter leidet. Vor zwei Wochen haben sie besonders gelitten.
An diesem Morgen konnte noch keiner ahnen, welchen Verlauf der Tag nehmen würde. Ich hatte ein sympathisches, junges deutsches Pärchen dabei, Lisa und Martin. Frisch verheiratet. Viele Pärchen verbringen ihrHoneymoonin der Karibik, so auch die beiden. Morgens im Bus erklärte ich ihnen und den anderen Gästen den Tagesablauf. Gespannt und aufgeregt hörten sie mir zu. Man fährt nun mal nicht jeden Tag auf das offene Meer hinaus, um mit dem größten Fisch der Welt zu schwimmen. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Viele Urlauber buchen diesen Ausflug, weil er ihnen als ein unbedingtes Muss verkauft wird. Wenn es dann allerdings wirklich losgeht und die Touristen in meinem Bus sitzen, wird vielen erst bewusst, worauf sie sich da eingelassen haben. Sie werden nervös. Auch an diesem Morgen spürte ich die Anspannung meiner Gäste.
Als wir am Anleger ankamen schien es, ein wunderbarer Tag zu werden. Neben der strahlenden Sonne zogen nur ganz vereinzelt graue Wölkchen vorbei. Lisa und Martin folgten mir mit den anderen acht Gästen auf das weiße Schnellboot. Meine Anwesenheit gab ihnen Sicherheit. Ich sprach ihre Sprache, verstand ihre Sorgen und konnte sie beruhigen. Als wir bei den Walhaien ankamen, erklärte ich ihnen die Regeln und die Benutzung der Ausrüstung. So wie ich es jeden Tag mache. Während Lisa schon einmal auf den Malediven tauchte, und ein Profi im Umgang mit Schnorchel, Taucherbrille und Flossen zu sein schien, hatte Martin dagegen keine Ahnung. Wasser war nicht sein Element. Planschen im seichten Meer, wenige Meter vor dem Strand alles, für das er bisher zu haben war. Doch jetzt befanden wir uns auf dem offenen Meer. Vom seichten Wasser waren wir knapp dreißig Kilometer entfernt. Wo man auch hinschaute, der Horizont blieb blau. Durch den Wellengang schwankte das Boot leicht hin und her und Martin wirkte sichtlich ängstlich. An seinem Gesichtsausdruck war zu erkennen, dass er sich gerade fragte, was zur Hölle ihn dazu gebracht hatte, diesen Ausflug zu buchen. Um unser Boot herum ragten inzwischen große Haifischflossen aus dem dunkelblauen Wasser. Drehten ihre Runden. Dass es sich dabei um friedliche Haie handelte, schien Martin nicht zu beruhigen. Sicher, irgendwo da unten waren auch andere Lebewesen unterwegs. Wie zum Beispiel die gefürchteten Bullen- und Tigerhaie. Das wusste auch Martin.
Ich setzte mich schließlich neben ihn. Erklärte ihm ruhig, wie er die Brille anlegen und durch den Schnorchel atmen muss. Dann setzten wir uns beide auf den Rand des Bootes. Die Flossen an unseren Füßen baumelten außen am Boot herunter. Fast berührten sie die Wasseroberfläche. Nervös schaute mich Martin an. Da sollte er jetzt reinspringen? Aber es gab da etwas, was ihn antrieb. Er hatte für den Ausflug gezahlt. Und zwar viel. Über zweihundert Euro pro Person kostet dieser Tagesausflug. Und würde er den Sprung jetzt nicht wagen, sein Geld bekäme er nicht zurück. Und er würde es mit Sicherheit bereuen.
„Die Möglichkeit, mit dem größten Fisch der Welt zu schwimmen, wirst du wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben haben.“ Meine Worte überzeugten schon viele meiner Gäste. Und auch ihn. Er sprang. Und ich hinterher. Sobald Martin auftauchte prustete er erschrocken und verängstigt. Ich nahm seine Hand und er beruhigte sich sofort. Da Martin wie alle Gäste, egal ob Nichtschwimmer oder professionelle Taucher, eine Schwimmweste tragen musste, blieb er, ohne sich zu bewegen, an der Wasseroberfläche.
„Leg dich auf die Wasseroberfläche und wirf mal einen Blick unter das Wasser.“ Martin folgte zögerlich meiner Anweisung, wobei er weiterhin krampfhaft meine Hand hielt. Dann fing er an, langsam neben mir zu schnorcheln. Seine Angst verschwand nach und nach. Fasziniert beobachtete er die wunderschönen Walhaie unter der Wasseroberfläche und vergaß vollkommen seine anfängliche Angst. Zurück an Bord des Bootes erzählte er den anderen Gästen euphorisch von diesem einzigartigen Erlebnis. Die Gäste stecken sich gegenseitig an. Hat einer Angst, haben sie auf einmal alle Angst. Die Euphorie von Martin gab den anderen Gästen Mut. Letztendlich schnorchelten an diesem Tag alle mit den Walhaien. Und alle waren sie euphorisch und glücklich.
Als Reiseleiterin habe ich nicht nur die Aufgabe, meine Gäste über den Ausflug zu informieren und auf sie aufzupassen. Ihnen Wissen zu vermitteln über Geschichte, Flora und Fauna. Meine Arbeit ist viel umfangreicher. Agiere ich zudem als Seelsorgerin. Ich mache meinen Gästen Mut, gebe ihnen Halt und Sicherheit. Nehme ihnen Ängste. Jeder Gast ist auf seiner Art besonders. An viele erinnere ich mich immer mal wieder gerne zurück. Bei einigen wenigen bin ich froh, sie nicht wiedersehen zu müssen. Es sind diese Art von Gästen, die sich schon morgens darüber beschweren, dass ihnen die Sonne zu hell, der Regen zu nass und die Klimaanlage zu laut ist. Man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Zu ein paar wenigen Gästen habe ich noch immer Kontakt, eine Freundschaft ist entstanden. Die meisten jedoch sieht man nie wieder. Vielleicht denken sie ja manchmal an mich zurück. An die Reiseleiterin, die ihnen Mut gemacht hat, damals, beim Walhaischwimmen.
Auf der Rückfahrt zum Festland zogen plötzlich schwarze Wolken auf. In der Karibik verändert sich das Wetter manchmal rasant schnell. Ehe wir uns versehen konnten, war der Himmel pechschwarz. Ein rauer Wind begann uns um die Ohren zu pfeifen, und der Wellengang nahm stetig zu. Dann fing es an zu regnen. Wie aus Kübeln begann es zu schütten. Die Schnellboote sind offen, und wir waren dem Regen gnadenlos ausgesetzt. An sich nicht schlimm bei tropisch warmen Temperaturen. Zudem hatten alle noch Badesachen vom Schnorcheln an. Ich selber war im Bikini. Langsam navigierte uns unser junger mexikanische Kapitän über das raue Meer. Wohin er fuhr war mir schleierhaft. Man konnte kaum noch die eigene Hand vor den Augen erkennen. Natürlich gab es ein GPS an Bord und unser Kapitän hatte viel Erfahrung. Doch wäre ein schnelles Boot auf uns zugerast, wir hätten ihm nicht rechtzeitig ausweichen können. Da bin ich mir ganz sicher. Die Sichtweite lag unter einem Meter. Ich stellte mich auf den hinteren Rand des Bootes, hielt mich am Gerüst des Sonnensegels fest und jauchzte vor Vergnügen. Nur ein kleiner Schauer, dachte ich. Dann fing sich jedoch das Wasser im Boot langsam an zu stauen, das bei jeder hohen Welle ins Innere des Bootes katapultiert wurde. Immer weiter stieg die Wasserhöhe an. Und zur Küste waren es sicher noch über zehn Kilometer. Von der euphorischen und glücklichen Stimmung unter den Gästen war nichts mehr zu merken. Zunächst trat eine Totenstille ein. Dann fingen einige an zu weinen und hielten sich krampfhaft irgendwo fest. Martins Gesicht war bleich vor Angst. Eng umschlungen saßen er und Lisa auf der nassen Bank. Schnell schnappte ich mir den schwarzen Eimer, der zur Aufbewahrung der Tauchermasken diente und fing an, das Wasser nach und nach aus dem Boot zu schöpfen.
„Was für ein Abenteuer! Alles inklusive heute“, witzelte ich.
Meine Gäste fanden das natürlich weniger lustig. Anspannung und Angst standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Meine lustige Art beruhigte sie jedoch ein wenig. Nach dem Motto: wenn die Reiseleiterin darüber noch Späße macht, kann es so schlimm doch nicht sein. Aber es war schlimm. Auch wenn ich meinen Gästen Gelassenheit vorspielte. Unser Boot war kurz davor unterzugehen. Und bei diesem Sturm hätte man uns so schnell nicht gefunden. Wenn überhaupt. Doch wollte ich unter allen Umständen Panik vermeiden. Egal was passiert, Panik würde alles nur noch schlimmer machen. Das war mir bewusst.
Nach einer halben Stunde legte sich der Sturm langsam und wir erreichten das Festland. Alle Gäste atmeten erleichtert auf. Der Schrecken stand ihnen jedoch ins Gesicht geschrieben. Ob Lisa und Martin jemals wieder mit einem Schnellboot auf das offene Meer hinausfahren werden, bleibt fraglich.
3
Es ist mein erster Sommer bei den Walhai-Ausflügen. Seit vielen Wochen bin ich nun fast täglich auf dem offenen Meer unterwegs, um Menschen aus der ganzen Welt bei diesem einzigartigen Erlebnis zu begleiten. Doch das Gefühl einer langweiligen Routine will sich noch immer nicht einstellen. Jeder Tag ist etwas Besonderes. Auch heute.
Luis wirft die Motoren an und steuert das Boot langsam und vorsichtig aus dem Gebiet, in dem sich inzwischen sehr viele Schnellboote eingefunden haben. In einer sicheren Entfernung von den Walhaien gibt er Gas. Der vordere Teil des Bootes hebt sich aus dem Wasser, und wir rauschen bei wolkenlosem Himmel über das Meer Richtung Festland. Luis ist unser Bootskapitän. Neben diesem Schnellboot hat er noch drei andere, die auch zum Walhai-Schwimmen eingesetzt werden. Davon lebt er. Und gut. Obwohl es diesen Ausflug nur vier Monate im Jahr gibt, reicht es fast das ganze Jahr zum Leben. Heute ist Ricardo, sein Sohn, mit an Bord. Er ist gerade siebzehn Jahre alt geworden und bessert sich in den Sommerferien mit dieser Arbeit sein Taschengeld auf. So kümmert er sich mit mir zusammen um die Urlauber an Bord. Er ist ein netter Junge. Die Arbeit mit den beiden macht großen Spaß. Sein Vater ist ein lockerer Spaßvogel. Er hat immer einen Witz parat, ist aber trotzdem professionell bei der Arbeit.
Nach und nach lässt sich am Horizont wieder das Festland ausmachen. Zu allererst Isla Mujeres. Eine Karibikinsel ungefähr acht Kilometer vor dem mexikanischen Festland. Die pompösen Hotelhochhäuser von Cancún zieren den Horizont.
Luis drosselt die Geschwindigkeit und steuert das Boot zur Insel, wo er etwa einhundert Meter vor dem weißen Sandstrand im kristallklaren Wasser den Anker wirft. Trotz der Entfernung zum Strand ist das seichte Meer hier nur knietief. Meterhohe Kokospalmen, kleine idyllische Hotels und farbenfrohe Fischrestaurants zieren die Silhouette der Insel.
Ich genieße das warme Wasser und unterhalte mich mit Luis. Er bringt mich zum Lachen. Immer ist er gut gelaunt. Ein fröhlicher Mensch. Ich beneide seine Frau, mit einem so tollen Mann verheiratet zu sein. Sicher führen sie eine schöne Ehe. Zwei Kinder haben sie, Ricardo und Lily. Beide schon fast erwachsen. Dabei ist Luis noch gar nicht so alt, gerade einmal Anfang vierzig. In meinem Kopf male ich mir aus, was für eine glückliche Familie sie wohl sind. Dann denke ich an Carlos und mich. Unsere Ehe. Wie verliebt ich anfangs war. Im ersten Jahr waren wir auch glücklich. Im Zweiten nicht mehr.
In etwas Abstand zum Boot hocke ich mich ins knietiefe Wasser und spüre den weichen Sand unter meinen Knien. Meine Augen verschwinden hinter der verdunkelten Sonnenbrille. Dabei beobachte ich Luis und denke an heute Morgen.
Eigentlich war es ein Morgen wie jeder andere in diesem Sommer. In aller Frühe, während alles um mich herum noch schlief, bin ich aufgestanden. Doch irgendetwas war anders als sonst. Fühlte sich anders an. Ich war irgendwie nervös. Konnte es mir jedoch nicht erklären. Arbeite ich doch nun schon seit mehreren Jahren als Reiseleiterin. Auch die Walhai-Tour mache ich nun schon seit fast drei Monaten. Warum also war ich plötzlich nervös?
Als ich mein braun gebranntes Gesicht im Spiegel meines Badezimmers begutachtete, traf es mich wie einen Schlag ins Gesicht. Es war, als hätte mir jemand in genau diesem Moment die Augen geöffnet. Ich hatte mich verliebt.
Als ich mit allen meinen Gästen zurück im Bus den Rückweg antrete, macht sich schnell Müdigkeit breit. Die Klimaanlage des Busses ist kalt und die Urlauber sind so erschöpft, dass die meisten nach wenigen Kilometern einschlafen. Auch ich mache die Augen zu und falle in einen entspannten Halbschlaf, aus dem mich Victor bei der Einfahrt ins Hotel wieder herausholt. Nachdem wir alle Gäste verabschieden, fährt er mich nach Hause.
Ich schließe die Wohnungstür auf. Stille. Niemand ist da. Es ist später Nachmittag, Carlos ist noch auf einem Ausflug unterwegs. Reiseleiter ist er, wie ich. Wir lernten uns kennen, als ich gerade einige Wochen in der Riviera Maya war und noch zur Reiseleiterin ausgebildet wurde. Das ist nun drei Jahre her. Wir verliebten uns schnell, und nach einem Jahr heirateten wir. Alles schien perfekt. Wir teilten nicht nur unsere Liebe zueinander, sondern auch unsere Arbeit und einen gemeinsamen Freundeskreis, unsere Kollegen. Carlos ist ein lieber Mensch, sehr freundlich und gutmütig. Mit der Zeit zog er sich jedoch immer mehr zurück. Inzwischen verbringt er fast jede freie Minute vor seinem Computer um Nachforschungen über Außerirdische und den Sinn des Lebens zu tätigen. Verfangen im Netz des Internets. Zum Lachen bringt er mich schon lange nicht mehr.
In der Küche mache ich mir etwas zu essen. Lege mich aufs Sofa und mache den Fernseher an. Ich schließe die Augen und schlafe ein.
4
„Warte“, ruft Luis und eilt über die Straße zum Bus auf mich zu. Seine dunklen Augen schauen mich liebevoll undtraurig an. Dann umarmt er mich. Trauer und Verzweiflung machen sich in mir breit.
Wie schnell sind doch die letzten Wochen vergangen. Fast täglich bin ich zum Walhai-Ausflug gefahren. Habe Stunden mit Luis auf seinem Boot verbracht. Gelacht. Ja, ich habe viel gelacht. Die Welt stand still für uns. Für diese Stunden, die wir zusammen mit den Urlaubern auf dem offenen Meer verbracht haben. Alles andere existierte nicht in diesen Stunden. Mein Leben mit meinem Mann in Playa del Carmen. Aus dem Sinn. Und doch war unser Verhältnis bis zum heutigen, letzten Arbeitstag, immer professionell. Geflirtet haben wir, ja. Aber das war auch schon alles.
In Mexiko ist es üblich, sich mit einem Wangenkuss zu begrüßen. An einem Morgen am Bootsanleger begrüßte ich alle in einer Reihe stehenden Kapitäne. Luis stellte sich gleich an den Anfang. Dann in die Mitte und anschließend ans Ende, um mehrere Begrüßungsküsse zu ergattern. So ist er, ein charmanter Witzbold, der mich zum Schmunzeln bringt. Seine Arbeit macht er mit großer Leidenschaft, und selbst die Gäste verfallen nach kurzer Zeit seinem unwiderstehlichen Charme.
Ich schließe die Beifahrertür. Es zerreißt mir das Herz mir vorzustellen, Luis acht Monate lang nicht zu sehen. So lange dauert es, bis es wieder Ausflüge zu den Walhaien geben wird.
Victor fährt los. Luis bleibt zurück. Hinter meiner Sonnenbrille werden meine Augen feucht. Ich blicke zurück. Doch er ist schon weg. Zurück bleibt eine drückende Leere und die zuckersüße Erinnerung eines unvergesslichen Sommers.
In der Wohnung ist es ruhig und ich bin erleichtert, dass Carlos noch unterwegs ist. Kaum ist es mir möglich, meine Gefühle zu verbergen. Von daher gehe ich ihm in letzter Zeit gerne aus dem Weg. Wie soll das alles jetzt weitergehen? Luis werde ich zunächst nicht wiedersehen. Nur der Gedanke daran, jetzt von ihm getrennt zu sein, bereitet mir Bauchschmerzen. Und das, obwohl wir lediglich zusammen gearbeitet haben und uns nie privat trafen.
Eigentlich müsste ich mich jetzt bei einer neuen Agentur als Reiseleiterin bewerben, denn mit dem Ende der Walhai-Saison ist auch meine Arbeitsstelle weggefallen. Erst mal jedoch wollen Carlos und ich einen Monat Urlaub machen. In Mexiko City. Seiner Heimatstadt. Seine Familie besuchen. Der Gedanke daran, einen Monat Tag und Nacht mit Carlos und seiner Familie zusammen zu sein und ihnen eine heile Welt vorzutäuschen, bereitet mir erneut Bauchschmerzen. Wie kann ich mit Carlos zusammen sein, wenn ich mich die ganze Zeit nach Luis sehne? Der Gedanke, dass er jetzt bei seiner Ehefrau ist, machen meine Bauchschmerzen nicht besser.
In der Küche hole ich mir eine eiskalteLimonadaaus dem Kühlschrank und unter der Dusche spüle ich mir das Salz aus den verblichenen, kurzen Haaren. Reinige anschließend noch meine Taucherbrille, denn die werde ich wohl vorerst nicht benötigen. In einer gemütlichen Shorts und einem pinkfarbenen Trägerhemd lege ich mich faul aufs Sofa und streichle meinen getigerten Kater, der sich schnurrend auf meinen Bauch legt. Sofort entspanne ich mich.
5
Es ist früher Vormittag. Auf meinem Bett liegt mein bunter Rucksack und aus dem Schrank suche ich ein kurzes schwarzes Sommerkleid. Dann verstaue ich noch etwas Wechselwäsche und einen Bikini. Im Badezimmer greife ich nach meiner Zahnbürste. Meine Vorfreude kann ich kaum verbergen.
Carlos kommt ins Zimmer. „Wir müssen los“, sagt er in einem ruhigen, für ihn typischen Ton.
Am Busterminal hievt Carlos seinen großen Koffer aus dem Kofferraum des Taxis. Ich schnappe mir meinen Rucksack und gebe ihm einen Kuss auf den Mund. Freundlich aber ohne Leidenschaft. So als wären wir ein altes, seit Jahrzehnten verheiratetes Paar und würden es nur noch aus Gewohnheit machen. Dann verschwindet er. Steigt ein, in einen großen komfortablen Reisebus zum Flughafen.
Ich bleibe zurück im Busterminal. Mein Blick fällt auf die riesige Anzeigetafel mit den Busabfahrten in alle möglichen mexikanischen Städte. Sogar nach Belize und Guatemala kann man von hier in einem bequemen klimatisierten Reisebus fahren. Da es in Mexiko keine Fernzüge gibt, die die Ortschaften miteinander verbinden, ist die einzige Möglichkeit zu Reisen der Bus oder das eigene Auto. Das Flugzeug können sich die meisten Mexikaner nicht leisten, obwohl es auch hier inzwischen Billigfluglinien gibt. Sie sind für die allgemeine Bevölkerung Mexikos, in dem der Mindestlohn in einigen Bundesstaaten nur um die fünf Euro pro Tag beträgt, zu teuer. Sicher ist vieles in diesem Land relativ günstig, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Und doch, ich bezahle für meine kleine, einfache Wohnung, die abseits des Zentrums liegt, knapp dreihundert Euro im Monat. Das schaffe ich nur, weil ich als Reiseleiterin gut verdiene. An guten Tagen mit reichlich Trinkgeld können das schon mal einhundert Euro sein. Normalerweise ist es ungefähr die Hälfte. Bezahlt wird pro Tour. Bin ich krank oder im Urlaub, gibt es nichts. Da in der Nebensaison zwischen September und Dezember weniger Touristen die Region besuchen da Regenzeit ist, habe ich auch weniger Arbeit. Es ist die Zeit, in der ich und viele meiner Kollegen Urlaub machen. So wie auch jetzt, Anfang Oktober.
Zwei Wochen sind vergangen, seitdem ich Luis das letzte Mal gesehen habe. Am letzten Tag des Walhai-Ausfluges, Mitte September. Und immer wieder habe ich versucht, mich abzulenken. Mit Kinobesuchen, Freunden oder einem Strandtag. Dinge, die ich normalerweise liebend gerne mache. Doch überall wo ich war, war auch die Sehnsucht nach Luis. Sie schwebte wie eine Wolke über mir. Immer und überall. Ließ das Paradies grau erscheinen. Das Leben freudlos. Auf einmal fühlte ich mich inmitten von guten Freunden einsam. Die Gegenwart meines Mannes bereitete mir keine Freude mehr. Die spürte ich erst wieder, als der Anruf kam. Und mit ihm die Hoffnung. Luis. Ja, wir hatten unsere Telefonnummern ausgetauscht. Und er rief an.
„Es wird ein Seminar geben, um als Reiseleiter in einem Nationalpark zertifiziert zu werden. Ich werde das Seminar besuchen und habe dich auch angemeldet.“
Ich war sprachlos. Mein Herz machte einen Sprung. Dass er ohne mich zu fragen, mich einfach bei einem Seminar angemeldet hatte, störte mich keineswegs. Ganz im Gegenteil. Ich fühlte mich geehrt, wie er um ein Wiedersehen mit mir kämpfte.
„Wir sehen uns dann dort“, beendete er das Telefonat. Es war so gut wie perfekt. Das einzige Problem war nur, dass der Seminartag einen Tag nach meinem Flug nach Mexiko City stattfinden würde. Da ich jedoch noch keine neue Agentur habe, ist das Seminar genau das, was ich brauche. Es würde mir Vorteile einbringen, um eine neue Agentur zu finden. Und das sah auch Carlos ein. Also verschob ich meinen Flug um zwei Tage. Carlos jedoch fliegt wie geplant. Heute.
Ich gehe die Stufen des geräumigen Reisebusses hinauf und lasse mich in einem bequemen Sitz am Fenster nieder. Die Klimaanlage summt, und schnell wird es spürbar kalt und ich bekomme eine Gänsehaut.
Ungefähr eine Stunde später kommen wir in Cancún an. Can cúnbedeutet übersetzt aus der Maya-Sprache soviel wie „Schlangennest“ oder „Ort der goldenen Schlange“. Vielleicht, weil es hier im Dschungel so viele Schlangen gibt.
Cancún gehört heute zu einer der meistbesuchten Städte der Welt, mit jährlich über sechs Millionen Touristen aus dem Ausland. Viele wohlhabende Mexikaner haben hier ihren einen zweiten Wohnsitz, den sie vor allem über die Weihnachts- und Osterfeiertage nutzen. Cancún besteht zum Einem aus der luxuriösen Hotelzone, derZona Hotelera, die sich auf einem zwanzig Kilometer langen Landstreifen befindet. Wie ein Halbkreis umschließt sie die große Lagune Nichupté. An beiden Enden ist der Landstreifen mit dem Festland verbunden.
Zum Anderen besteht Cancún aus dem Stadtzentrum, welches sich auf dem Festland befindet, und durch das wir jetzt durchfahren. Hier leben die meisten Einwohner in verschiedenen Stadtvierteln. Von privaten, abgezäunten Wohnanlagen mit edlen Villen, bis zu dreckigen und gefährlichen Vierteln, mit ungepflegten, einstöckigen kleinen Häusern, die Wand an Wand gebaut sind, hat Cancún so gut wie alles zu bieten. Im Jahr 2010 lebten hier schon über eine halbe Million Menschen. Eine große Nummer, wenn man bedenkt, dass vor nur einem halben Jahrhundert hier so gut wie nichts existierte. Einzelne kleine Fischerdörfer an der Küste waren neben den Mayas, die in kleinen Dörfern noch immer den dichten Urwald besiedeln, die einzige Zivilisation dieser Region. Anfang der Siebzigerjahre hatte die mexikanische Regierung dann die geniale Idee, diese Region zu einem pompösen Urlaubsort zu verwandeln. Für den Menschen eine tolle Sache. Für Flora und Faune dagegen eher nicht. Der Landstreifen, der damals noch eine Insel war, wurde durch einen künstlichen Damm mit dem Festland verbunden. Auf ihm entstand ein Luxushotel neben dem anderen. Für die Bauarbeiter errichtete man einfache Wohnungen abseits der Hotelzone, auf dem Festland. Der Urwald musste großen Stahlbauten weichen. Tiere wurden aus ihrem Lebensraum vertrieben. In rasanter Geschwindigkeit wurde gebaut und gebaut. Nach Wohnungen folgten Supermärkte, Schulen, Universitäten und große Einkaufszentren. Die Stadt musste funktionieren. Kathedralen oder einen zentralen Platz gibt es hier nicht. Cancún wurde erschaffen, um Mexiko Geld einzubringen. So wurde in kurzer Zeit aus einem unberührten Paradies eine weltweit beliebte Touristenhochburg.
Die Sonne brennt gnadenlos vom wolkenlosen Himmel, als ich aus dem Reisebus aussteige. Mein abgekühlter Körper beginnt langsam wieder warm zu werden. An der großen Hauptstraße ist die Hölle los, überall sind Menschen unterwegs. Autos hupen.Combisin heruntergekommenen Zuständen stauen sich an der Haltestelle. Menschen drängeln, steigen ein und aus. Alles wirkt chaotisch.
Ich stelle mich zur Menschenansammlung an den Straßenrand und warte. Sicher hätte ich auch ein Taxi nehmen können, doch ich habe es nicht eilig. Zudem spare ich so ein paar Pesos. Die Luft stinkt nach Abgasen. Es ist nicht einfach, in dem Gewusel den richtigenCombizu finden und schnell hineinzuspringen, bevor er weiterfährt. Nach zehn Minuten schaffe ich es. Auf der Windschutzscheibe einesCombisteht in schwarzen Buchstaben PUERTO JUAREZ geschrieben. Durch die seitliche offene Schiebetür mache ich einen Satz in den Bus, als er kurz quietschend anhält. Dabei muss ich mich ducken, da die Decke sehr niedrig ist. Ich gebe dem Fahrer fünf Pesos. Der Bus ist voll. Es ist heiß und stickig und riecht unangenehm nach Schweiß. Da die Schiebetür während der Fahrt offen bleibt, zirkuliert die Luft im Bus etwas und macht den Gestank und die Hitze erträglicher. Aus den Boxen der Stereoanlage dröhnt mexikanische Rap-Musik. Der Busfahrer ist ein junger Mann, vielleicht gerade neunzehn Jahre alt. Ich muss mich gut festhalten, um nicht durch den Bus geschleudert zu werden. Die wilde Fahrt dauert nicht lange. Nach kaum zehn Minuten hält er an, und mit einem Sprung bin ich wieder draußen.
Mein Rücken ist nassgeschwitzt von der schwülen Tropenluft und dem schweren Rucksack, als ich mich ans Ende einer langen Menschenschlange stelle. Vor wenigen Minuten hat die Fähre von der Insel angelegt, und nun kommt uns ein Menschenschwall entgegen. Passagiere, die in die Stadt wollen.
In einem kleinen Laden am Anleger kaufe ich mir eine Fahrkarte. Nur Hinfahrt. Schließe mich dann den Menschen an, die langsam Einer nach dem Anderen, die Fähre betreten. Viele Urlauber sind dabei, mit schweren Koffern, an denen noch der Klebestreifen mit den Buchstaben CUN vom Flug befestigt ist. Aber auch Einheimische mit großen Kisten voller Lebensmittel oder anderen Artikeln. Sie haben den Besuch in der Stadt für einen Großeinkauf genutzt. Es herrscht eine lebhafte Stimmung. Vor mir ist eine größere Gruppe von US-Amerikanern. Laut plappern sie auf Englisch, als wären sie alleine auf der Welt. Hinter mir weint ein Baby. Die Mutter trägt es in einem Tuch auf dem Rücken, dass sie sich um den Oberkörper gewickelt hat. Fast selber noch ein Kind. Sie ist klein und dunkelhäutig. Hat schwarze lange Haare und dunkle, traurige Augen. Ihr weißes Kleid ist mit bunten Blumenmustern bestickt. Man erkennt sofort, dass es Handgemacht ist.
Leicht schwankt die gelbe-blaue Fähre hin und her, als ich sie über die hintere Rampe betrete. Ich gehe die Treppe hinauf zum Sonnendeck und suche mir einen Platz. Natürlich sitzen hier oben in der glühenden Mittagshitze nur Touristen, die sich gerne freiwillig grillen lassen. Einheimische bevorzugen dagegen den klimatisierten Bereich darunter. Trotz Hitze bleibe ich dennoch sitzen, denn für die herrliche Aussicht über das glitzernde karibische Meer nehme ich den ein oder anderen Schweißtropfen gerne in Kauf. In etwas Entfernung strahlen die luxuriösen Hochhäuser derZona Hoteleraum die Wette.
Die Fähre legt ab, und es lässt sich schon die Silhouette der Insel in der Ferne erkennen. Die Blautöne der Karibik schwanken zwischen einem leuchtenden Türkis und einem grünlichen Dunkelblau. Zügig und relativ ruhig fahren wir auf die Insel zu, die nach und nach Gestalt annimmt. Es gibt keine Hochhäuser wie auf dem Festland. Kleine Hotels und offene Restaurants mit Palmblattdächern zieren das Bild von Isla Mujeres. Und Boote. Schnellboote und Jachten liegen an hölzernen Bootsstegen. Plötzlich drosselt die Fähre ihre Geschwindigkeit. Die Insel ist jetzt ganz nah und es herrscht viel Verkehr auf dem Wasser. Große Katamarane fahren mit lauter Musik und tanzenden Gästen an Bord an uns vorbei. Party-Katamarane. Kleine Holzboote liegen an einem kleinen Korallenriff vor der Insel, während die Gäste im Wasser schnorcheln. Und dann bahnt sich da noch eine große Autofähre ihren Weg zum Festland, während zwei Verrückte auf ihren Jet-Skis vorbeirauschen.
Ich gehe die Rampe hinunter und betrete den großen Betonsteg. Das erste Mal, dass ich Isla Mujeres betrete. Während der Walhai-Ausflüge habe ich nur den Strand der Insel kennengelernt. Nun bin ich endlich hier, und das, mit einem Kribbeln im Bauch. Wird wohl an der Aufregung liegen. Irgendwo auf dieser Insel lebt Luis. Mit seiner Frau.
Im Zentrum der Insel herrscht großer Trubel. Viele Tagesausflügler sind unterwegs. Überall wo man hinblickt gibt es Souvenirläden und kleine bunte Restaurants. Es gibt italienisches, vegetarisches und natürlich mexikanisches Essen. Viele Lokalitäten bieten frische Smoothies aus Früchten und Gemüse an. Vorsichtig überquere ich die einspurige Hauptstraße, auf der wohl mehr offene Golfwagen als normale Autos fahren. Einheimische rauschen auf ihren Mopeds die engen, grau gepflasterten Straßen entlang.
Die Fußgängerzone ist klein, und schon nach fünf Minuten Fußweg stehe ich vor den Klippen auf der anderen Inselseite. Hier ist das Meer rau und verliert sich in einem dunklen Blauton in der Ferne am Horizont. Ich spüre die milde Brise im Gesicht und atme tief durch. Die Wellen klatschen an die Klippen, kaum zwei Meter unter mir. Da der letzte Hurrikan hier vor einigen Jahren alles weggespült hat, wurde eine kleine steinerne Schutzmauer errichtet und davor ein breiter Fußweg, auf dem ich mich jetzt befinde. Für eine Weile setze ich mich auf die Mauer und blicke sehnsüchtig auf den Horizont. Dort draußen habe ich unvergesslich schöne Momente erlebt. Mit Luis. Dort haben wir uns kennengelernt. Ich spüre eine tiefe Sehnsucht in mir. Wie ich diese Momente vermisse. Wie ich ihn vermisse. So sehr, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. Und jetzt bin ich auf seiner Insel. Seinem Zuhause. Er ist so nah und doch so fern.
In der Fußgängerzone kaufe ich mir einen belegten Bagel. Seit dem Frühstück hatte ich nichts mehr gegessen, und mein Magen knurrt wie verrückt. Die kleine Fußgängerzone ist sehr idyllisch. Ich spüre das typisch bunte mexikanische Leben, das in den großen Städten der Karibik bereits vom Massentourismus überschattet wird. Während sich in Cancún die meisten Einwohner erst vor wenigen Jahrzehnten aus Mexiko City oder anderen Orten dort niedergelassen haben, sind die meisten Inselbewohner schon seit vielen Generationen hier. Als auf dem knapp zwölf Kilometer entfernten Festland nur dichter Dschungel zu erkennen war, gab es auf Isla Mujeres dagegen bereits Zivilisation. Schon seit Tausenden von Jahren wird die Insel von Mayas genutzt. Dann, vor ungefähr fünfhundert Jahren, eroberten sie die Spanier und während der letzten Jahrhunderte wurde sie immer wieder von Piraten für kürzere und längere Aufenthalte genutzt. Übersetzt bedeutet Isla Mujeres die Insel der Frauen. Als ihr Entdecker gilt bis heute Francisco Hernández de Córdoba, der als erster Spanier die Insel betrat. Hunderte Jahre vor Christi erbauten die Mayas auf der Südspitze einen kleinen steinernen Tempel zu Ehren ihrer GöttinIxchel, die Göttin der Fruchtbarkeit, des Mondes und der Medizin. Durch den Fund von steinernen Frauenfiguren und Schmuck auf der Südspitze der Insel, wo sich noch heute der kleine Maya-Tempel befindet, bekam die Insel angeblich ihren Namen. Vielleicht von spanischen Eroberern, vielleicht von Piraten. Auch die Piraten haben ihr Erbe auf der Insel gelassen. Der berühmte Pirat Fermin Mundaca ließ vor über einhundert Jahren ein riesiges Anwesen erbauen, das man noch heute als Villa Mundaca besichtigen kann. Andere berühmte Piraten haben ihre letzte Ruhestätte auf dem kleinen Friedhof der Insel gefunden. Mein Blick fällt auf die grauen Gräber aus Beton, die oberirdisch dicht aneinandergereiht sind. Die gesamte Region liegt auf einer Kalksteinplatte. Tiefe Löcher zu graben ist daher extrem schwierig. Erde gibt es kaum.
In einem einfachen zentralen Hotel miete ich mir ein kleines Zimmer im ersten Stock. Das Gebäude ist lila angestrichen und macht einen gepflegten Eindruck. Meinen Rucksack streife ich ab und lasse mich auf das weiche Bett fallen.
Nach einem Blick auf mein Handy wird meine Enttäuschung groß, und mir wird bewusst, wieso ich einen Tag vor dem Seminar auf die Insel gekommen bin. Sicher nicht, um die Schönheit der Insel zu bewundern. Hatte er mich nicht eingeladen? „Komm auf die Insel damit ich sie dir zeigen kann“, waren seine exakten Worte. Habe ich da vielleicht etwas falsch verstanden?
Frustriert bin ich. So sehr, dass ich keine Lust mehr habe, das Hotelzimmer heute noch zu verlassen. Hatte ich mich doch so gefreut, ihn endlich wiederzusehen. Einen ganzen Tag mit ihm zu verbringen. Ohne Arbeit.
Die Sonne steht schon tief am Horizont, und der Himmel verfärbt sich blutorange. Ich beschließe, eine Dusche zu nehmen. Als ich mich abtrockne piept mein Handy. Jetzt habe er Zeit. Er kommt, schreibt er. Mein Herz fängt wild an zu rasen.
Aufgeregt setze ich mich auf den weißen Plastikstuhl vor meiner Hoteltür. Von hier habe ich einen Blick auf die Einfahrt des Hotels, die auf die kleine Straße führt. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis schließlich ein knatternder, blauer Motorroller in die Einfahrt fährt. Als der Fahrer den Helm abnimmt, erkenne ich den schwarzen Lockenkopf von Luis. Ich beobachte ihn, wie er die beleuchteten Treppen nach oben geht. Noch hat er mich nicht gesehen. Mein ganzer Körper bebt vor Aufregung. Dann treffen sich unsere Augen. Luis lächelt mich an. Als er mich ein wenig tölpelhaft umarmt, spüre ich seine Nervosität. Im kleinen Hotelzimmer erklärt er mir, dass er verschwitzt sei und sich duschen müsse. Etwas verdutzt beobachte ich ihn dann dabei, wie er sich vor mir entblößt und ins Badezimmer verschwindet, ohne dabei die Tür hinter sich zu schließen. Als er fertig ist kommt er zurück ins Zimmer und stellt sich splitternackt vor mich. Denkt er wirklich, ich wäre auf die Insel gekommen, um mit ihm ins Bett zu steigen? Natürlich habe ich Gefühle für ihn. Aber ich möchte Carlos nicht betrügen. Plötzlich fühle ich mich unglaublich naiv. Was will ich hier eigentlich? Luis ist Latino. Natürlich muss er denken, dass ich Sex will, wenn ich ihn alleine in einem Hotelzimmer treffen möchte. Wobei man dafür wahrscheinlich noch nicht einmal ein heißblütiger Latino sein muss.
„Wollen wie eine Runde mit deinem Moped drehen? Du wolltest mir doch die Insel zeigen, oder?“, werfe ich in den Raum.
Der milde Fahrtwind streichelt mein Gesicht. Im Dunkeln leuchten die Straßenlaternen in einem matten Gelb und weisen uns den Weg. Links tief unter uns die Klippen. Das Mondlicht glitzert über der endlos scheinenden pechschwarzen Karibik. Außer dem Rauschen des Meeres höre ich nur das stetige Knattern des Mopeds. Es ist stockdunkel, als Luis an der Südspitze der Insel den Motorroller zum Stehen bringt. Wir steigen ab und gehen den dunklen Pfad an den Klippen entlang. Vorbei an der steinernen Statue der Fruchtbarkeitsgöttin. Hier am Ende der Insel befinden sich neben den Ruinen des Maya-Tempels lediglich steile Klippen. Die Sicht ist atemberaubend. Auf der einen Seite sieht man die eleganten Hochhäuser derZona Hotelera, wie sie majestätisch um die Wette glitzern. Auf der anderen Seite spiegelt sich das Meer aus Sternen auf der dunklen Wasseroberfläche.
Wir setzen uns auf eine Bank. Und reden und reden. Ich bin glücklich. Nach und nach vergeht auch meine Nervosität. Luis scheint es ähnlich zu gehen. Verliebt schaut er mich an. Es ist ihm anzusehen, wir sehr er sich nach einer Umarmung sehnt. Einem Kuss. Doch wir bleiben auf Distanz. Trauen uns nicht. Vielleicht weil wir beide wissen, dass es nicht richtig wäre.
Auf dem Rückweg fahren wir durch Wohngebiete. Wie wohl sein Haus aussieht, frage ich mich. Ob er hier in der Nähe wohnt? Natürlich frage ich nicht. Wohnt er da doch mit seiner Frau zusammen. Und das Thema ist heute Abend ein Tabu.
Inzwischen ist es gespenstig ruhig geworden auf der Insel. Die Tagesausflügler sind allesamt zurück auf dem Festland. Nur hier und da spielen noch Kinder am Straßenrand während ältere Menschen vor ihren Häusern sitzen und sich unterhalten. Plötzlich hält Luis vor einem Hauseingang, vor dem eine alte Dame sitzt. Er steigt vom Moped und begrüßt sie mit einem Kuss auf die Wange. Ich folge ihm leicht irritiert.





























