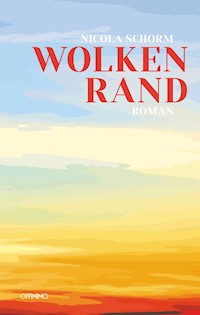
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nie wieder. Nie wieder sein Lächeln. Nie wieder seine Stimme, sein Geruch. Nie wieder das zitternde Erschauern, wenn er sie berührte. Beim Aufwachen tat es immer noch weh, auch heute, nach drei Jahren. Jeden Morgen dasselbe Entsetzen - er war nicht mehr bei ihr. Als Annas Ehemann stirbt, kollabiert ihre Welt. Erst die Begegnung mit dem jungen Thiago hilft ihr, die Trauer zu überwinden und auf einen Neuanfang zu hoffen. Doch sie ahnt nichts von der wahren Identität des geheimnisvollen Unbekannten. Ein ergreifender Roman über den „Coup de foudre“, eine verrückte Liebe, voller Abgründe und südamerikanischer Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolkenrand
Nicola Schorm
Wolkenrand
Roman
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-195-3 (Print) / 978-3-95894-196-0 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2021
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Quelle Umschlaggabb.: shutterstock.com / Chockdee Permploysiri
"Everything will be all right in the end.
If it's not all right, it is not yet the end."
Patel, Hotel Manager, The Best Exotic Marigold Hotel.
Sie
Behutsam entfernte sie das grüngemusterte Einwickelpapier von den gelben Rosen, die seine Lieblingsblumen gewesen waren. Die Hitze der letzten Tage hatte ihnen zuhause nichts anhaben können. Dass sie den Strauß schon drei Tage vor dem eigentlichen Datum besorgt hatte, passte irgendwie zu allem, ergab innerhalb ihres neuen Lebensgefüges einen für sie erkennbaren Sinn. Beim Arzt verbrachte sie die letzte Stunde vor ihrem Termin im Wartezimmer, die Hände auf dem Schoß gefaltet, die Augen geschlossen. Sie meditierte. Das ging niemanden was an und brachte ihr den ersehnten Seelenfrieden.
Auch heute morgen hatte ihr Tag mit einer halbstündigen Meditation begonnen. Die Zeit, die ihr früher unter den Fingern zerrann, hatte sich in einer unvorstellbaren Weise ausgedehnt. Sie brauchte feste Punkte, an denen sie sich orientieren konnte. Wie die Arzttermine oder ihre regelmäßigen Treffen mit der einzigen Freundin, die ihrer Trauer standgehalten hatte, der einzigen, die nicht geflohen war. Aber auch im Café musste sie oft über eine halbe Stunde auf Leticia warten, weil sie zu früh da war.
Sie war froh, dass er sie gedrängt hatte, ihren Beruf nicht ganz aufzugeben. Dienstags und donnerstags gab es keinen Leerlauf, fühlte sie sich sinnvoll und wenn auch nicht glücklich, doch zumindest zufrieden.
Nach ihrem Umzug nach Frankreich vor acht Jahren hatte sie zunächst fast eines damit verbracht, ihr neues Zuhause so einzurichten, dass sie sich wieder wohlfühlen konnte. Die schweren Ledermöbel aus Deutschland waren genauso von den Käufern ihres Hauses in Berlin übernommen worden, wie auch sämtliche Lampen, Vasen, Beistelltischchen, Teppiche und Betten.
Er hatte das Bedürfnis, neu anzufangen. Ganz neu.
Nur die fünf Kisten mit den Büchern und das Notwendigste an Geschirr und Besteck wurden einige Tage nach ihrer Ankunft in Sanary im neuen Domizil von der Umzugsfirma abgeliefert, zusammen mit den Koffern, die ihre Kleider und Schuhe enthielten.
Mit dem Verkauf des alten Patrizierhauses war ein Abschnitt ihres gemeinsamen Lebenswegs beendet, der von gesellschaftlichen Verpflichtungen, Einladungen und Soirées geprägt gewesen war. Ihr Mann war Abgeordneter und hatte wichtige Funktionen innerhalb der Partei übernommen. Wenn es sich nicht um politische Freunde oder Widersacher handelte, die am ovalen Esstisch diskutierten, so waren es Journalisten, Unternehmer oder berühmte Künstler.
Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht. Hoffentlich entwickelte sich die sanfte Brise nicht zum Mistral, dem berüchtigten Wind an der französischen Mittelmeerküste, der bisweilen sogar Sonnenschirme den Strand entlangtrieb.
Wie sehr sich ihr Leben verändert hatte! Manchmal war sie nicht sicher, ob es nicht besser gewesen wäre, in Deutschland zu bleiben und das Ferienhaus eben dieses sein zu lassen. Aber wie bei allen Entscheidungen wurde sie eigentlich nicht gefragt. Da sie um einiges jünger war und ihren Mann sehr bewundert hatte - was bis zu seinem Tod so geblieben war - waren ihre Rollen irgendwie festgelegt.
Sie schüttelte leicht den Kopf. Leider hatten sie keine Kinder. Oft fragte sie sich, ob sich in diesem Fall ihr Status des „kleinen Mädchens“ von alleine erledigt hätte.
Bei der Vernissage eines Malers, zu dessen engsten Freunden sie zählte, war er, ohne lange zu zögern, auf sie zugekommen und ging den ganzen Abend nicht mehr von ihrer Seite. Er war ein sehr charmanter, interessanter Gesprächspartner und obwohl sie im ersten Moment seine Avancen eher belustigt registrierte - immerhin war er zwanzig Jahre älter und ihre Begleiter im Normalfall meistens in ihrem Alter - hatte er es doch geschafft, sie zu verzaubern. Damals war sie dreiundzwanzig, genau halb so alt wie jetzt.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Nach drei Jahren das erste Mal, dass sie an seinem Todestag nicht das Weite suchte. Im ersten Jahr nahm sie an einem Intensivkurs in provenzalischer Küche teil, der in Aix-en-Provence stattgefunden hatte. Für wen sie das „Gigot au vin rouge“ kochen sollte, war unwichtig. Hauptsache, sie dachte an etwas anderes.
Vor einem Jahr dann der Besuch in der alten Heimat - sie blieb extra einige Tage länger, um über den 2. Oktober nicht in Sanary zu sein - weit weg vom Friedhof, vom Alltag ohne ihn.
Sie konnte nicht nachvollziehen, wie manche Menschen täglich das Grab ihres Liebsten besuchen konnten und dadurch getröstet waren. Bei ihr war es umgekehrt - hier, so nah an dem, was von ihm übriggeblieben war, mit Blick auf das Datum mit dem Kreuz vor seinem Namen auf dem Grabstein, der das Unveränderliche für immer auf ihre Netzhaut brannte, hier war es ihr unmöglich, mit ihm zu reden, was sie normalerweise in Gedanken ständig tat.
Trotz der ungewöhnlichen Hitze erschauderte sie. Die kurzen blonden Härchen auf den Armen stellten sich auf; Gänsehaut, die in unbeschreiblicher Leere ihren Ursprung hatte. Sie schloss die Augen. War nur noch Hülle, von Haut umgebene Luft.
Er
Neugierig beobachtete er die schwarz gekleidete Frau, die eben einen Strauß gelber Rosen andächtig in der hässlichen grünen Plastikvase verteilte, bis die ästhetische Wirkung mit der ihrer Vorstellung übereinstimmte.
Aus dieser Entfernung konnte er nur schwer ihr Alter erkennen - ihre anmutigen Bewegungen ließen allerdings vermuten, dass sie noch nicht richtig alt war. Nicht gebrechlich, nicht von Schmerzen heimgesucht. Zumindest nicht von körperlichen.
Nachdenklich zupfte er sich etwas am linken Ohr; eine Angewohnheit, die ihm das Denken erleichterte. Irgendeine seiner Freundinnen (es gab nicht wenige davon, deshalb wusste er nicht mehr genau, ob es Lucia, Denise oder Manu, Tamara, Jessie oder Claudia gewesen war) hatte ihm von Reflexologie vorgeschwärmt, obwohl auch sie nur davon gehört hatte - also war es vermutlich Manu, Manuela, die so viel aufschnappte und weiterplapperte, dass er noch jetzt, wenn er sich daran erinnerte, angewidert die Nase verzog.
Damals hatte er dann etwas nachgeforscht; er war tatsächlich überzeugt, der gewisse Punkt am Ohrläppchen hätte eine direkte Verbindung zu den Nervenzellen in seinem Gehirn. Aber nein, dem war nicht so.
Es war eine Angewohnheit und sie gehörte ebenso zu ihm wie alles andere:
Wie seine unterschwellige Melancholie, seine Abneigung gegen Geschwafel, Smalltalk, alles oberflächlich Seichte, alles vermeintlich Moderne, was die Menschen vom Denken abhielt.
Wahrscheinlich war die Traurigkeit seiner dunklen Augen das, was die Mädchen so unwiderstehlich anzog. Jede dachte, ihn retten zu müssen und biss sich an seiner hartnäckigen Verschlossenheit die Zähne aus.
Es stimmt, zur dunklen Tiefe seiner Seele gesellte sich ein nicht zu unterschätzendes Äußeres. Er hatte von seiner ecuadorianischen Mutter die dunkle Haut geerbt und vom Vater vermutlich die Statur, die ebenmäßigen Gesichtszüge, die lange Nase. Die seiner Mutter war entsprechend ihrer indianischen Abstammung etwas breiter und irgendwie knolliger - seine hingegen aristokratisch gerade mit einem schmalen Nasenrücken. Nur die vollen Lippen verdankte er mit Sicherheit den mütterlichen Genen.
In Wirklichkeit war er sich seines guten Aussehens erst bewusst, seit er nach seinem Wirtschaftsstudium in Ecuador zwei Jahre in Deutschland gelebt hatte und während seines Masters in internationalem Business in Hohenheim beim Erkunden von Stuttgart auf der Königsstraße von Typen angesprochen wurde, die auf der Jagd nach männlichen Models waren.
Genauso gut konnte es sein, dass sie schwul waren und nur auf der Suche nach neuem Fleisch. Er nicht. Absolut nicht.
Er lächelte leise in sich hinein. Einer seiner Mitschüler in der deutschen Schule in Quito hatte es nach dem Schwimmunterricht in der Dusche bei ihm ausprobiert. Fehlanzeige! Er hatte ihm ein blaues Auge verpasst.
Unvermittelt ließ er sein Ohrläppchen los. Die Rosenfrau, die während seiner gedanklichen Ausflüge mit gesenktem Kopf vor dem Grab gestanden hatte, machte sich daran, den Friedhof zu verlassen.
Ob sie gebetet hatte? Oder mit dem, der da begraben war, eine geheime Zwiesprache gehalten hatte, die doch nur Monolog sein konnte?
Er beschloss, ihr zu folgen. Das andere hatte Zeit.
Er würde morgen wiederkommen.
Sie
Die weißen Steinchen auf dem Weg zum Parkplatz knirschten unter ihren Füßen. Nie wieder würde sie etwas anderes als Trauer mit dem kratzend knarrenden Geräusch assoziieren.
An das erste Mal als sie hinter dem Sarg über dieselben Steinchen gegangen sein musste, erinnerte sie sich nicht. Aus dem Gedächtnis gestrichen.
Das Einzige, was sie sah, wenn sie an diesen 2. Oktober dachte, war die Schleife auf dem Kranz mit den gelben Rosen. In ewiger Liebe, Deine Anna.
Was bedeutete „ewig“? Er fehlte ihr.
Die Betäubung und Starre der ersten Monate hatte sie davor bewahrt, die gesamte Tragweite seiner endgültigen Abwesenheit zu ermessen.
Inzwischen wusste sie um die schneidende Kälte des Gegenteils von ewig. Von unendlich. Es war: Niemals.
Nie wieder. Nie wieder sein Lächeln. Nie wieder seine Stimme, sein Geruch.
Nie wieder das zitternde Erschauern, wenn er sie berührte.
Beim Aufwachen tat es immer noch weh, auch heute, nach drei Jahren. Jeden Morgen dasselbe Entsetzen - er war nicht mehr bei ihr.
Sie zwang sich, mit ihren Gedanken ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Hier. Jetzt. Die Autoschlüssel aus der Tiefe der schwarzen Umhängetasche zu fischen. Ihre Mundwinkel bewegten sich für einen kurzen Moment nach oben, als ihre Finger vergeblich nach dem gesuchten Objekt fahndeten. Damenhandtaschen!
Wie oft hatte er sich einen Spaß daraus gemacht, sie „Mary Poppins“ zu nennen, wenn sie den gesamten Inhalt ihrer Tasche ausleeren musste, um etwas Bestimmtes wiederzufinden.
Auch heute glitten ihre Finger an Handcreme, Pflasterschachtel und Nagelschere vorbei, ertasteten Kugelschreiber, Ringbuch, Brillenscheide, Geldbeutel, Tempos und Handy, Kopfschmerztabletten, Olbastropfen für die verstopfte Nase, das Fläschchen mit homöopathischen Kügelchen (Ignatia) und das etwas größere mit Bachblütentropfen. Und den Müsliriegel, den sie vor einer Woche eingesteckt hatte, um ihn nach der Blutabnahme zu frühstücken. Kein Schlüssel. Sie schüttelte den Kopf über sich selbst. Immer diese Abwesenheit. Eben nicht „Hier“. Und noch weniger „Jetzt“.
Auf einmal fiel es ihr wieder ein. Stimmt. Sie hatte die Autoschlüssel in ihre Hosentasche gesteckt, um eben voriges zu vermeiden.
Jetzt lachte sie doch richtig. Stellte sich vor, er wäre als unsichtbare Gestalt an ihrer Seite und würde nicht aufhören können, zu grinsen.
Sie sah auf ihre flache, weiße Armbanduhr. Der nächste Patient kam erst in einer dreiviertel Stunde, sie hatte genügend Zeit, um in Ruhe nach Hause zu fahren, sich umzuziehen und sich mental auf die Behandlung vorzubereiten.
Nachdem sie auf den Entriegelungsknopf gedrückt hatte, setzte sie sich in ihren dunkelblauen Golf, steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn nach rechts.
Dann fuhr sie rückwärts aus der Parklücke heraus und langsam an dem fremden Mann vorbei, ohne ihn zu beachten.
Er
Im Gegensatz zu ihr fand er seinen Autoschlüssel sofort. Er zog am Schlüsselanhänger aus Plastik mit dem Schriftzug „Avis“ und fischte den Schlüssel aus seiner rechten Hosentasche. Im Stillen verfluchte er sich, einen roten Alfa Romeo angemietet zu haben. Viel zu auffällig. Das kam davon, manchmal unüberlegt zu handeln. Aber er hatte auch nie vorgehabt, ein Auto zu verfolgen und dabei inkognito bleiben zu wollen.
Er wusste nicht genau, warum er sie nicht auf dem Friedhof angesprochen hatte.
„Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bei ihrer Andacht störe. Zufällig war ich auf der Suche nach genau diesem Grab.“
Nein. Es wäre zu einfach gewesen. Und gleichzeitig zu kompliziert. Er hatte keine Lust, Erklärungen abzugeben, und aus einer Laune heraus beschlossen, die Sache anders anzugehen.
Da war sie wieder - diese Spontaneität, die ihn schon in manch missliche Lage gebracht hatte. Die Mutter, die von Zeit zu Zeit ihren Hausastrologen aufgesucht hatte, schüttelte lächelnd den Kopf über ihren impulsiven Sohn und wusste, wie sehr er durch sein Widdersternzeichen geprägt war. Unfreiwillig saugte er gleichzeitig mit einigen Gebräuchen der indianischen Vorfahren, über die er sich hüten würde, in Deutschland auch nur ein Wort zu verlieren, alle möglichen Details über seine „Carta Natal“ ein: Aszendent Krebs - daher die Melancholie, der sanfte, weiche Kern, der so wenig zur Energie und gebündelten Kraft des Feuerzeichens passte. Nur über seinen Vater erzählte sie ihm nichts - als ob seine Traurigkeit nicht hauptsächlich darin ihren Ursprung hätte.
Nichts, als er im Kindergarten auf der deutschen Schule in Quito, in der „Villa Kunterbunt“, ein Foto von ihm mitbringen sollte, wie alle anderen Kinder.
Ebenso wenig, als er sie in der Pubertät mit ständig wechselnden Fragen über seinen Vater zur Verzweiflung brachte. Er wurde bockig. Mit sechzehn hatte er es durchgezogen, über einen Monat lang kaum ein Wort an die Mutter zu richten. Aber diese war stärker. Härter. Kein Wunder. Sie hatte die Firma des Großvaters übernommen, ihre Geschwister ausbezahlt und danach die Produktion verdoppelt. Gerissene Geschäftsfrau durch und durch, wusste sie genau, wer als Erster aufgeben würde.
Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht hatte sein Vater sie verlassen, weil es unmöglich war, mit ihr zu leben. Aber was war mit ihm, seinem Kind?
Warum war er auch aus seinem Leben verschwunden, als ob es ihn nie gegeben hätte?
Ob diese Frau im dunkelblauen Golf vor ihm die Antwort wusste?
Sie
Es war viertel vor drei, als sie den Wagen auf dem Abstellplatz vor dem Haus abstellte. Die hohen Pinien warfen auch im Sommer genügend Schatten, so dass sie Bernhards Projekt fallengelassen hatte, der die fertigen Baupläne für eine Garage auf dem Schreibtisch hinterlassen hatte. Zusammen mit unendlich viel Papierkram.
Sie brauchte keinen Platz für eine Werkzeugbank, und dass ihr Fahrrad gelegentlich nass wurde, war ihr auch egal. Wenn es verrostet wäre, würde sie es verschenken und dann weitersehen.
Seines hatte sie schon weggegeben. Wozu sollte sie es aufbewahren? Auch die Hosen, Hemden, Schuhe hatte sie nach einem Monat, als sie es endlich fertigbrachte, seinen Schrank aufzumachen, in kürzester Zeit entsorgt. Gespendet. Auch wenn ihre Mutter nur entsetzt den Kopf schüttelte, als sie ihr beim Skypen stolz davon berichtete. Warum sollte sie in einem Museum leben? Wo sie bei jedem Handgriff, in jedem Augenblick, bei jedem Atemzug an sein Fehlen erinnert würde? Als ob es nicht reichen würde, beim Aufwachen im viel zu großen Bett sein morgendliches Lächeln zu vermissen. Jeden Morgen war es das erste gewesen, was sie sah. Achtzehn herrliche Jahre lang. Im Gegensatz zu ihm war sie morgens oft schlecht gelaunt - aber im Lauf der Zeit hatte er es geschafft, ihre Brummtöne in leise Seufzer umzuwandeln. Es war unmöglich, sich von seinen warmen Augen mit den wundervollen Lachfältchen nicht anstecken zu lassen.
Sie zwang ihre Gedanken wieder in die Gegenwart.
Schloss die Haustüre auf, schaltete die Alarmanlage aus - im Gegensatz zu Berlin war diese hier unerlässlich, da es in der Provence mehr Gelegenheitsdiebstähle gab als in jeder anderen Region Frankreichs - schlüpfte aus den flachen, dunklen Schuhen, die sie am Eingang zum Schlafzimmer stehenließ.
In weiser Voraussicht hatten sie vor vielen Jahren dieses wunderschöne, einstöckige Feriendomizil erstanden, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Immerhin hatte sich ihr Mann seinen Traum, hier zu leben, erfüllt. Nur fünf Jahre waren ihnen vergönnt - viel zu früh und ohne Vorankündigung hatte er sie verlassen. Als er mit nur achtundfünfzig Jahren alle Ämter ablegte und sich in den Vorruhestand versetzen ließ, versuchten nicht nur seine politischen Freunde ihn davon abzubringen, sondern auch die wenigen, die er aus der Schul- und Universitätszeit seine „wahren“ Freunde nannte. Die sich immer beklagt hatten, er würde zu viel arbeiten, zu wenig genießen.
Die Einzige, die voll und ganz hinter ihm gestanden hatte, war, wie immer, sie selbst gewesen. Ein sanftes Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Ebenso selbstverständlich wie sie ihn begleitet hatte, als seine Karriere ihn auf die exponierten Schlüsselpositionen in der Partei katapultierte, war sie an seiner Seite, als er beschloss, dem politischen Geschehen den Rücken zuzukehren, und es den deutschen Schriftstellern nachmachte, die während der Nazizeit nach Südfrankreich ins Exil aufbrachen.
Nach der Wahl vor acht Jahren hatte sich das Blatt gewendet - die Oppositionspartei stellte den neuen Bundeskanzler und er, der heimlich mit der möglichen Berufung zum Minister geliebäugelt hatte, musste seine Ambitionen begraben.




























