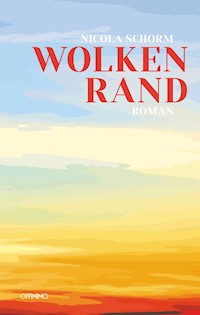12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Es war kalt in der Kirche. Sie fröstelte und zog den schwarzen Mantel etwas enger um sich. Der Schal. Sie hatte den Schal zuhause vergessen. Sie schloss die Augen und ihre Gedanken flogen zu dem Tag im August vor fünf Jahren zurück, als alles begonnen hatte. Als er beim Frühstück ohne jegliche Vorwarnung die verhängnisvollen Worte ausgesprochen hatte: „Es ist aus. Ich gehe.“ Die neue Kurzgeschichtensammlung von Nicola Schorm nimmt den Leser mit auf eine literarische Reise in Gefühlswelten der Verzweiflung und in innere Zustände des existentiellen Zweifels und Leids – aber gleichzeitig zu Momenten voller Güte, Liebe, Glück und Weisheit. Im Mittelpunkt der raffiniert miteinander verwobenen Episoden schlägt mit dem „Haus der Schmetterlinge“ das beunruhigende und anrüchige, pulsierende Herzstück der Erzählungen – ein Buch im Buch, das zu imaginären und verbotenen Orten führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Ähnliche
Symphonie aus Lust und Leid
(Adieu Valentin)
Kurzgeschichten
von Nicola Schorm
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-077-2
Coverabbildung: © ElDen-1 / Shutterstock
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2018
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
An meine Leser
Wie ein Komponist die Noten aneinanderreiht, um eine Melodie zu erschaffen, so fädle ich Wort an Wort, um meine Geschichten zu weben.
Jeder Satz hat seinen Rhythmus und seinen Sinn. Es gibt leise Erzählungen und andere, die laut wie Trompetenstöße oder wie ein Trommelwirbel klingen; auch Crescendos und Synkopen, verspielte Melodien, Motive und helle Glockenschläge, die sich wiederholen, die wieder aufgenommen werden, und den Verdacht nahelegen, dass, was losgelöst und getrennt wirkt, in Wirklichkeit in engster Beziehung zum Gesamten steht.
Leider kann ich kein musikalisches Werk verfassen, obwohl mir bewusst ist, dass die Musik die vollständigste aller Künste darstellt und den direkten Weg zur Seele findet. Nichts wünsche ich mir mehr, als dass meine Geschichten in Ihnen, meinen Lesern, ein Gefühl oder eine Empfindung, eine Veränderung Ihres Gemütszustandes auslösen.
Herzlichen Dank meiner Erstleserin, die mir stets bedingungslos und hilfreich zur Seite steht, und welcher ich dieses Buch in Liebe widme: meiner Mutter. Es tut mir leid, dass ich kein Musikstück für sie komponieren kann, welches sie auf dem Klavier spielen könnte.
Inhalt
Erster Satz: Lose Etüden zur Herbstzeit
Zweiter Satz: Variationen in Moll
Dritter Satz: Improvisation über das Ende
Erster Satz: Lose Etüden zur Herbstzeit
1. Schlaflos
2. Ratlos
3. Maßlos
4. Namenlos
5. Farblos
6. Furchtlos
7. Sinnlos
8. Sprachlos
9. Atemlos
1. Schlaflos
Er erinnerte sich an die trägen endlosen Sommernachmittage, die gleißende Hitze, die Fliegen, die die kleinmaschige Netzstruktur der Verandatür überlistet hatten und die die wahren Herrscher des Hauses waren. Alle Bewohner hassten sie, selbst die Oma, die die geduldigste, warmherzigste Frau der ganzen Welt war. Er konnte es heute, nach so vielen Jahren, immer noch nicht begreifen, wie schnell sie die Fliegen mit der bloßen Hand zu fangen pflegte – sie war so flink, so geschickt, dass er sich oft mitten ins Märchen von dem tapferen Schneiderlein versetzt fühlte – nur dass das Schneiderlein das Gesicht seiner Oma trug und eine Frau war. „Sieben auf einen Streich“, oh ja, das hätte sie ohne Weiteres geschafft.
Wenn er genau darüber nachdachte, was als nächstes mit den hässlichen Insekten geschah, da in der zärtlichen Hand seiner Großmutter, die ihm sanft über den Kopf strich, wenn er fieberkrank im Bett lag, die ihm mit kreisenden Berührungen die heftigen Bauchschmerzen vertrieb, dann wurde ihm schlecht. Sie zerdrückte das Ungeziefer, hatte so gar kein Mitleid mit den niederen Kreaturen; es knirschte und knackte, wenn sie das harte Außenskelett zermalmte. Sie wusch sich die Hände danach, aber manchmal war sie ihm unheimlich.
Ebenso wenig versuchte er daran zu denken, wie sie im Hühnerstall nach dem geeigneten Suppenhuhn für das sonntägliche Mahl ausschaute, das sie ebenso rasch wie die Fliegen mit einer gekonnten Dreh – und Knackbewegung beider Hände, die in vollkommenem Einklang arbeiteten, erdrosselte.
Er liebte Hühnersuppe, verbannte die Gedanken an die Federn, die er erst vor drei Stunden vor dem Stall zusammengefegt hatte.
Irgendwie schaffte er es, die Bilder voneinander abzuspalten, zu trennen, was logischerweise ein – und dasselbe war. Das weiße Fleisch in der Suppe schmeckte vorzüglich und war durch und durch anders als das gackernde Huhn, das lebte, fraß und stank.
Die Hitze war unerträglich, brachte das Hirn in einen Zustand der Auflösung, schmelzte die wirren Gedanken zu einem widerlichen Brei, der klebrig und widerwärtig den Übergang vom Wachsein zum erlösenden Träumen erschwerte, unmöglich machte. Es gab keine Klimaanlagen im Land seiner Kindheit. Aber es gab strenge Regeln, die befolgt werden mussten. Alle Kinder mussten Mittagsschlaf halten, Siesta. Es gab kein Entrinnen und da die Fenster durch dicke Vorhänge verdunkelt wurden, war auch das Lesen ein unmögliches Unterfangen.
Das wäre seine einzige Rettung gewesen, in den Büchern der Realität zu entfliehen, andere Wirklichkeiten zu durchleben, diese üblen zwei Stunden zu einem spannenden Ausflug in andere Welten zu nutzen.
Die Zeit erschien ihm, dem Fünf, Sechs, Siebenjährigen endlos, und auch wenn er tatsächlich an vielen Tagen aufwachte, wenn ihn die Mutter von der Tortur erlöste, er also doch den Schlaf gefunden hatte, waren dennoch die Tage, an denen es nicht so war, in der Überzahl.
Inzwischen hatte er keine Probleme mehr, mittags ein kleines Schläfchen zu halten – im Gegenteil, er genoss es an den Wochenenden, an denen er allen gesellschaftlichen Verpflichtungen aus dem Weg ging, die um die Mittagszeit stattfanden, um so endlich die durch die Arbeitszeit im Büro überfälligen Siestas der ganzen Woche auf einmal nachzuholen. Samstags und sonntags schlief er manchmal bis zu drei Stunden.
Schlaflosigkeit bereitete ihm heute nur noch der Mond. Bei Vollmond wälzte er sich im Bett hin und her, ärgerte sich über sich selbst und las so manches Buch zu Ende.
Und heute – heute war Vollmond, 3.28 Uhr morgens – erinnerte er sich an früher, an die Sonne, an die Fliegen, an die Oma.
2. Ratlos
Die neue Welt war laut und schnell. Grell und schräg. Die Menschen, mit welchen sie früher ohne Probleme ins Gespräch kam, hasteten von einem Ort zum nächsten, verschanzten sich im Zug, im Bus, hinter ihren Handys, drückten wie wild auf die immer kleineren Tasten und hingen mit ihren Ohrstöpseln am Tropf, sicher geschützt und isoliert vor dem Kontakt zu den Anderen, zu ihr.
Manchmal hatte sie das sichere Gefühl, in einem Albtraum zu leben. Außerdem war sie sich nicht ganz sicher, ob sie noch klar im Kopf war. Es gab Anzeichen dafür, dass trotz Kreuzworträtsel und Sudokus ihre Gehirnzellen zu Tausenden abstarben. Wo zum Beispiel hatte sie ihre Lesebrille abgelegt, die sie seit drei Tagen nicht mehr fand? Beim Haarewaschen wusste sie nicht mehr, ob es das erste oder zweite Mal war, dass sie das Shampoo auf den schütteren Haaren verteilte.
Die Ärzte, die sie regelmäßig aufsuchte, versicherten ihr, dass alles stimmte, dass ihr Gehirn ordentlich funktioniere, ebenso wie die anderen Organe – dem Alter entsprechend.
Ob sie sie anlogen?
Im Bus auf dem Weg zu den Spezialisten hatte sie früher nette Gespräche. Auch mit dem Gemüsehändler um die Ecke hatte sie jeden Tag einige Worte gewechselt. Aber er hatte den Laden altershalber geschlossen. Im Supermarkt redete man nicht miteinander.
Sie ertappte sich dabei, beim Putzen und Kochen, beim Kehren und Aufräumen mit sich selbst zu sprechen. So sehr sie sich dessen schämte, es wurde langsam zur Gewohnheit.
Heute besprach sie mit sich selbst eine Idee, die ihr seit gestern im Kopf herumschwirrte. Im Gemeindeblatt hatte sie gelesen, dass dringend Unterkünfte für die siebzig Flüchtlinge aus Syrien gesucht wurden, die ihre kleine Stadt aufnehmen musste.
Wer sie gehört hätte, gesehen, wie sie laut alle Vor- und Nachteile abwägte, sich widersprach und überzeugte, hätte seinen großen Spaß gehabt, und sie leicht für eine alte Schauspielerin halten können. Dabei war sie früher Deutschlehrerin.
Und das kam ihr in den nächsten Monaten sehr zugute, denn Amina und Haldoun, die beiden Kinder der Familie, die sie bei sich aufgenommen hatte, lernten schnell und „Oma“ wurde ihr Lieblingswort.
3. Maßlos
Während sie auf dem Balkon in der Sonne döste, hatte sie in Gedanken bereits fünfzehn Sätze zu Papier gebracht. Wohlklingende, geschmeidige, verschachtelte Sätze; Sätze, die die Abgründe zudeckten, die das Augenmerk auf die erfundene Nebenwelt richtete, dort, wo sie in Wirklichkeit zuhause war. Der Kugelschreiber klebte widerlich zwischen Zeigefinger und Daumen. Sie überlegte, ob es die Sonnencreme war, die das schwarze Plastikgehäuse auflöste oder ob es ihre Haut war, die noch eben rußverschmiert mit Schmirgelseife und metallener Kratzbürste misshandelt worden war. Kurz vor der Sonnencreme. Zum Saubermachen der Paellapfanne (gestern war die halbe Redaktion bei ihr zum Essen eingeladen, sie hatte ihren vierzigsten Geburtstag nachgefeiert) hätte sie besser die Handschuhe angezogen; aber das entwürdigende Unterfangen, die zu engen, gelben Plastikhüllen über ihre Hände zu zerren, mit Gewalt, was locker und leicht sich streifen lassen sollte, zu durchbohren, bis die Finger unbequem, blutleer, wasserfest für das Fett und das Schmirgeln bereit wären – diese grauenvolle Anstrengung hatte sie davon abgehalten. Sie wusste, dass sie nicht nur diese Entscheidung falsch getroffen hatte. Aber was war richtig?
Manchmal in der Nacht wusste sie nicht mehr, welcher ihrer Geliebten neben ihr lag. Sie wusste nur, dass ihr ihr Leben entglitten war, nicht, in welchem Moment sie auf der Kreuzung die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Der mäßige Erfolg als Redakteurin für das Ressort Psychologie und Lebensfragen – ausgerechnet sie! – befriedigte sie nicht. Nicht mehr. Im ersten Moment hatte sie das Gefühl, den Himmel mit den Fingerspitzen zu berühren. Aber das war vor neun Jahren. Kurz danach, an ihrem einunddreißigsten Geburtstag machte sie mit ihrem langjährigen Freund Schluss und warf sich dem Chef, den sie heimlich bis zur Verzweiflung begehrte, in die Arme. Er hatte sie vor versammelter Belegschaft auf den Mund geküsst. Damals hatte sie tatsächlich geglaubt, sie würde ihm etwas bedeuten, sie sei ihm mehr als nur ein weiterer Anstecker, Fraueneroberungsorden, auf seinem Revers. Zugegebenermaßen war der Sex mit ihm unbeschreiblich – niemals vorher hatte sie so tief das Verschmelzen mit einem anderen Körper erlebt. Als er nach nur acht Wochen zu ihr zog, war sie sich sicher, er würde sich trennen, sie würden heiraten, für immer zusammen bleiben. Eine andere Frau hatte achtzehn Jahre früher denselben Traum gehabt. Seine Frau, die mit Hilfe der Kinder (14, 12 und 10 Jahre alt) ihre Macht gekonnt ausspielte, die ihn mit nächtlichen Anrufen quälte, nicht vor Selbstmorddrohungen zurückschreckte …
Er ging zu ihr zurück.
Gedemütigt und verletzt durchlebte sie alle Stadien der Verzweiflung. Es ging ihr an die Substanz. Sie nahm acht Kilo ab, schlief nur noch mit Schlaftabletten. Nach langen Monaten der Selbstaufgabe und Verzweiflung lernte sie bei einer Fete, zu der ihre Freundin Sallie sie mitgeschleppt hatte, einen netten Kinderarzt kennen, lieb, leicht verlottert (sympathisch) und vor allem: ledig.
Verwundert musste sie eingestehen, dass ihr junger Körper sich auch diesem anderen öffnete, nach Sex dürstete, dass sie sich nach ihren gemeinsamen Nächten wieder „ganz“ fühlte, geheilt. Allerdings liebte sie ihn nicht. Woran sie das merkte? Ihr Begehren blieb nicht auf ihn beschränkt, sondern trieb wilde Kapriolen, welchen sie allen Freiraum zugestand. Auch die Vorstellung, er würde mit anderen Frauen schlafen, störte sie nicht. Sie bestand nicht mehr auf der infantilen Prämisse der Ausschließlichkeit, im Gegenteil reizte sie mehr und mehr die Vielfalt der Spielmöglichkeiten, die Ausschöpfung der verrücktesten Phantasien. Es waren wilde Jahre. Sie hatte aufgehört, ihre Abenteuer zu zählen oder zu erzählen.
Allein in ihren drei Manuskripten, die in der Schreibtischschublade vergeblich darauf warteten, endlich zu Ende geschrieben zu werden, war manche Episode doch etwas autobiographisch.
In den Osterferien hatte sie das Haus der Eltern ausgeräumt, die inzwischen im Altersheim ihre Tage im schwebenden Dämmerzustand der Zeitlosigkeit verdösten. Sie hatte ein Gedicht gefunden, das sie mit achtzehn Jahren verfasst hatte und welches die Mutter, aus welchem Grund auch immer, in ihrer Schmuckschatulle aufbewahrt hatte. Jetzt hing es an ihrem Kühlschrank und sollte sie an ihr früheres Ich erinnern, mit dem sie nur noch den Namen gemeinsam hatte. Irgendwann hatte sie sich verloren, zwischen den Laken, den Küssen, den Ländern, dem Wein. Jeder ihrer Männer begeisterte sie. Aber nur für ein Weilchen – danach war sie wieder auf der Suche und verliebte sich so schnell wie andere in ein paar neue Schuhe.
Ihr „Mr. Perfekt“ hatte tausend Gesichter, sie konnte sich nicht festlegen, nicht mehr, brauchte den Kick des Neuen, Unbekannten.
In Wirklichkeit war sie allein.
Allein mit ihrer maßlosen Sucht nach Leben.
4. Namenlos
Es war ungerecht.
Seine beiden Freunde hatten einen Opa, der den gleichen Namen trug wie sie. Warum hatten seine Eltern ihn nicht Klaus getauft? Klaus oder Thomas. Das waren gute Namen, in die man hineinwachsen konnte, die man ausfüllen konnte, ohne sie zu hinterfragen; Namen, bei welchen niemand die Augen weit aufreißen und ein Grinsen unterdrücken würde. Er hätte seinen Eltern sogar verziehen, dass er keine Geschwister hatte, wenn sie ihm nur einen normalen Namen gegeben hätten.
Im Kindergarten begann die Hänselei.