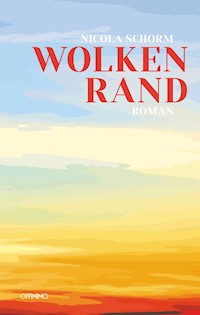14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marion, 42, bricht ohne besonderes Reiseziel aus ihrem streng strukturierten Alltag als Englischlehrerin in ihren Urlaub auf. Seit neun Jahren fährt sie mit der Bahn kreuz und quer durch Europa und „sammelt“ Menschen, Begegnungen mit den Mitreisenden, die ihrem Leben Sinn geben. Sie zeichnet die Lebensgeschichten ihrer Gefährten auf und gibt gleichzeitig immer mehr Einblick in ihre eigene Innenwelt. Auf der Rückfahrt wird ihre Handtasche inklusive des neunten Tagebuchs gestohlen und gelangt über Umwege zu Fabrizio – der Auftakt einer großen Liebesgeschichte. Lesung aus dem Roman „Das neunte Tagebuch“: Wann: 9. November um 19.00 Uhr Wo: im Restaurant LaVesa, Rosenstraße 45/1 in 71063 Sindelfingen Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Nicola Schorm
Das neunte Tagebuch
Roman
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-057-4
Lektorat: Christine Hochberger
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2017, www.omnino-verlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Für Edda
Fabrizio
Es spielt keine Rolle, wie ich in den Besitz dieses Tagebuches gekommen bin, sagen wir einfach, es hat mich gefunden.
Im Gegensatz zu Marion bin ich fest davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, arbeitet mein Cousin Luigi in einer Pizzeria in Hamburg. Außerdem hat er einige Nebeneinkünfte, die im Entferntesten mit der italienischen Mafia zu tun haben. Das alles geht mich nichts an, was kann man schon für seine Familie?
Tatsache ist, dass er beim Poker spielen eine Damenhandtasche samt Inhalt, zu dem unter anderem dieses Tagebuch gehörte, gewann, die ein Kumpel von ihm wohl irgendwo gefunden hatte. Gefunden, entwendet, geklaut, wer weiß das schon genau?
Er kennt meine Liebe zu Büchern, ich hatte einige Semester Literaturwissenschaft studiert, bevor ich den Fahrradhandel meines Vaters übernehmen musste. So gab er es mir.
Dieses Buch hat alles verändert.
Am Anfang fiel mir das Entziffern der Handschrift nicht leicht – heute bin ich soweit, mit geschlossenen Augen ein vorgegebenes Wort fast identisch nachzeichnen zu können. Ich habe Satz um Satz so viele Male entworren und in mir wirken lassen, dass manche Gedanken mir inzwischen vorkommen wie meine eigenen.
Ich liebe diese Frau. Ich liebe ihre Intelligenz und ich liebe ihre Seele. Ich werde sie glücklich machen, sie wird vergessen, dass es ein Leben vor mir gab.
Ich liebe ihren Körper, von dem ich keine einzige Beschreibung besitze, den ich mir trotzdem vorstellen kann, weich und warm, weiblich, wollüstig und wunderschön.
Einer ihrer Gefährten verglich sie mit Jane Seymour. Ich habe mir eines der Fotos der Schauspielerin ausgedruckt. So ähnlich sieht sie aus.
Es gibt einige Dinge, die mir Sorgen machen.
Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich so heißt, wie sie schreibt.
Kann es sein, dass sie einen falschen Namen angegeben hat?
Im ganzen Internet ist kein Hinweis auf sie zu finden, es gibt zwar andere Personen mit demselben Namen bei Facebook, doch meine Marion bleibt unauffindbar.
Ich habe eine Deutschlandkarte im Wohnzimmer aufgehängt, mit dem Zirkel einen Kreis von zweihundert Kilometer Radius um München gezogen und alle kleinen Städte angekreuzt, die groß genug sind, um ein Gymnasium zu besitzen, und doch zu klein für zwei oder mehrere.
Was, wenn sie auch darin nicht ehrlich war?
Mittwochs bleibt das Geschäft nachmittags geschlossen. An meinen freien Mittwochnachmittagen fahre ich in die nächsten fraglichen Städte. Manchmal kann ich gleich zwei auf einmal abhaken; dann hat keine der an den Gymnasien beschäftigten Englischlehrerinnen auch nur das Geringste mit ihr gemein. Außer dem Fach. Wenn es stimmt.
Meine zweite Sorge gilt der Zeit. Es gibt keinerlei Hinweise auf das Jahr, in dem sie ihr Tagebuch schrieb. Es gibt allerdings Zeichen, die richtig interpretiert, einen Spielraum von bis zu fünf Jahren offenlassen. Im schlimmsten Fall wäre sie also zehn Jahre älter als ich. Ist es mir egal?
Es ist mir egal. Nur einmal habe ich geträumt, ich fände sie zu spät. Fassungslos las ich ihren Namen, eingemeißelt auf einem Grabstein. Träume sind Schäume – meine Suche geht weiter!
Was mich allerdings am meisten beunruhigt, ist, ihr klarzumachen, dass sie für mich bestimmt ist. Und ich für sie. Wenn ich sie wirklich gefunden hätte, wüsste, wo sie lebt, was dann? Ja, was dann?
Ich könnte an ihrer Tür klingeln und ihr das Tagebuch zurückgeben. Und?
Sie würde sich bedanken, eventuell hätte sie Angst vor mir – ich könnte immerhin der sein, der sie bestohlen hat.
Das geht nicht.
Ich könnte zufällig mit meinem Fahrrad in ihres hineinfahren, einen kleinen Unfall provozieren und sie dann als Entschuldigung zum Essen einladen. Wir hätten einen wundervollen Abend, würden uns wiedersehen und uns langsam näherkommen ... bis sie irgendwann bei mir zu Hause in der Bibliothek stöbern oder in den Schubladen im Schlafzimmer und – oh Schreck! – ihr Buch finden würde.
Das geht auch nicht.
Außerdem bin ich sicher, dass sie definitiv allergisch auf kleine Schwindeleien oder ausgewachsene, fette Lügen reagiert. Nein, das geht auf keinen Fall!
Ich könnte eine Anzeige in der lokalen Zeitung aufgeben:
„An Maria Marion: Habe Ihr Reisetagebuch Nummer neun und würde es Ihnen sehr gern zurückgeben. Näheres Kennenlernen erwünscht, Heirat nicht ausgeschlossen.“
Aber wenn sie es nicht liest? Abgesehen davon, dass sie denken würde, ich bin verrückt. Was nach Meinung meiner Freunde vermutlich zutrifft.
Nein, auch das geht nicht.
An was glaubt sie, diese Frau, für die es keinen Gott und keine Wiedergeburt gibt?
An die Begegnungen mit den Menschen, an Fahrräder und Farben. Ich heiße Fabrizio. Ist das nicht ein gutes Zeichen?
Vielleicht müsste ich Josef heißen, wie Josef von Maria und Josef oder Tony wie Maria und Tony in West Side Story.
„Maria, Maria, Maria, Maria ...“, ich singe das Lied bei Tag und Nacht, sie hört mich nicht.
Heilige Madonna, Maria, hilf mir!
Es ist gut, dass ich so viel zu tun habe, die Nachfrage nach Fahrrädern steigt von Jahr zu Jahr. Ich habe mehrere Angestellte und werde die Geschäftsräume neben unserem Standort anmieten, um die Lagerkapazität zu erhöhen. Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen, haben eine moderne Reparaturwerkstatt integriert und stellen seit einigen Monaten eigene E-Bikes her. Elektrische Fahrräder mit Lithiumbatterien, die dem Wunsch nach mehr Mobilität und weniger Umweltverschmutzung entgegenkommen.
Warum ich das alles erzähle?
Es geht mir finanziell hervorragend. Meine Arbeit macht mir Spaß, und ich habe Erfolg. Genügend, um es mir zu leisten, junge, unbekannte Autoren zu unterstützen. Genügend, um Marions Buch zu veröffentlichen.
Vielleicht hat sie kein Interesse, vielleicht doch.
Ich werde einige Exemplare drucken lassen, in einer ansprechenden Umschlaggestaltung, einem Schriftsatz, der ihr hoffentlich gefallen wird und ihr diese Bücher zusammen mit dem vorgeschlagenen Vermarktungskonzept, inklusive möglicher Rezensionen, Interviews etc. zukommen lassen. Und einem Brief, in dem ich ihr meine Verehrung versichere und eidesstattlich erkläre, dass die Publikation nur dann vorgenommen wird, wenn sie damit einverstanden ist.
Selbstverständlich werde ich ihr die Entscheidung überlassen, die in ihrem Tagebuch erwähnten Personen umzubenennen, eventuell sogar die Geschichte als solche leicht zu variieren.
Alles liegt in ihrer Hand. Sie kann genauso gut die Exemplare vernichten und meinen Brief verbrennen. Oder andersrum.
Das Einzige, worum ich sie bitten werde, ist, mich auf einer Fahrradtour durch eine schöne Landschaft, die sie sich aussuchen kann, zu begleiten.
Die Toskana vielleicht?
Ich suche sie, und ich werde sie finden. Dann werden wir sehen ...
Marion
Es ist so weit. Mein kleiner Koffer steht gepackt am Eingang, die Nachbarin, die die Blumentöpfe gießen wird, ist verständigt, und der Zweitschlüssel zu meiner kleinen Wohnung liegt, wie immer, unter dem Fußabstreifer, der zerschlissen und mit ausgefransten Ecken schon bessere Tage gesehen hat. Die Zeitung habe ich abbestellt und den Wecker entschärft, der sonst pünktlich um sechs Uhr morgens meinen kurzen Schlaf beendet.
Ich bin aufgeregt und dennoch seltsam ruhig.
Endlich ist es so weit! Vier Wochen Urlaub im Jahr, auf die ich mich elf Monate lang freue und innerlich vorbereite. Ich lebe für diese vier Wochen und in ihnen spielt sich alles ab, was Bedeutung hat.
Hat irgendjemand vor mir bemerkt, wie sich die Zeit überlisten lässt? Jeder dieser Tage, die mich erwarten, entspricht meinem Gefühl nach einer Woche- manchmal geht es mir sogar mit den Nächten so und in diesem Fall wird aus einem Monat ein halbes Jahr.
Im Alltag habe ich meine festen Tagesabläufe, jeder Montag gleicht dem Montag der folgenden Woche so sehr, wie dem der vergangenen. Das Wetter mag sich verändern, meine Routine bleibt dieselbe. Oft kommt es mir so vor, als ob dieses Netz aus Gewohnheiten, das mich hält und mir ein Gefühl von Kontrolle gibt, in Wirklichkeit wackelig und falsch mir über den Körper geworfen wurde, um als beweglicher Käfig meine Schritte einzugrenzen.
Wer hat das getan? Wer mich so eingeschlossen?
Ich werde später darüber nachdenken, jetzt ist es Zeit, meinen Mantel anzuziehen, die Handtasche in die linke Hand zu nehmen, den Koffer mit den praktischen Rollrädern in die rechte und mich auf den Weg zum Bahnhof zu machen.
Ich wohne im dritten Stock. Das Treppensteigen ist mir mehr als eine willkommene sportliche Betätigung ein Vergnügen an sich. Soll ich mich heute am Handlauf festhalten oder nicht? Was bedeutet es, wenn mir jemand im Treppenhaus begegnet? Werde ich es schaffen, zuerst eine Stufe, dann zwei, dann drei auf einmal zu nehmen und danach wieder zwei, dann eine, dann zwei, dann drei, ohne aus der Reihe zu kommen? Mit welchem Fuss werde ich im Erdgeschoss ankommen? An manchen Tagen laufe ich rückwärts hinauf und dann denken die Menschen, ich bin gerade auf dem Weg nach unten.
Heute brauche ich meine Spiele nicht, heute sind meine Gedanken erfüllt von dem, was kommen wird, ein letzter Blick auf den Spiegel am Eingang: Ich zwinkere mir zu und finde, heute ausnehmend hübsch auszusehen. Die Augen sind nicht mehr so groß und rund wie früher, aber der Ausdruck ist doch derselbe, ich bin es, die durch sie blickt, egal, ob zwanzig oder zweiundvierzig. Oder nicht?
Was zunehmend schwieriger wird, ist es, Wiederholungen zu vermeiden bei den Reisen, wo am Allerwichtigsten ist, Neues zu sehen und zu entdecken. Wenn ich die gleiche Strecke ein ums andere Mal fahre, dann fällt die eine Reise mit der anderen irgendwann in eine zusammen – und dann sind die vier Wochen nicht länger als ein Monat, ja, verlaufen sogar Gefahr, zu zwei Wochen zu schrumpfen.
Obwohl es mir nicht auf die Landschaft, die an mir vorüberfliegt, ankommt. Aber allein die Tatsache, dass ich nach drei Malen schon wüsste, wann der Zug überall hält und welches die nächste Ortschaft sein wird, wo man aus- oder einsteigen kann, allein das, dieses Wissen, sei es auch nur unbewusst, würde mir einen Teil des Spaßes verderben.
Die Tageszeit, an der ich auf dem Bahnhof in meiner Heimatstadt abfahre, verschiebe ich jedes Jahr um zwei Stunden und dann hängt es davon ab, in welche Richtung der nächste Zug fährt, ob nach Osten oder nach Westen, und natürlich ist dieser Teil der Reise jedes Mal derselbe. Es ist der Vorspann, die Einleitung, die nur die Vorfreude wachsen lässt und in der ich mein Herzrasen mühsam besänftige.
Die nächste große Stadt ist schnell erreicht und dann wird es spannend: Wann fährt der nächste Zug in den Norden oder Süden? Welche Entfernung ist weit genug, um diese erste Nacht im Zug zu verbringen? Ab dann wird es leichter, jedes Mal gibt es immer mehr Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen weiterzureisen; wie ein riesiges Fadengewirr multiplizieren sich die Wege –_manche Schnittstellen sind in Wirklichkeit Sterne, wo Osten, Westen, Süden und Norden und Nordnordost und Südsüdwest um meine Auswahl buhlen.
Ich liebe die alten Abteile, mit ihrer ganz spezifisch eigenen Atmosphäre, die wie weise Urgroßmütter mir Schatz und Schutz gewähren. In ihnen spielt sich mein Leben ab, dort atme und denke, höre und verstehe ich, sammle Menschen wie andere Briefmarken oder getrocknete Blumen.
Meine Schätze sind die Begegnungen mit anderen derselben Spezies, Mensch, die hier, in dieser unkonkreten Zwischenwelt, wahrhaftiger sind und sein können, als sie es normalerweise zulassen würden. Nicht alle, nein, natürlich nicht. Aber auch die, mit denen es keinen Austausch, keine Verbindung gibt, auch sie sind mir wertvoll und erfüllen mich, ohne ihr Wissen und noch weniger ihren Willen.
Tagebuch
Teil 1
Fritz
Ich weiß nicht, wie er heißt. Aussehen tut er definitiv wie Fritz. Systematisch erfinde ich mir passend zum Menschen den Lebenslauf, freue mich, wenn meine Rückschlüsse, entstanden durch genaues Beobachten der äußeren Erscheinung, von Kleidern, Hosen, Mützen, Hüten, Schuhen, ja vor allem und unbedingt von Schuhen, mit der Realität kongruieren. Doch noch mehr fasziniert mich, wenn dem nicht so ist, wenn es klafft zwischen außen und innen, mir die Widersprüche irgendwann im Gespräch offensichtlich werden. Dann werden all meine Nerven aufgeweckt, gekitzelt, stimuliert, dann bin ich ganz Auge, ganz Ohr, ganz wach und präsent.
Ob es langweilige Menschen gibt? O doch, ich denke schon. Glatte, ölige Menschen ohne Ecken und Kanten und viel schlimmer noch, ohne Bewusstsein ihres beschränkten, seichten und sinnlosen, unwesentlichen Lebens. Menschen wie Schafe und Kühe, immer im Rudel, sich nicht ihrer Einzigartigkeit bewusst. Jasager, die nichts hinterfragen, weil sie keine Fragen haben.
Ich suche Menschen, die keine Tiere sind und wenn, dann Nashörner, Adler, Wildkatzen, Giraffen und Würmer; Schlangen oder Tiger.
Zurück zu Fritz mit dem langen, gezwirbelten Schnurrbart und dem dicken Bauch, mühsam in eine weinrote Weste mit vergoldeten Knöpfen gezwängt, der in der großen Stadt, in der ich umgestiegen war, um dieses Mal in den Süden zu fahren, die Tür zu meinem Abteil aufzog.
„Guten Tag. Ist hier noch ein Platz frei?“
Nicht nur einer, das Abteil ist vollständig leer, abgesehen von einer Frau mittleren Alters mit hochgesteckten dunklen Haaren, die mit übereinandergeschlagenen Beinen angestrengt unbeteiligt aussieht, also mir. „Ja, wie es aussieht, sind alle Plätze frei. Auch auf dem Kärtchen an der Tür mit den Platzreservierungen ist niemand vermerkt. Sehen Sie?“
Mühsam hatte ich ein Abteil gefunden, das genau diese Anforderungen erfüllte.
„Oh wie angenehm, dann darf ich mich also zu Ihnen setzen?“
„Bitte, wenn Sie möchten!“
Nach den immer wieder ähnlich peinlichen ersten Minuten, in denen jeder angestrengt versucht, möglichst beschäftigt und geschäftig dem Gegenüber (meist setzen sich die Menschen gegenüber, selten neben mich) die Gelegenheit gibt, zu beäugen und beäugt zu werden, doch auf keinen Fall in Augenkontakt zu geraten, nach diesen ersten Momenten also, kehrte langsam wieder ein Gefühl der Normalität zurück. Das Abteil war nicht mehr nur meines, sondern wurde geteilt, dieser enge Lebensraum für einige Stunden identisch mit dem des Fremden, der seine Zeitung geräuschvoll entwirrte.
Die Spannung ließ jetzt etwas nach, ich hatte Muße, in Ruhe Aktenkoffer, Mantel (Lodenmantel), bügelgefaltete, dunkelgraue Stoffhose und perfekte Designerschuhe zu begutachten.
Wohin mochte er fahren?
Für den Fall, dass ich nach Grund und Ziel meiner Reise gefragt werden würde, hatte ich mir einige mögliche Antworten ausgedacht, die von Reise zu Reise etwas variierten. Im Moment war ich auf dem Weg zu einem Kongress in Rom; das Thema war Anthropologie, konnte aber je nach Lust und Laune in Kommunikationswissenschaften, Medizin, Psychologie oder auch Linguistik umgeändert werden.
Manchmal fuhr ich zu einer erfundenen Freundin, die ich fünf oder zehn Jahre nicht mehr gesehen hatte. In ganz seltenen Fällen war ich auf dem Weg zu einer Beerdigung.
Sicher fuhr Fritz zu keinem meiner erfundenen Ziele.
Er mochte um die 45 Jahre alt sein, schien keinerlei Geldsorgen zu haben, die Schuhe allein mochten die Hälfte meines Monatsgehalts gekostet haben. Er trug keinen Ehering und seine Bewegungen wiesen durch nichts darauf hin, dass er eventuell homosexuell sein könnte. Schade!
Es war einige Jahre her, dass ich einen ausnehmend interessanten schwulen Künstler aus Wien kennengelernt hatte, Moritz, der sich Maurice nannte. Wir hatten eine unvergessliche Nacht, teilten unsere Begeisterung über die Schönheit der Werke von Schiele, Munch und Klimt, philosophierten über den gesellschaftskritischen Anspruch der Expressionisten und stritten über die Bedeutung von Beuys. Noch mehr klafften unsere Meinungen bei der Kunstrichtung des Kitsches mit Jeff Koons an der Spitze auseinander, aber ungeachtet dessen gingen wir mit dem Hochgefühl, das diesen menschlichen Begegnungen eigen ist, auseinander. Er experimentierte mit Lichtkunst und zwei Jahre nach unserer Reise besuchte ich eine seiner Ausstellungen im ZKM-Museum in Karlsruhe und war fasziniert wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal Karussell fährt. Er war ein Zauberer mehr noch als ein Künstler, der mein Erstaunen in Unglauben und meinen Unglauben in Glück verwandeln konnte.
Fische, die auf eine Leinwand projiziert wurden, konnten durch kleine Bewegungen meiner Hand (oder des Schattens der Hand) berührt und bewegt werden, schwebten schwerelos durch den fiktiven Raum, wurden hochgeschubst, angetippt, weggeschnipst. Ein bezauberndes Spiel mit der Fantasie.
Nein, ich glaubte nicht, dass Fritz ein Künstler war, zu bieder seine Kleidung, zu bürgerlich der Bierbauch – allein der ausgefallene Schnurrbart, Dali nachempfunden, weckte meine Assoziation zur Kunst und machte mich stutzig.
„Noch jemand zugestiegen?“
Der Schaffner unterbrach meine Gedanken. Nachdem wir beide unsere Fahrkarten gezeigt hatten, holte ich mein Tagebuch aus der Handtasche. Hier zeichnete ich all meine Begegnungen sorgfältig auf. Jede meiner Reisen hatte ich in einem dieser mit indischer Seide von Hand eingebundenen Schätze festgehalten. Dieses Jahr hatte ich einen rotlila Stoff ausgewählt und mit goldenem Permanentmarker die Zahl neun auf den Buchrücken gemalt. Vor neun Jahren war mein ältester Neffe geboren und einen Monat vor seiner Geburt war ich dreiunddreißig Jahre alt geworden, gerade so alt wie Jesus Christus, als er am Kreuz gestorben war; dass er starb, daran hege ich nicht den geringsten Zweifel.
Dieses war also bereits das neunte meiner Reisetagebücher, die fein säuberlich geordnet auf dem Bücherregal neben meinem Schreibtisch standen und die ich zur Hand nahm, wenn der Alltag unerträglich wurde, mich die Schüler bis an den Rand der Verzweiflung getrieben hatten, oder wenn mich ständig neue, unsinnige, bürokratische Regeln aus meiner Ruhe brachten
Sie erinnerten mich daran, dass sich das Leben lohnte, dass es lebenswert verrückt und wild, bunt und aufregend sein konnte.
Nicht nur die verschiedenen Lebensgeschichten meiner Gefährten hielt ich darin fest, wie ich sie in meinen Gedanken nannte, sie waren keine Freunde, keine Bekannten. Vielleicht hätte noch Begleiter gepasst, aber das Spiel zwischen aktiv und passiv, das mich demnach zur Begleiteten degradierte, entsprach nicht dem, was ich ausdrücken wollte. Meine Gefährten waren auf derselben Ebene wie ich, wir waren eigenständige, unabhängige und gleichwertige Menschen, die für einige Stunden zu Gefährten wurden. Ich zeichnete also nicht nur ihre Geschichten auf, auch meine intimsten Empfindungen, Gefühle und Gedanken notierte ich.
Niemand anderes als ich bekam meine Tagebücher zu lesen, und nur gelegentlich überlegte ich, ob sie wohl nach meinem Tod in die richtigen Hände gelangen würden. Manchmal stellte ich mir vor, sie in meinem nächsten Leben, das es selbstverständlich nie geben würde, als gedruckte Bücher zu lesen. Ob ich mich an mich erinnern würde?
Wahrscheinlicher war allerdings, dass sie gemeinsam im Abfall landen würden, nutzloser Kram. Selbst wenn ich hier bisweilen einen fiktiven Leser anspreche, gehe ich doch davon aus, dass dieser niemals lesen wird, was ich hier zu Papier bringe.
Vor einer Stunde waren wir in München weggefahren, mein Lieblingsstift flog über das Papier, ich flocht meine Vorfreude und Neugier in die Wörter, die ich zu langen, kettengleichen Sätzen verzwirbelte.
Als ich kurz innehielt, spürte ich, dass der Blick von Fritz (solange ich nicht seinen richtigen Namen wusste, musste er mit diesem vorlieb nehmen) auf mir ruhte. Er wich meinem Blick nicht aus, er schien im Gegenteil darauf gewartet zu haben, dass ich aus meiner Versenkung wieder auftauchte.
Er streckte mir seine Hand entgegen. „Verzeihen Sie bitte, dass ich mich erst jetzt vorstelle, ich bin ein Tölpel.“
Er hatte tatsächlich Tölpel gesagt. Ich erinnerte mich nicht daran, wann ich dieses Wort zum letzten Mal gehört hatte; es musste Jahre her sein!
Franz Deigner. Angenehm!“
Wie lustig! Nicht Fritz, Franz! Manchmal wunderte ich mich über meine Intuition ... Ich gab ihm meine Hand. „Marion Brandauer.“
„Wie der berühmte Karl Maria Brandauer? Sind Sie etwa mit ihm verwandt?“
Ich lächelte. „Nein, leider nicht, aber ich bewundere ihn sehr.“
„Aber Sie sind Schriftstellerin, nicht wahr?“
Wieder musste ich lächeln. „Aber nein, was stellen Sie sich vor! Ich bin Lehrerin, Englischlehrerin, aber ich schreibe Tagebuch.“
Oh, ich hatte nicht aufgepasst! Der Anthropologie-Kongress löste sich in Luft auf und musste dem Besuch meiner erfundenen Freundin, die seit Jahren in Rom lebte, weichen.
„Man sieht, dass es Ihnen leicht fällt, zu schreiben und wie sehr sie es genießen. Ihr Mienenspiel und ihr sich ständig verändernder Gesichtsausdruck waren mir eine Freude.“
Er hatte mich also seit einer Weile beobachtet. Ich wusste nicht, ob ich geschmeichelt oder empört sein sollte. Aber es war nur fair, dass auch ich Objekt seiner Neugier war, gleiches Recht für alle! „Ja, ich schreibe sehr gerne, aber wirklich nur für mich.“
Es war ihm anzusehen, wie gerne er gelesen hätte, was ich in der letzten Stunde geschrieben hatte. Nie im Leben würde ich es ihm zeigen! Jetzt war es an mir, ihn zu befragen. „Und Sie? Schreiben Sie auch?“
Ich hatte erwartet, er würde verneinen, aber das Gegenteil war der Fall.
„O ja, ich schreibe Werbetexte, kurze prägnante und leicht verständliche Slogans, vergleichbar mit Schlagertexten, die sich wie Ohrwürmer in den Köpfen der Menschen festsetzen. Ein faszinierendes Metier, natürlich weit entfernt von den Ansprüchen eines Schriftstellers. Sie müssen wissen, ich bewundere Schriftsteller. Schade, dass Sie nur Englischlehrerin sind.“
Bitte? Hatte ich richtig gehört? Was nahm sich dieser durchgestylte dickliche Herr mit dem verrückten Schnurrbart heraus, der offensichtlich weder an Schüchternheit noch an Minderwertigkeitsgefühlen litt und wohl immer aussprach, was ihm gerade in den Sinn kam.
Außerdem war ich erstaunt, dass ausgerechnet dieser Mann einer der jungen Kreativen sein sollte, die die Medien beherrschen. Nicht mit diesen biederen Klamotten, diesem Körperumfang – eher noch hatte ich angenommen, er sei Unternehmer, Fabrikant oder Großgrundbesitzer.
Was sollte ich antworten? „Ja, Sie haben recht. Mir wäre es auch lieber gewesen, Sie wären Schriftsteller und nicht bloß Werbetexter, so banal, wie diese Sprüche oft sind!“ Zack! Jetzt hatte er es! Ich war sehr zufrieden mit mir!
Franz brach in ein lautes und unmäßiges Lachen aus, so ungefähr, wie der Weihnachtsmann lachen würde. „Hohohoooo! Hahaha!“ Er hob seine rechte Hand: „Give me the five, Englischlehrerin, jetzt sind wir quitt!“
Wie peinlich war das denn? Ich entschloss, seine erhobenen fünf Finger zu ignorieren und wandte mich wieder meinem Schreiben zu.
„Kommen Sie, Marion, seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt! Wissen Sie was? Lassen Sie es mich wiedergutmachen. Begleiten Sie mich auf einen Kaffee oder Cappuccino in den Speisewagen.“
Er hatte mich überrumpelt. Eh ich es mich versah, saßen wir im Speisewagen und waren in ein anregendes Gespräch vertieft.
„Wie kommt man dazu, Werbetexte zu schreiben?“
„Oh, wissen Sie, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und sollte den elterlichen Hof übernehmen. Nicht nur das, auf Wunsch meiner Eltern habe ich die Tochter des nachbarlichen Gehöfts geheiratet.“
„Ah, Sie sind also verheiratet?“
„Nein nein, schon lange nicht mehr! Warten Sie, ich werde es Ihnen erzählen, immer schön der Reihe nach.“ Er legte eine kurze Pause ein. „Ich bin der Älteste von fünf Geschwistern. In unserer Familie gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Seit Generationen und Generationen übernahm der älteste Sohn den Bauernhof. Um das Zerstückeln des Landes zu vermeiden, bekamen die anderen Kindern Anteile der Ernte, aber ihre Kinder hatten keinerlei Anspruch mehr auf irgendein Erbe. Diese Regeln waren klar und uns seit unserer Kindheit bewusst. Niemand hatte sich je dagegen aufgelehnt.
Schon während der Schulzeit wurde ich vom Vater auf meine Aufgabe vorbereitet, musste den Stall ausmisten, beim Aussäen helfen, in der Erntezeit in der Schule fehlen. Sie müssen wissen, dass ich sehr gern in die Schule ging, anders als meine Geschwister, die oft Kopfweh oder Bauchweh vortäuschten, um den Unterricht zu schwänzen. Ich hasste die Erntezeit, aber noch mehr widerte mich der Viehgestank an, das Melken, das Füttern, das Impfen. Aber am Allerschrecklichsten war das Schlachten. Seit einigen Jahren esse ich wieder Fleisch, aber in der ersten Zeit nach meinem Ausbrechen war ich überzeugter Vegetarier. Aber ich greife den Ereignissen vorweg.“
Er holte tief Luft.
„Zunächst folgte ich klaglos den Anweisungen des Vaters, lud die nicht sehr attraktive, aber doch liebenswerte Käthe, die Tochter der Nachbarn, zu den Tanzfesten im Dorf ein. Am Anfang mochte ich sie auch wirklich gern. Sie ließ mich ihre Brüste anfassen, und ich erkundete mit meiner Zunge ihren Mund.“
Wie ich schon erkannt hatte, nahm Franz kein Blatt vor den Mund. Mir wurde es etwas zu intim, aber er war voll in Fahrt und meine hochgezogenen Augenbrauen bewirkten genau das Gegenteil von dem, was ich beabsichtigt hatte.
„Ich war sechzehn, war begierig, zum ersten Mal ein Mädchen nackt zu sehen, sie an allen verbotenen Stellen zu berühren. Ich wollte mich auf sie legen und ja, ich wollte eindringen in ihr Innerstes, sie besitzen, endlich dieser aufgestauten Lust und diesem Drang nachgeben. Meine täglichen Masturbationen stachelten meine Gier nur noch mehr an, und so suchte ich jede Gelegenheit, um mit Käthe allein zu sein. Leider war sie durch nichts in der Welt dazu zu bringen, ihre Beine zu spreizen, ihr Unterhöschen herunterzuziehen und mich zumindest sehen zu lassen, was ich in meinen feuchten Träumen eroberte.“
„Mich interessiert nicht im Geringsten, was Sie mir da erzählen“, unterbrach ich ihn unwirsch. „Es geht mich nichts an, und es ist taktlos, über diese Dinge zu sprechen.“
Mit diesen Worten erhob ich mich, funkelte ihn grimmig an und ging entschlossenen Schrittes zurück ins Abteil. Dieser Mensch hatte kein Benehmen!
Ich überlegte, wie ich am besten die restliche Reise überstehen würde, war drauf und dran, mir ein neues Abteil zu suchen, in dem möglichst alle Sitzplätze schon besetzt waren, damit es ihm unmöglich wäre, mir zu folgen, direkt auf den letzten freien Platz würde ich mich zwängen!
Da kam er zerknirscht und mit einer Schachtel Pralinen ins Abteil zurück. „Marion, es tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, ich wollte Ihnen nur erklären, wie ich zu dem wurde, der ich heute bin. Ich verspreche Ihnen, in unserer weiteren Unterhaltung mehr aufzupassen. Wenn es Ihnen recht ist, können wir ein Wort festlegen, um den Inhalt zu zensieren. Was meinen Sie? Wenn Sie mir etwas erzählen, was für mich uninteressant ist, langweilig oder unpassend dann sage ich ganz schnell „Pizza“ oder „Kleingeld“ oder „Auto“. Oder „Ampel“, „Brille“ oder „Brezel“. Ebenso machen Sie es, wenn Sie mich stoppen wollen. Welches Wort suchen sie aus?“
Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, ihn in eine vergleichbar unangenehme Situation zu bringen. „Brezel.“ Mit seiner reumütigen Miene und seiner direkten, unverfälschten aber auch unverfrorenen Art erinnerte er mich an ein Kind. „Bei drei Brezeln wechsle ich in ein anderes Abteil.“
Er nickte. „Scheint mir fair zu sein. Bitte erzählen Sie mir, wohin Sie fahren, Marion.“
Er hatte es sich redlich verdient. Bestimmt eine halbe Stunde lang flunkerte ich das Blaue vom Himmel herunter, erfand eine Mädchenfreundschaft mit allen dazugehörigen Anekdoten und Details, verstrickte mich immer weiter in die Geschichte, bis sein „Brezel“ mir Einhalt gebot.
„Okay, ich hab’s kapiert, Sie besuchen ihre beste Freundin, die seit zehn Jahren in Rom lebt. Sie müssen mir zugestehen, dass es langsam etwas langweilig wurde. Ihre nächste Frage an mich?“
Der Mann hatte wirklich Nerven! Insgeheim war ich überaus neugierig, wie sein Leben nach der unerfüllten Sehnsucht weiterverlaufen war, hoffte aber, von weiteren Ergüssen verschont zu bleiben. „Welchen Werbespruch haben Sie auf dem Gewissen?“ Ich wollte ein wenig an diesem zur Schau gestellten Ach-was-bin-ich-toll-Gebahren kratzen. Nicht umsonst hatte er meine nette Geschichte von eben zu langweilig degradiert. „Hm ... Wer Geld hat, braucht Geld. Wer Schönheit hat, braucht Schönheit. Wer Intelligenz hat, braucht Intelligenz.“
Er überlegte kurz: „Das neue Kreditkartensystem Her damit! Ist das ultimative Hab-ich schon!“
Ich war sprachlos. Die ganze Stadt war mit seinen Werbeplakaten tapeziert. Abgesehen davon, dass ich diesen jämmerlichen Spruch nicht verstand, versuchte ich, mir meine Überraschung zumindest nicht anmerken zu lassen. „Ah ja, das hab ich schon mal gehört.“ „Genauso lässt es sich anwenden auf Gesellschaftssysteme wie zum Beispiel, Wer Freiheit hat, braucht Freiheit oder Wer Öl hat, braucht Öl, wer Folter hat, braucht Folter, wer Krieg hat, braucht Krieg.“
Ich hatte große Lust, Brezel zu schreien. Alles an Franz war seltsam und banal zugleich.
Aber erst als er fortfuhr, „Wer Liebe hat, braucht Liebe“, „wer Sex hat, braucht Sex“, da schoss mir Brezel über die Lippen.
„Okay, okay, ist schon gut. Sagen Sie, Marion, haben Sie mal mit irgend jemandem über ihr Problem auf diesem Gebiet gesprochen? Ich meine, waren Sie schon mal bei einem Psychologen deswegen? Wenn nicht, dann würde ich Ihnen dringend dazu raten.“
Er war unverschämt. Mir blieb die Sprache weg. Aber bevor ich ein weiteres Brezel stammeln konnte, war er schon im nächsten Satz.
„Ich habe eine jahrelange Therapie hinter mir. Wissen Sie, kurz nach meiner Hochzeit mit Käthe, als ich mich endlich am Ziel meiner Wünsche glaubte, wurde ich impotent.“
Nun tat er mir zu leid, um ihn zu unterbrechen.
„Ich war einundzwanzig und auf dem Bauernhof von morgens um fünf Uhr bis spät abends eingespannt, in einem Beruf, der mir nicht gefiel, der mir von Tag zu Tag mehr verhasst war; war mit einer Frau verheiratet, die ich nicht liebte, deren Körper, nachdem ich ihn besessen hatte, jeglichen Reiz für mich verloren hatte.
Zunächst suchte ich Ablenkung, fing an, regelmäßig mit Freunden aus dem Dorf Poker zu spielen und trank immer häufiger mehr als ich sollte. Ich war zutiefst unglücklich. Über zwei Jahre sah es so aus, als würde alles immer nur so weitergehen, sich nichts verändern, nichts jemals besser werden. Und dann kam ich eines Nachts nach Hause, und obwohl ich ziemlich betrunken war, konnte ich doch erkennen, dass ein nackter Mann, im Arm ein Bündel aus Kleidern, aus unserem Schlafzimmerfenster stieg und davonrannte, barfuß ,wie er war, als ob der Teufel hinter ihm her wäre.
Wir hatten nach unserer Hochzeitsnacht nur noch zweimal miteinander geschlafen, Käthe war jung und nicht frigide.
Ich kann es ihr nicht übel nehmen, dass sie mich betrogen hat.“
Gespannt folgte ich seiner Geschichte.
„Am nächsten Tag packte ich meinen Koffer, nahm mir achthundert D-Mark aus der Gebäckdose, wo wir unsere Ersparnisse versteckten und lief zum Bahnhof. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Tränen der Verzweiflung und Trauer oder Freudentränen waren, die mir über das Gesicht liefen. Vermutlich ein Gemisch von beiden.“
Ich schluckte.
„Sie sind geflohen, ausgebrochen.“
„Ja, genauso fühlte es sich an, ein ausgebrochener Sträfling, auf der Flucht“, erwiderte Franz lakonisch.
Es hat Jahre gedauert, bis ich wieder einen Fuß in mein Dorf setzte. Mit der entsprechenden Lebenserfahrung muss ich sagen, dass ich zwar nicht stolz auf die Art meines Weggangs bin, besser hätte ich klar und deutlich meine Bedürfnisse ausgedrückt, entgegen jeden Widerstandes der Eltern, aber immerhin ist ein schlechter Abgang besser als gar keiner.“
„Und dann? Ich meine, mit achthundert D-Mark kommt man nicht sehr weit ...“
„Da haben Sie recht, Marion! Ich hätte die Dose leer machen sollen.“ Er grinste. „Aber es hat gereicht, sehen Sie, ich habe überlebt. Nein, im Ernst, es reichte genau für eine Woche Halbpension in der ersten billigen Absteige, die ich in der Nähe vom Münchner Bahnhof fand. Jeden Morgen kaufte ich als Erstes die Zeitung und ging alle Stellenangebote durch. Am dritten Tag war ich der Erste, der sich auf die Anzeige einer Werbeagentur, die einen Boten brauchte, meldete. Ich muss in diesen Tagen vertrauenswürdig und bedürftig ausgesehen haben. Sie haben mich genommen.“ Seine Augen leuchteten.
„Mit dem ersten Gehalt bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben ins Kino gegangen. The Shining, mit Jack Nicholson, ein wahnsinniger und verrückter Film, so merkwürdig, dass mein Leben im Vergleich dazu einfach und beschaulich war, obwohl ich, losgelöst von Frau und Familie, mich manchmal fühlte wie in einer anderen, fiktiven Welt. Auf der anderen Seite war da dieses Gefühl der Freiheit, das ich in dieser reinen und unverfälschten Form nie wieder erlebt habe.“
Ich nickte. „Das Alleinsein hat seine Vorteile, gewiss. In jedem Moment nur sich selbst Rechenschaft schuldig zu sein, ohne andere Bedürfnisse in Betracht ziehen zu müssen, ist für die meisten Menschen undenkbar.“
„Sie leben auch allein? Sind Sie geschieden?“
„Ich habe nie geheiratet. Vermutlich ist das Bedürfnis nach Zweisamkeit bei mir nie so ausgeprägt gewesen.“
„Aber sie sind nicht etwa lesbisch?“
Zum ersten Mal verletzte mich seine Offenheit nicht, verursachte im Gegenteil den Wunsch, die von mir vor die ausgesprochenen Sätze eingebauten Filter zu entfernen, sie für die Dauer dieser Unterhaltung zu vergessen. Warum nicht? Was war so schlimm daran, alles auszusprechen, was in den Gedanken blühte, ohne das Unkraut auszurupfen und vor dem Aussprechen in Gedanken bereits die Reaktion des Gesprächspartners vorwegzunehmen?
War mir das überhaupt möglich? Innerlich jubelte ich. O ja, es würde mir Spaß machen, alle unsagbaren Dinge auszudrücken, ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten. Andererseits müsste auch ich bereit sein, mich zu öffnen, ohne schockiert, peinlich berührt, betroffen oder beleidigt zu sein.
Es war ein Spiel, und ich wollte mitspielen – falls es mir zu nahe ging, hatte ich immer noch meinen Brezeljoker auf der Hand. „Nein, ich bin nicht lesbisch, so wenig, wie Sie schwul sind.“
Franz lachte sein Weihnachtsmann-Hahaha. „Sie sind nicht auf den Mund gefallen, meine Liebe, Sie gefallen mir!“
Wäre er etwas anziehender, hätte ich, um ihn irgendwann auszuziehen, mit „Ah ja?“ geantwortet. Und daraus hätten sich weitere Dialoge abgeleitet, die damit geendet hätten, dass wir ineinander verschlungen die Illusion von Liebe und Glück gelebt hätten, eine Nacht lang.
Aber dem war nicht so. Ich ignorierte sein Sie gefallen mir und brachte ihn wieder auf die unterbrochene Erzählung seiner ersten Zeit in der großen Stadt zurück. „Sie arbeiteten also bei der Agentur ...?“
„Ja, zwei Jahre lang trug ich mit dem Mofa Briefe und Rechnungen aus, brachte Pakete zur Post oder holte sie ab, brachte Überweisungen zur Bank. Es wurde erst spannend, nachdem ich zum Chauffeur des Direktors befördert worden war. Er war ein freundlicher, aber auch sehr einsamer Mann, und was am Interessantesten war: Er hatte die Agentur von seinem Vater übernommen, war unglücklich und fehl am Platz und versuchte, so gut es ging, seine fehlenden Ideen durch die bestechende Auswahl seiner Angestellten wettzumachen, deren Kreativität er stimulierte und belohnte.“
„Ähnlich, wie es Ihnen mit dem Bauernhof gegangen war, nicht wahr?“
„Ganz genau, das war das Lustige an der Geschichte. Er hätte vermutlich fürs Leben gern auf dem Land gewohnt und wäre als Bauer zufrieden und glücklich.
Er lachte verschmitzt. „Wenn er nicht um die fünfzehn Jahre älter gewesen wäre als ich, hätte man denken können, sie haben uns als Babys vertauscht!“
Ich freute mich mit ihm über diese Vorstellung. „Mein Vater war Lateinlehrer. Ich wusste zwar bald, dass Latein nicht mein Ding war, aber Lehrerin bin ich trotzdem geworden. Komisch, oder? Ob ich das ausgewählt habe, weil ich es unbewusst musste? So wie ihr Chef oder Sie? Leider kann ich nicht sagen, wie meine Eltern reagiert hätten, wenn mein Berufswunsch Musikerin oder Psychologin gewesen wäre, denn da waren sie schon längst tot. Es kann sein, dass diese Rebellion gegen den Vater bei mir nie stattgefunden hat, weil er nur als Traumbild in meinem Kopf bestand. Die wenigen Erinnerungen, die ich an ihn hatte, verblassten von Jahr zu Jahr mehr; es gab keine Reibung, keinen Vergleich und weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, mich von ihm abzugrenzen.“
„Das heißt, wenn mein Vater vielleicht früh verstorben wäre, könnte es sein, dass ich mit aller Leidenschaft Bauer wäre?“, überlegte Franz. Zweifel und Mitgefühl färbten sein Kopfschütteln. „Nein, ich glaube nicht, dass es an meinem inneren Abscheu gegen alles, was nach Mist und Blut riecht, etwas geändert hätte. Was ist mit Ihren Eltern geschehen, Marion?“
Unbeteiligt beantwortete ich alle Fragen, die implizit in der einen enthalten waren. „Sie hatten einen Autounfall und waren beide auf der Stelle tot. Ich war neun Jahre alt, kurz vor dem Ende der dritten Klasse. Die Schwester meines Vaters, meine Tante Charlotte, die selbst keine Kinder hatte, nahm uns bei sich auf. Mich und meine jüngere Schwester Myriam. Wir mussten umziehen, in eine andere Stadt, ein anderes Haus. Aber ehrlich gesagt war dieser Neuanfang besser als das Ertragen der mitleidigen Blicke meiner ehemaligen Schulfreunde, die mich mieden, als hätte ich die Pest. Damals tat alles so schrecklich weh, dass ich irgendwann zu Eis erstarrte. Erst jetzt, im Nachhinein verstehe ich, dass vielleicht alles anders gekommen wäre, wenn die Kinder und auch ihre Eltern mit uns anders umgegangen wären, uns normaler behandelt hätten, nicht wie zwei Aussätzige, denen für immer der Zugang zum Paradies versperrt bliebe. Aber es ist egal, es ist vorbei. Die Tante hat sich um uns gekümmert; wir hatten zu essen und ein Dach über dem Kopf.“
„Sie sind pragmatisch geworden?“ Franz hob fragend eine Augenbraue.
„Vielleicht. Vor allem bin ich verschlossen geworden, damals. Das Einzige, was mich begeisterte, war das Stricken und das Geige spielen. Wahrscheinlich hätte mir eine Therapeutin helfen können, aus meinem Schneckenhaus wieder herauszukommen, aber Sie wissen ja, wie das war, vor dreißig Jahren hat kein Mensch an so was gedacht. Aber Sie haben eine Therapie gemacht?“