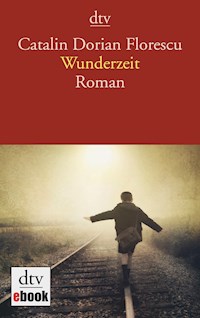
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wunder gibt es immer wieder An einem Augustmorgen Anfang der Achtziger Jahre wartet der 15-jährige Alin mit seinen Eltern an der Grenze zu Jugoslawien angespannt auf die Ausreise. Er denkt zurück an seine Kindheit im Rumänien Ceauşescus, aber auch an das große Amerika-Abenteuer mit seinem Vater: Einige Jahre zuvor waren die beiden in die USA gereist, damit Alin dort operiert werden konnte. Die skurrilen Erlebnisse schweißen Vater und Sohn zusammen, doch der amerikanische Traum zerplatzt rasch. Was die beiden in New York erleben, ist so niederschmetternd, dass sie nur rasch wieder nach Hause wollen, ganz gleich ob sie je wieder ausreisen dürfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Catalin Dorian Florescu
Wunderzeit
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2001 by Catalin Dorian Florescu
Erstmals erschien der Roman 2001 beim Pendo Verlag, Zürich – München.
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Umschlaggestaltung: Wildes Blut, Atelier für Gestaltung, Stephanie Weischer
unter Verwendung eines Fotos von Trevillion Images/Mark Owen
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-42358-8 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14321-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Widmung
Das gelbe Zollhaus …
Rot
Unterwegs mit Vater
Amerika
Rückkehr
Abschied
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
Meinem wundervollen Vaterund allen anderen Helden meiner Kindheit gewidmet
Das gelbe Zollhaus hat Fenster, und mehrere Türen gehen auf und wieder zu. Vater findet bestimmt einen Ausgang. Den halten sie bestimmt nicht fest. Vater ist großartig, wenn es darauf ankommt. Und jetzt kommt es darauf an. Jetzt sitzen wir nicht im Kino, wir sitzen in der Realität. So sieht sie also aus, die Realität, und Vater kennt sich gut damit aus. Er wird es schaffen, aus diesem Häuschen dort vorne herauszutreten. Er ist zu schlau für sie. Er hat uns schließlich einmal nach Amerika gebracht. Er wird es schaffen, und die Geschichte wird gut ausgehen.
Hier also leisten unsere Jungs Dienst. Hier also, am Ende unseres Vaterlandes. Unsere Jungs. So nennt sie der Tagesschau-Sprecher, und seine Stimme bebt dabei immer. Die Stimme bebt, die Erde kann auch beben. 1977 bebte bei uns die Erde. Wenn aber die Stimme bebt, geht es um höhere Dinge. Das hat mir Mutter erklärt.
»Mein Küken, das ist doch ganz einfach«, hatte sie gesagt. »Wenn du mal später Klassenerster bist und diesen Rascha Mircea überholt hast, dann wird meine Stimme beim Erzählen beben.« Mutter übertreibt gelegentlich. Was sie jedenfalls damit sagen wollte, ist, dass es etwas mit Stolz zu tun hat. Aber Mütter drücken es immer so umständlich aus. Zuerst rufen sie hundertmal »Mamas Küken«, dann erst kommen sie zur Sache. Es ist zum Verzweifeln.
Unsere Jungs bewachen aus der Ferne unseren Wagen auf dem leeren Parkplatz des Grenzpostens. Sie tragen die Schönwetteruniform. Unter dem Hemd schwitzen sie ein bisschen.
10. August. Neun Uhr morgens.
Es sind genau zwei Minuten und dreißig Sekunden vergangen, seit Vater das Auto verlassen hat. Vor genau einer Minute ist er im Haus verschwunden. Da haben sie ihn bestimmt nicht foltern können, in einer Minute. In einer Minute, da können sie nicht einmal fertigpissen, unsere Jungs. Ich habe einmal die Zeit gestoppt: Hosenschlitz auf, pissen, den Willi schütteln, Hosenschlitz zu. Knapp eine Minute. Zuschlagen liegt da nicht drin.
Wir sind am Ende unseres Vaterlandes. Es hat, wie alle anderen Dinge auch, ein Ende. Man kann ihm das Ende früher oder später setzen.
»Früher oder später, da werde ich wahnsinnig«, sagte Mutter.
»Früher oder später, da schlage ich zu«, sagte Vater.
»Früher oder später, da verlasse ich dich.«
»Früher oder später, da verlassen wir dieses Irrenhaus. Wir setzen dem Ganzen ein Ende.«
Wir wählten früher.
Wo wir uns gerade befinden, da geschehen Wunder, oder auch nicht, und wenn sie doch geschehen, dann nennen die Erwachsenen das Danach Freiheit. Ich verstehe nicht viel davon, aber eine tolle Sache ist es allemal. Wie der Stolz. Die Freiheit fängt dort hinter der Absperrung an. Bei der gelben Tafel mit der unverständlichen Schrift drauf: Jugoslawien.
Zeit für das fünfte Wunder.
Vater, wo bleibst du?
Rot
Bis heute Morgen haben wir in unserer kleinen Zweizimmerwohnung gelebt. Links und rechts und unterhalb von uns wohnten eine Menge anderer Leute. Einige hielten Katzen, Hunde, Kanarienvögel, Schwiegereltern. Es gab in unserer Nachbarschaft siebzehn Schwiegereltern und zwölf Haustiere.
In diesem unserem Land wohnten wir überhaupt alle eng beieinander. Das stärkte unser sozialistisches Lebensgefühl. Bestimmt. Enger wäre es nur gegangen, wenn wir alle in der gleichen Wohnung gelebt hätten. So aber grenzte der Krach von Vater und Mutter an den Krach der Väter und Mütter meiner Freunde.
Von außen sahen unsere Wohnungen wie kleine beleuchtete Würfel aus, aufeinandergeschachtelt. In ihrem Inneren stritten Erwachsene über weiß ich was. Wenn man ihnen von der dunklen Straße aus zuschaute, hörte man nichts. Vater hingegen wusste es besser, denn er war nebenbei unser Hausverwalter und bekam einiges mit.
»Du möchtest wissen, worum es in anderen Familien geht, wenn sie Krach haben?«, fragte er mich einmal erstaunt. »So genau kann ich es dir nicht sagen. Die holen mich, wenn die Zeit reif ist für Beleidigungen. Dann muss ich mir einiges anhören. Bis ich sie auseinandergebracht habe, habe ich meistens neue Schimpfwörter gelernt. Hurendreck zum Beispiel. Keine Ahnung, was das ist, aber das sagt Negreanu zu seiner Frau, wenn er besoffen ist. Hure, das ist das Mindeste, das muss einfach sein, und er wiederholt es irgendwie genüsslich. Er läuft rot an. Danach wärmt sie ihm die Suppe auf. Dann ist da noch dieses zurückgezogene Akademikerpaar im sechsten Stock. Du weißt schon, welches. Das mit dem ungarischen Familiennamen. Er ist so dünn und dürr, sie trägt diese scheußlichen Hüte mit breitem Rand. Also, er nennt sie Krake. Verstehst du? Krake, mit Tentakeln und so weiter. Was er damit sagen möchte, weiß nur er alleine.«
»Und sie, Vater, wie nennt sie ihn?« Vater stockte kurz.
»Impotent.«
»Hm?«
»Das erkläre ich dir, wenn du ein Mann bist.«
Vater vergisst, dass ich ihn nicht mehr brauche, wenn ich ein Mann bin.
Vorgestern Abend nahm Mutter Abschied von ihrer besten Freundin. Sie erzählte bloß, dass wir für einen Monat in die Berge führen. Sie erzählte nichts davon, dass wir ohne Wohnung bleiben würden. Wie üblich kam sie am Schluss des Gesprächs auf meine Geburt zu sprechen.
»Und da hat der Junge losgeschrien. Hat auf sich aufmerksam gemacht, der Kleine. Und wie. Da merkte man schon, dass es ihm vorbestimmt war, Einzelkind zu bleiben«, sprach Mutter in den Hörer.
Ich lauschte weiter hinter der Tür.
»Nein, der aß Eis, stell dir vor. Draußen regnete es in Strömen. Eine Frau alleine im Krankenhaus, stell dir vor«, fuhr sie fort.
Die sich was vorzustellen hatte, hieß Doina. Sie saß am anderen Ende der Leitung. Manchmal musste auch Mutter sich was vorstellen. Dann ging es um Liviu, den Mann von Doina. Der trieb es mit anderen Frauen. Wenn Mutter so redete, dann bebte ihre Stimme. Vor Wut. Das hatte sie zu erklären vergessen.
Bei meiner Geburt aß Vater viel Eis, Mutter und ich schrien im Krankenhaus um die Wette. Ich war laut, Mutter war leer. Vater meint, er habe vor Aufregung so viel Eis gegessen, dass er Krämpfe bekam und aufs Klo musste. Das soll’s geben.
»Verdammt noch mal. Kannst du mit dieser Geschichte nicht einfach aufhören?«, erwiderte Vater, als Mutter am Telefon davon erzählte.
»Aufhören? Wieso denn? Ist doch lustig. Deine Frau bekommt ein Kind, und du reinigst die Klobrille«, antwortete Mutter spöttisch, nachdem sie den Hörer mit der Hand abgedeckt hatte.
»Hör einfach auf. Was muss der Junge so mit anhören.«
»Er hat längst alles mitbekommen, längst alles. Aber keine Angst, er kann unterscheiden. Er ist intelligent.«
»Kannst du nicht einfach den Mund halten?«
»Den Mund halten? Ich? Ich habe doch nichts getan. Was habe ich denn getan?«, fragte Mutter unschuldig.
Vater schluckte leer. Niemand hatte mich gesehen. Niemand erzählte, ob ich viel Besuch bekam, auf der Neugeborenenabteilung.
Als ich geboren wurde, war es für den ersten Mondflug zu spät. Dabei wäre ich so gerne mitgeflogen. Apollo 11. Armstrong, Aldrin und Collins. Als Armstrong von der Leiter der Apollokapsel herabsprang, erbrach ich den Milchbrei auf die Bluse des Hausmädchens. Vater und Mutter waren am Meer. So wird es erzählt.
Milchbrei ist wohl nichts für Raumfahrer.
Es ist Anfang August, und vorgestern am späteren Abend war die Luft immer noch warm. Die Umrisse unseres Wohnhauses verschwammen, aber die vielen Würfel leuchteten. Es herrschte eine seltsame Ruhe überall. Nachdem ich meinen Eltern eine Zeit lang zugehört hatte, entfernte ich mich bäuchlings wie ein Apache und ging Dorin suchen.
Dorin war mein bester Freund im Viertel. Seine Familie war anders als meine. Meine Eltern sind Intellektuelle. Das ist wichtig bei uns, ob man intellektuell ist oder nicht. Dabei weiß ich, dass der Obergenosse die Intellektuellen gar nicht mag. Vater hat es erzählt. Aber wenn es ums Heiraten geht, ist man besser ein Intellektueller. Schwiegermütter mögen das.
Die Familie von Dorin arbeitete in der Fabrik: Vater, Mutter, Bruder. Nur Nero, der Hund, groß und schwarz, arbeitete nicht. Der hatte seinen Platz auf dem engen Gang vor der Küche. Dorin würde auch in der Fabrik arbeiten. Das sagte auch er selber.
Jedes Mal, wenn ich an der Wohnungstür von Dorin läutete, bellte Nero los. Das wusste ich im Voraus und legte mir die Worte zurecht.
»Nero, ruhig, Nero, ich bin’s.« Nero wusste nicht, wer ich war, und bellte weiter. Ich versuchte mich zu beruhigen und läutete wieder. Dann ging die Tür auf. Man hatte keine Schritte gehört, als ob seine Mutter dahinter gewartet hätte. Sie machte die Tür einen Spalt weit auf, ich sah nur ihren Kopf. Wenn sie mich nicht gleich loswerden konnte, zog sie noch einige Male an der Zigarette. Hinter ihr schwebte eine Menge Rauch in der Luft.
»Such ihn, Junge, anderswo. Der ist nicht da. Sag ihm, er soll heimkommen, wenn du ihn findest. Er soll sich um Nero kümmern. Sonst vergifte ich den Köter eines Tages. Sag ihm das.« Dann schlug sie die Tür zu, und man hörte nichts mehr. Sie liebte Nero. Da war ich mir sicher.
Vorgestern Abend fand ich Dorin im Hinterhof. Er versuchte an einen Spielzeugpanzer heranzukommen, den ein Kleiner fest an sich drückte. Als er mich sah, ließ er den schreienden Knirps los und kam auf mich zu. Wir überquerten die Schienen der Straßenbahn durch ein Loch im Zaun, der die Straße teilte, und gingen ins Nachbarhaus hinein. Wir fuhren ins oberste Stockwerk. Von dort aus gelangten wir schnell aufs Dach. Dort war die Stille noch größer und die Dunkelheit noch finsterer. Wir fürchteten uns vor Außerirdischen. Bis man uns vermisst hätte, wären wir wohl schon auf dem Sirius gewesen, die fliegen ja mit doppelter und dreifacher Lichtgeschwindigkeit. Oder man hätte uns für grässliche Experimente benützt und unsere Willis gemessen, uns ins Hirn geschaut, und dann hätte man alle unsere Erinnerungen ausgelöscht. Tolle Aussichten. Danach hätte ich in die Geschichtsstunde gehen und der Madame – so nannten wir unsere Geschichtslehrerin – erzählen müssen, dass ich alle Jahreszahlen zum glorreichen Kampf des Volkes gegen …, gegen …, na, gegen die anderen, die Bösen, vergessen hätte. Und dass sie sich, bitte schön, bei den Außerirdischen beschweren könne. Die hätte mir kein Wort geglaubt, und Vater hätte erneut in die Schule gehen müssen, was aber die Madame, die eine Schwäche für ihn hat, ganz sicher nicht bedauert hätte.
»Auaaah! Kies. Wer zum Kuckuck hat Kies hierhergebracht?«, fragte Dorin flüsternd, als wir uns hinsetzten.
»Ufos«, antwortete ich.
»Ha, Ufos. Was sollen denn die Ufos mit dem Kies anstellen?«, fragte er ungläubig.
»Brennstoff.«
»Brennstoff? Kies? Und die lagern’s hier auf dem Dach unserer Nachbarn ab? Wozu?«
»Welteroberung.«
»Und die fangen bei uns an?«
»Sei kein Schaf. Es war ein Witz.«
»Komiker.«
»Komiker, wer’s glaubt.«
»Dabei habe ich mich verletzt. Es brennt.«
»Psst, sei still«, flüsterte ich und fügte dann doch noch hinzu: »Was wolltest du von Cibi?«
»Den Scheißpanzer wollte ich. Ist ein ganz schönes Modell. Englisch.«
»Und deshalb hast du den Kleinen wie eine Sparbüchse durchgeschüttelt? Sein Vater hat’s doch mit der Flasche. Wenn der es erfährt, da kannst du was erleben. Da läuft er hinter dir her und lässt dich nicht mehr in Ruhe. Bis du aufgibst. Weißt du noch, wie du dich vor ihm auf dem Dach des Kiosks in Sicherheit bringen musstest? Erst als man deinen Bruder mit Nero holte, verzog er sich.«
»Ach, das war doch vor einem Jahr. Mittlerweile kann er keine fünf Schritte mehr machen. Man hat ihn letzte Nacht auf allen vieren gefunden, das Gesicht voller Hundekot.«
»Was?«
»Ja, er ist mit dem Gesicht hineingefallen. Und heute Morgen hat er angekündigt, dass er Nero vergiften wird. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass es Neros Kot war. Er hat es also auf Nero abgesehen und ich auf seinen Sohn. Die Rechnung ist doch einfach.«
Wir schwiegen kurz, dann fiel ihm ein, weshalb wir dort waren.
»Hatten wir nicht vor, uns Weiber anzuschauen?«, fragte er.
»Klar.«
»Wieso quatschen wir dann so viel?«
Wir saßen auf dem warmen, aufgeweichten Teer und hoben vorsichtig die Köpfe über das Geländer. Unsere Augen wurden groß wie Pflaumen. Jenseits der Straße leuchtete unser Wohnhaus wie ein Weihnachtsbaum. Überall waren die Fenster weit offen, ein leichter Wind ging durch die Vorhänge. Dorin zündete sich eine Zigarette an.
»Schau dir mal die vierte Wohnung von links an. Im siebten Stock. Superfrau. Sie läuft gerade ins Schlafzimmer. Könnte spannend werden.«
»Noch besser ist’s im sechsten Stock beim Hauseingang B. Die Studentin. Gerade zieht sie die Bluse hoch. Ohh …«
»Ahh …«
»Sie tut’s doch nicht«, und ich fügte im gleichen Atemzug hinzu: »Seitdem wir vor einem Jahr am Fluss dieses Riesenpech hatten, glaube ich nicht, dass es mal wahr wird.«
»Doch, doch. Mein Bruder hat die ersten Brüste erst mit neunzehn gesehen. Da haben wir noch Zeit, oder?«
»Hol mal das Fernglas raus«, forderte ich ihn auf.
»Schlechte Nachricht, Fernglas njet. Vater war besoffen und ist darauf eingeschlafen«, antwortete er.
»Auf dem Fernglas?«
»Psst. Gebrauche deine Augen, Einstein. Sagt das euer Chemielehrer auch?«
»Nein, der sagt: Gebraucht eure Hirnzellen oder verkauft sie.«
»Hm.«
»Hm.«
»Im fünften Stock tut sich was. Schnell.«
»Wo? Wo? Mach Platz! Platz!«
»Was heißt da mach Platz? Das Geländer ist hundertfünfzig Meter lang. Außerdem hat sie die Vorhänge zugezogen. Pech gehabt.«
»Hm.«
Wir schwiegen eine Zeit lang.
»Schau. Die links streiten sich. Die streiten sich, man hört nichts«, meinte Dorin.
»Seltsam. Er ist Leutnant von Beruf«, erwiderte ich.
»Hast du ihn schon schreien gehört? Ich schon.«
»Wetten, er gibt ihr eine Ohrfeige?«
»Wetten, dass er es nicht tut?«
Der Leutnant und seine Frau schrien sich lautlos an. Sie lief von der Küche ins Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer, dann wieder ins Wohnzimmer zurück. Er lief hinterher, packte sie am Arm und schlug auf ihren Bauch ein. Sie fiel aufs Bett. Wir schwiegen. Ich wusste nicht, was sagen. Hatte Dorin die Wette gewonnen? Er hatte sie ja nicht geohrfeigt.
»Schweinerei«, sagte ich.
»Du hast recht«, sagte er.
»Da ist es besser, stumm wie die Grigorescu zu sein. Schau sie an, jedes Mal, wenn wir hier oben sind, sitzen sie in den Sesseln und schauen fern. Die bewegen sich nie.«
»Was, wenn sie tot sind, und man hat sie nicht entdeckt?«
»Hm … sag mal, streiten deine Eltern auch so heftig?«
»Kommt vor«, antwortete ich. »Oft streiten sie auf eine Art, die ich nicht begreife. Sie werden nicht laut, aber was sie sagen, klingt nach Streit. Und bei dir?«
»Kommt vor.«
In manchen Wohnungen gingen die Lichter aus, in anderen an. Herr Mitrofan kam in seine Wohnung, hängte den Mantel auf, setzte Wasser auf, zündete seine Pfeife an.
»Der ist immer alleine, bei dem läuft nie was.«
»Der ist doch alt.«
»Grüßt nicht.«
Wir setzten uns hin, lehnten uns ans Geländer an. Nach einiger Zeit hob ich den Kopf hoch, manche Sterne flackerten, manche schienen die Farbe zu wechseln.
»Weißt du, wieso die Sterne flackern?«
»Nein.«
»Ich auch nicht. Aber manchmal glaube ich, dass sich irgendeiner bewegt. Dann schaue ich genau hin, und wenn er beschleunigt oder im Zickzack fliegt, na, dann ist es bestimmt ein Ufo. Satelliten können so was nicht. Das weiß ich ganz sicher. Diese Ufos können nachts Menschen von den Straßen entführen, und später löschen sie ihre Erinnerungen aus. Das tun die. Es gibt berühmte Geschichten dazu. Einmal verfolgten mehrere Polizeiautos so ein Ufo die ganze Nacht lang. Das war in Amerika. Das passiert in Amerika oft.«
»Du warst schon in Amerika. Hast du eins gesehen?«
»Klar doch. Passiert dort jeden Tag. Man ist kaum auf der Straße, und schon sieht man Ufos. Meistens muss man aber dazu ganz abgeschieden wohnen. Ich saß im Vorgarten – denn dort haben alle Häuser eigene Vorgärten – und wartete auf Vater, als ich auf einmal, direkt über dem linken Flügel eines Flugzeugs …«
»Sag mal, ist es wahr, dass ihr übermorgen abfahrt?«, unterbrach mich Dorin.
Ich schluckte leer. Woher wusste er, dass wir in den Westen reisten? Vater hatte gesagt: »Sagt es niemandem, sonst sind wir geliefert.«
Ich war es nicht gewesen, Ehrenwort.
»Dein Vater hat es meinem Vater gesagt. Es heißt, ihr fahrt in die Berge und dann Richtung Süden, ans Meer.«
Das war bestimmt keine Falle. Das waren Vaters Worte gewesen. »Sagt allen, wir fahren in die Berge und dann Richtung Süden, ans Meer«, hatte Vater empfohlen.
»Jawohl, wir fahren in die Berge und dann Richtung Süden, ans Meer«, antwortete ich.
»Und was geht ihr in den Bergen machen?«
Vater hatte gesagt: »In den Bergen schauen wir uns die alten Klöster und die Bergseen an.«
»In den Bergen schauen wir uns die alten Klöster und die Bergseen an. Wollen wir gehen? Es wird kühl.« Ich stand langsam auf.
»Es wird kühl, gehen wir«, erwiderte er.
Unten auf der Straße gab mir Dorin die Hand. Wir gingen zurück zu unserem Wohnblock, diesmal über den Fußgängerstreifen.
»Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.«
»Ich dir auch.«
»Wir sehen uns in einem Monat wieder.«
»Bestimmt.«
Er ging in den Hauseingang B hinein, ich in den Hauseingang A. Der Fahrstuhl funktionierte. Gott sei Dank. Acht Stockwerke im Dunkeln hinaufsteigen macht keinen Spaß, wenn man an Außerirdische glaubt.
Unsere Hauseingänge wurden mit Buchstaben bezeichnet, so vergaßen wir das Alphabet nicht. Zum Beispiel B wie Bette Davis, B wie BB, jene mit dem Schmollmund, ich sah sie im Fernsehen, an einem Freitag. Freitags zeigten sie ausländische Filme. Brigitte Bardot lag auf einer Sonnenterrasse, später fuhr sie in einer Limousine, die Limousine von BB hatte einen Blechschaden, aber glücklicherweise geschah es in Frankreich und nicht bei uns, bei uns konnte man sich den Schaden nicht leisten, man brauchte Beziehungen dafür. Für die Reparatur.
Der Eingang hieß einfach B. Ein einziges B genügte. Man merkte, dass die Franzosen größere Mühe mit dem Vokabular hatten. Aber sie hatten auch nicht Frau Wygor als Lehrerin. Bei ihr nützten Beziehungen nichts. Frau Wygor war alt, hatte einen Bauch, davor trug sie unser Klassenheft, in dem jeder mit seinem vollständigen Namen aufgeführt war. Daneben standen unsere Leistungen in Ziffern und mit blauer Tinte. Meine Leistung im Fach »Rumänische Literatur und Sprache« ließe zu wünschen übrig, meinte sie vor den Sommerferien zur Klasse. Ich schluckte leer und wünschte sie auf der Stelle weg. Dazu trug sie den richtigen Nachnamen, auf den Buchstaben W können wir gerne in unserer Sprache verzichten.
Mit blauer Tinte konnte ich gut umgehen, wenn es galt, meine schulische Leistung zu verbessern. Ich brauchte bloß eine Rasierklinge und eine sichere Hand. Leider klappte es nur beim Diktatheft, das Klassenheft bewachten sie wie den Hammer und die Sichel. Ich hatte mich schon immer gefragt, ob es den Hammer und die Sichel wirklich gab, vielleicht vergoldet und unter Panzerglas. So wie es das erste Fahrrad und die erste Dampfmaschine gibt, gab es vielleicht auch den Hammer, mit dem der erste Revolutionär den letzten Reaktionär erschlagen hat. Die Begriffe hatte ich aus dem Geschichtsunterricht, dort brauchte meine Leistung keine Rasierklinge.
Ich hörte, der letzte Reaktionär sei noch nicht tot. Man nannte ihn Dissident, und er trug Steine herum, manchmal zwanzig Jahre lang. Mein Vater hatte es gesagt, und auch der Radiosender, den er nachts hörte. Am Tag und außerhalb unserer Wohnung war das Wort Dissident verboten. Mein Vater hat es verboten, und ich hielt mich gerne daran, ich wollte nicht, dass er Steine trug, bei seinen Rückenproblemen.
Einst fragte der Dicke in unserer Klasse – und Dicke gab es wenige, denn nur wenige hatten genug, um dick zu werden –, er fragte, wer der erste Revolutionär überhaupt gewesen sei. Marx sei es gewesen, meinte die Große mit den Zöpfen, die Streberin. Sie kriegte im Winter die meisten Schneebälle ab. Er habe die theoretischen Grundlagen schriftlich niedergelegt, und Lenin habe sie korrigiert und angepasst für die Revolution der Bolschewiken in unserem Bruderstaat. Die gibt nur an, dachte ich, die liest doch nur Enzyklopädien. Enzyklopädien lese ich auch, wenn ich etwas besser verstehen möchte: Bolschewiken, wissenschaftlicher Sozialismus, Kapitalismus. Ich aber gebe nicht an. Und überhaupt, überlegte ich, wie war wohl Lenin zu seiner Rasierklinge gekommen, um die Grundlagen der Revolution zu korrigieren?
Bei mir war es jedenfalls nicht einfach. Einerseits durfte die Klinge nicht zu scharf sein, damit im Diktatheft kein Loch entstand, wie damals beim Aufsatz über den glücklichen Arbeiter. Ich musste die Seiten herausreißen, den Text samt Fehlern neu schreiben, die roten Striche und Anmerkungen von einem Schulkameraden einfügen lassen, was mich das kleine Modell eines Maserati, das Herzstück meiner Autosammlung, kostete. Zumindest die Note konnte ich mir selber setzen, meinem Wunsch entsprechend. Mutter unterschrieb.
Andererseits musste die Klinge zugänglich sein, denn mein Vater bewachte sie, Marke Gillette, wie unsere Lehrer das Klassenheft. Weder durfte meine Mutter sie für ihre Beine gebrauchen noch ich für das Botanikheft. Da hinein klebte ich die Flora unserer Heimat, manchmal passte nicht die ganze rein, dann musste ich sie anpassen, so wie Lenin die Revolution. Die besten Klingen waren drei, vier Tage alt, mein Vater legte sie jeden Morgen säuberlich zurück auf das feine Verpackungspapier. Dort lagen sie den ganzen Tag. Ich wagte nicht, sie zu berühren.
Wenn die Rückgabe eines Diktats angesagt war und mein Vater eine neue Klinge auspackte, dann schlug ich Wurzeln auf der Türschwelle zum Badezimmer. Wie unsere Flora, die hatte ja auch dem Feind getrotzt, dem Deutschen. Sie hatte sich ihm in den Weg gestellt. So wurde es uns im Geschichtsunterricht beigebracht. Mein Vater, der zittert wegen des Blutdrucks, zitterte dann noch mehr, aber anmerken ließ er sich nur den Stolz, einen solch interessierten Sohn zu haben. Am dritten Tag interessierte mich die Klinge so sehr, dass ich wie er zitterte, doch ich versteckte die Hände in den Taschen und ließ nur den Wunsch erkennen, mich einmal so rasieren zu können wie er und fleißig üben zu wollen, ganz für mich alleine. So gehörte die Gillette-Klinge bald mir, eine zitternde Hand gab sie der anderen.
Wir informierten uns nicht nur im Geschichtsunterricht. TELEENCICLOPEDIA, die Informationssendung, kam jeden Samstag um zwanzig Uhr im Fernsehen zwischen der Ansprache des Obergenossen um neunzehn Uhr dreißig und »einer weiteren Folge der amerikanischen Serie Dallas« um einundzwanzig Uhr. Uns gefiel sehr, wie die Ansagerin amerikanisch sagte. Das hieß: nicht von hier, von dort, woher die Rasierklingen für mein Diktatheft kamen und der fremde Radiosender für meinen Vater. Dort gab es Drama und Whiskey alle paar Minuten und ein Haus, länger als alle unsere vier Hauseingänge A, B, C, D zusammen. Allen gefiel amerikanisch. Niemand war auf der Straße, alle waren in den Wohnungen, und es gab nur eine Frage: Wer hat auf J. R. geschossen?
Doch zuvor kam TELEENCICLOPEDIA: Sie zeigte die Fische, wie man sie aus dem U-Boot des Kommandanten Cousteau sah, und die Pyramiden ohne roten Stern darauf. »Vorläufig«, sagte Vater, »denn die Dritte Welt gehört auch bald den Russen. Die Dritte Welt, das ist dort, wo die Menschen noch ärmer sind als wir und wo sich Schlange stehen nicht mehr lohnt.«
Ich fragte mich, wieso ich in der Schule Englisch lernte, wenn die Russen sowieso bald überall sein würden. Und wieso leerten sich die Straßen nicht, wenn am Mittwoch die Ansagerin den russischen Film Die Rückkehr des Soldaten Aljoscha ankündigte?
Jedenfalls redete mein Vater viel. Nicht mit meiner Mutter, aber vor sich hin. Das hätte ihm einige schwere Steinbrocken bescheren können. Also sorgte ich vor. Ich sagte in der Klasse, der Obergenosse sei der erste Revolutionär gewesen, er habe ja dafür im Gefängnis gesessen, für die Revolution. Das trug meinem Vater bestimmt einige Pluspunkte ein, mir jedoch das Gelächter der Klasse. Aber ich wusste es besser. Der Obergenosse war doch der Stärkste, der hatte die Revolution ja sitzend gewonnen.
Die Pyramiden.
Seltsamerweise erinnerte mich dieses Wort nicht an die Ägypter, sondern an die schlanken Beine der Geschichtslehrerin, die sie übereinanderschlug, die weichen Waden dicht zusammengepresst. Sie verteidigte das Tor besser als der Torhüter unserer Stadtmannschaft. Die war in die zweite Liga abgestiegen, sie hingegen ließ keine Blicke durch. Was beim Fußball nach der Torlinie kommt, wusste ich. Dann ist der Ball im Netz, und alle schreien: »Tooor!« Bei der Madame wussten wir nicht so genau, was nach den Waden kam. Aber wichtig war es allemal, wenn sie das Tor so verteidigte.
Die Madame war für mich eine Madame, weil sie so was Französisches an sich hatte. Was das war, was Französisches, wusste ich nicht. Aber so sagten die Älteren, die sich in diesen Dingen auskannten. Ich glaubte es nicht ganz, denn BB war auch französisch, und die hatte von allem viel. Unsere Madame hatte von allem wenig, an den Hüften wenig, an den Schenkeln wenig, und auch dort, wo sich das Hemd der Mädchen wölbt. Um hindurchzusehen, hatten wir Brillengläser mit Quecksilber gebastelt, die Älteren meinten, die würden Stoff durchsichtig machen. Nur bei Madame wagten wir nicht, sie aufzusetzen, außer der eine, Tarhuna, der sonntags auf dem Gemüsemarkt Zigaretten und Jeans Marke Levi’s verkaufte. Aber der meinte, er habe nichts gesehen, wahrscheinlich trage Madame einen BH aus Blei. Das war bestimmt gelogen, denn Blei ist schwer und giftig, wir haben in der Chemie nachgefragt, Madame hingegen war leicht und ohne Makel. Ihre weiße Bluse war zuoberst aufgeknöpft. Manchmal kriegte ich rote Wangen davon.
Es hieß, Madame habe ein Herz für meinen Vater. Ich hatte nur ein Herz, und das schlug für Ariana. Auch mein Vater hatte nur eins, aber wofür sein Herz schlug, wusste ich nicht. Nicht für Fußball, nicht für Karriere, nicht für meine Mutter. Vielleicht wird es so mit der Zeit: Das Herz schlägt dann einfach.
Vater war unter anderem Verwalter unseres Wohnblocks. Sein Büro für die Verwaltungsarbeit war oberhalb unserer Wohnung, auf dem flachen, geteerten Dach. Es hieß, manche Frauen hätten sich mit ihm eingeschlossen. Ob das wahr ist, weiß ich nicht. Zum Abendessen kam er pünktlich.
An den lauwarmen Sommerabenden, wenn im Fernsehen die russischen Filme liefen, kamen die Leute, um die Wohnungsmiete zu bezahlen. Sie nahmen den Fahrstuhl und fuhren acht Stockwerke hinauf. Wenn der Fahrstuhl nicht wollte, gingen sie zu den anderen Hauseingängen, fuhren hinauf und kamen dann übers Dach in Vaters Büro, Hauseingang A. Ein richtiger Strom von Menschen, in zwei Richtungen, wie die Meeresströme in der Geografie, oben warm und unten kalt.
Die Mieter, die zu meinem Vater gingen, fluchten über die »verdammten Fahrstühle«, und dann gingen sie über zu den Autos, den Straßenbahnen, den Kühlschränken und so weiter. Offenbar funktionierten sie alle nicht in unserem sozialistischen Land. Und wenn sie funktionierten, wurden sie ausgeführt. Wer diese Geräte erfunden hat, hat nicht mit den Fluchwörtern unserer Sprache gerechnet.
Wir hielten die Balkontür offen und hörten mit. Über das Dachgeländer hinweg schwebten Gott, weibliche Genitalien und Haustiere in unsere Wohnung herein, getragen von kräftigen männlichen Stimmen. Auch ich wurde in der Schule mit Haustieren verglichen, mit Vorliebe mit Ochsen, also wusste ich, dass es nicht schmeichelhaft war, als Ochse zu gelten. Was die weiblichen Genitalien mit dem kaputten Fahrstuhl zu tun hatten, verstand ich nicht. Auch nicht, wieso sie Gott bemühten, wenn etwas nicht lief, da dieser gar nicht lebt und somit nichts kaputt machen kann. Das steht in unseren revolutionären Grundlagen, in jenen, die Lenin angepasst hat.
Die Leute, die vom Büro meines Vaters weggingen, fluchten auch. Meistens fluchten sie über die Kürzungen von Strom, Wasser und Heizung, die Vater ihnen zuvor angekündigt hatte. Sie fluchten nicht anders, jedoch weniger und nur so nebenbei.
Manchmal, nachdem alle Leute heimgegangen waren, klopfte es an die Bürotür meines Vaters. Es war der Milizmann unseres Viertels, und er erkundigte sich nach der Gesundheit von Vater. Was er eigentlich wissen wollte, hatte etwas mit dem Leben unserer Nachbarn zu tun. Manchmal läutete der Mann sogar an unserer Wohnungstür. Vater blieb höflich.
Bei uns wurde oft das Wasser abgestellt. Dann klopften alle an die Röhren. Je höher man wohnte, umso heftiger klopfte man. Manchmal, wenn wir es vorher wussten, füllten wir alle Gefäße auf. Manchmal reichte der Druck nicht bis zu den höheren Stockwerken. Dann läuteten die Telefone, dann ging ich in den fünften Stock duschen und meine Mutter in den sechsten, um Suppenwasser zu holen. Mutter sagte, Vater solle sich nichts bieten lassen, er solle das Wasserwerk anrufen. Vater rief an.
Als ich mich von Dorin verabschiedet hatte und in die Wohnung kam, fand ich Vater und Mutter in der Küche. Sie spielten das Flüsterspiel, wie es alle Erwachsenen in unserem Land kannten. Einer redet, so leise er kann, der andere schreckt alle paar Minuten auf und macht psst, psst. Das soll angeblich gegen fremde Ohren helfen. Ich wusste, dass sie unsere Abreise besprachen. Sie taten das seit einiger Zeit ununterbrochen. Noch ein Tag lag dazwischen. Ein ganzer langer Tag, und weil ich mir für diesen letzten Tag einiges vorgenommen hatte, ging ich früh ins Bett.
In der Nacht träumte ich davon, dass er tot war. Die miese Ratte, die meinen Liebesbrief an Ariana gestohlen und ihn der hässlichen Geografielehrerin mit dem gleichen Vornamen zugesteckt hatte. Er war sogar mausetot und begraben unter einem Konservenregal. Ich schaute hin und steckte eine Konserve in die Tasche. Ich flog dann durch ein Fenster in unsere Wohnung hinein und sah Vater und Mutter, die leise miteinander sprachen. Ich wusste, dass sie Verbotenes besprachen. Dann war der Traum zu Ende.
Das Verbotene war bei uns das, was sie nie in der Tagesschau brachten. Die Erwachsenen drehten dann das Radio lauter, oder ihre Stimmen wurden leiser. Was sie sagten, hatte damit zu tun, dass es in unseren Geschäften nur zwei, drei Konservensorten gab, auf vielen Metern ausgebreitet. Oder dass andere Völker, die Schweizer zum Beispiel, viel mehr als wir hatten. Obwohl es von allem so viel gab, herrschte immer Ordnung, und sie verloren nie die Übersicht.
Die Tagesschau berichtete immer über andere Dinge: über die Chormusik, den Führer, die Ernte. Es war die Ernte, die in den Konserven war, von denen der Dieb in meinem Traum erschlagen wurde. Die Tagesschau fing immer pünktlich um neunzehn Uhr dreißig an, so pünktlich wie die Schulglocke, auf die beiden war Verlass. Um neunzehn Uhr einunddreißig schaltete Vater für gewöhnlich den Fernseher aus. Strom sparen, hieß es, aber ich wusste es besser: Er mochte das Gesicht des Führers nicht. Er sagte es oft mit leiser Stimme, immer dann, wenn ich weggehen musste. Aber die Türen hatten Ohren, und das waren meine. Ich wusste auch, dass mein Vater gut und lange fluchen konnte und dass er dabei nie den Faden verlor. Wenn er aus der Küche kam, hatte er einen Kopf, der so rot war wie das Tomatenmark auf sechs Meter Länge, unter dem der Verräter in meinem Traum lag. Könnte Gesichtsrot töten, dann wäre der Führer tot, mausetot sogar, und mein Vater ein Mörder wie ich in meinen Träumen.
Dabei wäre die Angelegenheit mit der Tagesschau einfach zu lösen gewesen. Es hätte genügt, meine Mutter zu den Schweizern zu schicken, die sie mit ihrem Lieblingssatz »Du sollst keine Geheimnisse vor mir haben« überzeugt hätte, ihre geheimen Dinge, die sie immer ordnen mussten, unserer Tagesschau zu verraten. Dann hätte die Tagesschau darüber berichtet, mein Vater hätte es erfahren und wäre nicht mehr in der Küche rot angelaufen. Ich hätte endlich die Tagesschau zu Ende sehen und herausfinden können, wie sie die Tomatenernte in die Büchsen füllten, durch die der Briefedieb in meinem Traum starb.
Es war nicht einfach, in einer Familie aufzuwachsen, die so viel Strom sparte. Zum einen konnte man nie zu Ende fernsehen. Zum anderen ging das Licht nach einem unbekannten Zeitplan aus, den nur mein Vater kannte. Dann wurde Radio gehört, denn dort wurden die Geheimnisse der Schweizer in unserer Landessprache erzählt. Ich glaube, dass auch andere Eltern Strom sparten, denn in unserer Nachbarschaft gingen die Lichter nach dem gleichen Zeitplan wie bei uns an und aus.
Ich hatte einmal einen Freund gefragt, was sie denn machten, im Dunkeln. Er antwortete: »Karten spielen. Und was macht ihr?«
»Wir schauen euch zu«, antwortete ich.
Karten spielen war bei uns eine Art Volkssport, man brauchte dafür ein Radiogerät, den Daumen und den Zeigefinger, um den gewünschten Sender zu suchen, und dann ging das so: Zwischen zehn Uhr abends und Mitternacht war das Ohr meines Vaters mit dem Lautsprecher verwachsen. Er filterte die Stimmen aus der Geräuschsuppe heraus, die Suppe kam aus dem All, und ich fragte mich oft, wie sie in unser Wohnzimmer fand. Am Gerät gab es kleine grüne Punkte, die tänzelten, so wie die Stimmen sprachen. Wenn Mutter aus dem Opernhaus heimkam, durfte sie sich nur in den Sendepausen bewegen, sie wusste Bescheid und stellte alles schon am Nachmittag bereit.
Am Dienstag und Freitag durfte ich länger aufbleiben, dann war die politische Sendung dran, und die Stimmen aus dem All sagten, der Führer sei schlecht und die Ernte auch und so ziemlich alles, von dem man uns in der Schule beibrachte, dass es gut sei. Vater nickte zustimmend. Doch Vater ging schon lange nicht mehr in die Schule, er wusste nicht, dass der Führer für unser Wohl im Gefängnis gewesen war und sich persönlich tagtäglich um die Ernte kümmerte, die in die Büchsen hineinkam. Vater lief viel lieber rot an, wenn er den Obergenossen hörte.
Wenn die politische Sendung kam, froren wir alle ein, wo wir gerade waren. Vater mit dem Pullover über dem Kopf, Mutter mit dem Teller in der einen und dem Geschirrtuch in der anderen Hand und ich auf der Kloschüssel. Manchmal blieb ich bis zu einer halben Stunde drauf, denn die Badezimmertür quietschte, und die Spülung spülte zu laut, es wurde noch keine für politische Sendungen erfunden. Nach einer halben Stunde atmete mein Vater wieder ein, Mutter stellte den Teller ab, ich spülte runter, dann kommentierte Vater, und ich freute mich, so einen klugen Vater zu haben, der so kommentieren konnte wie die Lehrer in der Schule. Manches, was er sagte, ergab für mich keinen Sinn, da ich nirgends auf der Straße Dissidenten sah, und die Ernte war sicher nicht so schlecht wie ihr Ruf, wenn damit so viele Konserven gefüllt werden konnten.
Mutter sagte früher oft, dass Vater dafür sorgen solle, dass wir aus dem Land ausreisen könnten. Es sei die reine Irrenanstalt.
Über die Irrenanstalt wusste ich nichts, aber ich war der Meinung, dass Vater weiterreden sollte. So hätten er und Mutter ein Gesprächsthema gehabt und hätten sich nicht immer zwischen Abendessen und der politischen Sendung im Wohnzimmer böse Blicke zugeworfen. Den miesen Kerl hingegen, der meinen Brief gestohlen hatte, hätte ich liebend gerne erschlagen. Oder noch besser, man hätte ihn zu den Schweizern schicken sollen. Die hätten dann sehen können, was sie mit ihm anfangen wollten.
Ich erwachte unruhig. Das war kein Wunder nach einem solchen Traum. Noch ein Tag, dann wäre Mutter zufrieden. Wir würden die Irrenanstalt verlassen haben.
Am Abend würde ich Ariana treffen.
Es war Sonntagmorgen.
So wie an warmen Sommerabenden herrschte Ruhe in der Stadt. Auf den Straßen war mehr Schatten als Licht, aber das Licht holte auf.
Der Sonntag roch bereits am Morgen nach den Zwetschgenknödeln von Großmutter, und ich fühlte schon ihre Handflächen auf meinen Wangen, wenn sie mich am Mittag begrüßen würde. Ich wollte nur schnell vorbeischauen, denn es war der letzte Tag vor der Abreise, und ich hatte mich noch vom Zentralpark und von Ariana zu verabschieden.
Vater war frühmorgens weggefahren. Nicht zum ersten Mal in letzter Zeit. Er hatte nachts immer wieder Gepäck weggetragen, hatte sich jedes Mal leise aus der Wohnung herausgeschlichen und war dann langsam zum Auto gegangen. Das hatte ich von unserem Balkon aus beobachtet. Er hatte sich bemüht, langsam zu gehen, wie ein Mann, der nichts zu verbergen hatte und nur zufällig zu später Stunde unterwegs war.
»Ich muss mich bemühen, wie ein Mann zu gehen, der nichts zu verbergen hat und nur zufällig zu später Stunde unterwegs ist. Sonst denunziert uns womöglich jemand, und sie nehmen unseren Wagen und den Anhänger unter die Lupe«, hatte er gesagt.
»Und dann?«, hatte ich gefragt.
»Und dann was?«
»Was geschieht dann?«
»Wenn sie alles entdecken, was ich darin versteckt habe, kannst du deinen Vater alle zwei Wochen im Gefängnis besuchen und ihm Lebensmittel mitbringen. Weißt du, unsere Gefängnisse sind nicht wie jene Gefängnisse der Amerikaner, mit Fernseher und so weiter.«
»Vater, würdest du dort sterben?«
Vater war verwirrt.
»Sterben? Keine Ahnung. Aber Prügel würde ich bekommen. Und wie.«
»Was würden sie dir denn für eine Strafe geben?«
»Weiß nicht, einige Jahre bestimmt, aber das wäre nicht alles. Du und Mutter hättet’s auch schlecht. Alle würden es wissen und euch meiden. In der Schule hättest du Probleme damit und Mutter im Opernhaus. Jede einzelne eurer Bewegungen würde beobachtet werden. Aber ich höre lieber auf damit, Genosse, sonst bekommst du nur Angst.«
»Vater, würden uns Doina und Liviu auch meiden?«
»Gut möglich, gut möglich, man würde es ihnen zumindest empfehlen. Sie würden’s bedauern und tun, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf Menschen ist eh kein Verlass, wenn es um Prognosen geht. Ach, lass uns nicht an das Schlimmste denken.«
»Ich glaube nicht, dass das Schlimmste wirklich eintrifft, wenn man daran denkt. Ich habe auch schon gedacht, dass Ariana …«
»Ariana? Aha! Da ist die Katze aus dem Sack. Deshalb ist unser Genosse so anders in letzter Zeit.«
Vater strahlte wie ein Maikäfer, und das war mir peinlich. Ich schluckte leer.
»Ariana ist eine Schulkameradin …«
»Hm.«
»Ja, ehrlich, nur so eine Schulkameradin …«
»Hm.«
»Hm.«
»Habt ihr schon …?«
»Vater, hör auf!«
»Gut, in Ordnung.«
Wir schwiegen, und Vater schaute mich dauernd von der Seite an. Auf jener Seite lief mein Ohr rot an. Das hat was mit Scham zu tun. Mutter hatte es mir erklärt. Wie immer umständlich.
»Vater, erzähl mir lieber, wer die Oros sind!«
»Die Oros? Bekannte. Halten den Mund. Gute Menschen. Sie wollen selber raus. Ungarnstämmige. Sie wohnen am Stadtrand und haben einen gut abgeschirmten Garten.«
»Bringst du unser Gepäck immer zu ihnen?«
»Ja. Dort bastle ich an unserem Anhänger herum, am doppelten Boden, weißt du? Am letzten Tag, da muss ich ihn nur noch füllen.«
»Vater, hast du Angst?«
Inzwischen war Mutter ins Zimmer gekommen. Man redet nicht über Angst in Anwesenheit von Frauen. Deshalb wohl gab mir Vater darauf keine Antwort.
Ich schaltete den Fernseher ein. Am Sonntagmorgen zeigten sie immer Daktari oder Flipper. Danach kam die Armeesendung. Die schauten alle freundlich in die Kamera hinein, und man hatte gar keine Angst vor der Uniform. Wir hatten eine tolle Volksarmee mit strahlenden Gesichtern und sauberen Panzern. »Unsere Jungs setzen sich ein«, sprach ein Leutnant ins Mikrofon. Es war ein anderer Leutnant als derjenige mit der Faust im Bauch seiner Frau. »Heute, zwei Wochen vor unserem Nationalfeiertag, setzt die Armee alles daran, um die letzten Vorbereitungen für das große Fest des Volkes erfolgreich abzuschließen. Die Forderungen des geliebten Führers sollen vollständig erfüllt werden. Unsere Armee kümmert sich darum: um die Ernte des Volkes, die Straßen des Volkes und um sein gesamtes Wohlergehen. Sogar für die Gesundheit der Menschen sorgen unsere Jungs.« Es folgte ein Dokumentarfilm über den Einsatz junger Offiziere im Gesundheitsdienst.
Ich wurde in einem Land geboren, in dem die Gesundheit der Genossen Priorität hatte. Genossen waren alle, die untereinander gleich waren. Ein bisschen gleich zumindest. Jene, die es nicht waren, waren nicht unter uns. Dissidenten zum Beispiel.
Auf die Gesundheit wurde geachtet. Es wurde regelmäßig marschiert und gesungen, gesungen und »Es lebe hoch!« gerufen, »Es lebe hoch!« gerufen und die Ernte eingebracht und dann weiter marschiert. Es gab bestimmte Tage, an denen mehr marschiert wurde als sonst. Der Geburtstag des Obergenossen, der Tag der Arbeit, der nationale Feiertag, da hatten wir uns von der faschistischen Besetzung heldenhaft befreit. Die Faschisten waren andere als wir. Sie kamen aus dem Westen, wir wollten sie nicht, da erhoben wir die Waffen gegen sie. Das erzählte unsere Geschichtslehrerin. Die mit dem komischen Funkeln in den Augen, wenn Vater zum Elternabend ging. Wenn das große Fest des Volkes losging, marschierten zuvorderst die Kleinen, genannt Heimatfalken, danach wir, die Pioniere, dann die Armee, dann die Sportler, dann die anderen. Die Stadt duftete nach gebratenem Fleisch, und an langen Holztischen feierten jene, die schon marschiert waren.
An unserem Nationalfeiertag war ich immer besonders glücklich. Wegen des Bratenduftes, der zu unserem Fenster aufstieg. Ich lief auf den Balkon, meine Nasenflügel dehnten sich wie diejenigen des braven Stieres Ferdinand, wenn er Blütenblätter riecht. Blut mag er nicht. Ich liebe Zeichentrickfilme. Auf der Hauptachse, die den Nordbahnhof mit dem Opernplatz verband, waren die schmalen Tische mit weißem Papier überzogen, das Papier hatte grüne Senfflecken. Braune Bierflaschen. Marschiert wurde entlang der Hauptachse, vorbei an der marmornen Tribüne gegenüber dem Zentralpark.
Wir versammelten uns immer rechts davor und zogen nach links. Auf der Tribüne saßen wichtige Genossen, auf ihrer Höhe flatterten die Fahnen heftig, und es wurde »Hurra!« und »Hoch lebe die Partei!« gerufen. Danach gingen wir wieder auseinander. Ich eilte immer nach Hause, um die Jagdflugzeuge im Fernsehen zu sehen. In der Hauptstadt marschierte nämlich die Armee, die Soldaten hoben alle gleichzeitig das linke Bein, dann das rechte Bein, und auf der Höhe der Tribüne drehten alle den Kopf in die Richtung des Obergenossen. Die Gewehre hielten sie vor der Brust, sie schienen Spielzeuge zu sein. Die Panzer hatten Lichtflecken von der Augustsonne, die blendeten. Es sah alles so federleicht aus. So hatten wir bestimmt auch die Faschisten vertrieben.
Die Fahnen in der Hauptstadt waren rot. Parteifahnen.
Aus dem nachfolgenden Menschenzug lösten sich immer zwei Heimatfalken, sie liefen die Haupttribüne hinauf und überreichten dem Obergenossen und seiner Frau Blumensträuße. Er freute sich darüber und winkte dem Volk zu. Er nahm einen von ihnen auf den Arm.
Die Haupttribüne in der Hauptstadt war viel höher als unsere. Alles war anders. Dort wohnte der Obergenosse. Es wurde erzählt, dass er unsere Stadt mied, weil wir zu progressiv waren. Dabei ließen wir ihn besonders laut hochleben. Doch der Obergenosse war auch ein viel beschäftigter





























