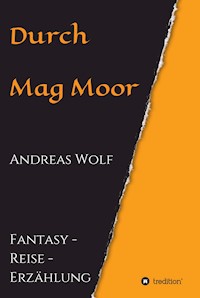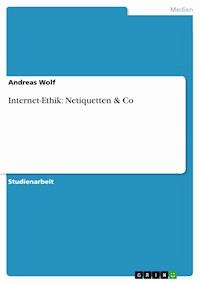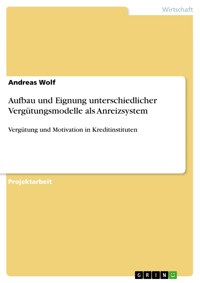Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt, sprich: das Universum mit seinen uns mittlerweile ziemlich vertrauten Gesetzen, bleibt uns letztlich völlig unverständlich, solange der Sinn des gesamten Unternehmens im Dunkeln verharrt. Wir sehen also zumeist nur Z 1, den uns bekannten empirischen Zustand. Die Frage nach dem Weshalb?, Wodurch?, Woher? und Wohin? bleibt so lange völlig ungeklärt, bis man nicht den uns völlig unbekannten, allerdings komplementären und daher auch näherungsweise begreifbaren Zustand Z 2 theoretisch zu erfassen sucht. Die vorliegende Schrift geht über eine Diskussion des Zeitbegriffs, der Funktion des Lichts sowie der Existenz jenen gar nicht so düsteren Weg von der Physik zur Metaphysik. Und beantwortet dabei auch die uralte Frage des Subjekts, nämlich jene, was der Sinn des individuellen Lebens ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Die Zeit
Interessante Folgen aus einem bräsigen Beginn.
Grand Design.
Sein und Zeit.
Heidis Welt.
Das Licht
Die Hinterlist der Dinge.
Das Offene.
Genesis.
Bestandsaufnahme.
Der Gehörnte tritt auf.
Inertialsysteme.
Der Quantensprung.
Ein verblüffend einfacher Schluss aus verwirrend vielen
Theoremen.
Das Subjekt
Hochwertige Biomassen.
Neuronale Schwundstufen.
Oikeiosis.
Die ÜLG im Härtetest.
Eine weitere Nachtfahrt nach Lissabon.
Schopenhauer, Schelling und der Dude.
Vogelkundliches.
Die große Zahl.
Die unendliche Geschichte.
Super-Mario und der Zauberer.
Die transzendentale Einheit der Apperzeption.
Die hohe Zeit.
Jetzt zieht Leutnant Jünger seinen Mantel aus.
Alltag und Aura.
Das reale Reale.
Schrödingers Katze.
Das Ethische
Nachwort
„Das ist die Unschärferelation. Sie beweist, dass wir nie wissen können, was geschieht.“ „Ich aber weiß, was geschieht. Und wie erklärst du dir das?“ (Es folgen physikalische Erläuterungen.) „Das mag alles sein. Aber nur in dieser Welt. Ich gebe zu: Es ist clever, subtil, aber letzten Endes überzeugend.“ Gespräch zweier Physiker in „A serious man“, Coen-Brüder (2009), wobei der Zweite bereits tot ist.
I. Einleitung
Die Menschen, schreibt Douglas Adams, werden geboren, dann sterben sie und dazwischen verbringen sie die Zeit mit dem Tragen von Digitaluhren.
Offensichtlich besteht der laue Witz dieser Bemerkung darin, dass in der Zeit zwei Ebenen kollidieren, zum einen die reale Zeit mit ihren Stunden und Tagen, zum anderen die Zeitlichkeit selbst, nämlich die der Existenz. Diese Schrift möchte das Phänomen näher betrachten und stellt daher die Zeit, den Menschen, sprich: das Subjekt sowie das Licht, das mit seinen sehr einfachen und diskreten und vor allem digitalen Zuständen des An und Aus eine überraschende Funktion einnehmen wird, in den Mittelpunkt der Betrachtung. Philosophisch interessant sind die Begriffe also, weil sie Grenzbegriffe sind. Wir stellen uns bei diesem großtönenden Terminus bequemerweise ein kleines Zollhaus im Gebirge vor, das derart gebaut ist, dass der eine Teil des Gebäudes in dem uns bekannten Land liegt, während der andere Teil sich bereits im Nachbarland befindet, und setzen, um das Bukolische auch richtig schön dick aufzutragen, eine Schranke mitten in den Weg. Wir benutzen bewusst dieses behäbige Bild, nämlich als Verneigung vor Ernst Jünger und seinem sehr anschaulichen Beispiel einer Zollstation (Das abenteuerliche Herz, zweite Fassung), das wir, der Verständlichkeit wegen, frei übernehmen, und hoffen, dass es uns noch gute Dienste leisten wird. Namentlich das der Schranke.
Die Begriffe Zeit und Licht sind philosophisch unbelastet. Der Begriff des Subjekts ist hingegen schwer diskreditiert und daher erläuterungsbedürftig.
Indem wir den Begriff des Subjekts stark machen, unternehmen wir weder einen „transzendentalen Napoleonismus“ noch wollen wir uns „schönseelisch“ in Empfindungen verlieren. Auch bedeutet der Rückgriff auf subjektive Erfahrungen keineswegs, dass diese nun singulär wären, wie überhaupt das besondere Subjekt ein Pleonasmus ist: Jedes Subjekt ist besonders (indem es seine eigene Welt ausbildet). Einmalig sind wir alle (oder waren es zumindest).
Gleichwohl wird der Fortgang der Erläuterungen den Begriff des Subjekts ins Zentrum stellen. Deswegen sei den Einwänden gleich die Spitze genommen. Wir halten ausdrücklich gegen das verbockte Fichtesche Ich, das angeblich die Welt setzt (was ontologisch sehr gewagt, real völlig verrückt und noch nicht einmal psychologisch richtig ist) sowie gegen den ziemlich liebenswerten Individualanarchisten Stirner (Der Einzige und sein Eigentum) und erklären, um gleich zum Ende einer verqueren Scheindiskussion zu kommen, dass der Solipsismus zwar einen richtigen Gedanken ausspricht, ihn aber falsch verortet. Es gibt unzählige Argumente gegen den Solipsismus (der also offensichtlich ein zähes Eigenleben zu haben scheint). Am augenfälligsten ist das bekannte Privatsprachenargument von Wittgenstein: Das Ich kann sich nur und allein im allgemeinen Medium einer überpersönlichen Sprache verstehen oder missverstehen. Wir wollen also diese eigentümliche Doppelstruktur von wahrem Gedanken und völlig falscher Ausführung wie folgt markieren: „Was der Solipsismus meint, ist ganz richtig, nur lässt es sich nicht sagen, sondern es zeigt sich“ (Wittgenstein, Tractatus). Was sich da zeigt, werden wir noch genauer sehen. Es ist auf jeden Fall eine erkenntnistheoretische Pointe.
Auch wir wollen das Hohelied der Liebe (Paulus) singen. Jede Form der Liebe, sei es im „vollen Reden“ (Lacan), sei es in der ruhigen Anschauung, sei es im Verständnis, ist erotisch im weitesten Sinne, und dieses Erotische wiederum ist nichts anderes als eine Annäherung, wobei die Zeugung (oder Empfängnis) die höchste Form der Annäherung ist. Wo aber die Annäherung preiswürdig ist, muss die Distanz so etwas wie die Geschäftsgrundlage sein. Eine merkwürdige, sehr eigentümliche Geschäftsgrundlage. Denn das Andere erscheint immer auch seltsam operettenartig, anziehend zwar, aber doch wie schaumgeboren, und der Andere irgendwie soubrettenähnlich (oder pagenhaft), auf jeden Fall erscheint er ontologisch halbseiden und ungeerdet, er hat, so denken wir, keineswegs die Seriosität des Seins (Thomas Mann), die wir glauben für uns selbst beanspruchen zu dürfen, und die wir uns doch glatt zusprechen würden (allerdings nur privatim und in stillen Stunden, denn sonst gäbe es – erstaunlicherweise – echten Ärger).
Deine Schmerzen sind mir nach dem Muster meiner Erfahrungen erlebbar, deine Worte nur nach meinen Konnotationen anschaulich (weshalb, so Kant, das russische Wort für Buch, „kniega“, für jeden Nichtrussen ein leeres und reines Geräusch bleiben muss), deine Welt wird sich meiner Welt irgendwie akkommodieren müssen, sofern sie Eintritt erlangen will. Das sind banale Beispiele und somit gradueller und empirischer Art. Der Tod hingegen ist ein nichtbanales Beispiel, ja kaum noch ein Beispiel zu nennen, er ist keineswegs empirischer, sondern metaphysischer und, wie sich gleich zeigen wird, kategorischer Art.
Dein Tod ist ein empirisches Erlebnis und somit ein Verlust. Die Welt ist ärmer geworden. Das Bild verlöscht. Mein Tod ist kein empirisches Erlebnis, sondern wesentlich mehr, nämlich das Ende jeglicher Erlebnisse und auch jeglicher Empirie. Es ist, streng genommen: ein Ereignis. Der Rahmen bricht. Hier ist die Welt nicht ärmer geworden, sondern vollständig verloren. Während dein Tod ein Verlust in der Welt ist, ist mein Tod der Verlust der Welt selbst. Das ist ein schwerer kategorischer (genauer gesagt: existentialer) Unterschied. Diesen entscheidenden Unterschied gilt es klar zu markieren, um nicht in heillose Verwirrung zu stürzen. Philosophisch gesehen kann man sich auf den Tod allerdings immer verlassen.
Der Tod ist eine antiobjektivistische „Naturkonstante“ innerhalb einer objektivistischen Welt. Ja, mehr noch: Er meldet nachdrücklich Zweifel an der „Weltlichkeit der Welt“ (Heidegger) an und zeigt mehr oder weniger frech, wir möchten fast sagen: katzenhaft frech, ihre phänomenale Seite. Wir benutzen den Begriff der Phänomenalität zunächst einmal in seinem landläufigen, allerdings auch abgründigen Sinn, nämlich als Erscheinen, womit noch völlig unklar bleibt, wer oder was erscheint und vor allem: ob dieses Erscheinen ein Aufscheinen im Sinne eines Zeigens und gar Offenbarens oder als Scheinhaftigkeit im Sinne der Täuschung zu verstehen ist oder womöglich beides zugleich, nämlich derart, dass die Täuschung nichts anderes als die Offenbarung selbst sein könnte. Wir halten eine – spätere – Darlegung keineswegs für reine Scholastik, denn die Welt selbst hat diese nicklige und – fußballerisch gesagt – sehr unschön zu bespielende Struktur, so dass Klagen und Stoßseufzer letztlich an die Wirklichkeit selbst zu richten sind.
An sich ist die Welt von höchster Wunderhaftigkeit und besitzt keineswegs jenes glatte touchpadartige Bedienerfeld, also eine vermeintlich objektivistische Oberflächenstruktur, die im Vollzug des Lebens fortschreitend verlängert und zugleich dabei auch immer stärker verschleiert wird. Man kann hier in einer rhetorischen Zuspitzung der Verhältnisse von einem designten Seinsverhältnis sprechen, was natürlich eine famose Sache ist, denn nur so können wir als Schnupperkursteilnehmer des Lebens die Dinge ziemlich vereinfacht sehen, in ihnen recht geläufig handeln und gleichsam auf einem Ozean von Fragen leichthändig navigieren und uns dabei auch noch als Kapitän aufspielen, wir, die wir ja bestenfalls Leichtmatrosen und postmoderne User sind. Das Ganze ist also, kurz gesagt, eine doppelte Simulation, recht nett zu befahren, aber natürlich grundfalsch, grundfaul und vor allem abgründig. Denn ob wir überhaupt in einer Art von kumpelhafter Nähe mit der Welt und namentlich mit dem sogenannten Sein auf einem vermeintlichen Duzfuß stehen, und wenn ja, wie und vor allem warum, scheint uns doch einer näheren Betrachtung wert.
Wir möchten der Einfachheit halber diese Überlegungen in den Bereich des mittleren Erstaunens setzen. Als großes Erstaunen bezeichnen wir hingegen, dass es eine Welt überhaupt gibt, dass, ungeachtet näherer Bestimmungen, etwas da ist und nicht vielmehr nichts, was, rein formal betrachtet, die bei weitem eleganteste Lösung wäre. Beide Phänomene sind hochgradig unverständlich und absolut erklärungsbedürftig (wir wüssten beim besten Willen nicht, was noch erklärungsbedürftiger wäre). Man kann beides als metaphysische Fragen bezeichnen (und somit sachlich abweisen), wohingegen das kleine Erstaunen alltäglich ist und somit in den Bereich der Empirie fällt, nämlich das Phänomen der Zeit, das in diskreten Übergängen die hier angedeutete (metaphysische) Da/Fort-Problematik (empirisch) permanent wiederholt und somit einen an sich sehr rätselhaften Vorgang bis an die Grenze des Selbstverständlichen banalisiert.
Wir sind nachdrücklich der Ansicht, dass in der öffentlichen wie auch wissenschaftlichen Behandlung dieser Problematik - mitsamt ihrer Tendenz zur kompletten Bagatellisierung - ein schwerer und daher notwendiger Verkennungsmechanismus wirksam ist, der, in einer altmodischen Terminologie gesagt, dem Begriff der Verdrängung vollständig entspricht, einer Verdrängung, die vielleicht nichts anderes als die Kulturleistung selbst sein könnte. Wir halten das sachliche Desinteresse an dieser Fragestellung für absolut konstitutiv, um überhaupt so etwas wie „Welttüchtigkeit“ zu erlangen, und betrachten die Zurückweisung dieses Problems, das zwischen innerem Augenrollen und offenem Kopfschütteln liegen mag, als eine Fluchtbewegung, deren Gründe wir im Fortgang ausfindig machen möchten.
II. Die Zeit
Interessante Folgen aus einem bräsigen Beginn.
Wir definieren die Zeit ganz traditionell als Maßstab für die Bewegung (wörtlich: Veränderung) der Dinge im Raum (Aristoteles, Physik). Ein Apfel (Ding) fällt (Bewegung) vom Baum zur Erde (Raum), und zwar in einer bestimmten Zeit. Für Bewegung können wir umstandslos den Begriff der Kausalität einsetzen, denn Bewegung ist letztlich nichts anderes als Kausalität, hier allerdings: notwendige Bewegung. Interessant an der Definition des Aristoteles ist, dass beide Terme deckungsgleich und somit funktional vertauschbar sind. Wir können also sagen: Zwei Sekunden sind gleich dem Fall des Apfels von einem bestimmten Baum, wie auch: Um zu wissen, was zwei Sekunden sind, brauchst du nur den Fall des Apfels von einem bestimmten Baum zu beobachten. Die Zeit ist also nur der Maßstab, umfasst aber die Bewegung (Kausalität) der Dinge im Raum, namentlich: ihre Geschwindigkeit. Wenn wir also sagen: Es ist später geworden, müssten wir also korrekt sagen: Die Bewegung der Dinge im Raum war komplexer als vermutet, was natürlich die erste und kurze Aussage implizit immer schon mit meint.
Wir wollen die Geschichte einer Philosophie der Zeit nicht unnötig breittreten und beschränken uns auf einige Weiterungen, Erneuerungen und Umwälzungen des bequemen aristotelischen Zeitbegriffs. Zentral ist hierbei Augustinus, der in seinen Bekenntnissen (Confessiones) den Zeitbegriff a) theologisiert, b) kasuistisch macht und c) einige sehr erstaunliche Gedanken hinzufügt. Theologisch ist der Gedanke, dass die Zeit gleichsam die Geschäftsbedingungen des Irdischen darstellt, eine Art AGB, die man, ähnlich einer Facebook-Mitgliedschaft, vielleicht etwas fahrlässig unterschrieben hat, um überhaupt dabei zu sein. Die Zeit ist der Modus des Irdischen. Der Zeitrahmen selbst besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist der abgelebte Modus des Zeitlichen, die Zukunft ist das vage Ausstehende und nur die Gegenwart, hier genau: der Augenblick, hat eine materielle Qualität. Kasuistisch wird die augustinische Argumentation jedoch insofern, als genau dieser Augenblick rasierklingendünn zwischen einem unendlichen Nichts der (idealisierten) Vergangenheit und einem unendlichen Nichts der (vagen) Zukunft steht.
Diese Argumentation ist nicht völlig unproblematisch, und zwar aus einem einfachen psychologischen Grund. Wie überhaupt nur die Zeit für den auffällig wird, der sie verloren hat, ist die formale Kasuistik des Jetzt ein vorderhand geradezu klassisches Degenerationsphänomen. Ein Leben nämlich, das sich sinnvoll glaubt oder es gar ist, würde so überhaupt nicht fragen. Zudem sind derartige Überlegungen vor allem Reflexionsbestimmungen (Hegel, Phänomenologie des Geistes), also abstrakte Hirnakrobatik, für die Hegel grundsätzlich das bösartige Wort des (gegenstandslosen) Räsonnements bereithält. Wir sehen aber auch die Stärken des Arguments deutlich. Denn immerhin könnte es ja sein, dass sich in der realen und vorderhändigen Gegenstandslosigkeit des reinen Jetzt-Moments etwas sehr Wesentliches versteckt hält, und da wir es im Weiteren sehr häufig mit Verbergungsphänomenen zu tun bekommen werden – eine extrem fiese Struktur dieser Welt, das können wir jetzt schon sagen – wollen wir hier nicht zu großsprecherisch sein.
Augenfällig jedenfalls beinhaltet die Philosophie des Augenblicks zwei interessante Denkfiguren. Augustinus, oder wie wir ihn jetzt korrekt als Heiligen Augustinus bezeichnen wollen, erkennt zwei bedeutende Momente im Augenblick. Erstens, den des Ereignisses, den man nach Grimms Wörterbuch auch als „Eräugnis“ bezeichnen kann, nämlich als Sichtbarmachung (der Dinge durch das Subjekt) und Sichtbarwerdung (des Subjekts durch Gott). Zweitens erlebt das Subjekt streng genommen nur den Augenblick. Sein Lebensweg mag durch Räume und Zeiten führen, wie es ihm beliebt, die Jahre und Länder mögen fern sein, wie sie wollen, das Subjekt, streng genommen, lebt nur den Augenblick, alles andere sind vage Mutmaßungen oder vom Efeu der Erinnerung umwucherte Phantasmagorien des Gewesenen, kurz und mit einem Ausdruck gesagt, der eindeutig nachaugustinisch ist: Kopfkino. Und so, wie das Subjekt im Verzehr der Zeiten immer im Jetzt ist, liegt – nach Augustinus – auf seinem Treiben auch immer das göttliche Licht (oder: Spotlight) des mitwandernden himmlischen Auges im Ereignis, das wir als Eräugnis hergeleitet haben.
Wir sprachen vom Heiligen Augustinus, und das vor allem in Hinsicht auf folgendes Phänomen: das des Zeitpfeils. Mit der Erschaffung der Welt habe Gott einen Mechanismus in Gang gesetzt, nämlich den der völligen Irreversibilität der Zeit. Während der Raum (zumindest in einem alltäglichen Verständnis) anspruchslos zu bereisen ist, mit Hin- und Rückfahrt, lässt die Zeit keinerlei reversible Operationen zu. Man kann hier vom starken Atem Gottes sprechen oder auch davon, dass das Paradies verriegelt sei „und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist“ (Kleist, Über das Marionettentheater), doch das sind zunächst einmal literarische Metaphern, fast noch Redensarten. Wir wollen sachlich bleiben und zweierlei festhalten: Boltzmanns Gesetze der Thermodynamik haben im 19. Jahrhundert diesen erstaunlichen Grundgedanken physikalisch bestätigt. Dass Zeit überhaupt vergangen ist, lässt sich, kosmologisch gesehen, neben der abnehmenden Temperatur des Universums nur noch daran erkennen, dass die Dinge irreversibel komplexer, sprich: entropischer werden, wodurch auch erklärt wird, dass ein auf den Boden gefallenes Wasserglas sich nie mehr zusammenfügen lässt, es ist nämlich, etwas blöde gesagt, Zeit hindurchgeflossen. Und das bedeutet aber auch: Zeitreisen sind im Materiellen unmöglich. Denn wären sie möglich, bräuchten wir uns keine Gedanken über einen Besuch in unserem Mittelalter zu machen, sondern wären längst unsererseits schon von zukünftigen Menschen auf Reisen in ihr Mittelalter besucht worden. Wir werden es also weiterhin mit dem Träumen versuchen müssen.
Grand Design.
Die erstaunlichste Neufassung des Zeitbegriffs unternimmt Immanuel Kant. Für ihn sind Zeit und Raum Anschauungsformen, die es ermöglichen, überhaupt etwas zu erkennen. Diese Anschauungsformen können selbst nicht empirisch sein (weil sie die Empirie ja erst mental konstituieren). Zeit und Raum sind die Ordnung der Dinge, also eine Matrix, deshalb nennt Kant sie transzendental.
Das bedeutet zunächst nur die „Bedingung der Möglichkeit“. Um ein Ding erkennen zu können, muss es sich in Raum und Zeit befinden. Der Unterschied zwischen empirisch und transzendental ist denkbar einfach: Alles, was man zur Not auch weglassen könnte, ist empirisch, alles, was zwingend notwendig ist, ist transzendental. So gesehen ist ein Leben ohne Möpse vielleicht sinnlos, aber auf jeden Fall möglich. Das gilt ausnahmslos für alle Dinge, jedoch niemals für Zeit und Raum. Allerdings weisen beide eine doppelte Struktur auf. Sie sind zum einen konstitutiv für die Welt, zum anderen natürlich auch operativ in der Welt. Selbstverständlich lässt sich der Raum, also das Volumen einer Kaffeetasse, berechnen (sozusagen: der kleine Raum) wie auch ein Hundertmeterlauf stoppen (sozusagen: die kleine Zeit). Wir nennen den kleinen Raum R 1, den großen Raum R 2, und entsprechend die kleine Zeit Z 1. Für die große Zeit, die Matrix, die Bedingung der Möglichkeit, behalten wir uns ein besonderes Kürzel vor, nämlich: Z 2.
Wir wollen uns nicht in Kants Kritik der reinen Vernunft verlieren und deshalb nur auf einen vorderhand belanglosen Aspekt sowie auf ein schwerwiegendes Problem verweisen. Der zunächst belanglose Aspekt, der allerdings noch bedeutend werden wird, besteht darin, dass Kant der Zeit den Vorrang gegenüber dem Raum zuweist. Kant begründet das naheliegend: Während alle äußeren Dinge in Zeit und Raum ablaufen, sind die inneren Dinge raumunabhängig. Um zu träumen, einen Gedanken zu denken, Musik zu hören, bedarf es keiner Raumdimension, allerdings jener der Zeit, denn jede Verfertigung von Gedanken, jedes Verstehen ist zeitlich. Auch das Genießen hat eindeutig einen zeitlichen Index.
Das schwerwiegende Problem ist hingegen das, was Kant als die Antinomien der reinen Vernunft bezeichnet. Nahezu jeder Mensch – vorzugsweise im Grundschulalter – wird auf sie gestoßen sein. Denn entweder sind Zeit und Raum endlich, und dann müssen sie einen Anfang beziehungsweise eine Grenze (also eine metaphysische „Verankerung“, einen „Grund“, und das wiederum heißt: einen Ursprung) haben, oder sie sind unendlich (und haben dann ihrerseits eine metaphysische Qualität). Die Empirie führt also nicht weiter. Nun ist der Begriff des „Ursprungs“ so ungefähr die schlimmste Beleidigung, die man der empirischen Wissenschaft und übrigens auch jedem Marxisten antun kann, denn sie entzieht ihnen, streng genommen, die Geschäftsgrundlage. Denn ihre Geschäftsgrundlage ist ja die Empirie, die wir kurzerhand Z 1, nämlich Zustand 1, also das Wirkliche (und seine Gesetze) nennen. Deshalb auch ein gewisses Changieren hinsichtlich des sogenannten Urknalls, oder auch Singularität genannt, was an sich kein Problem wäre, aber streng genommen empirisch nie hätte stattfinden können, eine Peinlichkeit, die namentlich hinsichtlich ihres vorgängigen Zustandes, wir nennen ihn der Einfachheit halber: Z 2 (und erinnern uns dabei an das Schimpfwort des Ursprungs), als kritische Quantenfluktuation eines namentlichen Nichts – oder wie auch immer anders – herbeizitiert werden mag. Leider bleibt das Problem bestehen. Es lautet: Die Empirie ist nicht empirisch. Und kann es auch gar nicht sein.
Auch die zunächst ausgesprochen elegante Lösung Kants, dass Zeit und Raum zum einen empirisch real (nämlich im Sinne der messbaren Größen) und zugleich transzendental ideell (nämlich im Sinne eines allgemeinen denknotwendigen Rasters) sind, zeigt hier völlig ungeschminkt ihr unschönes Gesicht. Denn so würde die Zeit (als Kausalität) sowohl das (empirische) Bild der Wirklichkeit malen als auch zugleich ihr (transzendentaler) Rahmen sein. Sie wäre also Inhalt und Form in einem. Das mag unsere überwältigende Erfahrung mit der Zeit ausdrücken. Sie ist aber logisch hochgradig problematisch und scheint eher der Ausdruck einer Verkennung oder des philosophisch „schlanken Fußes“ als eine echte Hilfe zu sein. Es sei denn, hinter dieser logischen Aporie verbirgt sich etwas ganz Wesentliches, nämlich eine Art von binärem Code, allerdings metaphysisch binärem Code, dann würde dieses Dilemma schon einigen Sinn machen. Vielleicht verschränkt sich hier irgendetwas. Und was? Keine Ahnung. Sehen wir etwa aus wie Aristoteles? Eben.
Wir können die Frage in diesem frühen Stadium unserer Überlegungen allerdings nicht entscheiden und zeigen sie deshalb nur auf.
Offensichtlich liegt das Phänomen der Zeit für einen Großdenker wie Hegel ziemlich abseits seines Denkweges, denn seine speziellen Ausführungen hierzu sind von einer erstaunlichen Beiläufigkeit. Das ist umso merkwürdiger, als er ja das gesamte Weltgeschehen auf unabsehbare Weise (Marx, Frankfurter Schule, Strukturalismus) dynamisiert und einem entwicklungsgeschichtlichen Prozess unterworfen hat. Ja, man kann umstandslos sagen, dass jedes heutige Denken, vom wissenschaftlichen Denken bis hin zum Alltagsdenken, die Zeit als den zentralen innerweltlichen Entdeckungshorizont namhaft gemacht hat. Dass es die Zeit richtet, ist die zentrale Hintergrundmetapher der Moderne. Wir wollen hier so klar wie möglich reden und sagen, dass sämtliche Fragen und Probleme des Lebens der innerweltlichen Zeit, sprich: der Geschichte überantwortet werden und innerhalb ihres Rahmens als prinzipiell lösbar erscheinen.
Wir können die extrem hohe Sinnfälligkeit und empirische Valenz dieses einfachen Gedankens keineswegs in Abrede stellen und kommen schon hier an unsere Grenzen, denn gesetzt, dass das Wissen exponentiell wächst, wäre es völlig unverständlich, ausgerechnet im verregneten Juli 2017 sinnvolle Aussagen über die Welt als Ganzes treffen zu wollen. Gäbe es aber eine invariante Grundstruktur – und von ihr ist ja versuchsweise die Rede – dann könnte sie Parmenides ebenso gut darlegen wie Karl Raimund Popper. Denn natürlich ändert sich der Mensch und somit auch die Wirklichkeit und somit auch deren Erfassung, aber die Struktur der Welt sollte sich nun nicht ändern, denn sonst wären wir in einem völlig irren Universum, und dann kann man gleich kegeln gehen. Wir übersehen den leicht frömmelnden Zug dieses Gedankens nicht und müssen frei heraus bekennen, dass uns diese metaphysische Grundstellung angesichts der naturwissenschaftlichen Wissensexplosion (auf die wir später noch bedenkenlos zurückgreifen werden) zumindest fragwürdig erscheint (und deshalb sprechen wir ja auch ausdrücklich von: Struktur). Denn es hieße im Umkehrschluss letztlich, nun gar nichts mehr zu sagen, den Weltgeist (der wir immer selbst sind) in Ruhe arbeiten zu lassen und stattdessen „seinen Garten zu kultivieren“ (Voltaire, Candide). Wir aber besitzen überhaupt keinen Garten und werden in letzter Zeit auch etwas unruhig.
Betrachtet man Hegels Gedanken zur Zeit (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften) etwas näher, so fällt auf, dass er sich bequemerweise aristotelischer, augustinischer und kantischer Gedanken bedient und sie mitunter nur mäßig originell umcodiert. Den naiven Zeitbegriff selbst übernimmt er a) von Aristoteles. Der Gedanke eines hohen Jetzt, des Augenblicks, ist – wie wir sahen – b) augustinischer Provenienz. Hören wir Hegel selbst: „Aber die Zeit selbst ist in ihrem Begriffe ewig; denn … die Zeit als Zeit ist ihr Begriff … Die Zeit wird nicht sein, noch war sie, sondern sie ist“ (Enzyklopädie). Das ist ein spekulativ bedeutender Gedanke. Denn die Permanenz des Jetzt ist das bekannte Spotlight, das gleichsam von oben auf unserem Erdenlauf liegt und mitwandert. Interessant daran ist, dass Hegel das hohe Jetzt, das stehende Jetzt, kurz: das nunc stans nicht theologisch fasst (also als Momente, in denen man besonders intensiv an den lieben Gott denkt), sondern rein formal. Es hat also zwei Dimensionen: erstens die der Transmission, also horizontal (man geht von einer Gegenwart zur anderen, also das empirische Da und Fort), zum zweiten aber liftartig, also vertikal (man steht immer in der Spannung des transzendenten Da und Fort). Logisch, möchte man sagen, denn sonst könnte man ja auch nicht in jedem Augenblick sterben. Und genau dies soll ja empirisch der Fall sein. Mehr noch: Es ist der Fall schlechthin. Es ist nichts anderes als der „punktuelle Durchbruch“ (Walter Benjamin) durch eine mehr oder weniger gemütliche Zeitachse.
Wir sprachen eingangs davon, dass Hegels Gedanken zur Zeit mitunter ziemlich schräg daherkommen. Wir erläutern dies kurz. Wie Kant geht auch Hegel vom Primat der Zeit über den Raum aus (wir werden gleich sehen, dass dies richtig ist, allerdings in einer anderen Hinsicht). Auch hier ein Zitat (Enzyklopädie): „Die Wahrheit des Raumes ist die Zeit, so wird der Raum zur Zeit; wir gehen nicht so subjektiv zur Zeit über, sondern der Raum selbst geht über. In der Vorstellung ist Raum und Zeit weit auseinander, da haben wir Raum und dann auch Zeit; dieses ‚Auch‘ bekämpft die Philosophie“. – Die Wahrheit des Raumes ist die Zeit – das ist (formal) ein interessanter spekulativer Gedanke.
Die Zeit hätte nämlich dann – zu Ende gedacht – eine Raumfunktion. Das ist die Pointe, und hieße, dass das übliche objektivistische Raumzeitgerede die metaphysische Funktion der Zeit komplett unterschlägt. Wir glauben, dass Hegel diesen Gedanken gesehen, aber nicht gedacht, oder, was dasselbe ist: weggedacht hat, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, eine innerweltliche Erlösungsgeschichte zu erzählen. Nichts anderes ist nämlich der Hegelianismus.
Seine Ableitungen sind zunächst einmal etwas befremdlich, aber, wie wir sehen werden, nicht völlig ohne Charme. Er sagt nämlich sinngemäß: Der Punkt ist die Negation des Raumes und die Zeit ist wiederum die Negation des Punktes (der im Fortgang der Argumentation dann zur Fläche wird). Vereinfacht, aber anschaulich gesagt: Man liegt auf einer Sommerwiese und hat ein starkes Raumempfinden. Nun kommt in einiger Entfernung eine nackte Frau über die Wiese (also der Punkt). Die nackte Frau negiert dieses hohe und vage Raumempfinden. Da die Frau allerdings zwei Minuten später hinter einem Busch verschwunden ist, negiert wiederum die Zeit (also die Bewegung des Punktes im Raum) den (hohen) Raum und schließlich auch den Punkt (Da/Fort) selbst, sprich: Die Zeit ist die Negation (des Punktes) der Negation (des Raumes). So weit Hegel.
Wir mögen hier einiges missverstanden haben (wüssten allerdings auch nicht genau, was), aber es wäre gleichgültig, denn der entscheidende Gedanke ist bereits ausgesprochen: Erstens, die Wahrheit des Raumes ist die Zeit, zweitens, die Zeit hebt über die Negation der Negation den ziemlich inferioren Raum in sich selbst auf, und das heißt drittens: