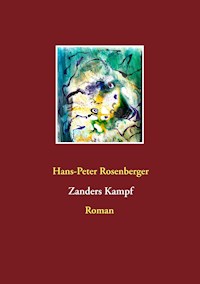
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Titel "Zanders Kampf" ist eine Allusion auf Hitlers "Mein Kampf". Zander, der Protagonist des Romans, ist aversiv gegenüber allen totalitären Machenschaften und Selbstgewissheiten, gegen Gedanken und Ansprüche, die ihren Ursprung im nazistischen 3. Reich haben. Fast ein Erwachsenenleben lang ist er konfrontiert mit der Tatsache, dass Hitlers Gedankengut keineswegs überwunden ist, sondern noch immer in den Köpfen vieler seiner Mitmenschen rumort, unbewusst oder bewusst, und z.T. sehr intentional verwendet und verwirklicht wird. Im Alter bekämpft er, zusammen mit seinem Freund Muck, braune Seilschaften und Machtansprüche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Peter Rosenberger: geboren am 28. Dezember 1937 in Stuttgart, Studium Germanistik, Anglistik, Philosophie, Geschichte in Tübingen und München; 2005 erschien Die Reise nach Yuste. Ein kulturhistorischer Bericht über eine Reise durch Frankreich und Spanien, 2008 Geschichten aus dem Leben oder Amigos in Abano und Abbazia. 2009 Berühmte und Orte, 2011 Reisebiotope und Artenschutz
Hans-Peter Rosenberger lebt in Bad Reichenhall
Für meine Frau
Um über einen Ort zu schreiben, muss man ihn lieben oder hassen. Oder beides, wie bei einer Frau. (Raymond Chandler)
Alle handelnden Personen und alle erwähnten Behörden sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind fiktiv, so wie auch sämtliche Vermutungen. Insbesondere die Relation FPÖ – „Rechtes Bündnis“ ist frei erfunden.
Die Glocken von St. Zeno mahnten durch das Reichenhaller Tal. 12.00 mittags. Rolf Zander verließ seine Wohnung im Panorama-Haus, einem riesigen Gebäude mit großzügiger Lounge, 160 Wohnungen, sehr kleinen, kleinen, bescheidenen mittleren bis gehobenen mittleren mit respektabler Terrasse, ursprünglich entworfen als Ferienwohnungen und beim Bau ab dem Jahre 1971 durchaus akzeptabel ausgestattet. Fenster, Balkone und Terrassen waren nicht nur für da-malige Verhältnisse großzügig, die Aussicht war und ist schön und beeindruckend, von den meisten Wohnungen zumindest, da das Gebäude halbhoch am Berg steht. Der Komplementärbau ist ein Hotel mit Restaurant, Massagepraxis und Schwimmbad, die auch den Bewohnern und Besuchern des Wohnhauses zur Verfügung hätten stehen sollen.
Zum Verlassen des Hauses wählte Rolf Zander den Ausgang durch die Tiefgarage. Er musste einen Pack alter Zeitungen im Abfallraum auf der Ebene der Tiefgarage entsorgen, und er nahm dafür in Kauf, drei schwere Türen, eine Glastür und zwei aus Stahl, und das Sperrgitter an der Einfahrt zur Garage öffnen zu müssen, um dann schließlich ins Freie gelangen zu können, wo ihn das helle Grün des späten Frühjahrs begrüßte. Ein paar Schritte hinunter auf der Baderstraße, dann konnte er in der scharfen Kurve der Adolf-Schmid-Straße links in den Rad- und Gehweg einbiegen. Noch immer waren damals an dieser Stelle die Hinweisschilder auf die Massagepraxis Geyer und das Hotel Mercure Panorama angebracht, obwohl das Hotel längst nicht mehr in Betrieb war, weil es Bankrott gemacht hatte, womit auch die Firma Geyer einen anderen Ort für ihr heilsames Treiben hatte suchen müssen. So dienten die Schilder damals allenfalls noch als Orientierungshilfe für Besucher des Apartmenthauses.
Zander ging ein kleines Stück der Tivolistraße hinunter, den seinerzeit morschen Holzzaun entlang, der den weitläufigen Park des alteingesessenen Hotels Axelmannstein, der Urzelle der inzwischen etwas verblichenen Bad Reichenhaller Kur-Herrlichkeit, von der Straße abschirmt, vorbei an der Hotel- und Ferienappartementanlage Tivoli auf der anderen Straßenseite mit spektakulärem Außenaufzug und dekorativem Brunnen daneben, weiter dann die Wisbacher Straße, zu der die Tivolistraße mutiert, bis zum Brunnenplatz, vorbei am gegenüber liegenden Seniorenheim, dessen nüchterne, aber keineswegs unsympathische Architektur zwischen den beiden Villen links und rechts, die eine behäbig und einschließlich des dazugehörigen Salettls Geborgenheit vermittelnd, die andere Jugendstil fast in Reinform, eine leicht lässliche Sünde vergangener Jahre war, leicht lässlich, weil die Bewohner des Seniorenheimes mitten in der Stadt und doch in ruhiger Umgebung ihre letzten Jahre verbringen konnten, ganz im Gegensatz zu den Insassen vieler anderer Seniorenheime, die sich eher wie in einem Gefängnis am Rande des Lebens mit ein paar Annehmlichkeiten, etwas Freigang und erweitertem Ghetto fühlen müssen. Vielleicht gedenken die Herrschaften aus dem Seniorenheim, wenn sie im Schatten der Bäume sitzen, die diese Straße liebenswert schmücken, mitunter des Namenspatrons ihrer Straße, des 1849 in Ainring geborenen Franz Wisbacher, Lehrer, der 1875 Reichenhall im Schlepptau einer russischen Fürstin verließ, was ihn nicht besonders glücklich machte, sodass er schon zwei Jahre später wie-der in Reichenhall als Lehrer tätig war. Weitgehend marod und zermürbt, musste er, ohne Pensionsanspruch, 1880 den Schuldienst quittieren. Er widmete sich jetzt ausschließlich, da nichts anderes zu tun war, seinen Schreibambitionen. Die Ambitionen waren aber wohl größer als die Qualität seiner Gedichte. 1912 beendete ein Unglück am Hammerauer Bahnhof sein frustrieren-des Dasein. Unten, am eigenwilligen und beliebten Brunnen, überquerte Rolf Zander die Fußgängerzone, die sich an dieser Stelle in die Ludwig- und die Salzburger Straße teilt, ging, was nicht gern gesehen wurde, über den Parkplatz des Hotels Luisenbad, das, da das Axelmannstein seinem früheren hohen Ansehen inzwischen nicht mehr gerecht werden konnte, zur besten Hoteladresse in Bad Reichenhall geworden war, zum Dr.-Ortenau-Park, dessen Benennung eine kleine Wiedergutmachung an einem jüdischen Lungenfacharzt war. Seine große Beliebtheit in Bad Reichenhall hatte ihm die Möglichkeit verschafft, im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Ärzten im Deutschen Reich, bis zum 1. Oktober 1938 praktizieren zu können. An diesem Tag jedoch hatten die Nazis allen jüdischen Ärzten die Approbation entzogen, auch jenen, die es, wie Gustav Ortenau, zum Generaloberarzt - heute Oberfeldarzt - im 1.Weltkrieg gebracht hatten. Nicht ganz unverhofft hatte dieser Tag nicht wenigen arischen Medizinern - 57 Prozent waren 1937 Mitglied der NSDAP - zum Besitz einer Praxis oder zu einer gut dotierten Anstellung an einem Krankenhaus verholfen, und mancher Enkel aus einer Medizinerfamilie zehrt noch heute von dieser Wohltat an reinrassigen deutschen Ärzten. Für diese besondere Spezies war das Verbrechen an den Juden ein Segen gewesen, wie seinerzeit der Erlass des Kaisers Friedrich II., der 1231 im apulischen Melfi einen Kodex hatte verfassen lassen, demzufolge nur ausgebildete Mediziner als Ärzte praktizieren durften und immer noch dürfen. Die gleiche Monopolstellung hatte der Kaiser damals übrigens auch den Apothekern verschafft, womit ihnen eine sichere und munter sprudelnde Geldquelle erschlossen worden war und bis heute ist. Der Dank: hin und wieder dient Kaiser Friedrich II. als Namenspatron für eine Apotheke.
Die transitorische Schonung Dr. Ortenaus mag allerdings auch den wirtschaftlichen Interessen des Kurortes Bad Reichenhall geschuldet gewesen sein, zu dessen damals noch vornehmem und vermögendem Klientel auch eine beträchtliche Zahl von Personen jüdischen Glaubens gehörte. Selbst Adolf Hitler gab sich, was Bad Reichen-hall betrifft, erstaunlicherweise desinteressiert und ließ sich schnurstracks durch den Kurort Richtung Berchtesgaden chauffieren, nachdem der Pilot des Flugzeugs, mit dem er nach Ainring gelangte, seinem Privatflugplatz gleichsam, gelandet war.
Jenseits der Bahnhofstraße, die den Dr.-Ortenau-Park auf der anderen Seite begrenzt, kehrte Rolf Zander zielstrebig bei Mamma Rosa ein, dem - sieht man von der nur abends geöffneten kleinen Trattoria Baci e Abbracci in der Schachtstraße einmal ab - besten italienischen Lokal in Bad Reichenhall, das unter Alimentari, Feinkost, italienische Spezialitäten firmiert und doch eher eine Trattoria ist. Sie boomt wie kaum ein anderes Lokal in Bad Reichenhall, nicht zuletzt auf Grund der italianità, die der freundliche Wirt und Koch und seine liebenswerte Frau, früher zusammen mit deren manchmal etwas herberen Cousine, mit spürbarer Lust verbreiten. Allesamt sind schon lange in Deutschland und beherrschen das deutsche Idiom eigentlich ganz passabel, befleißigen sich aber, alle üblichen Floskeln – Begrüßung, Verabschiedung, Erkundigung nach dem Befinden, Aufnahme der Bestellung - italienisch zu artikulieren. Die meisten Gäste wiederum bemühen sich, die Vielzahl ihrer Aufenthalte in Italien und die dabei erworbenen Sprachkenntnisse nachzuweisen und danken ihrerseits auf Italienisch, ein Ping-Pong-Spiel, manchmal mit etwas missglückten Rückgaben des Aufschlags, doch den Deutschen das gar nicht verfehlte Gefühl verschaffend, in Italien in einer Trattoria zu sitzen, die sehr familiär geführt wird, mit all der Warmherzigkeit und Heiterkeit und Leichtigkeit, die man bei uns sonst kaum mehr antrifft. Es menschelt spürbar. Dabei wird gezielt, sehr seriös und sehr präzise gearbeitet, und man kann Martin Mosebach, den klugen und vielseitigen Schriftsteller, während eines Aufenthaltes in diesem Lokal, mit seinem ganz spezifischem Ambiente, seiner warmen und wärmenden Atmosphäre, seinen köstlichen Gerüchen, wo man zu jeder Jahreszeit einen faszinierenden Blick auf die Bäume und Baumgruppen des Dr.-Ortenau-Parks hat, nicht verstehen, der die Italiener das kälteste Volk der Welt nannte, oder gar den ausgewiesenen Italienkenner Rudolf Borchardt, der vom ausgeträumten Innern einer seit unvordenklichen Zeiten festgewordenen Rasse sprach, die vor allem eines sei: deutlich, ja grob von Seele. Für den überaus klugen Lessing waren die Italiener sogar Schmeißfliegen, die sich vom Kadaver des antiken Rom ernähren.
Rolf Zander hingegen liebte die Italiener und ihr Land, nicht nur, weil er, wie fast jeder anständige Deutsche seines Alters - er war im Dezember 75 geworden -, in Italien kulturell sozialisiert worden war, und er freute sich sehr auf das Mittagessen, das er hier ein- oder zweimal die Woche zu sich nahm, zusammen mit mindestens einem großen Glas des einfachen und preiswerten Rotweins, der damals noch vom Fass kredenzt wurde und der keinerlei Beschwerden verursachte. Die Spaghetti all’Arrabiata, die offiziell gar nicht angeboten wurden, waren so geschmackvoll zubereitet, dass nirgendwo in Italien selbst besser zubereitete zu bekommen waren. Fein geschnittene Knoblauchscheibchen, ganze Kapern, entkernte blaue Oliven waren die sichtbaren Ingredienzien; die Zusammensetzung des Sugo blieb natürlich das Geheimnis des patrone, so wie ihm vielleicht das Einkommen seiner Gäste ein Geheimnis war. Die Preise sind für das beschauliche Bad Reichenhall italienisch hoch, was auf eine Verkennung der Einkommensverhältnisse in Deutschland schließen lässt. Warum sollte der Wirt jedoch weniger für seine guten Speisen verlangen, wenn seine Preise anstandslos von den sich ihren Eliteanspruch suggerierenden Gästen bezahlt werden? Und: Er hält sich damit - inzwischen muss man gerechterweise sagen: hatte sich gehalten! -, wenigstens weitgehend, das ganz einfache Publikum vom Leibe, das den Ruf eines Lokals schnell ruinieren kann, selbst wenn es sich anständig benimmt. Noch lieber als die Spaghetti all’Arrabiata waren Zander die Tortellini, deren Füllung jahreszeitlich variierte, deren Zubereitung aber stets erstklassig war, umschmeichelt von einer feinen Buttersauce und oft aufgewertet von dünnen Trüffelscheibchen, deren Geschmack allerdings irgendwo auf dem Weg nach Bad Reichenhall weitgehend verduftet war. Zander verkniff es sich dann immer, an Turin zu denken, wo es einmal verboten gewesen war, mit der Straßenbahn zu fahren, so man Trüffeln mit sich führte - des durchdringenden Geruchs dieser Schlauchpilze wegen.
Bei Mamma Rosa im Lokal zu sitzen oder, bei schönem Wetter, gar auf dessen Terrasse, bereitete Zander ein behagliches Vergnügen. Er konnte ungestört Menschen beobachten: die jungen Bankangestellten in dunklen Anzügen, die ihnen ihrer Meinung nach zu einer Bedeutung verhalfen, um die sie erst noch lange Jahre buhlen mussten; de Mediziner, der seine exponierte gesellschaftliche Zunft durch den Gebrauch eines volkstümelnden bayerischen Dialekts zu kaschieren versuchte und gleichzeitig seinen Stand demonstrierte, weil er „vergessen“ hatten, sich seines weißen Arbeitsgewands zu entledigen; die alten Damen, manchmal auffallend beringt, die sich zum bescheidenen Essen und zum langen Plausch trafen, und die jüngeren Damen ohne Ringe, die sich, wie eigentlich überall, für einen Heiratskandidaten feilboten. Menschen waren das Elixier, das sein Leben bestimmte, und das sollte ihm, allerdings auf weniger vergnügliche Art, auf dem Heimweg wieder eindringlich vor Augen geführt werden.
Im Ortenau-Park lag ein Klumpen auf dem Rasen. Zander benötigte einige Zeit, um zu realisierte, dass er mit dem Klumpen im Augenblick ganz allein im Park war und dass der Klumpen eine menschliche Gestalt war. Ein Sandler, dachte er, sturzbetrunken. Der Gedanke war naheliegend, weil der Park damals der beliebte Aufenthaltsort einer Gruppe von sogenannten Asozialen war - um Bertolt Brecht abzuwandeln: wer ist wahrhaftig asozial, der Asoziale oder jene, die ihn zum Asozialen machen? -, die den Tag hier mit Bier, Schnaps und ihren Hunden verbrachten, erstaunlich friedlich und gesittet - sieht man von dem Müll ab, den sie regelmäßig bei ihrer bevorzugten Bank hinterließen -, wie es sich für einen Kurort mit langer Tradition gehört. Zander blieb stehen. Am Klumpen bewegte sich nichts. Der Klumpen war tot. Er vergewisserte sich, indem er die paar Schritte über den Rasen ging und den Klumpen mit der Spitze seines linken Fußes leicht stupfte. Keine erkennbare Reaktion. Er beugte sich hinunter zum überraschend gepflegten Gesicht des Klumpens und sah die Augen, deren weite Leere ihn für einige Momente hilflos machte, unfähig, irgendetwas rational zu registrieren. Er wandte sich mechanisch ab und schaute den Klumpen nicht mehr an. Dann zwang er sich zu vernünftigem Vorgehen. Gelegentlich hatte er den sonntäglichen Tatort in der ARD angeschaut, und er wusste deshalb, was zu tun war und was er nicht tun durfte. Er kehrte in seiner Spur auf den befestigten Weg zu-rück, den er gekommen war, zog sein Handy aus der Tasche und alarmierte die Bad Reichenhaller Polizeiinspektion. Die Telefonnummer - 9700 - hatte er anlässlich eines anderen Ereignisses gespeichert. Der Mann, der den Anruf in der Polizeiinspektion entgegennahm, reagierte bayrisch, d.h. für Nichtkenner bayerischer Umgangsformen unwillig. und brauchte eine ganze Weile, bis er die Brisanz des Anrufs erkannte. Er witterte Ungemach, das ihn und die gesamte Reichenhaller Polizeiinspektion, die immerhin für ein Gebiet von über 200 qkm zuständig ist, zumindest den Rest des heutigen Arbeitstages und wahrscheinlich weitaus mehr als den ganzen morgigen Tag intensiv beschäftigen würde. Ein Toter im Park, das war höchst ungewöhnlich für die in aller Regel ruhige Kurstadt und würde eine ganze Menge höherrangiger Kollegen von der Kriminalpolizeiinspektion T., Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Gerichtsmedizin und vielleicht sogar eine Sonderkommission nach Bad Reichenhall führen, was der Beschaulichkeit seines normalen beruflichen Daseins sehr abträglich sein würde. Er musste sich zusammenreißen und Rolf Zander gegenüber dienstlich werden. Er notierte sich gewohnheitsmäßig dessen Namen und Adresse und dessen Telefonnummer, das Datum und die genaue Uhrzeit, 14.03 Uhr bei Entgegennahme des Anrufs, obwohl das eigentlich überflüssig war, weil solche Angaben automatisch gespeichert werden, seit es die technischen Möglichkeiten dafür gibt. Dann bat er Rolf Zander, an Ort und Stelle auf das Eintreffen einer Funkstreife zu warten. Dem Anrufer war das recht; er hatte damit ge-rechnet, warten zu müssen.
Die Prozedur mit der Angabe der persönlichen Daten wiederholte sich, nachdem die beiden Streifenbeamten eingetroffen waren. Einen Ausweis hatte Zander nicht bei sich, weshalb er sich auf die Polizeiinspektion in der Poststraße begeben musste, wo seine Angaben überprüft und für richtig befunden wurden. Die Angelegenheit wäre damit vorerst für ihn eigentlich erledigt gewesen, wenn da nicht die Frage auf der Polizeiinspektion gewesen wäre, ob er den Toten kenne. Obwohl er die Frage verneint hatte, war er inzwischen eigentlich vom Gegenteil über-zeugt. Und das konnte ihn noch in die Bredouille bringen.
Erst auf dem Heimweg wurde ihm bewusst, dass die Kleidung des Toten sehr ordentlich war: teures Sommer-Sakko mit Stich ins Grüne, hellblaues Leinenhemd, leichte schwarze Hose und schwarze Sommerschuhe, wie man sie in den Schuhläden Bad Reichenhalls nicht bekommt. Er wunderte sich, dass er dies alles so genau registriert hatte, und er machte sich Vorwürfe, das Gesicht des Toten nicht intensiver betrachtet zu haben. Gegenüber dem Seniorenheim kam ihm die ältere Frau mit dem Kinderwagen entgegen, in dem sie ihre Katze auf ihren Wegen mitnahm und der ihr zugleich Halt bot. Ein paar Worte hin, ein paar Worte her, Sein Gedankenfluss war unterbrochen. Doch: Was sollte er tun? Die Ermittlungen der Polizei würden früher oder später auch zu ihm führen, der so unglückselig mit diesem Toten, einem Dr. Zangonil, verbandelt war. Sollte er also der Polizei zuvorkommen?
Die Baderstraße lenkte ihn für kurze Zeit von seinen bohrenden Gedanken ab. Er musste, obwohl die Straße nach Michael Bader, einem Hotelbesitzer und Bauunternehmer aus München benannt war, unwillkürlich an die Bader denken, deren Beruf im Mittelalter entstanden war, als Kreuzzügler die Badekultur der Bevölkerung des Vorderen Orients kennengelernt und sie bei ihrer Rückkehr nach Europa gebracht hatten, wo alle Bevölkerungsschichten einschließlich der ganz oberen, was Hygiene betraf, noch sträflich darbten. In von den Kommunen eingerichteten Badestuben, die an die Bader verpachtet wurden, konnten die meist dringend der Reinigung Bedürftigen Schwitz- oder Wasserbäder nehmen, und mit der Zeit oblag den Badern die Körperpflege einschließlich Frisieren, Haare schneiden und rasieren. Das war es nicht, was sie in Verruf brachte, sondern es war das muntere gemeinsame Treiben von Männlein und Weiblein in den Badehäusern, das natürlich die verdienstvolle Sittenwächterin Kirche auf den Plan rief, deren höhere und auch minder hohe Mitglieder sich dafür aber ganz offiziell eine Beischläferin halten durften. Die Bader fanden noch weitere einträgliche Betätigungen: sie fungierten als eine Art Heilpraktiker, die therapeutische Behandlungen durchführten: den Aderlass und das Schröpfen, seinerzeit eine Art Allheilmittel, dann Klistieren und zahnärztliche Behandlungen, meist beschränkt auf Zähne ziehen bzw. ausbrechen, eine höchst unangenehme Prozedur. Die Ärzte hatten sich auf die innere Medizin zu beschränken, und das eröffnete den Badern eine zusätzliche Einnahmequelle: sie führten Amputationen durch und kleinere Operationen wie das Entfernen von Polypen.
Die gedankliche Abschweifung tat gut, doch hielt sie nicht lange an. Der Tote im Park nahm wieder Besitz von Zanders Bewusstsein; es gab kein Entrinnen. Zurück in seiner Wohnung schaltete er den Fernsehapparat ein und zappte nach dem Lokalsender. Eine Sendung über Landwirtschaft in Ainring, keine Sondermeldung. Er holte sich eine Flasche des guten chilenischen Rotweins Los Vascos Cuvee Especial Cabernet Sauvignon Baron de Rothschild (Lafite) aus dem Weinregal und ein schönes Rotwein-Glas aus dem Gläserschrank, entkorkte die Flasche und setzte sich samt Flasche und Glas auf den Balkon. Er dachte nach. Der Tote war tatsächlich jener Dr. Zangonil aus der benachbarten österreichischen Landeshauptstadt, der ihm vor zwei Jahren so viel Ärger und Verdruss und vor allem ein ganz schlechtes Gewissen verschafft hatte. Er holte jene Dummheit ins Gedächtnis zurück, zu der ihn Dr. Zangonil animiert hatte. Die Flasche war schließlich leer, und er war ruhiger geworden. Er verschob das weitere Nachdenken auf den folgenden Tag und ging zurück in die Wohnung.
Die Einrichtung seines Wohnzimmers folgte einem Wort Ciceros: Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Entsprechend der Zahl der Bücher musste das Zimmer eine große Seele haben, und das wiederum erinnerte ihn an den Körper ohne Seele unten im Park. Er ging zu Bett, um dem Grübeln zu entkommen, und versuchte zu schlafen. Der Wein wirkte.
Am nächsten Morgen war er früh im Café Spieldiener, um die Lokalzeitung zu lesen. Zander war der erste und einige Zeit der einzige Gast. Das tat ihm gut. Er bestellte sich einen koffeinfreien Kaffee und ein Stück Käsekuchen - im bayrischen Staatsbad Bad Reichenhall war ein besserer nicht zu bekommen, und wer weiß, ob es seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, als der Kurbetrieb aufgenommen worden war, je einen besseren gegeben hat - und ließ sich das Reichenhaller Tagblatt bringen, das er nur im Café zu lesen pflegte, obwohl er zum Beispiel viele der Konzertkritiken von Elisabeth Aumüller durchaus schätzte. Auf der Titelseite ein Foto und ein paar Zeilen über den Toten im Park, eben Dr. H. Zangonil. Darunter ein Verweis auf den Lokalteil. Schnelles Durchblättern bis zum Bericht über das außergewöhnliche Ereignis, dem außergewöhnlich viel Platz eingeräumt worden war. Dr. Zangonil kam, was Zander aufgrund leidvoller Erfahrung wusste, aus der benachbarten österreichischen Landeshauptstadt, aber es war noch nicht bekannt, warum er sich in Bad Reichenhall aufgehalten bzw. warum man ihn nach Bad Reichenhall gebracht hatte. Die dünnen Informationen genügten jedoch, um Rolf Zander noch unruhiger werden zu lassen. Er war sich seiner Bekanntschaft mit dem Toten jetzt ganz sicher.
Seit seine Frau vor zwei Jahren gestorben war, hatte es sich Zander zur Gewohnheit gemacht, hin und wieder mit dem Zug oder mit dem Bus in die österreichische Landeshauptstadt zu fahren und dort regelmäßig früher oder später im Stiftskeller einzukehren, wo er sich allein schon der Tatsache wegen wohlfühlte, dass er hier seit Beginn ihrer Liebe viele schöne Stunden mit seiner Frau verbracht hatte, deren Weinpräferenzen den Obern so gut bekannt gewesen war, dass sie sich hatte erlauben können zu fragen, welchen Wein sie hier trinke. Der berühmte Stammtisch allerdings hatte mangels Nachwuchs nicht mehr existiert. In seinen jüngeren Jahren war es für Zander und seine Frau selbstverständlich gewesen, hier Honorationen der Stadt zu treffen: Professoren aus der philosophischen Fakultät der Universität, bekannte Mediziner oder solche, die bekannt werden wollten, den lokal berühmten Architekten P. aus Bosnien-Herzegowina, Spross der Familie eines seinerzeit dort tätigen österreichischen Verwaltungsbeamten - er hatte Büro und Atelier praktischerweise in den Gebäuden des Klosters, in dem auch der Stiftskeller seit Jahrhunderten florierte - , den Leiter der Staatsanwaltschaft in der österreichischen Landeshauptstadt, der seine Stellung nutzte, um sowohl von den Stammtischbrüdern als auch vom Personal des Weinlokals respektvoll und wie ein rohes Ei behandelt zu werden, Leute aus der Verwaltung des Landestheaters, die gelegentlich auch Schauspieler oder Schauspielerinnen mitbrachten, ein buntes Gemisch insgesamt, bei dem zu sitzen immer Freude und Unterhaltung mit sich gebracht hatte. Die Klammer hatte Hias geheißen, jeden Wochentag pünktlich zur Stelle, ein begnadeter Trinker, von dem das Gerücht gegangen war, er habe nacheinander 36 Viertel Wein auf einem Sitz getrunken. Er starb früh an Leberzirrhose. Im Sommer wurde der Stammtisch nach draußen verlegt, an den ersten Tisch rechts, wenn man das Lokal verlässt, und während der Festspielzeit konnte es durchaus geschehen, dass sich prominente Künstler mit an den Stammtisch setzten. Curd Jürgens z. B., der damals den Jedermann spielte, wurde am Tisch eher geduldet denn herzlich willkommen geheißen, vielleicht weil er die Bedeutung der einheimischen Honorationen mit seiner Anwesenheit minderte. Österreicher haben ja die Fähigkeit, anderen Österreichern und insbesondere Nicht-Österreichern ihre selbst verliehene Überlegenheit und Verachtung der Angehörigen anderer Nationen diffizil oder auch weniger diffizil spüren zu lassen, eine Attitüde, die möglicherweise aus der k.u.k.-Zeit stammt, als eine relativ geringe Anzahl deutsch Sprechender eine relativ große Anzahl von Angehörigen nicht deutsch sprechender Völker sehr effizient beherrschte und damit, aus der Sicht der Österreicher, natürlich zwangsläufig ihre Überlegenheit unter Beweis stellte.
Bei einem seiner sommerlichen Besuche im Stiftskeller war Rolf Zander mit einem Herrn ins Gespräch gekommen, der jünger gewesen war als er, gute Manieren gehabt und sich mit eben diesem Namen, Dr. Zangonil, vorgestellt hatte. Natürlich hatten sie über die österreichische Politik gesprochen, zu der sowohl Zander als auch sein Tischnachbar dezidiert individuelle Meinungen gehabt hatten, so dass das Gespräch interessant und lebhaft geworden war. Dr. Zangonil hatte dann vorsichtig ins Persönliche gelenkt, sich nach den Lebensumständen Zanders erkundigt, nach Familie, Tätigkeit, und Wohnort, alles auf eine höflich-unaufdringliche Art, was in Österreich durchaus den gesellschaftlichen Normen entspricht. Österreicher haben die Eigenart, immer besser sein bzw. besser gestellt sein zu wollen als andere, und sie wollen sich das auch bestätigen. Alles ganz normal also. Trotzdem: er hatte Zander ausgehorcht. Nicht so ganz österreichisch war‘s denn auch gewesen, dass er hinsichtlich von Auskünften über seine persönlichen Verhältnisse wesentlich zurückhaltender gewesen war als üblich. Bei der Verabschiedung hatten sie trotzdem ein Wiedersehen in der nächsten Woche zur gleichen Zeit am gleichen Tisch ausgemacht, und Zander, der nicht mehr viele Bekannte hatte, mit denen er sich angeregt unterhalten konnte, hatte sich auf das Wiedersehen sehr gefreut.
Während der zweiten Begegnung waren Dr. Zangonils Fragen bohrender und gezielter geworden. Schließlich hatte er sich mit Zanders Reiselust befasst. Da war er auf eine fast unerschöpfliche Quelle gestoßen, und das war seinen Absichten sehr entgegengekommen. Vorsichtig hatte er einen Vorschlag lanciert: Er habe wichtige Briefe zu verschicken und zu bekommen und vertraue bei dem Überprüfungsfimmel und der Datensammelwut in der heutigen Zeit seine Post nur noch ihm gut bekannten Personen zur Übermittlung an, gegen beste Bezahlung natürlich, wie er wörtlich gesagt hatte. Der Haken war bestens platziert gewesen.
Beim dritten Treffen war Zander bereit gewesen, die Rolle des Kuriers zu übernehmen. Leichte Bedenken - Dr. Zangonils Adresse oder ein Telefonfestnetzanschluss waren weder im Telefonbuch der österreichischen Landeshauptstadt noch im Internet zu finden gewesen - hatte er, obwohl er sich noch immer eingebildet hatte, nicht in vollem Umfang der üblichen Beamtennaivität ökonomischen Belangen gegenüber zu entsprechen, schnell beiseitegeschoben. Dr. Zangonil hatte damals schließlich distinguiert, seriös und vertrauenswürdig gewirkt. Was genau er transportieren sollte, war Zander eigentlich gleichgültig gewesen, und Gedanken an eventuell kriminelle Machenschaften hatte er erfolgreich verdrängt. Die Aussicht auf ein leicht und angenehm verdientes Zubrot hatte gesiegt, obwohl er von seiner Pension als höherer bayrischer Beamter und ein paar kleinen Nebeneinkünften auskömmlich leben konnte.
Im Stiftskeller hatte ihm Dr. Zangonil beiläufig einen großen Briefumschlag ohne Aufschrift überreicht. Die Zustelladresse in Amsterdam samt holländischer Handynummer - Jan Cuipers, van Campenstraat 14, in der Nähe der Heineken-Brauerei - war auf einem Zettel vermerkt gewesen, den er getrennt von dem Briefumschlag aufbewahren sollte. Dann hatte er Zander vorgeschlagen, den Transport via einer ruhigen und erholsamen Flusskreuzfahrt Köln - Amsterdam zu erledigen; er habe schon eine Doppelkabine als Einzelkabine auf Zanders Namen bei der Firma TransOcean Kreuzfahrten einschließlich Bahnticket für Hin- und Rückfahrt nach und von Köln reservieren lassen. Aus Sicherheitsgründen solle Zander die Kreuzfahrt vorerst selbst buchen und bezahlen. Zander war einerseits die Vokabel „Sicherheitsgründe“ suspekt gewesen, andererseits hatte ihn die Reise trotz der langen Bahnfahrt - sechseinhalb bis achteinhalb Stunden von Bad Reichenhall nach Köln - sehr gelockt. Er würde, so er die Möglichkeit nutzte, einen vollen Tag vor dem Ablegen des Schiffes in Köln verbringen können und somit Gelegenheit haben, in Köln das Wallraff-Richartz-Museum, eine der größten klassischen Gemäldegalerien Deutschlands, wieder zu besuchen, die mit der Fondation Corboud auch die umfangreichste Sammlung impressionistischer und neoimpressionistischer Kunst in Deutschland besitzt. Auch ein Wiedersehen mit den Werken im Kölner Museum Ludwig, einem der bedeutendsten Museen für die Kunst der Gegenwart, zumindest in Deutschland, hatte seine Reize. Nordwestlich von Arnheim, wo das Schiff einen ausreichend langen Stopp von sieben Stunden einlegen würde, liegt auf dem Gemeindegebiet von Otterlo im Zentrum des Nationalparks De Hoge Veluwe, das Kröller-Müller-Museum, das nicht weniger als 87 Gemälde und 180 Zeichnungen von van Gogh besitzt und somit die zweitgrößte Sammlung von Werken dieses Künstlers nach dem Museum van Gogh in Amsterdam. Die luftigen ebenerdigen Bauten, nach Querelen der Bauherrin mit den zur Zeit der Errichtung sehr renommierten Architekten Peter Behrens und Mies van der Rohe von keinem Geringeren als dem berühmten belgisch-flämischen Architektur-Autodidakten Henry van de Velde als Provisorium entworfen und später von sensiblen Architekten erweitert, schmiegen sich mit ihren riesigen Fensterflächen ebenso in die ruhige grüne Landschaft ein wie der weitflächige Skulpturengarten, für den das Museum berühmt ist. Zander hatte das Museum vor Jahren noch zusammen mit seiner Frau besucht, nach einer langen Suche in Arnheim nach einem Taxi, die sie schließlich in eine Polizeistation geführt hatte, wo ihnen freundlichst und zuvorkommend geholfen worden war. Ein Taxi war vorgefahren, und der Fahrer hatte sie lange durch Wald und ausgedehnte Lichtungen kutschiert, bevor er in Sichtweite des Museums angehalten hatte. Er hatte vorgeschlagen, auf die Rückkehr seiner Fahrgäste zu warten; sie hatten, angesichts der Erfahrungen in Arnheim, dankbar akzeptiert. Der Besuch des Museums war teuer geworden. Der Eintritt hatte stolze 20 € pro Person gekostet, weil auch der Besuch des Parks zu bezahlen gewesen war, obwohl den Park zu genießen sie gar keine Gelegenheit gehabt hatten. Ermäßigte Seniorenkarten, wie in südlichen und angeblich viel ärmeren europäischen Ländern gang und gäbe, hatte es nicht gegeben. Der Besuch jedoch hatte sich reichlich gelohnt, denn obwohl beileibe nicht alle der sich im Besitz des Museums befindlichen van-Gogh-Bilder ausgestellt waren, so waren es doch einige der bekanntesten Werke des Malers gewesen, u.a. eine Version der Kartoffelesser, die Caféterrasse bei Nacht (Place du Forum), das Porträt des M. Rolin und Die Brücke von Arles (Pont de Langlois). Zander hatte unwillkürlich an jenen sympathischen Monsieur Christian aus Paris, Kunstmaler, denken müssen, den er noch zusammen mit seiner Frau in Abano Terme kennengelernt hatte und der ziemlich überzeugt davon gewesen war, auf einem Brocante,





























