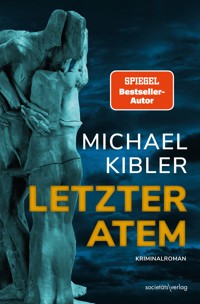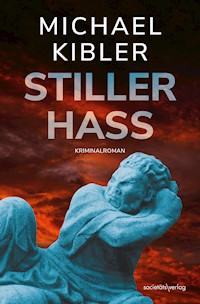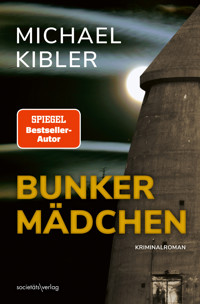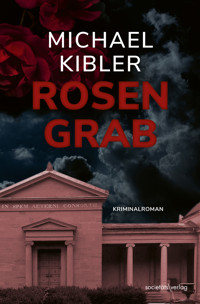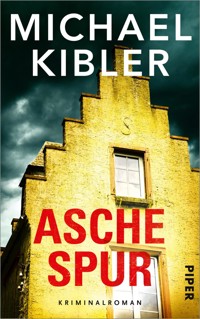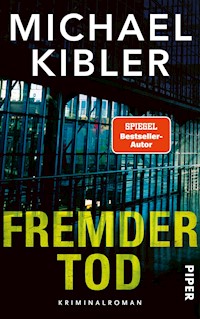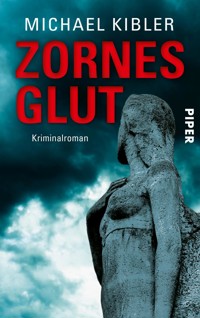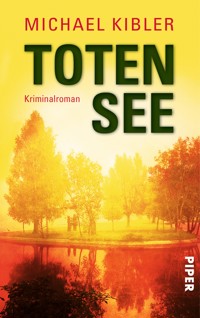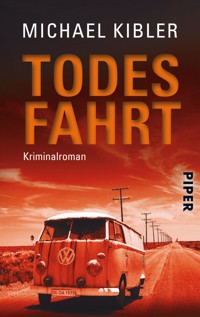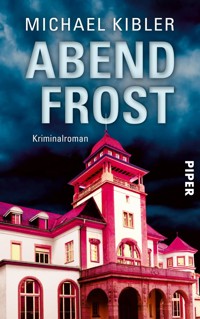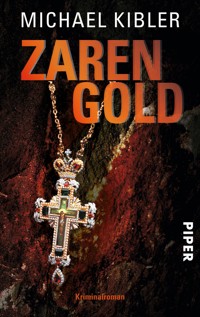
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein unerklärlicher Einbruch in der Russischen Kapelle und eine brutal ermordete junge Frau im Keller des ehemaligen Brauereiviertels – ihr zweiter Fall führt Hauptkommissarin Margot Hesgart und ihren Kollegen Steffen Horndeich in eine fremde, bedrohliche Unterwelt. Auch wenn die Kühlkeller des ehemaligen Darmstädter Brauereiviertels vom Ried bis in den Odenwald als »Katakomben« bekannt sind, sollten sie nie als Grabkammer dienen. Vom Blutsonntag in Sankt Petersburg zum Mord auf der Mathildenhöhe – auch aus der Ferne ist tödliche Gefahr blitzschnell ganz nah, wenn das Schicksal russisches Roulette spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Freunde in Gomel
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
6. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96836-2
© Piper Verlag GmbH, München 2007 Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: corbis images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
Es war, als würde ein Vorhang geöffnet, nur ein wenig, doch sie sah kein Licht. Ihr Kopf schmerzte, pochte. Etwas war schiefgelaufen, soviel war klar.
Sie versuchte sich zu bewegen. Es gelang ihr nicht. Jedes Mal, wenn sie auch nur einen Muskel spannte, schoss der Schmerz durch ihren Körper.
Hatte sie die Augen geschlossen oder geöffnet? In der Dunkelheit machte es keinen Unterschied.
Draußen tanzten Schneeflocken durch die eiskalte Luft, das wusste sie. Sie liebte den Schnee. Und sie fragte sich, ob sie ihn jemals wieder sehen würde.
Sie hörte das Lied. Ihr Lieblingslied. S perwym snegom ja uletaju – Mit dem ersten Schnee fliege ich davon …
Der dritte Advent stand bevor. Zum ersten Mal, seit sie in der neuen Wohnung lebte, hatte sie einen Adventskranz, auch wenn sie Weihnachten nach ihrem orthodoxen Glauben erst am sechsten Januar feiern wollte. Und zum ersten Mal seit Jahren war ihr der Gedanke an die Vorweihnachtszeit kein Gräuel mehr. Sie stellte fest, dass ihre Augen wirklich geöffnet waren. Aber sie konnte nichts sehen. Es war finster. Neben Schmerz und Übelkeit spürte sie nun auch die Kälte, die ihr Körper wie ein Schwamm aufzusaugen schien. Der Boden, auf dem sie lag, war feucht. Und es gab kein Licht mehr.
Am Morgen noch hatte sie am Fenster gestanden, als es dämmerte. Sie mochte das Licht der Straßenlaternen, wenn es vom Weiß des Schnees reflektiert wurde. Eine Straßenbahn hatte sich Berufspendler einverleibt, so wie ihr Körper jetzt die Kälte. Mehrere tausend Menschen wohnten in den Hochhausblöcken im Osten Darmstadts auf engstem Raum zusammen und doch voneinander getrennt. Sie erinnerte sich. Sie hatte darüber nachgedacht, dass sie bald diese Wohnung verlassen würde, dieses Haus, diesen Stadtteil. Lange hatte sie darauf gewartet, sehr lange. Viel hatte sie dafür getan. Viel geopfert. Aber jetzt …
Weihnachten. Sie würde viele Kerzen anzünden, würde in einem Meer aus Licht baden. Vielleicht würde sie danach sogar ihren Bruder besuchen fahren. Mit seiner Familie gemeinsam das orthodoxe Fest in der alten Heimat feiern. Mit ihren Nichten lachen. Mit ihrer Schwägerin backen. Dort – das war nicht mehr Heimat. Und hier – das war noch keine.
Hier unten, im Dunkel, das war – Tod. Sie musste raus aus dem Dunkel. Sonst würde sie sterben, das wusste sie. Wenn es ihr doch nur gelänge aufzustehen. Sie hob den Kopf. Der Schmerz. Und dennoch, wieder die Melodie: Angely letjat na Jug s utra … – Die Engel fliegen nach Süden am Morgen …
Dann das Geräusch.
Begleitet von gleißendem Licht, das schmerzte wie die Bewegung. Licht, das die Netzhaut verbrennen wollte.
Kto sche ja? Gde sche ja? Tschto eto so mnoi? – Aber wer bin ich? Wo bin ich? Was ist mit mir?
Der Schlag löschte nicht nur die Melodie in ihrem Kopf.
Er beendete auch ihre Hoffungen.
Er beendete ihr Leben.
Montag, 12.12.
Darmstadts Berufsverkehr hatte schon seit jeher erzieherischen Wert. Man mochte sich noch so aufregen über den Stop-and-Go-Verkehr – am Ende siegte die Gelassenheit. Oft aufgrund reiner Ermattung nach langen Schimpftiraden.
Hauptkommissarin Margot Hesgart ließ sich von ihrem Freund Rainer Becker ins Präsidium fahren. Die Wagen auf der Dieburger Straße stauten sich in Richtung Innenstadt schon auf Höhe des Biergartens, noch fast einen Kilometer von der nächsten Ampel entfernt. An den Straßenrändern türmten sich kleine Schneehügel. Der Winter hielt die Stadt fest im Griff.
»Ich fand das wirklich interessant, was dein Vater gestern erzählt hat«, erklärte Rainer, während er den Wagen wieder fünf Meter nach vorn rollen ließ.
»Ich kann es bald nicht mehr hören«, entgegnete sie und seufzte.
Im Gegensatz zu Rainer hatten andere Männer das Problem, vom Vater der Lebensgefährtin kategorisch abgelehnt zu werden oder sich sogar vor einem Hinterhalt mit Schusswaffe fürchten zu müssen. Margot hätte sich gewünscht, ihr Vater würde zumindest ein kleines bisschen mehr in Richtung Schrotflinte tendieren, denn manchmal hatte sie das Gefühl, als würde sich Rainer besser mit ihm verstehen als mit ihr.
»Sei doch froh, dass er so aktiv ist«, erwiderte Rainer gelassen. »Ich finde es klasse, was er so alles auf die Beine stellt.«
Der neueste Tick ihres Vaters war sein Interesse für Russland respektive für die Geschichte des letzten russischen Zaren. Im vergangenen Jahr hatte er sich in einem Komitee engagiert, das eine Ausstellung über Zar Nikolaus II. und dessen Familie konzipierte. Okay, Nikolaus hatte die Darmstädter Prinzessin Alexandra geheiratet. Doch Margot hatte für derartige Heldenverehrung so viel übrig wie ihr Vater für ihre – inzwischen überwundene – Bergsteigerbegeisterung. »Alle sind derzeit auf dem Russlandtrip. Papa organisiert seine Ausstellung, Kollege Horndeich sprach vor seinem Urlaub mit Freundin Anna in Moskau von nichts anderem mehr, mein Sohnemann erzählt nur noch über seine Studienarbeit über orthodoxe Ikonografie – ich habe fast den Eindruck, mein Leben steht kurz vor einer feindlichen Übernahme. Jetzt erzähl nur du mir noch, dass du dich für ein Forschungssemester nach Sibirien zurückziehst.«
Wieder zehn Meter weiter. Zwei Fahrräder fuhren rechts an Margot vorbei. Einziger Nachteil dieser Fortbewegungsart waren die rotgefrorenen Ohrläppchen und die aufgesprungenen Lippen. Rainers BMW war zwar langsamer, aber wenigstens warm.
»Ich wollte nur sagen, dass ich das Thema interessant finde. Und dass ich es bewundere, wie sich dein Vater da reinkniet. Wenn er was macht, macht er es richtig.«
Da mochte Margot ihrem Freund nicht widersprechen. Vor eineinhalb Jahren hatte sich ihr Vater in den Kopf gesetzt, Rainer und sie zu verkuppeln. Auch dieses Projekt hatte er mit einer unglaublichen Gründlichkeit vorbereitet. Nicht dass Margot und Rainer in den fünfundzwanzig Jahren davor einander nicht gekannt hätten. Doch in Bezug auf eine gemeinsame Beziehung war ihr Timing schlichtweg miserabel. In langjährigen Episoden zuvor waren sie füreinander jeweils nur ein Seitensprung gewesen. Nachdem sie dann beide frei gewesen waren, hatten Rainer und ihr Vater schließlich das Komplott zur finalen Eroberung von Margot geschmiedet. Was gelungen war. Und was Margot auch bisher nicht bereut hatte. Keinen Moment. Zumal Ben ihr gemeinsamer Sohn war, wie ein DNA-Test bewiesen hatte. Als Polizistin saß man da ja an der Quelle.
Margot hing ihren Gedanken nach, während Rainer den Wagen Zentimeter für Zentimeter in Richtung Ampel kriechen ließ. Als sie dann links in die Pützerstraße abbogen, war der Weg endlich frei. Verkehrstechnisch lag das Hauptpräsidium der Polizei günstig.
Rainer fuhr die Nieder-Ramstädter-Straße zügig nach Süden.
»Achtung, heute blitzen sie.« Noch so ein Vorteil, wenn man bei der Polizei arbeitete.
Rainer nahm den Fuß vom Gas. Sofort bremste der Wagen um zwanzig Stundenkilometer ab. Also nur noch 10km/h zu schnell.
Wenige Minuten später ließ Rainer den Wagen auf den Parkplatz vor Margots Arbeitsstätte rollen. Er schaltete in den Leerlauf und zog die Handbremse an. »Tschüss, mein Schatz.«
Rainers Hand streichelte sanft Margots Wange, zärtlich, liebevoll. Sie gab ihm noch einen Kuss, den er leidenschaftlicher erwiderte, als sie es erwartet hatte. Sie löste ihre Lippen von den seinen, zögerte und ließ dann ihre Zunge nochmals frech die seine stupsen, bevor ihre linke Hand den Sicherheitsgurt löste.
»Schade«, meinte Rainer.
»Wie ›schade‹?«
»Sehr schade. Habt ihr hier nicht ein Gebüsch für Notfälle?«
»Klar, gleich vor den Fenstern der Ausnüchterungszellen. Gäbe für die Radaubrüder ein tolles Erwachen. Allerdings sagt dein schlaues Auto, dass, wenn ich jetzt gleich die Tür öffne …« – sie beugte sich in seine Richtung, um einen Blick auf die Temperaturanzeige im Armaturenbrett zu werfen – »… minus acht Grad hereinwehen.«
»Wir könnten auch noch mal zurückfahren und …«
»Kannst du gern machen. Ich jedenfalls muss jetzt hoch in den zweiten Stock.«
»Gut, ich gebe auf. – Liese, tu Gutes, eil!«
Schade, sagte auch Margot Hesgarts innere Stimme, zum Glück nur stumm, während ihre rechte Hand bereits die Tür öffnete. »Ciao.«
Margot stieg aus dem Wagen, ließ die Tür ins Schloss fallen und klopfte auf das Dach des Autos – eine blöde Angewohnheit. Sie ging rückwärts auf den Haupteingang des Polizeipräsidiums Darmstadt zu, während Rainer den Gang einlegte und den Wagen langsam vom Parkplatz rollen ließ. Sie warf ihm noch eine Kusshand zu.
Das Thermometer des BMW funktionierte. Minus acht Grad traf wohl ziemlich genau die Temperatur, die ihr der Wind ins Gesicht blies. Aber es gab Stellen ihres Körpers, die die Kälte der Luft ignorierten und wohlige Wärme ausstrahlten. Die Gegend um ihr Herz herum. Na ja, und die irgendwo in der Mitte zwischen Nase und Zehen …
Erst als sie im Büro den Mantel ablegte, erkannte sie, weshalb sich Rainer mit diesem komischen »Liese, tu Gutes, eil!« verabschiedet hatte. Es war ein Palindrom, ein Satz, denn man von hinten wie von vorn lesen konnte. Schon seit sie sich kannten, war es ein Spiel zwischen ihnen, wem als Nächstes ein neues einfiel.
Sie legte ein Kaffeepad in die Kaffeemaschine, stellte einen Becher unter den Auslauf und drückte den großen roten Knopf. Die Maschine brummte, zischte, presste das Wasser durch Kaffee und Sieb. Kaffeearoma verbreitete sich im Raum. Ein Lächeln ließ Margots Gesicht erstrahlen. Vor zwei Wochen hatte sie die schlechteste Kaffeemaschine der Welt gegen eine neue, hochmoderne getauscht. Die kam in poppigem Blau daher, mit großem rotem Startknopf als Zierde. Ein Druck darauf, und die Tasse füllte sich mit aromatischem Bohnensud. Das Ganze schnell, lecker und erschreckend unkompliziert. Sie fragte sich, wieso sie die alte Maschine nicht schon vor einem halben Jahrzehnt in Pension geschickt hatte.
Margots Becher zierte ein gelber Smiley. Rainer hatte ihr die Tasse geschenkt, vor eineinhalb Jahren. Seitdem waren sie ein Paar. Endgültig. Hoffte Margot zumindest. Das vergangene Wochenende sprach dafür. Und die Reaktion ihres Körpers auf einen simplen Abschiedskuss ebenfalls. Sie waren freitags gen Süden gefahren, hatten sich in Füssen ein Musical über den Märchenkönig Ludwig angesehen, und eine gleichsam märchenhafte Nacht war gefolgt. Samstags waren sie mit der Seilbahn auf die Zugspitze gefahren. In dem Moment, in dem sie die Besucherterrasse betreten hatten, war die Wolkendecke aufgerissen, und sie hatten einen fantastischen Blick gen Norden gehabt, über Seen und Wälder, fast bis nach Ulm. Es war einer der Momente gewesen, in dem sie auf die Frage, ob sie Rainer heiraten würde, ein bedingungsloses »Ja« gehaucht hätte. Na gut, vielleicht ein »Ich denke darüber nach«. Gekoppelt an nur ganz wenige Bedingungen. Aber Rainer hatte ja auch nicht gefragt. Schade eigentlich.
Nach seinem Chauffeurdienst zum Polizeipräsidium war er direkt nach Kassel gestartet. Er lehrte als Professor für Kunstgeschichte an der dortigen Uni. Deshalb war er meist die Hälfte der Woche dort. Als er in Margots Haus im Darmstädter Komponistenviertel eingezogen war, hatte er die große Wohnung in Kassel gegen ein kleines Ein-Zimmer-Apartment getauscht. Er würde am kommenden Donnerstag wieder nach Hause kommen.
Nachdem Ben ebenfalls ausgezogen war und mit seiner Freundin Iris in Frankfurt lebte, war ihr Haus unter der Woche ziemlich leer. Dafür würde Weihnachten, so hatte Margot beschlossen, dieses Jahr einfach wunderbar werden. Ben und Iris würden da sein, Margots Vater – und Rainer hat sich sogar angeboten, einen Karpfen zuzubereiten.
Margot seufzte, fingerte nach dem benutzten Kaffeepad, warf es in den nebenstehenden Papierkorb, streute einen halben Löffel Zucker in den Kaffee – gegen die Bitterkeit – und setzte sich an ihren Schreibtisch.
Akten türmten sich neben dem Bereich, den sie »Schreibzone« nannte. Zwar waren im Zeitalter der Computer die Papierberge niedriger geworden, aber vom papierlosen Büro trennten die Mordkommission in Darmstadt sicher noch zehn randvolle Altpapiercontainer.
Den Löwenanteil der Berge nahmen Niederschriften zum jüngsten Mordfall in Darmstadt ein. Ein Unbekannter hatte zwei Wochen zuvor vor der russischen Kapelle einen Wachmann erschlagen. Margot und ihr Team waren der Lösung des Falls seitdem keinen Schritt näher gekommen. Umso mehr freute sich Margot Hesgart, dass ihr Teamkollege Kommissar Steffen Horndeich an diesem Morgen aus seinem dreiwöchigen Urlaub zurückkehren würde. Vielleicht würde ja er in den unzähligen Notizen, Berichten, Aufzeichnungen, Fotos und Zeichnungen auf etwas stoßen, das ihr und den Kollegen Sandra Hillreich und Heribert Zoschke entgangen war.
Margot schaute auf die Uhr: Es war schon kurz nach acht. Eigentlich kam Horndeich immer vor ihr ins Büro. Hoffentlich war die Maschine aus Moskau pünktlich in Frankfurt gelandet.
Margot ertappte sich, dass sie an ihren Kollegen wieder nur mit dessen Nachnamen gedacht hatte. Sie hatte bereits etliche Versuche hinter sich, ihn »Steffen« zu nennen. Doch Horndeich war einfach Horndeich. Fast wie ein Markenname …
Margot fühlte sich immer unwohl, wenn sie in Länder reiste, in denen ein Visum Pflicht war. Noch unwohler fühlte sie sich, wenn sie die Sprache des Landes nicht einmal in Ansätzen beherrschte. Ein Aus-Kriterium für ein Urlaubsziel war eine Schrift, die sie nicht lesen konnte. Insofern rangierte Russland für sie auf einer Ebene mit China und den Arabischen Emiraten.
Margot durchsuchte gerade den rechten Aktenstapel, als ihr Blick auf die Grünpflanzen auf dem Fensterbrett fiel. Diese Bezeichnung allerdings wurde dem Erscheinungsbild nicht mehr gerecht, zumindest nicht bei dem Zyperngras, das durch eine Variation verschiedner Brauntöne entzückte. Die Grünlilie hingegen machte ihrem Namen zwar noch keine allzu große Schande, doch die grasartigen Blätter gehorchten der Schwerkraft, als ob sie die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet hätten.
Margot überlegte, ob sie die braunen Blätter zupfen sollte, doch dann hätte sie die Pflanzen auch gleich mit einer Heckenschere kappen können. Also doch gießen – vielleicht erholten sie sich ja noch, bevor Horndeich auftauchte.
Kollege Steffen Horndeich betrat das Büro, als sie gerade das Gießkännchen über dem ausgetrockneten Boden des Zyperngrases entleerte. Es gab vieles, was ihren Kollegen einfach unverzichtbar machte …
Horndeichs Bartstoppeln und die gleichfarbigen Augenringe zeugten davon, dass er nicht allzu viel Schlaf genossen hatte. Deutlichstes Indiz dafür war jedoch, dass er nach einer knappen Begrüßung kein Wort über die verkümmerten Pflanzen verlor.
»Na, bist du wieder gut zurückgekommen aus dem Reich der Zaren?«, wollte Margot wissen.
Horndeich ließ sich auf seinen Stuhl fallen und seufzte. »Frag mich mal, wie der Flug war«, sagte er.
»Wie war der Flug?«
Horndeich seufzte erneut und winkte ab. »Frag nicht!«
Dann berichtete er über die Rückreise von Moskau: Sicherheitscheck bis auf die Unterhose, Bombendrohung, daraufhin ein Start mit sechs Stunden Verspätung. »Und es war ein erhebendes Gefühl, in 10000Meter Höhe darüber nachzudenken, ob es wirklich nur falscher Alarm gewesen war.«
»Soll ich dir einen Kaffee machen?«
Sein abermaliges Seufzen interpretierte sie als Ja.
Margot legte ein Pad in das Kaffeesieb, verriegelte die Maschine und drückte auf den roten Knopf. Wenige Sekunden später reichte sie dem Kollegen den Becher.
»Neu?«, fragte der und deutete mit dem Kinn in Richtung des blauen Bürogesellen.
Margot erklärte, dass sie das unsägliche Gebräu, das die alte Maschine produziert hatte, nicht mehr habe trinken wollen. Dann wechselte sie das Thema: »Abgesehen von der Rückreise– hattest du einen schönen Urlaub?«
Offenbar wirkte der Kaffee aus der neuen Maschine Wunder, denn schon nach dem ersten Schluck erwachten Horndeichs Lebensgeister, und es sprudelte aus ihm hervor: »Es war klasse. Eine Riesenstadt. Und Annas Verwandte haben mir alles gezeigt. Museen und Geschichte bis zum Abwinken. Und immerhin eine Woche schönes Wetter – wenn auch kalt.« Horndeich nahm einen weiteren Schluck Kaffee. »Und? Was habe ich verpasst in den letzen vier Wochen?«
Margot setzte sich auf ihren Bürostuhl. »Wir haben eine Leiche.«
Horndeich zuckte mit den Schultern. »Geht doch.«
»Wie meinst du das?«
»Na, in vier Wochen eine Leiche …«
»So kann man’s auch sehen«, sagte Margot. »Vor fast genau zwei Wochen«, erläuterte sie. »Ein Wachmann. Ist erschlagen worden. Auf der Mathildenhöhe, vor der Russischen Kapelle. Peter Bender. Fünfundfünfzig. Vom Wachdienst ›Torfeld‹. Mit denen hat die Stadt einen Vertrag.«
Aus Horndeichs Blick war allmählich jegliche Müdigkeit verschwunden. Sogar die Augenringe schienen heller zu sein. »Was muss ich wissen?«
»Okay, hier die Kurzfassung. Am Sonntag, dem ersten Advent, um drei Uhr morgens, stieg ein Einbrecher mit einer Leiter in die russische Kapelle ein.«
Die Russische Kapelle war das Schmuckstück der Darmstädter Mathildenhöhe. Inmitten der Jugendstilbauten nahm sich die Basilika etwas fremd aus – jedoch nur für Touristen. Für Einheimische gehörte die Kirche zum Park wie Schneewittchen zu den sieben Zwergen. Als sie gebaut wurde, war der Hügel noch eine einfache Grünanlage, mit ein paar Gartenhäuschen und Pavillons ausstaffiert. Einzige Attraktion war der Platanenhain, Lustgarten der Fürstenfamilie. Erst einige Jahre später wurde das Areal zum deutschen Zentrum des Jugendstils.
»Der Einbrecher wollte in die Chorempore der Kirche«, fuhr Margot fort. »Die liegt quasi im ersten Stock, über dem Eingangsbereich. Und man kommt nur durch die Seitentür von außen dorthin. Da der Einbrecher offenbar keinen Schlüssel hatte …«
»Haben die meisten nicht«, kommentierte Horndeich fachmännisch, »deshalb brechen sie ein.«
»… hat er eine Leiter benutzt«, fuhr Margot unbeeindruckt fort, »und oben das Seitenfenster eingeschlagen.«
»Und was gab es dort zu klauen?«
»Das fragen wir uns auch. In dem Raum lagern die ganzen Kisten mit Büchern, Madonnenbildern und Notenheften, die unten im Vorraum der Kirche von der russisch-orthodoxen Gemeinde verkauft werden.«
»Und? Was davon hat er mitgehen lassen?«
»Nichts.«
»Nun«, sagte Horndeich, »besser das Gewissen meldet sich spät als nie …«
»Die Leute aus der Kirche sagen zumindest, dass nichts fehlt. Der Täter hat den Raum verwüstet und ist wieder gegangen. Vielleicht aus Frust, vielleicht … Ich habe keine Ahnung. Unten angekommen, wurde er von Wachmann Peter Bender erwartet. Der war in der Nähe, als seine Zentrale meldete, dass die Alarmanlage angeschlagen hat. Er erwartete den Dieb wohl am Fuß der Leiter. Der Einbrecher sah den Wachmann und griff anscheinend sofort an. Es kam zum Kampf. Der Einbrecher konnte ihm den Schlagstock entreißen. Dann schlug er zu. Drei harte Schläge auf den Kopf, und dann ist Bender noch mit dem Schädel auf den gefrorenen Boden geknallt. Danach hat der Täter seine Leiter mitgenommen und ist verschwunden.«
»Ist Bender an den Schlagstockhieben gestorben, oder weil er mit dem Kopf aufschlug?«
Margot zuckte mit den Schultern. »Er starb an einer Hirnblutung infolge der Schläge.«
»Irgendwelche Spuren?«
»Ja. Ein ganzer Berg. Der Täter hat sich an einer Glasscherbe im Fensterrahmen geschnitten und dabei DNA-Spuren hinterlassen. Da die Kirche ja gerade renoviert wird, haben die Kollegen auch eine Menge anderer Spuren eingesammelt: Zigarettenkippen, Bierflaschen, sogar eine neue Leiter in einem angrenzenden Gebüsch. Aber all das hat zu nichts geführt.«
Horndeich stand auf und ging zum Fenster. »War es vielleicht nur ein fingierter Einbruch? Könnte es persönliche Motive für einen Mord geben?« Horndeich war ganz bei der Sache. Sonst hätte er sich spätestens jetzt über die Pflanzenleichen auf dem Fensterbrett beschwert.
»Sieht nicht so aus. Bender war verheiratet, hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, beide bereits erwachsen, und im gesamten Familien- und Bekanntenkreis fanden wir keinen einzigen Hinweis auf ein mögliches Motiv – kein Streit, keine Eifersucht, Schulden oder ähnliches. Er war auch nicht vermögend und hatte sich die kleine Lebensversicherung, die er abgeschlossen hatte, bereits auszahlen lassen. Es läuft wohl wirklich darauf hinaus, dass er einen Einbrecher überraschte. Der hat einfach nicht mit einem Wachmann gerechnet – um drei Uhr nachts bei fast zehn Grad minus.«
»Und?«
»Nichts weiter.«
Horndeich schüttelte den Kopf. »Ich meine, wie gehen wir jetzt weiter vor?«
»Ich schlage vor, du schaufelst dich erst mal durch die Akten. Vielleicht fällt dir ja was auf, was wir anderen gewöhnlichen Sterblichen übersehen haben.«
Horndeichs Blick wanderte zu den beiden Aktenstapeln auf dem Schreibtisch seiner Vorgesetzen; sie riefen in ihm eine vage Assoziation mit den Petrona-Twin-Towers im malaysischen Kuala Lumpur hervor, insbesondere deshalb, weil die beiden einstmals weltweit größten Hochhäuser im einundvierzigsten Stock mit einer Brücke verbunden waren. Im Falle der Bürokonstruktion ragte aus dem linken Stapel eine rote Aktenmappe heraus und stützte so den rechten ab.
Margot folgte seinem Blick und sagte: »Vorsichtig, ganz vorsichtig.«
»Warum?«
»Ist auch ohne Erdbeben einsturzgefährdet.« Sie schaute auf ihre Armbanduhr. »Ich habe einen Termin mit einem gewissen Herrn Plawitz. Er ist Experte für russische Kunstgegenstände– vielleicht weiß er etwas über wertvolle Schätze in der Russischen Kapelle, von denen wir nichts wissen.«
Horndeich schien überrascht. »Meinst du etwa Caspar Plawitz?«
»Kennst du ihn?«
»Anna ist mit den beiden ukrainischen Schwestern befreundet, die den Stand der Partnerstadt Uschgorod auf dem Weihnachtsmarkt betreuen. Die Schwestern und ein Bekannter übernachten bei Plawitz, hat mir Anna erzählt. Er nennt offenbar eine hübsche Hütte sein Eigen, mit reichlich Platz und einem eigenen Gästehaus.«
»Genau der«, sagte Margot und drehte sich zur Tür um. »Ich bin auf dem Handy zu erreichen und gegen elf wieder hier.«
»Alles klar.« Horndeich wagte sich ans Umschichten der Petrona-Towers, machte daraus erst mal vier kleinere Aktenberge und wuchtete einen davon auf seinen Schreibtisch.
»Margot?«
»Ja?«
»Wenn du an einem Gartengeschäft vorbeikommst – drei neue Töpfe mit Zyperngras wären nicht schlecht …«
Margot hielt ihre Hände von sich gestreckt und schaute auf ihre nach oben gerichteten Daumen. »Sorry, meine sind nicht grün.«
Caspar Plawitz residierte in einer riesigen Villa an der Heidelberger Straße am Südrand Darmstadts. Das Gästehaus daneben wirkte im Vergleich zur Villa geradezu winzig. Der Garten lag unter einer Decke von Schnee – einer weiten weißen Fläche, die sich hinter dem Haus sicher vierzig Meter in die Tiefe zog. Von der Straße aus war die Größe des Anwesens gar nicht richtig abzuschätzen. Die Fachwerkvilla hatte drei Stockwerke. Zwei Türmchen ließen das Gebäude wie ein Schlösschen wirken.
Plawitz empfing Margot Hesgart zuvorkommend. »Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«, fragte er, als er sie durch eine Empfangshalle in sein Arbeitszimmer im ersten Stock geleitete.
»Gerne«, antwortete sie.
Plawitz verschwand für einen Augenblick, den Margot dazu nutzte, sich umzuschauen. Sie hatte sich durch das gediegene Ambiente der Hausfassade täuschen lassen und ein Arbeitszimmer mit dunklen schweren Möbeln erwartet. Doch Chrom und Glas dominierten den hellen und großen Raum. Der Schreibtisch war aufgeräumt, ein Foto in goldenem Rahmen war der auffälligste Gegenstand. Eine Frau mit dunklen, langen Haaren lächelte den Betrachter aus wachen, intelligenten Augen an.
»Meine Frau Galina«, erklärte Plawitz, als er wieder eintrat und Margot vor dem goldgerahmten Foto stehen sah.
Sie setzten sich in bequeme Sessel, die um einen kleinen Couchtisch gruppiert waren.
Margot erkundigte sich nach eventuellen Kunstschätzen in der Russischen Kapelle. »Gibt oder gab es Ihres Wissens nach Gegenstände, an denen ein Dieb hätte interessiert sein können?«
»Nein, da muss ich Sie enttäuschen. In der Chorempore befinden sich keine Kunstgegenstände«, antwortete Plawitz. »Im Kirchenraum stehen einige liturgische Gegenstände, die der Gemeinde für den Gottesdienst dienen, aber das sind keine Kunstschätze mit besonderem Wert. Die Ikonostase ist sicher das Wertvollste, aber …«
»Die was?« Margot kannte die Kapelle auch von innen und hatte sie während der Ermittlungen öfter besucht als in ihrem ganzen Leben zuvor. Was jedoch nicht bedeutete, dass sie Expertin war.
»Die Ikonostase ist die mit Ikonen geschmückte Eichenwand. Sie trennt die Gläubigen von dem Altar, an dem der Priester die Mysterien feiert.«
Margot war die reichlich verzierte Wand in der Kirche durchaus aufgefallen, und sie hatte sich darüber gewundert, dass die Kirche quasi geteilt war. »Die Tür darin ist immer geschlossen?«
Plawitz lachte. »Nein, während des Gottesdienstes ist sie geöffnet, damit die Gemeinde freien Blick auf den Altar hat.«
Es klopfte an der Tür. Eine Hausangestellte trat ein und brachte zwei Tassen Cappuccino. In ihrem schwarzen Kleidchen mit der weißen Schürze passte die junge Frau weit besser in das Haus als die modernen Möbel.
»Und sonst gibt es dort nichts Wertvolles? Etwas, das nicht die Ausmaße von drei Kleiderschränken hat?«
»Nun, die Mosaiken haben schon einen gewissen Wert. Sie sind sehr filigran ausgeführt. Aber die sind ja noch da. Und auch der kleine Stein-Sarkophag ist nur für die Liturgie wichtig. Und ebenfalls noch vorhanden …«
»Nochmals zurück zu der Chorempore. Gab es dort vielleicht irgendwelchen Schmuck?«
»Nein, ganz gewiss nicht. Nicht einmal, als die Empore noch Fürstenloge hieß.«
»Fürstenloge?« Margot hatte den Begriff noch nie gehört, obwohl sie in den vergangenen Wochen einiges über die Kapelle gelernt hatte. 1897 war der Grundstein gelegt und zwei Jahre später war die Kirche eingeweiht worden. Alexandra, die Tochter des regierenden Darmstädter Fürsten Ludwig, hatte 1894 den Thronfolger Russlands geheiratet. Nach der Hochzeit wollte das russische Herscherpaar, wenn es die Verwandtschaft in Darmstadt besuchte, nicht auf Gottesdienste nach russisch-orthodoxem Glauben verzichten. Also ließ der Zar die Kapelle bauen – aus privaten Mitteln. Einige wenige Messen wurden in der kleinen Kirche abgehalten, doch mit Beginn des Ersten Weltkriegs standen die Familienmitglieder plötzlich auf verschiedenen Seiten der Schützengräben – der Zar hatte Darmstadt in dieser Zeit aus naheliegenden Gründen nicht mehr besuchen können. Die Russische Kapelle war erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wieder für Gottesdienste genutzt worden.
»Das, was wir heute Chorempore nennen, war seinerzeit die Fürstenloge«, klärte Plawitz die Kommissarin auf. »Während der Gottesdienste nahm die Zarenfamilie dort oben Platz.«
»Und man schmückte die Empore nicht mit Kunstgegenständen aus, die die Position der Familie unterstrichen hätten?«
»Nein, im Gegenteil. Weder der Zar noch seine Gattin legten gesteigerten Wert auf Pomp. Alexandra war eine tiefgläubige Frau. In der Kirche suchte sie Gott, nicht irdische Herrlichkeit.«
»Also kein Gold?«
»Definitiv kein Gold.«
Margot seufzte. Sie kam in diesem Fall keinen Schritt weiter. Sie stellte gerade die leere Tasse ab, als sich ihr Handy meldete.
Sich durch Aktenberge zu wühlen zählte nicht gerade zu Horndeichs Lieblingsbeschäftigungen. Auf der Skala der zehn meist gehassten Tätigkeiten nahm Aktenstudium einen der vorderen Plätze ein. Zwar hinter Bügeln, aber noch deutlich vor Wäschewaschen. Ganz anders sah es seit etwa einer Stunde mit dem Projekt »Essen fassen« aus, was Horndeichs Magen bereits mehrmals lautstark kundgetan hatte. Doch wenn sie den Kerl schnappen wollten, der Peter Bender auf dem Gewissen hatte, blieb Horndeich nichts anderes übrig, als sich mit den Fakten vertraut zu machen. Und so musste das Essen warten, zumindest bis die werte Kollegin wieder im Büro war.
Horndeich gewann immer mehr den Eindruck, als wäre Peter Bender einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Seine Kollegen beschrieben ihn als sehr gewissenhaft. Die letzte Runde über die Mathildenhöhe – wenn man den Aussagen der Kollegen Glauben schenken durfte – hätte kein anderer mehr freiwillig gemacht. Im Sommer waren die Grünflächen der Anlage dicht bevölkert und die Bänke stets besetzt. Gitarrenspieler zupften – oder traktierten – dann dort die Saiten, begleitet von den Gesängen ihrer Fanclubs. Jugendliche feierten friedlich von Freitagnachmittag bis Montag früh. Deren Vergehen lag meist darin, dass sie davon ausgingen, leere Bierflaschen und Zigarettenkippen würden den Weg zum Mülleimer selbst finden. Im Winter war die Mathildenhöhe ein sehr ruhiger Ort. Ab und an traf man Liebespärchen an, die romantischen Gedanken nachhingen oder sich sogar gegenseitig wärmten; einmal hatte Bender – so ein Kollege – ein Pärchen erwischt, das sich in den zugewachsenen Pfeilergängen am Hügel vor dem Ausstellungsgebäude geliebt hatte. Im November. Das musste wahre Liebe sein. Im vergangenen Dezember war da noch der Sprayer gewesen, der davon überzeugt gewesen war, dass das Ausstellungsgebäude deutlich an Attraktivität gewinnen würde, wenn er es mit seinem ein Quadratmeter großen Logo in feschem Lila schmückte. Aber das markierte auch schon das obere Ende der Skala an kriminellen Ereignissen, mit denen es Bender in der letzten Zeit zu tun gehabt hatte.
Der letzte Einbruch auf der Mathildenhöhe hatte sich im vergangenen Jahrhundert ereignet. 1987 hatten Einbrecher offenbar Gemälde aus dem Ausstellungsgebäude stehlen wollen. Der Versuch war jedoch schon an der Alarmanlage gescheitert.
Auch das private Umfeld von Rainer Bender ergab keinerlei Hinweise auf ein mögliches Mordmotiv: Die Ehe schien intakt, die Kinder waren erwachsen und beide berufstätig, das Haus war abbezahlt, das Auto auch – eigentlich hätte Bender den Rest seines Lebens genießen können. Seine Frau arbeitete als Grundschullehrerin und hatte deutlich mehr verdient als ihr Mann. Sie hatte noch zwei Lebensversicherungen laufen, bei denen er der Begünstigte gewesen wäre. Hätte Bender seine Frau umgebracht, man hätte ein mögliches Motiv gehabt. Aber umgekehrt?
Horndeich wühlte sich durch die papierne Manifestation fehlender Spuren. Vielleicht, so überlegte er, sollte er seine Einstellung zum Bügeln nochmals kritisch hinterfragen. Schlimmer als das hier konnte es kaum sein.
Er stand vom Schreibtisch auf, wandte sich der Kaffeemaschine zu, legte ein Kaffeepad ein, stellte seinen Becher unter die Düse und drückte die große rote Taste. Die Maschine erwachte zum Leben, räusperte sich – und kredenzte wenig später den herrlich duftenden Trank. Praktisch, dachte er, nahm den vollen Becher und begann eine Wanderung durchs Büro. Die wurde erneut akustisch vom Brummen seines Magens untermalt. Es war definitiv Zeit für ein Häppchen. Aber er wollte noch auf Margot warten.
Er nippte am flüssigen Ersatz. Die Akten offerierten ihm auf den ersten Blick keinen neuen Ansatz. Er fragte sich, wie er den Fall weiterverfolgen sollte. Noch hatte er keine Ahnung. Aber zumindest hatte er feststellen können, dass ihn die neue Kaffeemaschine bei seiner schweren geistigen Arbeit unterstützte und nicht behinderte. Er leerte den Becher in dem Moment, als das Telefon klingelte.
»Steffen Horndeich, Polizei Darmstadt, K10.«
Margots Stimme drang aus dem Telefon. »Horndeich? Setz dich in den Wagen, und komm zum Biergarten in der Dieburger Straße.«
»Ist’s dort nicht ein bisschen kalt? Wollen wir nicht lieber einen Döner bei Efendi –?« Die Neandertalerinstinkte hatten voll durchgeschlagen. Sein Körper war inzwischen so auf Nahrungsaufnahme programmiert, dass er erst mit etwas Verzögerung bemerkte, dass Margot gewiss nicht von einem gemeinsamen Mittagessen gesprochen hatte. Er schaltete das Programm wieder auf »Job« um.
»Gibt’s etwa noch ’ne Leiche?«
»Offenbar bist du unter die Hellseher gegangen«, stöhnte Margot.
»Verdammt.« Horndeichs Magen war schlagartig still. Gut dressiert. Doch nicht nur Neandertaler. »Bin gleich da.«
Zwei Leichen in vier Wochen, dachte Horndeich, während er den Hörer sinken ließ. Nein, innerhalb von zwei Wochen, wenn man es genau nahm. Das war dann doch etwas viel …
Als Horndeich das Auto aufschloss, fielen ihm die ersten Flocken auf die Stirn. Nachdem er von der Klappacher Straße auf die Nieder-Ramstädter Straße abgebogen war, musste er bereits die Scheibenwischer einschalten. Am Roßdörfer Platz gab er den Wischern die Sporen, um die Fahrbahn durch den weißen Wirbel hindurch noch zu erkennen. Darmstadt lag nicht häufig unter Schneemassen verdeckt. Doch dieser Winter schien im Hohen Norden Nachhilfeunterricht genommen zu haben.
Auf einem Grundstück an der Kreuzung der Dieburger Straße mit dem Fiedlerweg befand sich der Biergarten. Eine drei Meter hohe Mauer zog sich hinter dem Bürgersteig entlang, so dass das Freiluftgasthaus quasi im ersten Stock lag. Im Winter waren die Zugangstüren zu den Treppenaufgängen verschlossen, ebenso die Tür zum ebenerdigen Zugang auf der anderen Seite. Im Sommer tummelten sich dort Gäste zwischen sechzehn und sechzig unter den großen alten Kastanienbäumen. Bei frisch gezapftem Bier und Fleisch vom Grill hatte auch Horndeich im zurückliegenden Sommer einige Abende dort genossen. Doch im Winter sah das Gelände trostlos aus, wenn auch der Schnee den Bäumen zumindest die Nacktheit nahm. Die Kennlichter der Einsatzfahrzeuge warfen blaue Blitze in das Schneetreiben.
Horndeich stellte den Wagen am Ende der Schlange von Polizeifahrzeugen ab und ging zu den Kollegen, die bei dem Eingang standen, der in die Mauer eingelassen war und den Horndeich bislang nie bewusst wahrgenommen hatte. Die geöffnete Gittertür führte nämlich nicht nach oben in den Biergarten, sondern über eine Treppe in die Tiefe. »Runter?«, fragte er den uniformierten Kollegen, der den Zugang wie ein Türsteher bewachte.
Der Polizist nickte, und Horndeich stieg die Treppenstufen hinab. Etwa vier Meter tiefer gelangte er durch einen gemauerten Türrahmen auf einen Treppenabsatz. Seine Kollegin Margot stand dort, war kreidebleich und hielt eine qualmende Zigarette in der Hand. Das hatte Horndeich noch nie an ihr gesehen.
»Was haben wir?«, fragte Horndeich sachlich.
»Keinen schönen Anblick.« Wenn Margot das Gespräch so eröffnete, dann musste die Szenerie wirklich unappetitlich sein. Margot inhalierte einen tiefen Zug des Glimmstängels. »Eine junge Frau. Mitte zwanzig. Erschlagen. Baader und Häffner sind noch bei der Spurensuche. Du kannst aber schon mal einen Blick von oben draufwerfen. Die Kollegen wollen erst mal alles sichern, bevor wir ihnen zwischen den Füßen rumlaufen.«
Einen Meter neben Margot befand sich in der Steinwand ein weiterer Durchgang, von dem aus die Treppe weiter nach unten führte. Horndeich sah unten Licht schimmern. Er stieg die Stufen in das Kellergewölbe hinab, das von mehreren Scheinwerfern taghell erleuchtet war. Noch bevor er den Fuß der Treppe erreichte, konnte er den Raum überblicken. Der Anblick traf ihn trotz Margots Warnung mit voller Härte. Das Gewölbe war etwa acht Meter breit, führte sicher zwanzig Meter in die Tiefe und war vier Meter hoch. Horndeich schätzte, dass er sich acht bis neun Meter unter der Straße befand.
In der Mitte des Raums lag eine Frau. Horndeich erkannte mit einem Blick, dass sie nicht mehr lebte. Abgesehen von dem Blut, das sich mit den Wasserpfützen des Bodens vermischt hatte, gab es ein weiteres und recht eindeutiges Indiz: Der Dame fehlte der linke Teil ihres Gesichts. Wo einst Wange, Auge und Schläfe gewesen waren, befand sich nur noch eine braune Masse. Jemand hatte ihr den Schädel eingeschlagen. Horndeich schluckte.
Die Frau war fast nackt. Ihre blaue Hose lag drei Meter links neben ihr, Slip und Turnschuhe rechts. Horndeich war sich sicher, dass sein Teint in diesem Moment durchaus mit dem von Margot konkurrieren konnte. Denn er wurde auch blass, wenn er wütend wurde, und Schock und Zorn gaben sich bei ihm soeben ein Stelldichein.
Die Beamten der Spurensicherung verrichteten ihren Job mit geübter Routine. Doch auch ihnen schien das Bild gehörig an die Nieren zu gehen. Außer knappen Anweisungen wie »Licht!« oder »Foto!« schwiegen sie.
Horndeich ging zurück zu Margot.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte Horndeich.
»Die Kollegen vom ersten Revier haben einen anonymen Anruf bekommen, dass hier unten eine Tote liege. Zwei Beamte kamen her, aber der Eingang war natürlich zu. Sie riefen den Besitzer des Biergartens an, der schickte eine Assistentin mit einem Schlüssel vorbei. Sie öffnete das Tor, und eine Minute später standen die Kollegen vor der toten Frau.«
»Was ist das hier unten eigentlich?«
»Keine Ahnung. Das muss uns der Besitzer erklären. Er heißt Konrad Stroll und sollte gleich eintrudeln.«
»Haben die Kollegen den Anruf zurückverfolgen können?«
»Nein. Und der Kollege meinte auch, der Typ – wahrscheinlich war es ein Mann – hätte sich wohl irgendwas vor den Mund gehalten. Hat auch nicht viel gesagt. Eben nur, dass in den Kellern unter dem Biergarten eine tote Frau liege.«
In diesem Moment stieß ein kleiner, etwas untersetzter Mann zu Horndeich und Margot.
»Hallo, Kollege Hinrich«, grüßte Margot den Herrn. Martin Hinrich war Gerichtsmediziner in Frankfurt. Immer wenn in Darmstadt Leichen gefunden wurden, deren Todesursache auf ein Verbrechen schließen ließ, schaute sich der Pathologe aus Frankfurt die Toten an.
»Hallo. Wo liegt sie?«
Noch bevor Margot antworten konnte, kam Paul Baader die Treppe hoch und sagte: »Ihr könnt jetzt zu ihr.« Sein Tonfall verriet, dass ihn das Bild der Toten noch lange beschäftigen würde.
Gemeinsam mit Hinrich und Baader stiegen Margot und Horndeich zu der Leiche hinab. »Oh-oh«, entfuhr es auch dem hartgesottenen Arzt. Während er sich neben die Tote kniete, warf Margot einen Blick auf die Kleidung, die sie beim ersten Hinschauen nur flüchtig wahrgenommen hatte.
Baader trat neben sie. »Seltsame Klamotten«, flüsterte er, als ob er fürchtete, die Frau könne ihn noch hören. »Das ist keine Hose, das ist ein richtiger Blaumann, wie ihn die Arbeiter auf dem Bau tragen. Noch fast neu. Die Hose passt nicht zu der Bluse und dem Rest der Kleidung. Und die Jacke ist alt und schmuddelig. Seltsames Bild. Und da hinten liegt noch eine zerbrochene Taschenlampe.«
Margot besah sich die Kleidungsstücke, während Hinrich begann, die Tote zu untersuchen.
Horndeich kniete neben dem Arzt. Der hatte inzwischen die Körpertemperatur gemessen und den Kopf der Toten genau betrachtet. Hinrich atmete hörbar aus – ein Zeichen, dass er einen Gedankengang beendet hatte.
»Und? Was können Sie sagen?«
»Sie ist etwa seit zwei Tagen tot. Ich denke, sie wurde am vergangenen Samstag umgebracht. Ob früh oder spät – das kann ich euch sagen, wenn ich sie in Frankfurt auf dem Tisch hatte.«
Mit dem Gedanken an Hinrichs »Tisch« wollte sich Horndeich nicht eingehender beschäftigen. Auch er hatte schon einer Obduktion beiwohnen müssen. Ein Hobby war etwas anderes …
Margot hockte sich neben Horndeich.
»Sie hat zwei Wunden am Kopf«, dozierte Hinrich. »Eine rechts am Hinterkopf. Sieht so aus, als sei sie mit dem Schädel auf den Stein hier geschlagen.« Er deutete auf einen flachen Klinker, der ein paar Zentimeter rechts aus dem Bodenpflaster hervorlugte. Die dunkelbraune Schicht darauf schien Hinrichs Theorie zu erhärten.
»Tja, und dann diese Wunde.« Der Pathologe deutete auf die fleischig braune, von verklebten Haaren umgebene Masse, die einmal die linke Gesichtshälfte gewesen war. »Stumpfer Gegenstand, wahrscheinlich dieser hier.« Hinrich deutete einen Meter neben den Kopf der toten Frau. Dort lag ein Stein von der Größe einer Wasserflasche. Er wies an der Unterseite ebenfalls die braunschwarze Färbung auf.
»Die vordere Wunde war wohl die tödliche, wenn ihr nicht jemand vorher Gift gegeben hat.«
»Sonst noch was?«
Hinrich hob den linken Arm der Toten an, betrachtete die Hand. »Ich ziehe die Vergiftungsthese zurück. Sie hat sich gewehrt. Wer immer ihr das angetan hat – hier unter den Fingernägeln hat er sich verewigt. Findet jemanden mit Kratzspuren, checkt die DNA – dann habt ihr den Dreckskerl.« Es kam nicht oft vor, dass hinter Hinrichs flapsiger, bisweilen zynischer Fassade Gefühlsregungen hervorblitzten. Keine Sekunde später hatte er sich auch schon wieder im Griff. »Hier sind ein paar Würgemale – vor dem Tod zugefügt. Ich nehme an, Jane Doe hat sich mit dem Täter einen heftigen Kampf geliefert.«
Jane Doe. Sie hatten noch keine Ahnung, wer die junge Frau war. Jane Doe nannten die Amerikaner ihre unbekannten weiblichen Leichen, und Hinrich hatte es irgendwann übernommen. Baaders Team hatte in der Kleidung keinen Ausweis gefunden. Abgesehen von einem Schlüsselbund waren die Taschen leer gewesen. Margot hoffte, dass sie »Jane« bald ihren richtigen Namen zurückgeben konnten.
»Ist sie …?« Horndeich mochte es nicht aussprechen, deutete mit dem Kinn in Richtung des Slips.
»Keine äußeren Verletzungen. Aber Genaues kann ich euch erst sagen, wenn ich sie auf meinem …«
»Schon klar«, unterbrach ihn Horndeich, der nicht nochmals daran erinnert werden wollte, was der Arzt mit der Toten in Frankfurt alles anstellen würde.
»Können Sie sonst noch was sagen?«, fragte Margot.
»Nichts, was Sie nicht auch erkennen: Sie ist Mitte zwanzig. Die Gesichtszüge – also der rechte Gesichtszug … er wirkt slawisch; sie stammt wahrscheinlich aus Osteuropa. Alles Weitere kann ich euch wirklich erst sagen, wenn ich sie auf dem …«
»Danke!«, unterbrach ihn Horndeich.
Ralf Marlock, ebenfalls in Margots Team, trat auf sie zu. »Da ist ein Herr Stroll. Sagt, Sie wollten ihn sprechen. Soll ich ihn runterschicken?«
»Nein, ich hole ihn ab. Der Anblick ist schon für uns schwer zu ertragen.« Margot begleitete Marlock zu dem kleinen Absatz zwischen den Treppengängen, wo sie kurz vorher nach über drei Jahren Pause wieder dem Verlangen nach einer Zigarette erlegen war. Ein rundlicher Herr von etwa sechzig Jahren sah sie freundlich an. Er trug Anzug und Krawatte. Die nassen Flecken auf dem Mantel kündeten davon, dass es draußen immer noch schneite.
Margot stellte sich vor.
»Sehr angenehm«, erwiderte Stroll. »Sie haben hier unten eine Tote gefunden?«
»Ja.«
»Mein Gott, das ist ja schrecklich!«
»Ich möchte Sie bitten, sich die Leiche kurz anzusehen. Vielleicht kennen Sie sie.«
»Ja. Natürlich.«
Margot begleitete den Mann nach unten. Sie schaute nicht hin, doch den Moment, in dem Stroll die Tote sah, konnte sie akustisch ausmachen.
»Mein Gott!«, hauchte er.
»Sie kennen sie?«
»Nein. Ich sehe sie zum ersten Mal. Wer macht so was?«
Das würde ich auch gern wissen, dachte Margot. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ihr gelungen, gegenüber der Szene, die sich ihr bot, professionelle Distanz zu wahren – von der Zigarette und der Leichenblässe in ihrem Gesicht einmal abgesehen. Doch in diesem Moment drängten die Emotionen mit aller Macht an die Oberfläche. In ihrer Halb-Nacktheit war die junge Tote jeglicher Würde beraubt worden. Margot war froh darüber, dass der Täter in diesem Moment nicht in ihrer Nähe war. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich wirklich hätte beherrschen können. Ob sie nicht auf ihn losgegangen wäre …
»Muss ich noch näher ran?«, fragte Stroll. »Ich kenne sie wirklich nicht.«
»Nein, entschuldigen Sie.«
Beide verließen den Keller und standen bald darauf auf dem Bürgersteig.
»Ihnen gehört dieser Keller?«, fragte Margot.
Obwohl die Temperatur deutlich unter null lag, tupfte sich Stroll mit einem Taschentuch die Stirn ab. »Ja und nein. Also, der Keller, in dem die Tote liegt, gehört mir, weil mir der Biergarten darüber gehört. Doch das hier ist nur ein kleiner Teil der Katakomben.«
»Katakomben?«
»So nennen wir die Gewölbe. Reines Marketing. Hier unten gibt es natürlich keine echten Leichen.« Kaum hatte er es ausgesprochen, wurde Stroll klar, dass die Leiche im Keller durchaus echt war. Er errötete. »Also – ich meine …«
»Was sind das für Gewölbe?«, überging Margot den Fauxpas.
Stroll schien dankbar, dass sie ihn aus dem Fettnäpfchen zog. »Der Keller dort unten gehört zu einem großen unterirdischen System. Vor hundertfünfzig Jahren haben die Brauereien diese Keller in den Fels schlagen lassen – vor der Erfindung der Kühlmaschinen war dies der ideale Ort, um Bier zu lagern. Dort unten beträgt die Temperatur konstant neun Grad, im Sommer wie im Winter. Das war für die Brauereien ideal. Zwölf von ihnen haben damals ihr Bier dort untergebracht. Unser Keller gehörte zur Wiener Brauerei. Die gibt’s seit fünfunddreißig Jahren nicht mehr. War eine der wenigen, die nach dem Krieg an dem Standort überhaupt weitergemacht haben.«
»Das heißt, es gibt noch weitere Keller?«
»Zahlreiche.«
»Sind die miteinander verbunden?«
»Ja. Aber durch Krieg und Neubauten sind nicht mehr alle zugänglich. Sie reihen sich mehr oder weniger entlang des Brauertunnels, der von hier bis zum Schloss führte. Den Tunnel gibt es schon viel länger. Durch ihn wurde früher mal der Schlossgraben bewässert.«
Margot entfaltete in ihrem Kopf einen virtuellen Stadtplan. Das Schloss lag etwa einen Kilometer westlich.
Stroll fuhr fort: »Und für die Brauereien diente er als Abfluss für das Schmelzwasser des Kühleises.«
»Werden die Keller heute noch genutzt?«
»Sie sind nur noch Touristenattraktion – im Sommer veranstalte ich sogar Führungen.«
»Und wie sieht es im Winter aus? Ich meine, es ist dort unten doch sowieso immer gleich kalt und gleich finster.«
»Im Winter soll eigentlich keiner hier herumlaufen. In einigen Seitenkellern halten ganze Geschwader von Fledermäusen Winterschlaf.«
»Ist dieser Eingang der einzige Zugang zum Kellersystem?«, fragte Margot.
»Nein, es gibt noch weitere. Aber das ist der einfachste Zugang.«
»Haben Sie einen Plan von den Kellern?«
»Ja, in meiner Wohnung.«
»Könnten Sie uns den aufs Revier bringen? Sie könnten uns dann auch vielleicht genauer erklären, welche Keller von wo aus zu erreichen sind. Denn ich fürchte, wir werden uns dort ziemlich gründlich umsehen müssen.«
»Selbstverständlich. Wann soll ich zu Ihnen kommen?«
»Sagen wir, in einer Stunde«, sagte Margot.
Horndeich sah sich noch im Raum um, als wenig später zwei Kollegen einen Plastiksarg ins Gewölbe trugen. Margot begleitete sie. Unwillkürlich wurde Horndeich an die Zeit erinnert, als er seinen Zivildienst absolviert hatte. Er war auf einem Rettungswagen mitgefahren. Er erinnerte sich, wie er mit Kollegen eine Hundert-Kilo-Frau aus einem engen Dachgeschoss durch ein schmales Treppenhaus gewuchtet hatte. Drei Jungs waren sie gewesen. Als die Dame endlich im Sanka lag, waren sie alle nass geschwitzt.
Die Beamten legten die Tote in den Sarg; Horndeich konnte den Blick nicht von dem Geschehen abwenden. Sie schlossen den Deckel, hoben den Kunststoffbehälter an. Horndeich sah ihnen nach, als sie wieder den Keller durchquerten. Nachdem der vordere Beamte die ersten Treppenstufen erklommen hatte, geriet der Sarg zunehmend in Schräglage. Ein Rumpeln dröhnte aus dem Innern durch den stillen Raum.
Gefolgt von einem lautstarken Knurren von Horndeichs Magen.
Es gab Momente, in denen hasste er seinen Job. Dieser gehörte dazu.
Auf Horndeichs Schreibtisch – inzwischen von den Schichten der Petrona-Twin-Towers befreit – lag eine farbige Karte. Sie zeigte die Region zwischen Biergarten und Schloss. Mehrere verschiedenfarbige Kästchen markierten die Keller und Gewölbe des unterirdischen Systems.
Margots Blick und der ihres Kollegen folgten Konrad Strolls Zeigefinger, der gerade über einen gelben Streifen fuhr, der unter der Bezeichnung »Dieburger Straße« gezogen war.
»Das ist der Brauertunnel, von dem alle Keller abzweigen. Und hier haben Sie die Tote gefunden«, erklärte Stroll.
Der Fundort der Leiche befand sich in einem gelben Kästchen. Gleich daneben waren einige Rechtecke rot markiert. »Die hier sind verschüttet«, erklärte Stroll und tippte mit der Fingerkuppe darauf. »Dann gibt es hier und hier wahrscheinlich noch Keller«, fuhr er fort, mit dem Finger auf blaue Bereiche deutend, »aber das ist nicht ganz sicher.«
»Nicht ganz sicher?« Horndeich blickte auf. Inzwischen hatte eine handverlesene Auswahl kulinarischer Spezialitäten des Burger King Drive-in seinen Magen ruhig gestimmt.
»Durch Krieg und Bauarbeiten sind einige Zugänge verschüttet oder einsturzgefährdet. Durch die wagt sich keiner freiwillig. Was dahinter liegt, wissen wir nicht genau. In alten Unterlagen sind noch weitere Keller erwähnt, aber wir können ihre Lage nur erahnen. Wissen Sie, genau genommen interessiere ich mich für die Katakomben erst seit zehn Jahren.«
»Wegen der Touristenführungen?«, vermutete Horndeich.
»Auch«, bestätigte Stroll, »aber ich bin auch ganz privat einfach neugierig. Inzwischen habe ich ein paar Mitstreiter, aber wir stehen noch ziemlich am Anfang der Forschung.«
»Wo sind denn die anderen Zugänge, die Sie vorhin erwähnten?«
»Hier kann man durch noch eine Tür nach unten gelangen.« Stroll zeigte die entsprechende Stelle auf der Karte. Der Eingang lag etwa hundertfünfzig Meter westlich, ebenfalls in der Dieburger Straße.
Margot schaute auf die Markierung. »Aber zwischen den Kellern, zu denen die Türen jeweils führen, gibt es keine direkte Verbindung, oder?«
»Doch, über den Brauertunnel. Wobei die Verbindungen zwischen Tunnel und Keller nur schmale Röhren sind. Da müssen Sie auf allen vieren durchrobben.«
»Ist diese andere Tür auch abgeschlossen?«
»Ja, und einen Schlüssel dafür habe ich nicht. Den hat der Besitzer des Grundstücks, Herr Dellberg. Ich kann Ihnen die Telefonnummer geben.«
»Gibt es noch weitere Zugänge?«
»Nein, keine direkten. Von einigen Altbauten in der Dieburger Straße führten zwar mehrere direkte Zugänge zum Tunnel, aber die Hausbesitzer haben sie inzwischen alle zugemauert. Sie hatten irgendwann die Nase voll von neugierigen Hobby-Höhlenforschern, die plötzlich durch eine Tür in ihre Waschküche schlurften.«
»Und wo endet der Tunnel?«, fragte Horndeich. »Gibt es dort einen Zugang?«
»Sehen Sie hier – vom Biergarten aus führt er noch etwa fünfhundert Meter westlich in Richtung Stadt bis zur Pützerstraße. Als die gebaut wurde, krachte der Tunnel dort ein. Und am anderen Ende, keine fünfzig Meter von unserem Eingang entfernt, wo die Odenwaldbrücke über die Bahngleise führt, da gab es einen Zugang vom Bahndamm her. Ist aber auch zugemauert.«
»Was ist mit den Kellern passiert, nachdem die Brauereien Kühlhäuser gebaut hatten?«, wollte Horndeich wissen.
»Nun, die Nationalsozialisten wussten die dicken Felsmauern durchaus zu schätzen, zumal die Schreie unter der Erde nicht nach oben drangen. Als dann die Bomben fielen, waren die Keller Bunker. In der Brandnacht, als die Briten Darmstadt fast von der Landkarte tilgten, überlebten viele, weil sie sich in den Kellern versteckt hatten.«
»Und dann?«, fragte Horndeich.
»Die Keller waren bis in die fünfziger Jahre hinein Unterschlupf für die, die alles verloren hatten. Danach gerieten sie völlig in Vergessenheit. Vor zehn Jahren habe ich sie sozusagen aus dem Dornröschenschlaf geweckt, aber erst vor drei Jahren hatte ich die Idee mit den Führungen.«
Horndeich schüttelte sich. Dass in diesem Keller ein grausiger Mord geschehen war, würde die Attraktivität nur steigern …
Margot lenkte die Überlegungen wieder auf die aktuellen Ereignisse. »Unsere Kollegen von der Spurensicherung haben festgestellt, dass das Schloss der Eingangstür nicht beschädigt war. Die Tote trug einen Schlüsselbund bei sich. Und an dem befand sich ein Schlüssel zur Tür. Jetzt fragen wir uns: Wie kam sie an den Schlüssel?«
Stroll zuckte mit den Schultern. »Ich habe einen Schlüssel. Und ein paar Leute, die entweder dort forschen oder die im Sommer die Führungen machen.«
»Könnten Sie uns eine Liste dieser Leute geben?«
»Kein Problem. Ich kann Ihnen in einer Stunde eine Mail schicken.«
»Das wäre schön.« Margot bedachte Herrn Stroll mit einem Lächeln.
»Okay, was haben wir?«, fragte Margot in die Runde. Sie hatten sich im großen Besprechungsraum versammelt. Die Uhr über der Tür zeigte bereits halb sechs abends.
Jeder hatte einen Becher dampfenden Kaffee vor sich stehen. Margot schmunzelte, als sie das Panoptikum der Kaffeebecher wahrnahm. Sandra Hillreichs Becher wurde von hellen Fantasieblumen auf blauem Grund geziert, was ganz ihrem unbekümmert-fröhlichen Naturell entsprach. Seit zwei Jahren gehörte die Sechsundzwanzigjährige zum Team. Sie war die ungekrönte Königin der Recherche. Und wenn es galt, irgendeinem Computer Geheimnisse zu entlocken, dann war sie in ihrem Element, was die männlichen Kollegen inzwischen mehr schätzten als ihre langen blonden Haare.
Paul Baaders Kaffeebecher war weiß wie die Overalls, die er als Experte der Spurensicherung trug. Mitstreiter Hans Häffner trank seinen Kaffee aus dem letzten Überbleibsel eines Porzellanservices seiner Großmutter. Die filigrane Tasse bekam auf der Polizeiwache nicht nur ihr Gnadenbrot, sie schien auf wundersame Weise alle anderen Becher zu überleben.
Otto Fenskes Becher verriet den Job ihres Eigentümers: Ein dicker gelber Fingerabdruck zierte den schwarzen Grund. Die Kommissare Heribert Zoschke, Ralf Marlock und Joachim Taschke hatten jüngst durch Ikea zum Becher-Einheitslook gefunden. Und Horndeichs Becher konnte als Prototyp eines Polizeibechers herhalten: Neben den »Sesamstraße«-Figuren Ernie und Bert prangten darauf die Fragen: »Wieso? Weshalb? Warum?«
Margots Becher mit dem gelben Smiley gab an diesem Tag allerdings nicht ihre Stimmung und Gemütsverfassung wieder.
Da riss Horndeichs Stimme sie aus ihren Tagträumen. »Vermisstenanzeigen negativ. Nichts Passendes in Darmstadt, nichts im Landkreis, nichts in Hessen. So viel kann ich mit Sicherheit schon sagen. Über andere Bundesländer weiß ich noch nichts.«
Margot griff zum nächsten Strohhalm. »Haben die Spuren vor Ort was ergeben?«
Baader antwortete: »Der Fundort ist der Tatort. Auf der Treppe keinerlei Blutspuren, keine Schleifspuren – das ist eindeutig. Wir haben uns auch schon in den benachbarten Kellern umgeschaut, aber da sind überhaupt keine Spuren zu finden: kein Blut, keine anderen Dinge, die in irgendeiner Verbindung zu der Toten stehen können. Nur altes verschimmeltes Gerümpel.« Damit war Margots Strohhalm geknickt. »Es sieht im Moment so aus, als ob sich das Drama wirklich nur in diesem einen Keller abgespielt hat.«
Nächster Strohhalm. »Was haben die Kleider ergeben?«
Häffner ergriff das Wort. »Die blaue Arbeiterhose ist Standard, ziemlich neu. Gibt’s aber in allen Baumärkten. Die restlichen Klamotten und der Rucksack sind ebenfalls Massenware. Den Rucksack gibt’s im Kaufhof, die Klamotten bei H&M. Die Jacke … tja, da haben wir keine Ahnung. Sehr alt, kein Etikett mehr drin.«
Das Spiel hieß Strohhalmknicken. Dem zum Trotz nickte Margot und sagte: »Gut. Damit kommen wir also derzeit nicht weiter. Hat sich vielleicht schon was mit dem Schlüssel ergeben?«
Nun war es wieder Baader, der sprach, nachdem er aus dem Blätterstapel vor sich eine Seite hervorgezogen hatte. »Das Schloss der Tür war nicht beschädigt. An dem Schlüsselbund, den wir in ihrer Tasche gefunden haben, befand sich wie gesagt ein passender Schlüssel. Woher sie den hatte – keine Ahnung.«
Zoschke schaltete sich ein. »Stroll, der Biergartenbesitzer, hat uns schon die Liste mit den Leuten zugemailt, die im Besitz solcher Schlüssel sind. Wir telefonieren bereits herum, aber es gibt noch kein positives Ergebnis. Drei Leute gaben an, dass ihr Schlüssel an seinem Platz sei und nicht fehle.«
»Konnten die anderen Schlüssel zugeordnet werden?«, fuhr Margot fort.
Taschke nickte. »Zwei Schlüssel für Haustür und Wohnungstür. Ein Schlüssel ist wohl ein Briefkastenschlüssel, ein anderer könnte zu einem Kellerschloss passen oder zu einem Speicher. Dann hängt noch ein VW-Autoschlüssel dran.«
»Und was ist mit dem?«
»Es handelt sich um einen Schlüssel für einen älteren VW. Aber das Autohaus sagt, man kann den Typ anhand des Schlüssels nicht genau feststellen. Golf, Polo, Passat – alles, was älter ist als etwa fünfzehn Jahre, ist möglich.«
Margot hatte längst aufgehört, die geknickten Strohhalme zu zählen. Nachher würde der Reinigungstrupp einiges zu fegen haben … »Fenske, haben die Fingerabdrücke was Brauchbares ergeben?« Sie hatte sich deutlichere Hinweise auf die Identität der Toten erhofft.
»Nada. Der Rechner kennt die Fingerabdrücke der Toten nicht. Der Griff der Zugangstür wurde abgewischt, wahrscheinlich vom Mörder – er ist also auch durch diese Tür raus. Aber das trägt nicht dazu bei, seiner Identität näher zu kommen.«
»Wahrlich nicht«, brummte Margot.
Horndeich ergänzte: »Hinrich wird in Frankfurt ein DNA-Profil der Toten erstellen lassen – aber das Ergebnis liegt frühestens übermorgen vor. Wenn ihre DNA also bei irgendeinem anderen Verbrechen mit im Spiel war, erfahren wir vielleicht dadurch was.«
»Ich fasse also zusammen«, brummte Margot. »Wir haben gar nichts! Gab’s denn keine weiteren Spuren – Fußabdrücke, Zigarettenkippen, ein Bekennerschreiben mit Absender, ein Personalausweis, den der Täter verloren hat?«
Baader ergriff wieder das Wort, aber schon der Tonfall der ersten Silbe signalisierte das Nein als Antwort. »Auf dem Steinboden gab’s keine verwertbaren Fußabdrücke. Eins haben wir noch eingesammelt: ein kleines hellblaues Plastikstück. Könnte von einem Handy stammen. Ist schon unterwegs zum LKA in Wiesbaden. Genaues auch erst in ein paar Tagen. Wir haben nach Strolls Hinweis auch die zweite Zugangstür hundert Meter die Straße runter untersucht: Daran hat sich niemand zu schaffen gemacht. Und ob sich an den zugemauerten Eingängen von den Kellern aus jemand als Bergarbeiter betätigt hat, werden wir morgen überprüfen.«
»Okay. Ist das alles?« Margot wartete ganze drei Sekunden. »Gut, dann nehmt jetzt das Foto des Opfers, aber bitte das auf ›gnädig‹ retuschierte, und schickt es raus. Auch Bilder von den Klamotten. Großer Verteiler – Zeitungen und Hessischer Rundfunk. Frage: Wer kennt diese Frau? Wer hat am Samstag in der Nähe des Biergartens etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat jemanden an der Tür gesehen? Mal schauen, ob Kollege Zufall nicht besser ist als wir und wir morgen etwas mehr wissen.«
Später saßen Horndeich und Margot in ihrem Büro. Margot sah ihren Kollegen an. »So hast du dir den ersten Arbeitstag nicht vorgestellt, was?«
Horndeich versuchte ein Lächeln. »Nein, wahrlich nicht. Passiert auch selten, dass hier zwei Morde so kurz aufeinander folgen.« Zumal Darmstadt in der Kriminalstatistik noch nie einen Spitzenplatz belegt hatte. »Meinst du, die haben etwas miteinander zu tun?«
»Ich weiß es nicht. Auf den ersten Blick gibt’s kaum Gemeinsamkeiten.« Margot blickte zum Fenster. »Tja, an neue Pflanzen habe ich auch nicht mehr gedacht. Tut mir leid, dass die hier meine Pflege nicht überlebt haben.«
»Na, da haben wir doch heute wenigstens einen Ermittlungserfolg. Die Täterin ist sogar geständig.«
Margot erhob sich. »Hoffentlich erkennt jemand die Frau. Ich möchte wissen, wer sie ist. Und ich möchte den Typen kriegen, der das angerichtet hat.«
Horndeich nickte nur, stand ebenfalls auf und schlüpfte in seine Jacke. »Wir kriegen ihn!«, versicherte er. Aber er war nicht halb so überzeugt, wie er sich gab. Die meisten Tötungsdelikte fanden im familiären oder im nahen Umfeld der Opfer statt. Eifersucht, Geldsorgen, Verzweiflung – das waren die Motive, die den Täter schnell überführten. Doch in diesem Fall lag die Sache anders, das spürte Horndeich. »Was hat sie da unten gemacht?«, fragte er sich laut.
Eine Antwort darauf wusste er nicht, und auch Margot konnte ihm keine geben.
Horndeich war kurz nach Hause gefahren, hatte sich frische Klamotten angezogen und war dem Stoppelbart mit einer Rasierklinge zu Leibe gerückt. Noch eine Spur Drakkar Noir, dann machte er sich auf zum Weihnachtsmarkt auf dem Darmstädter Marktplatz. Der Markt konnte zwar nicht mit der Größe des Frankfurter Pendants oder mit dem Renommee der Buden in Erbach konkurrieren, doch Horndeich mochte die Intimität des kleinen Platzes.
Anna hatte ihm am Nachmittag noch eine SMS geschickt und ihm darin mitgeteilt, dass sie sich abends wie verabredet mit ihm treffen werde. Ganz sicher war sie nicht gewesen. Nach der strapaziösen Rückreise aus Moskau war sie zunächst in die Praxis gegangen, in der sie als Arzthelferin arbeitete, dann hatte sie am frühen Nachmittag die Gäste aus der Ukraine vom Bus abgeholt. Sie kamen aus der Partnerstadt Uschgorod.
Ende der Leseprobe