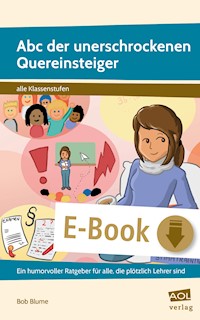17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
Die Welt hat sich verändert – die Schule nicht. In diesem Buch prangert Lehrer und Blogger des Jahres Bob Blume zehn Dinge an, die verändert werden müssen, damit die Schule endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Denn wir können es uns in einer globalisierten Welt nicht leisten, die wichtigste Ressource, die wir haben, in guter Hoffnung sich selbst zu überlassen. Ob Lehrermangel, Probleme bei der Digitalisierung, Notendruck, nicht mehr zeitgemäße Lehrerausbildung oder überfrachtete Lehrpläne – Bob Blume kennt die Probleme an Schulen aus eigener Erfahrung. Er legt die Defizite offen und zeigt Lösungswege auf. Und macht klar: So können wir nicht weitermachen. Wir müssen handeln! Schließlich geht es um die Zukunft unserer Kinder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Die Welt hat sich verändert – die Schule nicht. In diesem Buch prangert Lehrer und Blogger Bob Blume zehn Dinge an, die verändert werden müssen, damit die Schule endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Denn wir können es uns in einer globalisierten Welt nicht leisten, die wichtigste Ressource, die wir haben, in guter Hoffnung sich selbst zu überlassen. Ob Lehrermangel, Probleme bei der Digitalisierung, Notendruck, nicht mehr zeitgemäße Lehrerausbildung oder überfrachtete Lehrpläne – Bob Blume kennt die Probleme an Schulen aus eigener Erfahrung. Er legt die Defizite offen und zeigt Lösungswege auf. Und macht klar: So können wir nicht weitermachen. Wir müssen handeln! Schließlich geht es um die Zukunft unserer Kinder.
Autor
Bob Blume ist Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsinfluencer. Neben seiner stetig wachsenden Reichweite auf Twitter und Instagram ist er ein gefragter Experte in der deutschen Medienlandschaft zum Thema Schule. Interviews und Beiträge erschienen unter anderem im SWR, dem Deutschlandfunk, im ZDF und bei Zeit online.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe Mai 2022
Copyright © 2022: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: shutterstock / autsawin uttisin, The_Pixel, schab
Autorenfoto: Thomas Clemens
Redaktion: Regina Carstensen
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
KW ∙ IH
ISBN 978-3-641-28701-6V002
www.mosaik-verlag.de
Besuchen Sie den Mosaik Verlag im Netz:
Gewidmet N. und M.
Inhalt
Vorwort
Der Stand der Dinge: Ein Problempanorama
1 Der Stoff steht über allem
2 Unterricht ist erstarrt
3 Die Bürokratie verhindert eine Weiterentwicklung
4 Noten als Pawlowsche Reflexe
5 Prüfungen als Heiliger Gral
6 Die Lehrerausbildung prüft das Falsche
7 Schlechte Lehrer haben es zu leicht
8 Die Digitalisierung wird nicht verstanden
9 Eltern werden nicht eingebunden
10 Die Boomer ignorieren die Generation Social Media
Ausblick: Unnütze Bildung und utopische Revolutionen
10 Thesen für eine bessere Schule
Nachwort
Anmerkungen
Zitatnachweis
Literaturempfehlungen
Danksagung
Register
Vorwort
Die Lehrer sind der Politik anscheinend egal. Die Schüler: egal! Die Schulleitungen: egal! Es ist einfach alles egal.
Der Autor im Instagram-Video zu den politischen Entscheidungen
Am 1. Dezember 2020 konnte jeder, der wollte und einen Account des sozialen Netzwerks Instagram besaß, dabei sein, wie ich live die Nerven verlor. Ich schrie nicht etwa, wetterte nicht. Ich stellte fest. Zynisch und mit beißender Ironie. Die damalige baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hatte die Entscheidung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ignoriert, nach der die Ferien in Baden-Württemberg vorgezogen werden sollten, um den Gesundheitsschutz für alle zu gewährleisten. Dies geschah nach einer Woche Funkstille. Schulleitungen und Lehrerschaft hatten bis dahin zwar schon zur Kenntnis genommen, dass sie immer erst am Abend vor einem Vorhaben über sämtliche Umstellungen informiert wurden. Oftmals sogar, nachdem die Öffentlichkeit aus den Medien von neuen Veränderungen erfahren hatte. Aber das setzte dem Ganzen die Krone auf. Sämtliche Pläne wurden umgeschmissen, Klassenarbeiten so verlegt, dass die Schüler unter der schieren Anzahl ächzten. Alle Lehrerinnen und Lehrer des Landes konnten sich darauffolgend medial anhören, dass es ihnen nur um einen längeren Urlaub gegangen wäre. Ein Schlag ins Gesicht, dem noch viele weitere folgen würden.
In solchen Pauschalurteilen fehlt meist die wichtigste Erkenntnis: Innerhalb eines Systems, das es versäumt hat, sich zu erneuern, unterliegen die Mitarbeitenden auch dessen Einschränkungen. Und derer gibt es viele! Werden die Vorgaben nicht eingehalten, werden sie selbst dann zurückgepfiffen, wenn ihre Ideen funktionieren. Man denke an den Solinger Schulleiter, dem verboten worden war, Wechselunterricht vorzunehmen, obwohl die Inzidenzzahlen deutlich zu hoch waren und er ein funktionierendes Konzept vorgelegt hatte.1 Das sorgte in der Lehrerschaft für Frust. Und Wut.
Dem ließ ich an jenem 1. Dezember freien Lauf. In kurzer Zeit sahen sich fast 50000 Menschen dieses Video an. Über 300 Kommentare fanden sich darunter, in den meisten gestanden die Verfasser, dass es ihnen genauso gehe wie mir, dass sie sich alleingelassen und vergessen fühlten. Solche Zahlen muten in Zeiten von Influencern, die vor einem Millionenpublikum sprechen, vielleicht nicht sehr hoch an. Für den Bildungsbereich sind sie jedoch beachtlich. Und sie zeigen, dass der Einzelne mit vielen Vernetzten sich auch fernab von Gewerkschaften oder Vereinigungen Gehör verschaffen kann.
Dieser Aufschrei und die unterstützenden Reaktionen verdeutlichen die Kraft einer vernetzten Community, die sich auf Instagram und vor allem auf Twitter aus den Fesseln althergebrachten Denkens befreien möchte: Innovative Konzepte und Ideen werden hier genauso diskutiert wie die wichtigen Fragen danach, wie eine gute Bildung im 21. Jahrhundert aussehen kann.
Über Twitter und Instagram erreiche ich mittlerweile mehr als 50000 Menschen. Mein Blog, in dem ich sowohl über Bildung und deren praktische Umsetzung schreibe als auch unterrichtliche Materialien für Schülerinnen und Schüler bereitstelle, verzeichnete im ersten Jahr der Pandemie mehr als zwei Millionen Aufrufe. Viele der Lesenden sind Schüler, die sich in eigenem Tempo und mit eigenen Schwerpunkten auf Prüfungen, vor allem das Abitur, vorbereiten. Auch deshalb konnte ich in Radio und Fernsehen über Lernen und Lehren im digitalen Wandel sprechen. Und darüber, dass die Zeit für grundlegende Fragen gekommen ist.
Das Wichtigste aber ist: In einem solchen produktiven Umfeld, in dem die Wege kurz sind und die Gesprächsbereitschaft hoch, lernt man selbst stetig weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Gelernte ein Impuls sein kann, wie wir wegkommen von der ewig gleichen Schule, in der Lehrer Weisungen empfangen, die sie dann ohne Wenn und Aber umzusetzen haben. Und in der Schüler Stoff durchbringen müssen, anstatt ihr Interesse zu vertiefen. Nicht dass es nicht längst Modellschulen gibt, in denen außerhalb dieser Grenzen gedacht wird. Ein Blick auf die Preisträger des Deutschen Schulpreises zeigt fantastische Konzepte. Aber das tun sie meist trotz des Systems und nicht wegen ihm. »Eine neue Schulkultur lässt sich … nicht so einfach von außen in eine Einrichtung hineinbefehlen«, so der Bildungsjournalist Christian Füller.2
Schule sollte allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre Potenziale kennenzulernen, sie zu entfalten und so als interessierte und kritische Mitglieder der Gesellschaft Freude am weiteren Lernen zu entwickeln. Das tut sie in vielen Fällen noch nicht.
Genau das prangere ich an!
Ich schreibe dieses Buch als vernetzter Praktiker mit Interesse an der Theorie. Schon Jahre vor Corona habe ich, haben wir in der Gemeinschaft digitalaffiner Lehrerinnen und Lehrer über Lehren und Lernen im digitalen Wandel gesprochen. Und geflucht. Damals waren die Workshops noch wenig besucht, digitale Bildung drohte in einer Nische zu verkümmern. Das hat sich geändert.
Leider ist aber auch das Fluchen lauter geworden, denn Innovation wird in Deutschland gerne ignoriert. Oder in Bürokratie ertränkt. Oder von Menschen verhindert, die sich schlicht zu wenig mit dem Thema befasst haben.
Positiv ist jedoch: Das Thema Schule und Bildung ist von Corona in die Öffentlichkeit getragen worden. Erste zarte Pflanzen sind zu erkennen, wenn Politikerinnen und Politiker zumindest öffentlichkeitswirksam mit Praktikern und Theoretikern debattieren. Um sich öffentlich so zu äußern, dass dies bei einem breiten Publikum ankommt, muss man heutzutage kein Lehrerpräsident mehr sein. So konnte ich beispielsweise auf Instagram mit der Moderatorin Dunja Hayali über Versäumnisse der Bildung sprechen oder mit der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann über die Herausforderungen von Social Media und Schule. Mit der saarländischen Kultusministerin Christine Streichert-Clivot über neue Ansätze der Bildung. Mit Ludger Wößmann, dem Bildungsökonomen und Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, über »Lernlücken« und neue Kompetenzen in der Coronazeit.
So schön ein solch öffentlicher Austausch über aktuelle Defizite und Chancen auch ist, es gibt Themen, die noch grundsätzlicher sind und viel zu wenig besprochen werden, die zudem von einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert werden müssten. Nicht zuletzt, damit wir weniger wütend über die zahlreichen Baustellen des deutschen Bildungssystems sein müssen. Denn diese können einen zur Verzweiflung treiben oder dazu ein Buch zu schreiben, das schon im Titel klarmacht, dass es viel zu tun gibt.
Meine Hoffnung ist, dass ich aus dieser Perspektive Anregungen gebe, um über Säulen einer Schulbildung zu sprechen, die viele Menschen kritisch sehen, die aber oftmals in der hektischen Medienlandschaft untergehen. Meine Einladung gilt allen, die eine fehlende Entwicklung der Schulen anprangern, ob es Lehrerinnen und Lehrer, Schüler oder deren Eltern sind.
Dass immer noch zu wenig konstruktiv über Bildung gesprochen wird, ist kein Wunder: Zwischen all den Aufgaben, die Lehrer zu tun haben. Zwischen all der Arbeit, die Schüler leisten. Und zwischen all der Hilfe, die Eltern selbst guten Schülern geben müssen, um im Schulsystem zu bestehen, ist wenig Zeit für die wirklich wichtigen Fragen, die sich vermehrt aufdrängen.
Zwei dieser Fragen interessieren mich seit meinem Referendariat, in dem ich begann, mich auf meinem Blog mit den Widersprüchlichkeiten des Schulsystems auseinanderzusetzen. Sie sind eng miteinander verknüpft: Wie funktioniert gutes Lernen? Und: Wie sieht ein solches Lernen im 21. Jahrhundert aus?
Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig, vielschichtig und werden sehr unterschiedlich beantwortet. Was ich hier anbieten möchte, ist eine Sicht, die noch zu wenig Beachtung findet, nämlich jene, die sich aus der Erfahrung einer vernetzten Gemeinschaft ergibt. Sie bildet sich aus einem Denken von Pädagogen, Lehrkräften und Sozialarbeitern, die sich dafür interessieren, wie gute Schule aussehen kann. Dazu gehören aber auch Stimmen von Eltern und Schülern, die über Social Media miteinander ins Gespräch kommen.
Dieses produktive Miteinander kann Berge versetzen, traf aber bislang auf eine Mauer institutioneller Regelungen, die sich zunehmend weniger mit der Realität in Einklang bringen lassen.
Tausende Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler vereinigte in der Coronazeit der Hass auf starre Strukturen. Es war oft so, als könnte man das Ufer einer anderen Insel sehen, könnte erkennen, welche Möglichkeiten sich abzeichneten, doch ohne Floß oder Brücke waren diese nicht zu erreichen und damit nicht zu verwirklichen.
Dieses Buch soll der Wut eine Stimme verleihen und einige der vielen alternativen Sichtweisen auf Bildung und Schule, die schon längst existieren und die mit dem Engagement vieler wunderbarer Menschen vorangetrieben werden, aufzeigen.
Es soll dabei helfen, die Probleme, mit denen so viele zu kämpfen haben, klar zu benennen. Und Impulse für Lösungen anbieten. Ich hoffe sehr, dass ich denjenigen eine Stimme geben kann, die sich genau wie ich mit dem längst fälligen Wandel der Bildung befassen.
Mit Wut im Bauch und Freude im Herzen.
Bob Blume, Offenburg im Frühjahr 2022
Der Stand der Dinge: Ein Problempanorama
Vielleicht sollten wir das Kultusministerium kurz aus- und wieder anschalten.
Tweet des Autors
Die Pandemie hat die gravierenden Defizite des deutschen Bildungssystems schonungslos offengelegt. Allerdings zeigten sich diese nicht ausschließlich dort, wo man sie zunächst vermutet hätte. Sicher: Die technische Ausrüstung war allenfalls wünschenswert bis gar nicht vorhanden – und ist es immer noch. Als die Coronakrise hierzulande im März 2020 begann, waren die meisten Schulen nach ihrer Schließung nicht darauf vorbereitet, ihren Unterricht online weiterzuführen. Manche Schüler sahen ihre Lehrer wochenlang nicht.
Der DigitalPakt folgte erst spät und war dann so bürokratisch, dass es viele Monate dauerte, bis Geld abgerufen werden konnte. Dies wurde zu Recht medial beanstandet. Unter der medialen Schelte hatten aber auch jene Lehrerinnen und Lehrer zu leiden, die sich nicht anders zu helfen wussten, als Aufgaben per Post an ihre Schüler zu schicken, Anrufe zu organisieren, ob alles verstanden wurde, oder Plastikkisten mit Übungen ins leere Schulhaus zu stellen, die dann von dort abgeholt werden konnten.
Und selbst in den Einrichtungen, die digital ausgestattet waren, kam bald Frust auf. Schnell zeigte sich, dass vielerorts gar nicht so unterrichtet werden konnte, wie man es gewohnt war. Schülerinnen und Schüler tauchten einfach unter, und nicht alle Inhalte konnten online vermittelt werden. Was die Fragen aufwarf: Auf welchen Ideen basiert ein Unterricht, der sich eins zu eins digital übertragen lassen kann? Wieso tauchten die Schüler tatsächlich erst dann unter, als es kontrollierbar nachvollzogen werden konnte? Und ist es überhaupt noch zeitgemäß, Bildungserfolg an Inhalten abzulesen, die einmal alle paar Wochen in Prüfungen abgefragt werden?
Die Antworten von den Kultusministerien folgten prompt. Es ging, wie nicht anders zu erwarten war, darum, den Stoff möglichst ohne Verluste einzutrichtern. Auf die Idee, dass Schüler während der Pandemie-Phase vielleicht nicht nur mehr, sondern auch ganz andere Fähigkeiten erwerben, kamen die wenigsten. Und die, die verzweifelt darauf hinwiesen, wurden zu wenig gehört.
Es ist den Eltern nicht zu verdenken, dass nach dem ersten Lockdown die Frage nach dem Stoff die wichtigste war, die es zu klären galt. Es zeigte sich aber auch die hässliche Seite eines falsch verstandenen Bildungsideals: Wenn es ernst wird, kommt es eben nicht auf jene Kompetenzen an, die spätestens seit 2004 in allen bundesweiten Bildungsstandards feststehen; Kreativität, Kooperation, Umgang mit unterschiedlichen Medien – alles sekundär. Die Forderung nach dem Stoff muss eingelöst werden.
Wichtiger als diese unzeitgemäße Form der Vermittlung, die Schülergenerationen schon längst durch eigenständige Arbeit, Lernvideos oder Vernetzung ergänzt, wenn nicht sogar ersetzt haben, sind dann nur noch die Prüfungen. Die Pandemie hat sichtbar gemacht, dass selbst in einer Zombie-Apokalypse das Abitur noch geschrieben wird. Das Zertifikat steht über allem!
Und mit ihm sind es die Noten, die auf jeden Fall gegeben werden müssen. Für nicht wenige Lehrer war die erste Frage, ob denn im digitalen Fernunterricht auch Noten gegeben werden können. Vorgeschoben, so kann man mutmaßen, um jene auszuzeichnen, die sich Mühe geben, letztlich aber als Mittel, um über die Ferne noch ein Instrument zur Sanktionierung zu haben. Sind sie doch der verlängerte Arm einer schwächer werdenden Autorität. Dass motivierender Unterricht, der das Digitale einbezieht, eine Lösung hätte sein können – und auch unabhängig von Corona der richtige Weg ist –, war einigen klar. Allein: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Denn wenn digitale Welten in der Tat jenes Neuland sind, von dem Angela Merkel vor fast zehn Jahren sprach, dann sind viele Lehrerzimmer das »Altland« dieser Nation.
Und so war es auch nicht überraschend, dass selbst der junge Lehrernachwuchs, der doch eigentlich per definitionem im Digitalen beheimatet sein müsste, nicht so richtig wusste, was zu tun war. Und dieser Zustand hält noch an. Kein Wunder: Das, was in den meisten Seminaren in der Lehrerausbildung geprüft wird, ist eine Form von Unterricht, die in der Realität nicht wirklich existent ist. Es ist ein erstarrter Käfig, in dem die Kontrolle zu jedem Zeitpunkt dem allmächtigen Lehrer zugeschrieben werden kann.
Etwas Gutes haben aber die hausgemachten Defizite. Jene Lehrer, die gar keine Lust hatten, sich ein wenig zu bewegen, sich neu einzulesen oder sich fortzubilden – sie hatten es leichter. Sie konnten mit dem Finger auf all das zeigen, was ja in der Tat nicht funktionierte. Dass das Nichtfunktionieren von Unterricht möglicherweise an denjenigen liegen konnte, die ihn durchführten, blieb vielen verschlossen oder wurde bewusst oder unbewusst ignoriert.
Und so vermischte sich der Frust vieler Schülerinnen und Schüler mit jenem der Lehrer zu einer Melange, die mit eiskaltem Lächeln von den Medien aufgenommen wurde. Die Lehrer waren die perfekten Schuldigen. Alle! Denn irgendwer kannte immer eine Mutter oder einen Vater, der als Ersatzlehrer einspringen musste, weil der eigentlich Verantwortliche nicht aufzufinden war. Nicht zu vergessen: Weil viele Schüler noch so jung waren, ging es ohne Begleitung schlicht nicht.
Zwar war die Pandemie eine Zeit der Kommunikation. Aber konstruktive Diskussionen zwischen Eltern und Lehrern waren oft Mangelware. Vielmehr steigerte sich vielerorts die Unzufriedenheit, wurde zu einem Dauerzustand, der dann in den sozialen Medien sein Ventil fand. Auch dieses Problem ist systemisch. Eltern werden meist erst dann eingebunden, wenn Schüler nicht »funktionieren«. Lehrer dann angesprochen, wenn es Probleme gibt. Welch eine Verschwendung von Ideen, Anregungen und Ressourcen.
Und zuletzt offenbarte sich in den oftmals hohlen Phrasen der politisch Verantwortlichen, in denen immer wieder von »Bildungsbiografien« die Rede war, dass Gestaltung und Kreativität der Kinder und Jugendlichen gar nicht gefragt waren. Diese wurden, wieder einmal, zu passiven Empfängern eines in die Jahre gekommenen Systems degradiert. Sie wurden und werden nicht angehört, sondern sollen gefälligst das tun, was viele Generationen vor ihnen erleiden mussten.
Das alles hasse ich an der Schule.
Und das hasse ich deshalb, weil allenthalben aufblitzt, was möglich wäre, wenn wir uns aus den Fesseln von Vorstellungen befreien würden, die teilweise schon mehr als hundert Jahre alt sind. Beschrieben und angemahnt wurde es schon oft genug. Sicher, das ist nicht einfach, aber wir befinden uns in einer Phase, in der die Stimmen nicht mehr überhört werden können. In der Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit Schülerinnen und Schülern und deren Eltern über soziale Medien so viele Menschen erreichen, dass der Geist nicht mehr in die Flasche gedrückt werden kann.
Und um diesen Geist geht es auch hier.
Als bloggender Lehrer, der in den sozialen Medien präsent ist und deshalb vielfach kontaktiert wird, habe ich ein buntes Bild von jenen Aspekten des Bildungssystems bekommen, die in der Pandemie nicht funktioniert haben: Eltern schrieben mir, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Kinder permanent begleiten sollten (und es zudem mussten). Erzählten von Lehrern, die nicht auffindbar waren oder die die Schüler mit riesigen Aufgabenpaketen konfrontierten, die sie überforderten. Lehrer gaben mir zu verstehen, dass ihre Bedingungen kaum noch zumutbar seien, da die Regeln, die ihnen auferlegt wurden, nicht in Einklang gebracht werden konnten mit dem, was sie leisten sollten. Schüler berichteten davon, dass sie den Eindruck hätten, man würde sie nicht hören, sie hätten das Gefühl, noch stärker als sonst Befehlsempfänger zu sein.
Aber ich habe auch erleben können, was gemeinsames Handeln bewirken kann. Selbst kleinere Aktionen wie ein auf YouTube geteiltes Video, in dem die Mitwirkenden – Lehrerinnen und Lehrer, die ich über Twitter und Instagram angeschrieben habe – forderten, dass man ihre Bedenken wahrnimmt, wurden tausendfach geteilt. So schafften es ihre Appelle auch in die etablierten Medien, wo sie ein Millionenpublikum erreichten.
Bildungsforscher und Politiker, auch der ein oder andere Vorsitzende einer Lehrergewerkschaft haben bislang wenig Erfahrungen mit jener neuen Kultur, einer digitalen Kultur, in der alle am Schulleben Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen können, um die für unsere Gesellschaft so fundamental wichtige Frage danach, was eine gute Schule sein kann, bewerten zu können. Dabei liegen verschiedenste Konzepte und Ideen dafür längst auf dem Tisch, werden teilweise sogar schon umgesetzt, haben aber noch längst nicht genügend Echo erfahren. Klar ist jedoch: So können wir nicht weitermachen!
Mein Wunsch wäre, dass Eltern mit Schülern, dass Pädagogen mit Politikern, dass Lehrerinnen und Lehrer ins Gespräch kommen und darüber nachdenken, was wir zusammen ändern können. Ein utopisches Bild! Ein Ideal! Aber eines, für das es sich zu kämpfen lohnt – für eine neue Bildung.
1 Der Stoff steht über allem
Man könnte an den Ferien ein bisschen was abknapsen, um Unterrichtsstoff nachzuholen.
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg
Während die Schulen in Deutschland in die dritte Welle stolperten, trotz Mahnungen von Wissenschaftlern, diese wieder zu öffnen, zeigten die politisch Verantwortlichen im ausgehenden Winter 2021, wie wenig kreativ ihre Überlegungen in Bezug auf die Bildungseinrichtungen waren. Und wie wenig von dem, was sie selbst mit den Bildungsplänen in Auftrag gegeben hatten, sie eigentlich verstanden hatten. Kurz: Ferien zu verkürzen, um den ominösen Stoff nachzuholen, war – und ist – die schlechteste aller Ideen.
Der Lehrerausbilder und Blogger Jan Vedder, der in seiner Schule in Niedersachsen zusammen mit der Schulleitung Schule ganz neu gestaltet, hielt die Fixierung auf den Stoff in einer drastischen Feststellung fest: »Das Scheitern des Distanzlernens (unter den Fans auch Homeschooling genannt) ist nur zu einem Teil ein Totalversagen des Dritte-Welt-Digitallandes Deutschland … Es ist ein Versagen der Präsenzschule. Unter dem Brennglas der Pandemie wird uns vor Augen geführt, wie Schule bisher funktioniert: eine Lehre im Gleichschritt, geprägt von Unterrichtsstoff und Prüfungsdruck. Der Ruf nach der Rückkehr in eine Schulnormalität ist in Wirklichkeit also ein Aufruf zur Bewahrung des tradierten Systems. Der verpasste Unterrichtsstoff dient als Feigenblatt, so schnell wie möglich in eine Schule vor Corona zurückzukehren.«3 Deutlicher kann die Kritik an einem Weiter-so nicht formuliert werden.
Das bedeutet nicht, dass es nicht sinnvoll sein könnte, Angebote zu gestalten, in denen Schülerinnen und Schüler Inhalte nachholen könnten, die sie aufgrund eines (vom Bund über Jahre sehenden Auges verschuldeten) Technikdefizits oder fehlender Unterstützung verpasst haben. Der Widerspruch politischer Aussagen wird hier besonders offensichtlich. So wurden die Kultusministerinnen auch nicht müde zu betonen, dass das Wichtigste an Schule die Beziehung zu anderen Kindern sei. Über Prioritäten kann man streiten, aber will man allen Ernstes behaupten, dass solche Beziehungen in den Sommerferien nicht mehr so wichtig sind? Nein, es geht nicht um Beziehungen. Es geht um den Stoff.
In einer Bundesrepublik, in der die Abschlüsse vergleichbar wären, in der also in jedem Bundesland dasselbe gelernt würde, könnte man die Panik des verloren gegangenen Stoffs womöglich noch verstehen. Wenngleich auch hier die Frage beantwortet werden müsste, die ebenso die Länder hätten beantworten sollen, aber nicht haben: Wenn ein ganzes Jahr für die Veränderung auf das Abitur in acht Jahren einfach weggenommen wurde, weshalb ist ein zweifellos schwieriges Jahr in der Pandemie dann so katastrophal, dass über Ferienverkürzung, Samstagsunterricht und, man höre und staune, eine Verlängerung der Schulzeit nachgedacht werden muss?
Die Antwort darauf lautet: Der Stoff wird als objektive Größe betrachtet. Und genau das ist ein Irrtum.
Schon vor der ersten großen weltweiten Pandemie seit der Spanischen Grippe war also klar: In der Schule geht es vor allem um Stoff. Und die Lehrer sind die Dealer. Wie seit jeher sollen die den Stoff in die Schüler stopfen, damit diese ihn am Ende wieder auskotzen können. So macht man Schule kaputt. Wie schon erwähnt: Das hasse ich an der Schule.
Die Fixierung auf diesen legendären Stoff weist drei Aspekte auf, die problembehaftet sind:
1.Unter dem Wort »Stoff« kann sich jeder etwas vorstellen.
2.Man kann so tun, als ob der Stoff etwas Objektives wäre, der nur vermittelt werden muss.
3.Ein Stoff kann geprüft werden.
Die Vorstellungen darüber, was denn nun dieser Stoff sei, sind so unterschiedlich wie jene darüber, was eine gute Lehrperson ausmacht. Die meisten verkürzen »Stoff« als Wissen, wobei dann zu fragen wäre, welche Art von Wissen eigentlich gemeint sein soll. Es ist etwas anderes, ob ich weiß, wo man bei einem Auto schalten muss oder wie ich es fahre.
Aber dadurch, dass der Stoff von der Schule erwartet wird, ist er ständig Gegenstand von Gesprächen. So wird darüber diskutiert, ob jemand mit dem Stoff mitkommt. Ob Stoff nachgeholt werden muss. Ob man in diesem Schuljahr den Stoff geschafft hat. Und wie weit die eine Klasse im Vergleich mit einer anderen mit dem Stoff ist.
Beim näheren Hinsehen versperrt dieser Fetisch namens »Stoff« den Blick auf das, was wichtig ist.
Hier ein Beispiel dazu. Durch meinen Blog habe ich viel Kontakt mit Referendaren. Seit meinem eigenen Referendariat finden die Lehramtsanwärter, wie sie nun auch heißen, dort Artikel zu wichtigen Themen für ihren Unterricht und deren Vorbereitung. Es sind viele Artikel, denn zu Beginn einer Lehrerkarriere gibt es viel zu tun. Die jungen Lehrerinnen und Lehrer sind wirklich nicht zu beneiden, da sie in einer merkwürdig paradoxen Situation sind. Sie beginnen zu lehren und sollen es schon können.
Druck entsteht auch dadurch, dass Referendare möglichst guten, innovativen und gleichzeitig lehrplankonformen Unterricht durchführen müssen, dessen Qualität hinter den eines erfahrenen Lehrers nicht zurückfallen soll, denn – man ahnt es – sonst kommt man »mit dem Stoff nicht durch«.
In einer solchen Situation begleitete ich eine Referendarin, die es sich für eine Dokumentationsarbeit zum Ziel gemacht hatte, Schülern Mittel und Wege an die Hand zu geben, Vokabeln so zu lernen, dass sie diese möglichst lange behalten. Die Dokumentation der Unterrichtseinheit ist ein Baustein auf dem Weg zum Lehrer, also in erheblicher Weise wichtig für die Gesamtbeurteilung seines Unterrichts.
Auch wenn die Frage, welche Wörter zu welcher Zeit und auf welche Art und Weise gelernt werden müssten, eine weitere Diskussion wert gewesen wäre, doch die nachhaltige Aneignung von einem aktiven Wortschatz war schon mal ein wunderbares Ziel der Referendarin – so könnte man meinen. Als die besagte engagierte Frau aber mit Tränen im inzwischen leeren Klassenzimmer vor mir stand, sah sie dies jedoch nicht mehr so. Im Gegenteil. Die halbstündige Rechtfertigung vor den Eltern hatte Spuren hinterlassen. Was war passiert?
Die Referendarin war ein Opfer vom Stofffetisch geworden – und hatte sich für ihre Vorgehensweise – nämlich etwas zu lehren, was nicht im Englischbuch stand – gegenüber den Eltern rechtfertigen müssen. Dabei kann man jenen gar keinen Vorwurf machen, da Schulen sich nun mal für bestimmte Lehrwerke entscheiden, mit denen sie in ihrem Unterricht arbeiten wollen.
Schulbücher sind natürlich nicht per se schlecht. Zwar hat man im Referendariat zunächst ein schlechtes Gewissen, wenn man Schulbücher nutzt, weil einem irgendein besonders motivierter Mitreferendar erzählt, dass er wieder eine komplette Einheit an Stunden selbst erstellt hätte. Aber nutzen tut man die Bücher meist doch. Und das ist zunächst sowohl gut als auch schlecht.
Doch was sind Schulbücher eigentlich? Sie sind von Fachpersonen, oftmals Lehrer oder ehemalige Pädagogen, aufbereitete Sammlungen, die den Anspruch haben, die Vorgaben des Bildungsplans eines Bundeslands (diese unterscheiden sich von Land zu Land fundamental) möglichst nachvollziehbar und in einer sinnvollen Reihenfolge für die jeweilige Schulart und Klassenstufe aufzubereiten. Das ist für Lehrer in Zeiten von viel Arbeit einerseits sehr nützlich, denn es bedeutet, dass man nicht in jedem Fach und an jedem Tag vor einem leeren Blatt sitzt. Andererseits sind die Bücher in Stein gemeißelter Stoff. Und es ist schlicht auch eine Frage des Budgets, wann und wie oft dieser aktualisiert werden kann. Weil die Anschaffung von Schulbüchern so teuer ist, kann man schlecht nach einem oder zwei Jahren sagen, man hätte lieber ein anderes Buch.
Aber grundsätzlich gilt für Schulwerke: Mit der enormen Belastung, die Lehrer durch immer mehr Stoff und Organisation haben, kann nicht jede Stunde von Grund auf neu gestaltet werden. Das, was im Buch steht, muss dann auch »drankommen« und gelernt werden. Egal ob man der Meinung ist, dass man in der siebten Klasse in Englisch das Plusquamperfekt noch gar nicht können müsste. Egal ob die viel wichtigere Frage, wann man im Englischen einen Artikel vor einem Wort verwendet, gar nicht erst im Lehrbuch aufgenommen wurde.
Unabhängig davon ist für Schüler sowie für Eltern klar, dass die Einheiten, wie sie in den Schulbüchern angegeben sind, quasi den Lernfortschritt anzeigen, der dann mit den Klassenarbeiten zertifiziert wird. Dort wird dann geprüft, wer besser Lückentexte zu einem Thema ausfüllen kann. Wie sinnvoll das ist, dazu später mehr.
Schulbücher sind letztlich wenig aussagekräftige Stoffsammlungen, auf die sich die Bildungseinrichtung meist Jahre vorher geeinigt hat, um Aussagen darüber zu treffen, wie »weit man mit dem Stoff« ist. Das gilt übrigens auch für Lehrer, die in der Kaffeeküche darüber sprechen, was noch gemacht werden muss (als wäre es nicht möglich, die eine [!] Seite, wie man einen Text strukturiert, in die nächste »Einheit« zu nehmen). Oder die wissen wollen: »Sag mal, hast du schon die Relativsätze gemacht?«
Vor diesem Hintergrund hatten die Eltern anlässlich eines Elternabends die innovative Idee der Referendarin, sich einmal unabhängig vom Schulbuch mit der Aneignung von Wörtern zu befassen, auseinandergenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ging also weniger darum, welche Vorteile die Kinder haben, wenn sie sich für den Rest der Schulzeit problemloser die wichtigste Grundlage einer Sprache, die Vokabeln, aneignen können. Stattdessen hieß es: Warum ist die Parallelklasse in der Unterrichtseinheit schon weiter als unsere Kinder? Wie gesagt: Diese Frage zu stellen fällt Eltern leicht, zumal sie genauso gefangen sind in dem Denken, dass der scheinbar objektive Stoff anzeigt, »wie weit die Kinder sind«, wie viele Lehrer.
Auf längere Sicht hat die Orientierung am Stoff aber damit etwas zu tun, wie sich ein Kind später in der Welt zurechtfindet. Oder? Nein, das war ein Scherz. Die Orientierung am Stoff besagt, dass am Ende eine Art Standardprogramm abgespult werden kann, das dann »Bildung« simuliert. Um nicht falsch verstanden zu werden: Würde man sich Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten, welches Wissen und welche Haltungen konkret wichtig sind, würde eine Orientierung auch Sinn ergeben. Und sogar eine Kanonisierung, die nicht dasselbe ist wie Stoff.
Zunächst einmal ist es jedoch sinnvoll, sich die im Bildungsplan festgeschriebenen Fähigkeiten anzusehen. Denn auch das Gegenteil von »Stoff«, die Kompetenzorientierung, kann falsche Blüten treiben. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag eines Unternehmers auf einer Konferenz über innovativen Unterricht. In staatsmännischer Manier stieg er aufs Podium und drosch Phrasen, die sich nach hipper Berliner Start-up-Kultur anhören sollten. Und das taten sie auch. Vor allem aber ging es ihm darum, die sogenannten Kompetenzen als Gegenteil vom Stoff zu loben. Diese sind seit 2004 in den deutschen Bildungsplänen verankert. Um zu erklären, wie man hier falsch abbiegen kann, zunächst eine holzschnittartige Erklärung, was eine Kompetenz ist. Vereinfachend gesagt, ist sie eine Fähigkeit. Und als solche ist sie auch vom reinen Inhalt zu unterscheiden. Nochmals sei das Beispiel mit dem Auto genannt: Jemand, der fahren kann, hat die Kompetenz dazu. Selbst wenn er kein Wissen darüber hat, wie ein Auto funktioniert, oder die Verkehrsregeln nicht kennt. Das ist natürlich nicht als Plädoyer für ein kollektives Ignorieren von bestehenden Gesetzen zu verstehen, soll aber verdeutlichen, dass die Ausübung einer Tätigkeit etwas völlig anderes ist als ein Wissen über sie. Zumeist braucht es beides.
Die meisten Menschen, die viel in den sozialen Medien unterwegs sind, können das gut nachvollziehen, da hier das Wissen darüber, wie man miteinander umgeht, und der wirkliche Umgang weit auseinanderklaffen. Und auch das hat mit der Schule zu tun, wie noch zu sehen sein wird. Jedenfalls ist eine solche Kompetenzorientierung zunächst einmal sinnvoll. Als Deutschlehrer möchte ich keine Schüler, die theoretisch wissen, was ein Komma ist und dass man eines setzen könnte, dieses Wissen aber nicht anwenden können. Und das gilt auch für Wichtigeres als das Setzen eines Kommas.
Zurück zum Unternehmer, der in seinem Vortrag demonstrierte, dass eine solche Kompetenzorientierung in der Praxis aber gar nicht so einfach ist. So sagte er, es gehe ihm darum, dass sein Sohn beispielsweise in Geschichte eine Quelle interpretieren könne. Welche Quelle, das sei im Prinzip völlig egal, dazu könne auch irgendein kleiner Staat herhalten, Hauptsache, die Kompetenz der Interpretation könne an ihr gelernt werden. Meistens ist das Papua-Neuguinea, was wohl aber mehr am Doppelnamen liegt als daran, dass hier ein für das eigene Selbstverständnis unfassbar wichtiges geschichtliches Ereignis vorliegen würde. Nun habe ich es vorweggenommen, das Selbstverständnis.
Bei einem solchen Verständnis von Kompetenz, wie dieser Unternehmer es vortrug, wird ein Schüler vielleicht zum fähigen Mitarbeiter in einem Institut, einem Start-up oder in einem großen Unternehmen. Aber ein derartiger Kompetenzbegriff verkennt das, was Bildung auch und vor alledem sein sollte. Bei dem Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki umfasste der Bildungsbegriff eine politische Dimension. Er musste auf die Mitmenschlichkeit, die Gesellschaft und die politische Existenz des Menschen bezogen gedacht werden.
In einem Land wie Deutschland, in dem das historische Erinnern immer wieder neu verhandelt und diskutiert werden muss, in einem solchen Land soll es also egal sein, welche Quellen analysiert werden? Wäre es dann auch egal, wenn ein Kind nichts über den Holocaust weiß, aber durchaus die Struktur einer Quelleninterpretation aufsagen und im besten Fall durchführen kann?
Und leider muss man festhalten: Dies ist Realität. Mehr als 20 Prozent aller jungen Menschen können mit dem Begriff »Holocaust« nichts anfangen.4 Gar nichts. So zeigt sich: Es kann weder um eine hohle Kompetenz, die sich von jedwedem Inhalt abkoppelt, noch um eine sture Stofffixierung gehen. Es kann auch nicht um Aufgaben gehen, bei denen Schüler eine PowerPoint-Präsentation halten können, unabhängig vom Thema. Das gibt es wirklich: PowerPoint-Karaoke als Nachweis einer Kompetenz. Es ist augenscheinlich, dass das Selbstbetrug mit Ansage ist, denn um nur eine gute Folie zu erstellen, muss ich viel wissen. So viel nämlich, dass ich entscheiden kann, was alles wegzulassen ist.
Aber wenn weder das eine noch das andere trägt, woran sollte man sich dann orientieren?
Modelle, die eine Vorstellung von Bildung und Lernen transportieren, gibt es viele und in allen möglichen Abstraktionsgraden. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten von ihnen zu simpel sind, um das komplexe Zusammenwirken von sozialem Miteinander, Aneignung von Fähigkeiten, kommunikativer Aushandlung und Lernkultur zu verdeutlichen. Dennoch, das sogenannte Zopfmodell der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), das den Kompetenzbegriff in einer namensgebenden Zopfdarstellung präsentiert, ist eine schlüssige Darstellung dessen, »was Kinder lernen müssen«, wie es dort selbstbewusst heißt.
Der Zopf besteht aus drei Strängen, die jeweils ineinander verschlungen sind. Im ersten Strang findet sich das Wissen, das sich jeweils auf die Praxis, das Fach und das Überfachliche (eigene Übersetzung) bezieht. Der zweite beinhaltet Fähigkeiten, sowohl geistige als auch soziale und praktische. Der dritte Strang besteht aus Haltungen und Einstellungen, die zunächst nicht weiter definiert werden.
Die ineinander übergehenden Bündel werden insgesamt als Kompetenzen bezeichnet, an deren Ende Handlungen liegen. Auch hier ist eine Vereinfachung zu beobachten, aber entscheidend ist: Haltungen sind hier genauso wichtig wie Wissen. Und Wissen so wichtig wie die praktische Anwendung.
Dieser Zopf half mir bei meiner Argumentation, als es nach dem ersten Corona-Lockdown darum ging, wie weit ich mit meinen Schülerinnen und Schülern mit dem Stoff gekommen war. Danach hatte ich ihn aber, man hört Trompeten und Fanfaren, durchgebracht. Wie viele andere Kollegen übrigens auch. Mit erheblicher Kraftanstrengung, großem Engagement und einem Einsatz, der viele Lehrer an den Rand ihrer Kräfte brachte. Polemisch könnte man sagen: Den Schülern ist es erspart geblieben, für den Rest ihres Lebens nicht darüber Bescheid zu wissen, dass in Fabeln Tiere miteinander sprechen und dies meist eine wichtige Moral offenbart, die man nur entschlüsseln kann, wenn man den Text gut gelesen hat und weiß, um welche Textart es sich handelt. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Aber Spaß beiseite: Viel wichtiger war doch, dass die Kinder in dieser Zeit so viele Fähigkeiten und so viel praktisches Wissen erlernt hatten wie noch nie zuvor. Und zwar in Bezug auf das Arbeiten mit digitalen Medien.
Sie haben nämlich die Fabeln nicht nur gelesen, sondern sie mit deren filmischen Umsetzungen verglichen. Und dies taten sie nicht nur, indem sie alles in ihr Heft schrieben und dem Lehrer zur Kontrolle gaben, sondern indem sie sich im Chat darüber absprachen, wie sie vorgehen sollen. Und wem welche Rolle dabei zukommt. Und indem sie zusammen in einem Dokument ihre Aufgaben präsentierten und sich gegenseitig verbesserten.
Was sich anhört wie eine Beweihräucherung der Klasse – die sie nebenbei gesagt auch verdient hätte –, ist aber ein Verweis darauf, was der Unterschied zwischen reiner Fokussierung auf den Stoff ist und einem erweiterten Kompetenzbegriff, bei dem es um mehr geht als darum, wie weit man mit dem vorgegebenen Schulbuch ist.
Dieses Wissen um eine derartige Kompetenz ist wichtig und muss – so paradox es fast zwanzig Jahre nach Einführung der Kompetenzorientierung in die deutschen Bildungspläne klingen mag – in die Breite gestreut werden. Denn erst mit dem Verständnis darüber, welche Kompetenzbereiche in der Schule eine Rolle spielen, können die Fragen gestellt werden, die leider viel zu wenig aufgeworfen werden. Nebenbei: Bei einem wirklich kompetenten, also vertiefenden Umgang mit einem Thema kann Kompetenz dann nicht mehr als »Effizienzkriterium«5 verkürzt werden, wie es der Philosophieprofessor Christoph Türcke tut – eine willkommene Bezeichnung für die Kultusbürokratie. Kompetenz ist dann Zielsetzung einer vertieften Beschäftigung, die Zeit und Muße braucht.
Solange man davon ausgeht, dass vorgegebene Stoffsammlungen und Schulbücher schon das sein werden, »was man halt so in der Schule macht«, hat man die Gewissheit, wie weit jeder Lehrer und jede Klasse ist. Scheinbar.
Was aber geschieht, wenn man sich diese Bücher genau anschauen würde, um nachzuvollziehen, was Kinder hinterher können sollten? Welche praktischen, aber auch kognitiven Fähigkeiten weisen sie danach vor? Und wie haben sich (natürlich nicht ohne Weiteres messbar) ihre Haltungen und Einstellungen geändert? Eine solche Betrachtung würde viele neue Überlegungen erzeugen, zum Beispiel jene, ob der sich seit Generationen weiter vollziehende Stofffetisch nicht davon ablenkt, was sich in der Zwischenzeit in der Welt getan hat. So kann ein Schüler nicht in Englisch kommunizieren, obwohl er in den schriftlichen Klassenarbeiten brilliert. Und ein anderer spricht vielleicht besser die Sprache als die Englischlehrerin, weil er sich in seiner Freizeit Netflix-Serien grundsätzlich auf Englisch anschaut.
Es erscheint fast schon naiv, wenn der verbesserte Bildungsstand in Englisch, wie es im Amtsdeutsch heißt, an die schulische Leistung gekoppelt wird. Eine solche Korrelation als Kausalität zu erklären wäre das Gleiche wie zu behaupten, dass die Filme, in denen Nicolas Cage mitspielt, für die erhöhte Anzahl an Menschen verantwortlich sind, die in einem Pool ertranken. Sie glauben das nicht? Googeln Sie es. Der Chart ist nahezu identisch.
Schülerinnen und Schüler werden in einer vernetzten, globalisierten Welt besser in Englisch. Dieses kann in der Schule beobachtet werden, hat aber mit ihr nur sehr wenig zu tun. Man kann dazu Schüler befragen: Eine Siebtklässlerin offenbarte mir, dass sie in ihrer Freizeit mit Jugendlichen aus der ganzen Welt spricht – über einen Discord-Channel, einen Kanal also, mit dem Jugendliche sich vernetzen. Die ganze Klasse mit dem Schulbuch auf diese Stufe bringen? Vergessen Sie es!
Die Abwendung vom Stoff beinhaltet eine Chance, aber auch eine große Gefahr. Die Chance liegt darin, das Lernen und die Schule neu zu justieren. Und gemeinsam darüber nachzudenken, was eigentlich wichtig ist. Und wie man dies erreichen kann. Oder besser: Wie die Lehrperson die Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass gut gelernt wird. Der Lehrer wird dabei in den Worten des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie zum Change Agent.6 Zu demjenigen, der das Lernen bestmöglich beeinflussen kann. Und das eben mit den Mitteln und Wegen des 21. Jahrhunderts.
Das ist natürlich Utopie, denn ein solches Nachdenken braucht zwei Dinge, die Lehrer sowie Schüler nicht haben: Zeit und Muße. Und da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz, denn Sie wissen ja: der Stoff. Der Stoff verhindert eine ausführliche Beschäftigung mit einer derartigen Neujustierung. Zumindest dort, wo eine solche nicht von allen am Schulleben Beteiligten forciert wird.
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Die Abwendung von vorgekauten Inhalten, die durchgepaukt werden müssen, bedeutet keine Abkehr von Inhalten an sich. Die Forderung nach mehr Können ist die nach Tiefe, nicht nach mehr Oberfläche!
Denn Können und Kompetenz hat sehr viel mehr mit Übung zu tun als mit Verstehen. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Fächern, bei denen Übung gar nicht möglich ist. Wie soll ein Geschichtslehrer in der achten Klasse von der Französischen Revolution zur Weimarer Republik kommen und den Schülern zugleich Übungszeiten ermöglichen, wenn er nur zwei Stunden in der Woche hat, von denen nicht selten aus den unterschiedlichsten Gründen noch einige ausfallen? Das ist unmöglich. Als einzelne Lehrperson könnte man zwar Lehrplan und Vorgaben ignorieren und die Schüler zu Experten bei der Interpretation von Quellen aus der Zeit der Industrialisierung machen, aber die Kollegen würden (nach der Logik der Schulbürokratie) zu Recht fragen, warum denn ihre Klasse so weit hinterherhinke.
Alles hängt mit allem zusammen. Es geht nur mit gemeinschaftlichen Kraftanstrengungen.
Die Schulen, die die massiven Herausforderungen unserer Zeit annehmen und mit innovativen Konzepten zeigen, dass es in der Schule um mehr gehen kann als um eine Vermittlung von Stoff, demonstrieren, wie viel Potenzial in einer solchen Veränderung liegen kann. Sie wirkt sich auf alles aus, was Schule aus der Sicht derjenigen ist, die sie als Anstalt sehen wollen, in der jeder im gleichen Raum sitzt, das Gleiche zur gleichen Zeit hört und bearbeitet. Sie bedeutet nicht nur das Aufbrechen einer starren Stoffvermittlung, sondern umfasst das Selbstverständnis von Lehrern und Schülern. Alles hängt an deren Haltung.
Dennoch existieren Stolperfallen. Der missverstandene Kompetenzbegriff, den der von mir skizzierte Unternehmer in den Äther raunte, ist häufig anzutreffen und läuft Gefahr, sich an einem ausschließlich wirtschaftsorientierten Ideal anzudocken. Bildung ist danach das, was zur späteren Arbeit befähigt. Dann ist Bildung allerdings Ausbildung. Das wird aber einer so umfassenden, den ganzen Menschen betreffenden Aufgabe nicht gerecht. Aus meiner Sicht ist Bildung mehr. Sie beinhaltet, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann.
Was Bildung jedoch nicht ist, ist ein vorgefertigter Fundus von Material und Stoff, der für alle Empfänger gedacht ist. Sie können nicht im Gleichschritt in diese Inhalte gepresst werden. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass Schüler, die nicht angehalten werden, sich kritisch mit den Inhalten zu befassen, zum Lernen keine Lust mehr haben. Es ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, die bei gleichzeitig zunehmender Belastung möglichst motivierend, innovativ und eifrig sein müssen. Aber es lohnt sich. Oder anders formuliert: Bekommt man einen Stoff vorgesetzt, den man nicht mag, ist Verweigerung die plausible Konsequenz.
Der Gedanke, dass es in der Schule nicht länger um den Stoff geht, sondern um ein Bündel von Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen, wird unweigerlich zu einer Umorientierung führen und dazu, dass endlich die Fragen aufgeworfen werden, um das, was wir als Bildung so hochhalten, neu zu bewerten.
Ein derartiges Vorgehen kann unterschiedlich angegangen werden. Denkbar ist beispielsweise die Einführung von offenen Projekttagen oder -wochen, in denen vertiefendes Lernen möglich ist. Lehrerteams können zusätzlich gemeinsam Inhalte, Kompetenzen und Wissen vorstrukturieren und so dafür sorgen, dass man sich von den vorgegebenen Strukturen löst, ohne dass jeder macht, was er gerade will. Dass dies sogar über Schulgrenzen hinweg möglich ist, hat der Realschullehrer Sebastian Schmidt mit seinem digitalen Lernbüro gezeigt, mit dem er 2019 den Deutschen Lehrerpreis gewann. Lehrer tauschten sich hier über Ländergrenzen hinweg zu digitalen Unterrichtsmethoden und Videos aus, die sie in ihren Klassen einsetzen konnten. Übrigens mit einer Methode, die zeigt, wie Vertiefung auch funktionieren kann: Die Videos wurden und werden von Schmidt nämlich als Input oder Nachbereitung so eingesetzt, dass im eigentlichen Unterricht mehr Zeit dafür ist, die Kinder beim tatsächlichen Ausprobieren und Arbeiten zu unterstützen.
Die Erfahrung zeigt, dass es für einen dahingehenden Austausch unter Kollegen einen offiziellen Rahmen geben muss, wenn wirklich etwas bewegt werden soll. Und den gemeinsamen Willen der Mitwirkenden.
Lehrer sollten grundsätzlich überlegen, ob sie zusammen mit den Schülern das Lernen bestimmen oder ob der Stoff das Lernen bestimmt, sodass eine offene Aufbereitung nicht mehr möglich ist.
Eine ausschließliche Orientierung am vorstrukturierten Stoff ist nicht mehr zeitgemäß und führt zu einer weiteren Verkrustung eines ohnehin starren Systems. Deshalb ist der Stofffetisch eines der Dinge, die ich an der Schule hasse.
2Unterricht ist erstarrt
Warum ist Unterricht so langweilig?
Erster Vorschlag bei Google
Wenn man bei Google die Wörter »Warum ist Unterricht so …« eingibt, beendet die Suchmaschine den Satz mit dem Wort, das oben im Zitat zu lesen ist. Das ist also das, was Menschen am meisten, und man darf getrost vermuten, dass es sich dabei um Schüler handelt, wissen wollen. Um herauszufinden, warum Unterricht oft als so langweilig empfunden wird, hat man sich anzuschauen, was genau das eigentlich ist: Unterricht.
Als ich selbst noch Schüler war, war meine Vorstellung davon, was Unterricht ist, sehr naiv. Die Lehrer, so dachte ich, betreten den Klassenraum und wissen, was sie fragen oder sagen müssen. Und dann fragen sie, und man antwortet als Schüler nach bestem Wissen. Oder labert halt rum. So in der Art. Ein solches Bild von Unterricht hatte nicht nur ich, ein solches haben heute immer noch viele: Die Anschauung davon, wie Unterricht funktioniert, was die Lehrer in diesem tun und wie lange eine Stunde dauert, stammt aus einer Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die immer noch an vielen Schulen bestehende Zeiteinheit von fünfundvierzig Minuten wurde 1911 vom preußischen Kultusminister August von Trott zu Solz eingeführt (um den Nachmittagsunterricht zu kippen, die bisherige Unterrichtszahl aber zu erhalten, wurde einfach jede Stunde um fünfzehn Minuten gekürzt). Innerhalb dieses Zeitrahmens konnte dann der Lehrer sein Wissen den Schülern überstülpen. Die enge Taktung samt Ausrichtung der Klasse auf die vorne stehende Person hat sich bis dato wenig geändert, höchstens an Modellschulen oder neuen Schulformen. Man könnte auch formulieren: Unterricht im 21. Jahrhundert sieht sehr oft noch so aus wie Unterricht im 19. Jahrhundert. Wir bereiten Schüler unter Bedingungen der Vergangenheit auf die Zukunft vor.
Als ich nach dem Lehramtsstudium das erste Mal damit konfrontiert wurde, worum es bei der theoretischen Planung von Unterricht geht, war ich fasziniert und abgestoßen zugleich. Denn diese hatte so gar nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgestellt hatte. Unterricht ist in dieser Form eine auf die Minute getaktete Einheit.
Später konnte ich aber auch ganz anderes feststellen. Dass es nämlich immer noch Lehrer gibt, die Unterricht so durchführen, wie in dem dummen Witz zwischen Autodidaktik, Schwellendidaktik und Hammerdidaktik unterschieden wird. Danach ist der Autodidaktiker jemand, der sich im Auto auf dem Weg zur Schule überlegt, was man heute unterrichten könnte. Der Schwellendidaktiker überlegt sich auf dem Weg zum Klassenzimmer, was man machen wird, und entscheidet dies beim Betreten des Raums (bei Überwindung der Türschwelle). Und der Hammerdidaktiker beginnt die Stunde mit der Frage: »Was hamma denn letzte Stunde gemacht?« Haha.
Alle drei Varianten sind Realität und kommen häufiger vor als gedacht, sie sind aber noch kein Unterricht in dem Sinne, wie man ihn in der Fachdidaktik lernt. Wobei eine lockere Diskussion oder ein wenig Spaß sicherlich kein Problem darstellen. Im Gegenteil: Offener und authentischer Austausch kann zu den besten Stunden überhaupt führen. Das größere Problem ist da eher, dass das transportierte Unterrichtsideal, der Kern jeder Lehrerausbildung, so unrealistisch wie starr ist.
Um zu verdeutlichen, warum ich standardisierten Unterricht hasse, muss ich ihn zunächst erklären. Da müssen Sie jetzt durch.
Man könnte sagen, dass es grundsätzlich zwei Versionen von Unterricht gibt. Einmal den, den man im Referendariat durchführen soll. Den guten Unterricht also. Und einmal den Unterricht, den man danach macht. Davon abgesehen gibt es natürlich ungefähr so viele Vorstellungen davon, was guter Unterricht ist, wie es Fachleiter gibt, also jene Leute, die junge Referendare ausbilden. Aber das ist an dieser Stelle zu ignorieren, da man sonst zu ganz anderen Defiziten im deutschen Bildungsdschungel gelangt. Gehen wir also vom Idealzustand aus.