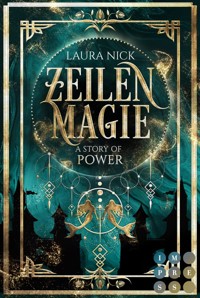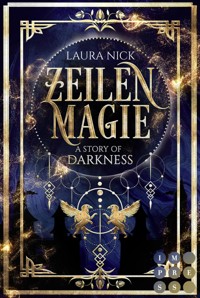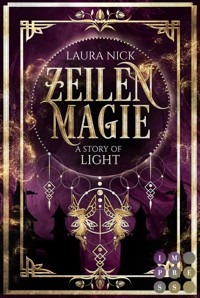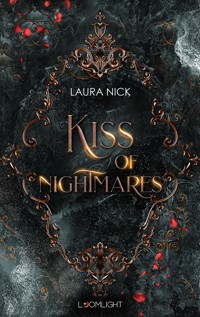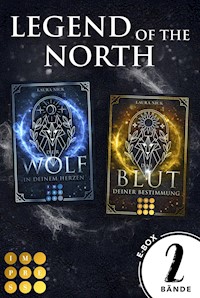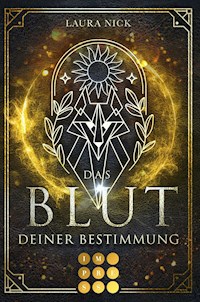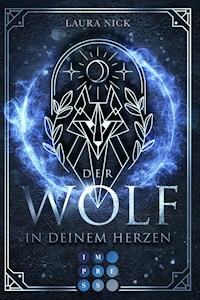12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Romantasy voller Magie, Spannung und mit einer wunderbaren Liebesgeschichte - perfekt für alle, die selbst gern von einem Buch eingesogen werden! Für Mia ändert sich alles, als sie beim Lesen eines uralten Buchs in ein fremdes und magisches Reich gerissen wird. Nymphen, Nixen und Elfen sind dort nicht nur etwas völlig Alltägliches - sondern sie verfolgen zum Teil gefährliche Pläne. Doch zwischen den Schatten dieser unberechenbaren Welt begegnet Mia Liam, einem rätselhaften Jäger mit scharfem Verstand. Während sie gemeinsam herauszufinden versuchen, warum sich Mia hier so seltsam zu Hause fühlt, knistert es immer mehr zwischen ihnen. Aber kann Mia Liam wirklich vertrauen oder birgt auch er ein Geheimnis? //Dieser Sammelband enthält alle Bände der mitreißenden Romantasy-Trilogie von Laura Nick. -- Band 1: A Story of Light -- Band 2: A Story of Darkness -- Band 3: A Story of Power Es handelt sich um eine bearbeitete Neuauflage der beliebten Fantasyserie »Fabula Magicae«, erstmals erschienen unter dem Pseudonym Aurelia L. Night.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses E-Book ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizensiert und wurde zum Schutz der Urheberrechte mit einem digitalen Wasserzeichen versehen. Das Wasserzeichen beinhaltet die verschlüsselte und nicht direkt sichtbare Angabe Ihrer Bestellnummer, welche im Falle einer illegalen Weitergabe und Vervielfältigung zurückverfolgt werden kann. Urheberrechtsverstöße schaden den Autor*innen und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Rechtlicher Hinweis § 44b UrhG: Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Mit Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: www.carlsen.de/kontakt
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH, Völckersstraße 14-20, 22765 Hamburg © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2025 Text © Laura Nick, 2025 Lektorat: Julia Feldbaum Coverbild: depositphotos.com / © ronedale / © totamilow / © robin_ph / © [email protected] / © maglyvi / © oksanello / © Shafran13 Covergestaltung der Einzelbände: Hannah Sternjakob Design ISBN 978-3-646-61233-2www.impressbooks.de
© privat
Laura Nick wurde März 1995 inmitten des Ruhrpotts geboren. Jedem, der sie hören wollte – oder auch nicht –, erzählte sie Geschichten über fantasievolle Abenteuer und Liebe. Unter dem Pseudonym Aurelia L. Night hat sie seit 2016 Fantasy- und Liebesromane veröffentlicht. Sie ist aktives Mitglied im PAN e.V. und setzt sich für die deutsche Phantasik in der Buchbranche ein. Mittlerweile lebt, liest und arbeitet Laura Nick mit ihrem Ehemann in Niedersachsen, nahe des Meeres und der niederländischen Grenze.
Wohin soll es gehen?
Autor*innenvita
Band 1: A Story of Light
Band 2: A Story of Darkness
Band 3: A Story of Power
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Laura Nick
Zeilenmagie 1: A Story of Light
Für Mia ändert sich alles, als sie beim Lesen eines uralten Buchs in ein fremdes und magisches Reich gerissen wird. Nymphen, Nixen und Elfen sind dort nicht nur etwas völlig Alltägliches – sondern sie verfolgen zum Teil gefährliche Pläne. Doch zwischen den Schatten dieser unberechenbaren Welt begegnet Mia Liam, einem rätselhaften Jäger mit scharfem Verstand. Während sie gemeinsam herauszufinden versuchen, warum sich Mia hier so seltsam zu Hause fühlt, knistert es immer mehr zwischen ihnen. Aber kann Mia Liam wirklich vertrauen oder birgt auch er ein Geheimnis?Dort, wo Magie und Verrat so eng miteinander verwoben sind wie Tag und Nacht, muss Mia lernen, ihrem Herzen zu folgen.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Für Oma.Ich wünschte,du hättest erleben können,was für ein Mensch ich geworden bin.
Und für all jene,die zwischen den Zeilen abtauchen unddie Realität vergessen.
Prolog
Alendia, vor neunzehn Jahren
Zäh wie Honig verfloss die Zeit. Wie es von ihr verlangt wurde, tanzte sie mit ihrem König und versuchte sich an bedeutungslosen Gesprächen mit den Gästen, wie es ebenfalls zu ihrer Gewohnheit geworden war.
Aber sie wollte fliehen. Nichts hielt sie hier auf diesem Fest. Die Sehnsucht nach ihrem Sohn machte sie wahnsinnig und ruhelos. Doch noch war es nicht so weit. Noch musste sie hierbleiben und den Geiern gefallen, die alle nur gekommen waren, um ihren Sohn zu betrachten, den König Seban stolz vorgestellt hatte. Als sich Mariella an die Blicke dieser Leute erinnerte, wie sie sich alle auf ihren Sohn gestürzt hatten, als wäre er Beute und nicht der zukünftige König, überkam sie ein Schauder.
Ihr Blick glitt durch den Ballsaal, bis er auf ein graues Paar Augen traf, das sie direkt in ihren Bann zog. Die Zeit schien stillzustehen, während es nur diesen einen Moment gab – zwischen ihr und dem ihr vollkommen fremden Mann.
Sein Anblick glich dem eines Königs. Sein blondes Haar fiel wellig bis zu seinen Schultern und ein Bart zierte seine Wangen. Mariellas Herz blieb stehen. Es gab nur noch ihn für sie.
Der Mann hatte etwas Raues an sich, eine Wildheit spiegelte sich in seinen Augen, die nur zu einem Krieger passen konnte, obwohl er durch seine Haltung und seine Kleidung wie ein König aussah.
Ohne sich zu entschuldigen, lief sie zu ihm. Alles in ihr schrie nach ihm. Es war wie ein Rausch, der sich ihrer bemächtigte. Ihr Herz erholte sich und begann in ihrer Brust zu rasen. Ihr Atem ging stoßweise.
Das war es! Das, was sie in König Sebans und ihrer Beziehung so sehr vermisste, was sie niemals zulassen konnte, selbst wenn sie es wollte. Die Leidenschaft. Das Gefühl unterzugehen, wenn man nicht bei dem anderen war. Mariella sollte sich schlecht fühlen, dass sie so empfand – für einen Fremden. Aber sie konnte nicht. In ihr flogen die Schmetterlinge umher, ließen sie glücklich lächeln, wie sie es schon seit Jahren nicht mehr getan hatte. Sie fühlte sich eins mit sich. Als sei dieser Unfall niemals passiert, der ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Der ihr jegliche Freude genommen und ihr gezeigt hatte, dass sie sich auf niemanden verlassen durfte.
Der Mann hatte sie nun ebenfalls entdeckt und kam auf sie zu. Er schien es genauso eilig zu haben wie sie.
Einen Moment blieben sie voreinander stehen. Nicht in der Lage etwas zu sagen, weil sie von ihren Gefühlen verschlungen wurden.
Er verbeugte sich tief vor ihr. »Darf ich um diesen Tanz bitten?«
Seine Stimme ließ ihren Körper erzittern. Sie hallte bis in ihr Innerstes nach. Sie konnte bloß nicken und ergriff die Hand des Kriegers.
Er führte sie auf die Tanzfläche und zog sie nah an sich. Sie wusste, dass er das eigentlich nicht durfte – keiner außer dem König durfte dies. Aber sie konnte sich ihm nicht widersetzen. Ihr Kopf war wie leer gefegt, nur noch sie beide existierten.
Jetzt gab es keinen König Seban und keinen Hofstaat mehr, den sie gekünstelt freundlich anlächeln musste. Nur der Fremde erfüllte ihre Gedanken.
»Ihr tanzt wundervoll«, raunte er in ihr Ohr.
Eine Gänsehaut fuhr über ihren Hals. Dort, wo sein Atem ihre Haut berührte, fühlte es sich an, als würden kleine Blitzstöße durch ihren Körper jagen.
»Danke.« Ihre Stimme zitterte. »Ihr auch.« Sie fühlte sich wie ein junges Mädchen. Frei von Verpflichtungen und Schuldgefühlen, die ihr das Glück raubten.
Er grinste. »Dann haben die Tanzstunden mit meiner Amme und meiner Tante ja doch Früchte getragen«, meinte er und grinste jungenhaft.
Mariella hielt den Atem an. In seinen Wangen wurden Grübchen sichtbar. »Das haben sie auf jeden Fall«, erwiderte sie atemlos und schenkte ihm ein zaghaftes Lächeln. Sie fühlte ihre Freude, die sie so vermisst hatte, das Lächeln, das bis in ihre Augen reichte. Fühlte ihr Herz, das nicht durchzogen von Hass und Ekel pumpte. Sie meinte, dieser Mann hätte alles Negative in ihr gelöscht.
Seine grauen Augen schienen sie zu verschlingen und anstatt sich abgestoßen zu fühlen, wollte sie ihm alles geben, was sie hatte. Sie fühlte keinen Ekel, als er sie so ansah. Nur Leidenschaft, die ihren ganzen Körper flutete und sie zum Brennen brachte. Die Leidenschaft, die sie für ihren König empfinden sollte, empfand sie für diesen Mann. Königin Mariella sollte sich ihrer Gefühle schämen. Aber das konnte sie nicht. In den Armen dieses Mannes empfand sie das erste Mal seit Jahren wieder Freiheit und Freude. Wie sollte sie sich schämen, wenn sie glücklich war? Wie sollte sie die Gefühle, die berauschend durch ihren Körper kreisten, hassen?
»Barthos, mein Freund!«, erscholl da die Stimme des Königs.
Ihr Tanzpartner zuckte zusammen, als sei er, ebenso wie Mariella, aus einem Traum gerissen worden. Er wandte sich dem König zu und erst jetzt wurde Mariella klar, mit wem sie getanzt hatte. Wer ihr Herz und ihre Welt zum Stehen gebracht hatte.
König Barthos. Herrscher von Eventyr. Der beste Freund ihres Mannes. Derjenige, der es nie geschafft hatte, zu einem offiziellen Anlass zu erscheinen, weil die Grenze von Eventyr erneut von Ogern angegriffen worden war und das Land seither versuchte einen Handel mit diesen Wesen zu schließen, der den Frieden bringen würde. Sie hatten die Oger zwar schon einmal besiegt, aber irgendwie hatten diese Riesen sich erholen können. Damals hatten der Held und die Kriegerprinzessin Eventyrs die Gegner mutig geschlagen, doch dann waren die beiden auf einmal verschwunden und nie mehr gesehen worden. Keiner wusste, was mit ihnen passiert war.
Wieder begann Mariellas Herz zu rasen, aber nicht wegen Barthos, sondern wegen der Erkenntnis, dass sie auf ewig Seban gehörte. Sie hatte es schon immer gewusst. Aber sie hatte die Hoffnung gehabt, dass sie irgendwann in Vergessenheit geraten und einer Mätresse Platz machen würde. Doch wie sollte sie mit dem Wissen leben, dass es ihn gab? Ihn, den einen, der ihre Welt zum Stillstand brachte.
»Seban! Es ist so schön dich endlich wiederzusehen«, erwiderte Barthos und die beiden Männer fielen sich in die Arme.
Königin Mariella biss sich auf die Lippe. Sie fühlte sich unwohl und wollte sich gerade zum Gehen wenden, als eine warme Hand die ihre umfasste und festhielt.
»Würdet Ihr uns die Freude machen, Euch vorzustellen?«, fragte Barthos an Mariella gewandt. Dabei blitzten seine Augen. Er schien noch immer zu glauben, dass sie zu haben war. Dass ihr Herz frei war für ihn. Mariella wurde schlecht vor Trauer.
Seban begann laut und schallend zu lachen. »Mir braucht sich die Dame nicht vorzustellen, mein Freund. Das ist Mariella. Meine Frau und Königin, die Mutter meines Sohnes.«
Mariella konnte beobachten, wie Barthos die Information hinunterschluckte, als würde er etwas Widerliches essen. Doch er schüttelte sich und legte eine Maske der höflichen Neugier auf. »Deine Frau also? Sie ist eine zauberhafte Tänzerin«, bemerkte er und wandte sich wieder seinem Freund zu.
»Ja, das ist sie wahrhaftig.« Sebans Blick lag bewundernd auf seiner Frau.
Mariella unterdrückte die Tränen, die ihr die Luft raubten. Sie verbeugte sich. »Ich brauche frische Luft, meine Herren«, entschuldigte sie sich und floh beinahe aus dem Ballsaal.
Wie schnell doch all ihre Hoffnungen zerschlagen worden waren. Sie verfluchte Barthos. Wieso musste er König von Eventyr sein?
Sie ließ sich auf eine der Bänke im Garten nieder und betrachtete die Sterne. Sie fühlte sich von der Welt missachtet. Sie hatte ein Kind mit einem Mann, den sie nicht liebte. Und der Mann, der ihr Herz zum Stolpern gebracht hatte, der ihre Welt erschüttert hatte, war der König eines anderen Landes.
Sie hatte sich nur eines gewünscht, nachdem sie von dem ihr wichtigsten Menschen – ihrer Freundin und Schwester – verraten worden war. Sie hatte sich gewünscht, dass es auf dieser Welt den einen gab, der ihr Herz erobern, der ihr die Erde zu Füßen legen würde. Nie hatte sie die Hoffnung gehabt, dass das Schicksal ihr diesen Mann tatsächlich schenken würde … Doch nun war er hier. Und gleichzeitig so unerreichbar für sie.
Hinter sich hörte sie, wie eine Tür aufging. Neugierig sah sie sich um. Die kräftige Statur König Barthos’ hob sich gegen das Licht ab. Er kam direkt auf sie zugelaufen und bevor sie etwas sagen konnte, umfasste er ihr Gesicht und eroberte ihren Mund. Nicht zärtlich und sanft, wie Seban es immer tat, sondern wild, besitzergreifend. Ihr Herz schmolz und sie gab sich diesem Mann hin. Und in dem Augenblick wusste sie: So musste sich die eine, die wahrhaftige Liebe anfühlen.
»Es … es tut mir leid«, keuchte Barthos, als er sich von ihr löste. »Aber ich konnte nicht gehen, ohne zumindest den Geschmack Eurer Lippen auf meinen zu tragen.«
Mariella fühlte sich fiebrig und ihr Atem ging genauso stoßweise wie seiner. Ohne nachzudenken, presste sie ihre Lippen noch einmal auf seinen Mund und lehnte sich gegen den kräftigen Körper des Königs.
Sie fühlte, wie sich seine Hände an ihre Wangen legten, sie hielten. Und sie wusste, dass sie dieses Gefühl der Liebe, der Freiheit und der Lust für immer fühlen wollte. Nicht nur für einen Moment, sondern für immer und ewig. Sie wollte nicht wahrhaben, dass Barthos für sie unerreichbar war. Sie wollte sich ihm hingeben mit Haut und Haar.
Seine Zunge eroberte ihren Mund und sie konnte ein leises Stöhnen nicht unterdrücken. Ihr Körper fühlte sich aufgeladen an, als sei ein Blitz in ihn gefahren.
»Barthos …?« Die Stimme König Sebans erstarb.
Mariella und der König Eventyrs fuhren auseinander. Die Königin konnte sehen, wie die Wut in den Augen ihres Gatten emporzüngelte. Wie der Hass sich in ihm aufbaute. Sie fühlte das schlechte Gewissen. Nicht weil sie Barthos geküsst hatte – das würde sie auf der Stelle noch einmal tun –, sondern weil Seban sie entdeckt hatte.
Normalerweise war Seban ein König des Friedens, er glaubte an die Kraft der Rede. Aber die Königin konnte sehen, dass dieses Verhalten nicht mit Worten wiedergutzumachen war. »Geh auf dein Zimmer, Mariella«, befahl er, als wäre sie ein Kind. Seine Stimme war eiskalt und duldete keinen Widerspruch.
»Seban …«, versuchte sie sich zu erklären. Doch sein zornerfüllter Blick genügte und sie verstummte.
»Wieso?«, fragte er seinen Freund und schien Mariella vergessen zu haben.
»Ich weiß es nicht. Sie bewegt etwas in mir, Seban, so sehr, wie es keine andere zuvor getan hat«, gab Barthos zu.
Die Königin sah zwischen den beiden hin und her. Hinter ihrem Rock hatte Barthos nach ihrer Hand gegriffen und drückte sie zuversichtlich. Sie warf ihm noch einen Blick zu und verließ die beiden Herrscher.
Mariella rannte auf ihr Zimmer. Ihr Körper bebte vor Angst und aufgrund des leidenschaftlichen Kusses. Sie spürte Barthos’ Lippen noch immer auf ihren. Sie ging zum Bett ihres Sohnes und betrachtete ihn. Hob ihn hoch und schnupperte an ihm. Versuchte sich zu beruhigen und ihre Gedanken zu klären.
»Was habe ich nur getan?«, fragte sie ihren unschuldigen Jungen.
Doch er schlief in Seelenruhe und bekam nichts von der Angst seiner Mutter mit.
Mariellas Blick wanderte zu dem Schmuckkästchen, das offen dalag und den Blick auf die kostbarsten Schätze freigab, aber auch auf zwei einfache Steine, die an Lederbändern befestigt waren. Groll regte sich in ihr. Sie hatte Schuld an dem, was passiert war. Niemand sonst. Wegen ihr war der Hass in ihr so stark geworden. Wegen ihr hatte Mariella alles verloren.
***
Gefühlte Stunden später kam Seban in ihre Räumlichkeiten. »Ich werde keinen Krieg gegen Eventyr führen«, erklärte er. »Aber ich habe Barthos des Landes verwiesen und er wird nie wieder in die Nähe von Alendia kommen.«
Seine Stimme war eiskalt.
Sie hatte ihn verletzt. Mariella wusste, dass er daran geglaubt hatte, dass sich zwischen ihnen etwas verändern könnte, sobald ihr Sohn auf der Welt war. Die Königin hoffte, dass ihr König sie so sehr liebte, wie er selbst es anscheinend glaubte.
»Seban, lass mich frei. Mein Herz … Es gehört Barthos. Da war nur dieser eine Augenblick und doch … Es war alles für mich. Bitte, Seban, lass mich zu ihm gehen …«, flehte sie ihn an.
»Nein.«
Ihr Herz zersplitterte. Die Scherben bohrten sich in ihren Körper und zerrissen die Mauern, die ihre Kraft im Zaum gehalten hatten.
»Was …?« Ihre Stimme war nur noch ein Hauch. Sie hatte gedacht, dass Seban sie liebte. Sie hatte daran geglaubt, dass wenigstens einer in ihrer Beziehung glücklich war. Aber anscheinend hatte sie sich geirrt. Anscheinend war es ihm niemals um seine Gefühle gegangen, sondern bloß um den Besitz. Sie war eine hübsche Frau, das wusste Mariella. Sonst hätten nicht so viele Adelige vor ihrer Tür gestanden und sie bewundert.
Sie war eine Trophäe.
Seban hatte sie nicht der Liebe wegen geheiratet. Sondern nur wegen ihres Aussehens. Diese Erkenntnis sollte sie erschüttern, aber machte sie bloß wütend. Sie war von der machthungrigen Hand ihrer Mutter in die nächste geraten.
»Ich werde dich nicht gehen lassen. Dein Platz ist an meiner Seite. Du hast mir einen Sohn geschenkt und glaube mir, es werden weitere folgen. Entweder mit deinem Einverständnis oder ohne. Es ist mir egal«, fuhr König Seban seine Königin an.
Die Wut überrannte Mariella wie eine Feuersbrunst und ihre Macht erwachte mit einem Ruck. Sie erfüllte ihre Venen, berauschte sie und ließ den Hass gegenüber dem König ins Unermessliche wachsen.
»Drohst du mir?« Ihre Stimme glich dem Zischeln einer Schlange, als sie Seban diese Frage stellte.
Wind fuhr durch den Raum, löste die Spangen in ihren Haaren und ließ die Strähnen auf den Strömungen der Luft reiten. Energie fuhr durch ihren Körper, ließ sie bedrohlich und mächtig wirken.
»Das ist keine Drohung«, knurrte Seban, »sondern ein Versprechen.« Er versuchte die Demonstration ihrer Macht zu ignorieren und wandte sich von seiner Königin ab.
Hass erfüllte Mariella. Er war wie ein Feuer, das sich durch ihre Adern fraß und all die Macht anstachelte, die sie besaß. »Du, Seban, mein König, wirst niemals mein Antlitz vergessen. Du wirst dich mit deiner ganzen Liebe nach mir verzehren und durch sie für immer blind sein, blind für alle anderen Frauen, blind für die Liebe«, prophezeite sie ihm.
Seban drehte sich wieder zu ihr um und Mariella konnte beobachten, wie ein grüner Blitz auf ihn fuhr und seine Augen eintrüben ließ. Niemals würde er eine Mätresse haben können, weil er sich immer nur nach ihr verzehren würde. Für immer würde er nur noch sie sehen.
In ihrer Blindheit bemerkte die junge Königin das Dienstmädchen nicht, das sich ängstlich im Flur verborgen hielt und die Magierin durch einen kleinen Spalt zwischen Wand und Tür mit großen Augen betrachtete.
Die Energie zog an Mariella und sie wandte sich ihrem Sohn zu. »Verflucht sollst auch du sein!«, fuhr sie ihr eigenes Kind an, das ein Grund war, wieso Seban sie wie eine Gefangene hielt. »Du trägst die Züge deines Vaters in dir, du wirst blind sein für die Liebe, sobald du sie am meisten brauchst. Jede Nacht wirst du zu dem Monstrum werden, das du im Inneren bereits bist – deinem Vater gleich.«
Die Macht hob das unschuldige Kind aus seinem Bett und begann ihr Werk zu tun.
Mariella verabscheute den Anblick des Tieres, in das sich ihr Sohn verwandelt hatte – es verkörperte Mut und Hass in einem.
»Ewig wirst du an den Boden gekettet sein. Du wirst gefangen sein – wie ich es bin«, fügte die Königin in ihrem Hass hinzu und das Baby schrie auf.
Die Königin spürte, wie der Fluch an ihrer Energie zerrte. Doch ihr war es egal. Sie war blind vor Wut. »Auf ewig sollen Alendia und Eventyr in einem Krieg gefangen sein. Du, Seban, wirst von dem Hass zerfressen, den du gegenüber deinem besten Freund fühlen wirst. Du wirst ihn leiden lassen wollen für das, was er dir angetan hat.«
König Seban wurde erneut von einem grünen Blitz getroffen und sackte bewusstlos in sich zusammen.
Die Macht in Mariella verpuffte. Schwach sackte die Königin auf den Boden. Die Magie zog sich zurück, müde von der Anstrengung. Und langsam wurde sie sich bewusst, was sie getan hatte.
»Nein«, raunte sie.
Ihr Blick glitt hektisch zum Kinderbettchen. Mit zittrigen Beinen stolperte sie zu ihrem Sohn. Sie hob erschrocken die Hand an ihren Mund, als sie das Tier dort kauern sah. Die grünen Augen richteten sich auf sie.
Die Königin konnte nicht glauben, was sie getan hatte. Der Hass hatte sie überrannt und sie hatte es zugelassen. Hatte sich hinreißen lassen – erneut – und dabei ihren eigenen Sohn verflucht.
Vorsichtig näherte sich ihre Hand dem Wesen und ließ es daran schnuppern. Das Tier legte seinen Kopf gegen ihre Haut. Die Augen schimmerten nass und der Königin zerfetzte es das Herz, als sie sah, wie zutraulich ihr Sohn ihr gegenüber noch immer war.
Seban hatte diesen Fluch verdient. Aber nicht ihr eigen Fleisch und Blut. Nicht das Licht ihrer dunklen Tage.
»Es tut mir leid, mein Kind«, hauchte sie verzweifelt.
Sie schloss die Augen und versuchte ihre Macht zu finden. Nur dieses einzige Mal wollte sie etwas Gutes mit dieser Magie bewirken. Ihr Kind brauchte ein Schlupfloch. Sie tastete nach dem Gefühl, welches sie berauschte, und fand es. Sie hatte sich verausgabt. Sie war schwach und sie konnte den Fluch nicht zurücknehmen. Er hatte sich schon in jede Zelle ihres Prinzen gebrannt, doch sie konnte ihm helfen.
»Ein Kuss deiner wahren Liebe wird die Flügel heilen«, murmelte sie leise und grüner Rauch entstieg ihrer Hand, der sich um ihren Sohn wickelte. »Und das Bekenntnis der Liebe wird dich heilen, wird den Fluch brechen, den ich dir beschert habe. Solltest du die Deine finden und sie dich ebenso unabhängig lieben wie du sie, wird dein Fluch gebrochen.«
Die Magie floss aus der Königin und mit ihr das Leben.
Kapitel1
Trauer erstickte mich. Ich versuchte die Tränen hinunterzuschlucken, die sich hervorkämpfen wollten. So lange waren wir noch nie voneinander getrennt gewesen. Es fühlte sich noch immer so unwirklich an, während ich auf dem Weg zur Beerdigung hinter meinen Eltern im Auto saß.
Seit Opas Tod hatten sie sich verändert, sie waren beide noch mehr in sich gekehrt. Ich bewunderte meine Mutter dafür, dass sie zumindest im Moment die Finger nicht um den Hals einer Wodkaflasche gelegt hatte. Mein Vater sah einfach nur erschöpft und blass aus.
Es brach mir das Herz, die beiden so zu sehen, aber was sollte ich tun? Ich selbst konnte nicht glauben, dass er wirklich fort sein sollte – für immer. Ein Kloß bildete sich bei den Worten in meinem Hals und ich bohrte meine Finger in die Oberschenkel, um mich von dem Schmerz im Inneren abzulenken.
Es wirkte. Zumindest so lange, bis ich mich wieder unter Kontrolle hatte. Es konnte einfach nicht wahr sein, sagte ich mir wieder und wieder. In den letzten Tagen war der Satz zu einem Mantra geworden, der mich davor bewahrte auszuflippen. Aber was geschah, wenn mir meine Lüge weggenommen würde?
Ich wusste, dass das passieren würde. Spätestens wenn ich den Sarg sah … Ich verdrängte den Gedanken. Es kann einfach nicht wahr sein. Es ist ein Fehler. Er kann nicht tot sein.
Wieso ausgerechnet er? Diese Frage stellte ich mir seit Tagen.
Alle meine Mitschüler hatten ihre Großeltern noch. Aber er, der mir in meinen sechzehn Lebensjahren mehr Elternteil gewesen war als meine eigenen Erzeuger, hatte schon gehen müssen. Wieso?
Mein Vater bog in die Straße ein, an der der Friedhof lag. Kalter Schweiß benetzte meinen Körper und eine Gänsehaut breitete sich auf meiner Haut aus, obwohl mir nicht kalt war. Ich begann zu zittern und der Wunsch umzudrehen war so stark, dass mir schlecht wurde.
»Ich will das nicht machen«, wisperte Mutter leise. In der Stille des Wagens wirkte es so, als ob sie es herausgeschrien hätte.
»Keiner von uns will es«, sagte mein Vater und seufzte leise. »Aber das sind wir ihm schuldig«, raunte er.
Ich presste die Kiefer aufeinander und starrte aus dem Fenster. In den Autoscheiben spiegelte sich mein Gesicht. Die grauen Augen schimmerten feucht. Meine schwarzen Haare, die ich von Opa geerbt hatte, fielen mir lockig ums Gesicht und rahmten es ein. Mein Spiegelbild sah aus wie eine Fremde. Noch nie hatte ich so abgezehrt und müde gewirkt wie in den letzten Tagen. Ich konnte nicht verstehen, wie sie so über Opa sprechen konnten. So, als wäre sein Tod endgültig. Ich konnte es noch immer nicht glauben – wollte es nicht akzeptieren. Denn das zu akzeptieren hieß, dass ich lernen musste, ohne meinen Großvater zu leben. Und das wollte ich nicht. Auch wenn es egoistisch klang, ich wollte einfach nicht, dass er weg war. Einfach so, ohne ein Wort des Abschieds.
Noch vor einer Woche hatte ich auf dem Schulhof gestanden und gewartet, aber er war nicht gekommen. Das hatte es noch nie gegeben und tief in meinem Inneren hatte ich gewusst, dass etwas nicht stimmte. Dennoch war ich nach Hause gegangen. Wo meine Eltern bereits auf mich gewartet hatten.
Er war eingeschlafen. Sein Herz hatte plötzlich im Schlaf aufgehört zu schlagen. Ich wusste nicht einmal mehr, was ich zuletzt zu ihm gesagt hatte. Und dieses Unwissen schien mich zu zerfleischen. Das konnte es nicht gewesen sein. Mein Großvater war nicht tot.
Mein Vater bog auf den Parkplatz und schaltete den Wagen ab. Keiner von uns rührte sich. Keiner wollte den ersten Schritt tun. Stillschweigend saßen wir in dem verstummten Auto. Die Stille erdrückte mich und ich wollte fliehen, gleichzeitig wollte ich aber nicht hinausgehen und mich mit der Wahrheit konfrontieren. Denn sobald ich auf den Friedhof ging, würde ich akzeptieren müssen, dass er nicht mehr da war.
Räuspernd schnallte mein Vater sich ab, atmete noch einmal tief durch und murmelte: »Dann wollen wir mal …« Er öffnete die Tür. Mit steifen Gliedern folgte ich ihm.
In mir fühlte sich alles leer an. Die große Leere hatte einfach alles in sich aufgesogen und – abgesehen von dem Unglauben und Schmerz – nichts mehr übrig gelassen.
Gemeinsam staksten wir über den Friedhof zu der kleinen Kapelle, in der der Abschiedsgottesdienst stattfinden sollte.
Das kleine Gotteshaus war schlicht, aber modern eingerichtet. Einige Stuhlreihen waren aufgestellt worden, doch wir setzten uns nicht. Gemeinsam blieben wir am Eingang stehen. Vater rechts und Mutter links von mir. Wir bildeten das Abbild einer heilen Familie, die wir nicht waren. Und nie mehr sein würden. Ein wichtiger Teil war uns entrissen worden.
Ich ignorierte den Sarg, der aufgebahrt vorn stand. Hielt meinen Blick stur aus der Kapelle gerichtet und wartete auf die anderen Gäste, die um Opa trauern wollten, der nicht tot war.
Der Friedhof lag ruhig da, nur ein paar einzelne Menschen liefen durch die kleinen Gassen zwischen den Gräbern, um ihre Liebsten zu besuchen.
Mit Widerwillen sah ich zum ersten Mal den Sarg an, den Vater ausgesucht hatte. Er war recht schlicht in rotbraunem Holz gehalten. Leichte Verzierungen von Blumenranken schlangen sich um den Kasten, in dem mein Großvater schlief. Ich verdrängte, dass er niemals mehr aufwachen würde.
Ich krallte meine Fingernägel in die Handballen, versuchte mich wieder abzulenken. In dem Moment kamen die ersten Gäste. Sie alle waren wie wir in Schwarz gekleidet. Die meisten hatten einen Regenschirm dabei, obwohl es noch nicht regnete. Doch die Wolken hingen bedrohlich am Himmel und ich hoffte, dass es noch regnen würde. Dass der Himmel Erbarmen zeigen würde und mittrauerte – um einen Menschen, der so viel Gutes getan hatte.
»Mein Beileid«, murmelte eine ältere Dame. »Ich mochte Erik. Er war ein Träumer. Hat nie aufgegeben daran zu glauben, dass jede Geschichte einen wahren Kern hat.«
Ich presste meine Kiefer aufeinander. Ich wollte nicht vor all den Menschen in Tränen ausbrechen. Wollte mir nicht vor ihnen die Blöße geben.
Dutzende Hände schüttelte ich. Und jedes Mal hörte ich, wie toll mein Opa gewesen war, als ob ich das selbst nicht wusste. Meine Hand tat weh, als wir uns in die vorderste Reihe setzten. Mein Blick war genau auf den Sarg gerichtet. Ich begann zu zittern. Am liebsten wäre ich zusammengebrochen, stattdessen spielte ich die Starke. Hielt die Hand meines Vaters, der schon rote Augen hatte von den vergossenen Tränen. Ich fühlte mich neben ihm so kalt. Er konnte offen mit seinen Gefühlen umgehen. Ließ sich nicht durch die anderen Menschen einschüchtern, so, wie ich es tat.
Mein Blick schweifte zu Mutter. Sie hatte ihre Hände krampfhaft im Schoß gefaltet und schien, genauso wie ich, mit sich zu ringen, wie sie sich verhalten sollte. Immerhin war es nicht ihr Vater gewesen, obwohl er sie wie eine Tochter behandelt hatte. Doch sie musste für ihren Mann da sein – eigentlich. Aber ich bezweifelte, dass sie es konnte. Dass irgendwer von uns für irgendwen da sein konnte.
Der Pastor kam in die Kirche, während leise Musik im Hintergrund gespielt wurde, die ich nicht einordnen konnte. Als der Mann vorn stand, verstummte die Melodie und er räusperte sich.
Ich konnte ihm nicht zuhören. Opa Erik war so viel mehr gewesen als das, was der Pastor da erzählte.
In meiner Kindheit war er mein Geschichtenerzähler gewesen. Ich erinnerte mich genau daran, wie ich auf seinen Knien gesessen und ihn angebettelt hatte, mir noch eine und noch eine Geschichte zu erzählen. Irgendwann waren sie ihm ausgegangen und er hatte mir Bücher gezeigt, eine Leidenschaft, die wir bis zum Schluss geteilt hatten.
»Weißt du, Mia, in jedem Buch steckt eine wahre Geschichte. Auf jeder Seite spielt sich Leben ab.« Das hatte er mir immer und immer wieder eingetrichtert, bis die Erkenntnis mir ins Blut übergegangen war. Ich konnte nicht ohne Bücher – genauso wenig, wie ich ohne Großvater konnte. Und genauso wenig konnte ich glauben, dass er fort war. Komplett und für immer. So viele Helden waren in meinen Büchern tot geglaubt gewesen und hatten dann doch überlebt, und egal, wie aussichtslos die Situation gewesen war … Sie waren doch siegreich aus der Geschichte hervorgegangen. Er war mein Held und – verflucht – ich brauchte ihn.
Ich schluckte hart.
Mein Vater drückte meine Hand, ehe er sie losließ und aufstand – gefolgt von fünf seiner Freunde. Gemeinsam gingen sie zum Sarg, hoben ihn hoch und führten die Masse an Menschen an. Mit steifen Gliedern folgte ich ihnen.
Wir liefen zu Opas Grab, das neben dem meiner Oma unter einer Trauerweide lag. Ich hatte meine Oma nicht gekannt, sie war früh an Krebs gestorben. Doch ich wusste, dass er sie geliebt hatte, mit allem, was er besessen hatte. Ich sehnte mich nach der Hand meines Vaters. Meine Mutter schluchzte den ganzen Weg schon und sie wurde immer zittriger. Sie stützte sich auf mich, zog mich noch weiter runter und zwang mich, mich in die erste Reihe zu stellen, als der Sarg in das Loch abgesenkt wurde.
Erst jetzt gab mein Verstand nach. Erst jetzt wich der Unglauben der bitteren Wahrheit.
Opa Erik war tot. Und er würde nie mehr zurückkehren.
Nie mehr würde er mir eine Geschichte erzählen. Nie mehr würde ich seiner Stimme lauschen und nie mehr würde er einfach mit mir auf der Parkbank sitzen und mir zuhören. Nie mehr würde das passieren. Weil er nicht mehr da war. Er war weg.
Tränen rannen mir jetzt ungehindert die Wangen hinunter, plötzlich interessierten mich die Menschen um mich herum einen Dreck. Der Schmerz schien mich zu zerfressen und jetzt war ich es, die sich an meine Mutter klammerte. Ich brauchte ihren Halt, aber statt mich in den Arm zu nehmen, zog sie mich noch weiter herunter, sodass ich mich losreißen musste, um nicht auf die Knie zu gehen.
Meine Mutter hängte sich direkt an den nächsten angebotenen Arm und schluchzte hemmungslos weiter.
Papa stand direkt am Grab, schaute hinab und ich konnte beobachten, wie eine Träne in das offene Loch tropfte, während der Pastor irgendwas davon redete, dass Asche zu Asche wurde.
Ich hörte ihm nicht zu. In meinen Ohren rauschte es. Ich konnte nicht weiter zuhören, wollte nicht zuhören. Ich wollte rennen, weit weg, und doch wollte ich bleiben. Ich wollte zusammenbrechen und weinen. Aber gleichzeitig konnte ich nicht. Ich wollte es nicht vor all diesen Menschen tun.
Meine Fingernägel bohrten sich in die Handballen und ich versuchte mich durch den Schmerz zur Ordnung zu rufen, aber das Mittel half nicht mehr. Ich spürte noch immer den innerlichen Schmerz, der mich zerriss. Der mir klarmachte, dass ich jemanden verloren hatte, der mir unglaublich wichtig war. Dass jetzt jemand in meinem Leben fehlte, der zuvor eine unglaublich große und vor allem wichtige Rolle darin gespielt hatte.
Ich war unvollständig. Meine Familie war unvollständig. Schlimmer als jemals zuvor. Und ich hatte das Gefühl, obwohl ich umringt von all diesen Menschen war, die ebenfalls trauerten, dass ich allein war. Niemand verstand mich, so wie es Opa Erik getan hatte.
Mutter stolperte nach vorn zum Grab, nahm eine Sonnenblume, die wir beim Gärtner gekauft hatten, und warf sie hinein. Leise stieß sie einen wimmernden Ton aus. Mein Vater ging zu ihr, zog sie beiseite und machte den anderen Leuten Platz, die es meiner Mutter nachtaten. Immer mehr Sonnenblumen füllten Opas Grab und der Friedhof wurde leerer.
Eine Gänsehaut überzog meinen Körper, als meine Eltern mich erwartungsvoll ansahen. Aber ich konnte nicht. Ich war wie versteinert. Ich konnte nicht weitergehen. Konnte keine Blume in das Grab werfen und ihn damit verabschieden. Ich biss mir auf die Lippe. Bohrte meine Fingernägel noch tiefer in die Handballen, sodass ich warmes Blut spürte, das meine Finger hinablief. Aber noch immer war ich wie erstarrt.
Langsam kam mein Vater auf mich zu, nahm meine Hand, zwang meine Finger, sich um seine zu schließen, und führte mich zum Grab. Zu diesem tiefen Loch, das meinen Großvater gefressen hatte.
Meine Mutter drückte mir eine Sonnenblume in die andere Hand und legte ihren Arm um meine Schulter. Das war das erste Mal, dass sie mir beistand, seitdem Opa tot war. Dass sie versuchte mir Kraft zu geben. Doch statt mich kraftvoll zu fühlen, fühlte ich mich unglaublich schwach.
Meine Beine gaben unter mir nach. Schluchzer fuhren durch meinen Körper und ich ließ meiner Trauer freien Lauf, als ich schrie. Meine Lungen blähten sich auf und ich schrie weiter, schrie meinen Schmerz und meinen Verlust hinaus, während Tränen über meine Wangen rannen.
»Mia«, sagte mein Vater leise, »du musst dich jetzt verabschieden.«
***
Stunden waren vergangen – zumindest fühlte ich mich so. Meine Kehle war rau und ich war wie ausgetrocknet. Und noch immer hockte ich mit meinem Vater im Gras. Tränen liefen mir mittlerweile stumm über die Wangen. Mutter war irgendwann wortlos aufgestanden und gegangen. Ich hatte ihr Zittern bemerkt und konnte mir vorstellen, dass ihr Körper nach der Erlösung – dem Vergessen – schrie. Nach ihrem persönlichen Heilmittel, das sie taub und stumm machte.
»Ich möchte es nicht«, sagte ich leise. »Ich möchte nicht, dass er nicht mehr da ist.«
Mein Vater drückte mich an seine Brust. »Ich weiß. Ich will das auch nicht. Aber es war seine Zeit. Er ist wieder bei Oma, die er abgöttisch geliebt hat. Ist das nichts Schönes? Sollten wir uns nicht für ihn freuen?«
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass uns nach dem Tod noch irgendwas erwartete – abgesehen von undurchdringlicher Schwärze.
Papa stand auf und reichte mir seine Hand. »Du musst das nicht allein machen.«
Ich schaute zu ihm hoch und zum ersten Mal erkannte ich die Wesenszüge meines Opas in ihm. Er sah nicht aus wie Opa Erik. Wir beide hatten einzig das schwarze Haar von ihm geerbt. Die grauen Augen hatten wir von Oma. Das hatte Opa immer wieder erwähnt.
Ich nahm Papas Hand und gemeinsam stützten wir uns, während wir zum Rand des Grabes gingen. Meine Hand umklammerte immer noch die Sonnenblume, die etwas mitgenommen aussah.
Als ich auf den Sarg hinuntersah, wurde mir schlecht. Mein Magen zog sich zusammen. Meine Knie wurden weich. Ich schüttelte den Kopf. »Ich kann das nicht«, sagte ich und rannte los.
Kapitel2
Das Leben ohne ihn war mir fremd. Es war falsch. Die Beerdigung vor vier Tagen hatte ein Abschied sein sollen. Hatte für jeden einen Abschluss darstellen sollen. Aber es gelang mir nicht. Nach der Schule wartete ich darauf, dass er um die Ecke kam, lächelnd mit einem Buch in der Hand, von dem er mir erzählen wollte oder das er mir auslieh, damit wir gemeinsam schwärmen konnten. Doch er tauchte nicht auf. Stattdessen war ich allein. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich schluckte schwer. Die Situation zu Hause machte meinen Verlust nicht besser. Meine Familie war kaputt. Vollkommen. Und keiner von uns wollte oder konnte etwas daran ändern. Ich wusste gar nicht, wie. Ich wusste es wirklich nicht. Egal, wie ich es drehte oder wendete, diejenigen, die etwas ändern sollten, waren meine Eltern. Niemand sonst konnte aus dem Teufelskreis ausbrechen.
Stille begrüßte mich, als ich zur Tür eintrat – was in den letzten Tagen nichts Neues war. Ohne ein Hallo ging ich die Treppe hoch und öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Darin herrschte Chaos – ein Positives. Meine Eltern hatten das Interesse am Lesen zwar nicht unterstützt, Großvater dafür umso mehr. Daher stapelten sich Unmengen an Büchern auf dem Boden, lagen verstreut im Raum. Ich nannte es liebevoll »Bücherchaos«.
Die Schultasche pfefferte ich auf den Drehstuhl und schmiss mich aufs Bett. Froh darum, dass Freitag war und ich nicht direkt mit den Hausaufgaben anfangen musste. Die Uhr an der Wand zeigte, dass ich noch zwei Stunden hatte, ehe wir zum Amtsgericht mussten.
Nachdenklich kaute ich auf meiner Lippe und starrte auf den Haufen Bücher, der am Fußende lag. Seit Opas Tod hatte ich keines davon angefasst. Und etwas in mir sträubte sich noch immer zu lesen. Es war unser Ding gewesen. Konnte ich das wirklich machen, ohne ihn? Konnte ich mich in fremde Welten träumen, ohne dass es sich wie Verrat anfühlte? Es kribbelte in meinen Fingern und gleichermaßen kam es mir wie Verrat ihm gegenüber vor. Und doch sehnte ich mich danach, meine kaputte Welt auszusperren, um Abenteuer zu erleben, die mit meinem Leben rein gar nichts gemein hatten. Ich wollte für ein paar Stunden vergessen. Das klang so verführerisch, dass ich nach dem erstbesten Buch griff und mich darin verlor. Genauso wie die Trauer.
***
Zu zweit machten Papa und ich uns auf dem Weg zum Amtsgericht. Das Surren des Motors war beruhigend. Doch änderte es nichts an dem schlechten Gewissen, das sich in mich hineinbohrte. Es fühlte sich wie Verrat an, dass ich mich unserer gemeinsamen Leidenschaft hingab, während er es nie mehr würde tun können. Ihm blieben all diese neuen Welten verwehrt, die ich nun entdeckte. Ich biss mir auf die Unterlippe. Mit den Fingernägeln schabte ich über die Haut am Handballen. Und doch hatte es gutgetan. Für zwei Stunden vergaß ich. Fühlte nicht diese bleierne Trauer. Nicht diese Schwere, die mich seit seinem Tod begleitete.
Ich sah zu meinem Vater. Seine Finger lagen verkrampft um das Lenkrad. Als ich ihn gefragt hatte, warum Mama uns nicht begleitete, hatte er mir nicht geantwortet. Nur über meinen Kopf gestreichelt und mir ein Lächeln zugeworfen, das mehr aussagte als jedes Wort, das er hätte an mich richten können.
Opa hatte Mama am Anfang geliebt wie eine eigene Tochter, bis sie so abgerutscht war, ohne dass irgendjemand verstanden hatte, wieso. Ich hatte sie mal nach dem Grund gefragt. Aber als Antwort hatte sie mich nur eisern angeschwiegen, als hätte ich die Frage nie gestellt. Opa hatte auch versucht mit ihr zu reden, aber danach hatte er sie nur noch bemitleidet.
Im Internet hatte ich mich im Hinblick auf das Stichwort »Suchtverhalten« schlaugemacht, na ja zumindest laienhaft, und in einem Punkt waren sich alle einig: Ein Süchtiger konnte erst aufhören, wenn er es wirklich wollte, und das geschah meistens erst, wenn er alles verloren hatte, was er liebte.
Mama hatte alles – noch. Sie hatte mich und sie hatte meinen Vater. Nur mein Großvater fehlte. Die Zeit, die sie besoffen verschenkt hatte, konnte sie nie wiedergutmachen, vor allem bei Opa nicht. Ich wünschte mir, dass sie endlich aufwachte. Dass sie für mich da sein konnte oder auch für meinen Vater, aber ich wusste tief in mir drin, dass mein Hoffen sinnlos war.
Papa hielt auf einem Parkplatz und ließ sich erschöpft in den Sitz sinken. »Bist du bereit?«, fragte er mich.
Ich versuchte mich an einem Lächeln, von dem ich mir aber ziemlich sicher war, dass es einer Grimasse ähnelte. »Ja.«
Über den Schaltknauf hinweg griff er nach meiner Hand, die noch zur Faust geballt war, und drückte sie. »Ich hab dich lieb, Mia. Das weißt du, oder?«
Ein Kloß wuchs in meinem Hals heran. Mit zusammengepressten Lippen nickte ich und öffnete den Griff meiner Hand, um seine Finger zu umschließen und den sanften Druck zu erwidern. Doch ich konnte die Worte nicht zurückgeben. Aus Angst, dass ich anfing zu weinen. Ich schmeckte die verräterische Feuchtigkeit bereits salzig auf meiner Zunge.
»Gut«, murmelte er und ließ mich los, um auszusteigen.
Eilig folgte ich ihm in Richtung Amtsgericht.
Es war ein beeindruckendes Gebäude. In unserer Stadt gab es viele alte Bauten und das gehörte eindeutig dazu. Die Steine waren noch mit Mühe eigenhändig aufeinandergesetzt worden. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Schweiß und vor allem Blut der Aufbau gefordert hatte.
Nebeneinander gingen wir ins Gericht. Empfangen wurden wir von einer großen sechseckigen Halle. In der Mitte thronte ein großer Plastikwegweiser, der die beeindruckende Stimmung zerstörte, die das Gemäuer verströmte. Ich stellte mir vor, dass dies früher ein Haus voller Leben gewesen war. Wie Dienstboten hindurchhuschten, um ihrem Herrn zu dienen. Wie beeindruckende Teppiche an den kahlen Wänden hingen und Kerzen in Ständern aufgereiht waren.
Ich sah, wie nervös mein Vater war. Sein Blick glitt die ganze Zeit unruhig hin und her. Die Finger in ständiger Bewegung, als bemühten sie sich, beschäftigt zu bleiben. Nicht zu rasten. Ohne den Wegweiser zu beachten, führte Vater uns durch schmale Gänge, in denen überall helle Holztüren eingesetzt worden waren und hässliche blaue Plastikschilder angaben, wer dahinter saß.
Ich verstand nicht, wie man so ein prunkvolles Gebäude so hatte verhunzen können.
»Wir sind nur im Büro des Notars«, sagte mein Vater auf einmal. »Weil wir so wenige sind.«
»Okay«, erwiderte ich etwas verunsichert. Was wollte er damit sagen?
Er blieb vor einer Tür stehen. In dem Plastikgehäuse stand: Herr Dr. Schmidt – Notar.
Mein Vater holte noch einmal tief Luft und ich nahm aus einem Gefühl heraus seine Hand. Er umschloss meine mit seinen großen Fingern und sah dankbar zu mir runter. Ich ging meinem Vater gerade mal bis zur Brust. Er drückte meine Finger und klopfte dann an die Tür. Nach kurzem Warten ertönte ein »Herein!« und wir betraten das Büro.
Der erste Eindruck war unpersönlich. Das Büro enthielt keine einzige persönliche Note, an der ich hätte erkennen können, wie der Mann war, der da hinter dem Schreibtisch saß. »Hallo zusammen. Setzen Sie sich doch bitte!«, begrüßte er uns.
Papa und ich ließen uns auf den gepolsterten Stühlen nieder, die vor dem Schreibtisch standen, und sahen den Notar abwartend an.
»Mein Beileid«, sagte der Notar und legte dabei seine Papiere zurecht. »Das Testament Ihres Familienmitglieds ist nicht sehr umfangreich, deswegen dachte ich, es sei schöner, es in einem kleinen Raum zu verlesen.« Er zückte ein geschlossenes Kuvert aus seinen Papieren und öffnete es. »Wollen wir beginnen?«
Mein Vater nickte.
Der Notar tat es ihm nach, räusperte sich und begann vorzulesen:
Meine liebe Familie, wenn ihr das lest, bin ich nicht mehr unter euch. Und ich weiß, dass ihr alle noch so viel zu klären habt, dass es der schlimmste Zeitpunkt ist, an dem ich euch verlassen konnte. Und das tut mir leid. Nicht, dass ich gestorben bin, sondern nur, dass ich euch nicht besser helfen konnte. Aber darum geht es jetzt nicht. Mia, mein kleiner Schatz, ich weiß, wie sehr du Bücher liebst, in deren Geschichten du ständig abtauchst. Aber ich weiß auch, dass du noch nicht den Platz hast, all die Bücher, die ich während der letzten Jahre angesammelt habe, zu verstauen. Deswegen bekommst du nur eines. Mein liebstes. Das Buch, das mir geholfen hat zu leben. Nach dem Tod deiner Großmutter hatte ich oft das Bedürfnis zurückzukehren. Aber ich blieb. Wegen deines Vaters, wegen der Zukunft, die ich noch nicht kannte. Ich hoffe, dass dieses Buch es dir ermöglicht, nach vorn zu schauen – wie es das bei mir geschafft hat. Den Rest der Bücher spende ich an die städtische Bibliothek – die können mal besseren Lesestoff vertragen. Bernd, mein Sohn. Für dich habe ich einen Brief. Einen persönlichen Brief. Ich möchte, dass du ihn liest, wenn du dazu bereit bist, dein Leben zu ändern. Denn so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Weder für dich noch für Lydia oder Mia. Ich will, dass es euch allen gut geht und das tut es momentan nicht, was mir das Herz bricht. Ihr habt nur dieses eine Leben und das solltet ihr genießen, mit jedem Atemzug, den ihr habt.
Während der ganzen Zeit hatte ich Opas Stimme im Kopf, die mir all das erzählte. Tränen liefen meine Wangen hinunter und ich versuchte verzweifelt das Schluchzen hinunterzuschlucken. Meine Finger hatten sich wiedermal in meine Handballen gekrallt. Papa erging es neben mir nicht besser. Seine Augen waren ebenfalls feucht und seine Finger lagen verkrampft auf seinen Oberschenkeln.
Der Notar räusperte sich. »Es tut mir leid, dass das so aufwühlend für Sie war.« Er beugte sich unter den Tisch und holte etwas hervor. Mir überreichte er ein in ein Tuch eingehülltes Paket und meinem Vater einen schmalen Umschlag.
Mit zittrigen Händen nahm ich das Paket entgegen und prüfte das Gewicht in meiner Hand. Es war schwer und ich fühlte die Umrisse eines Buches. Aber ich packte es nicht aus. Das wollte ich zu Hause machen. In Ruhe. In meiner gewohnten Umgebung.
***
Es war mittlerweile Nacht und nur die Lampe neben dem Bett erhellte mein Bücherchaos, während ich auf das Paket vor mir starrte. Seit Stunden schon konnte ich mich nicht dazu überwinden das Buch auszupacken. Ich wollte diese Geschichte kennenlernen, die meinem Opa geholfen hatte. Gleichzeitig hatte ich Angst. Solch große Angst, dass sie mich beherrschte und daran hinderte nachzusehen, was ich geerbt hatte. Es war das letzte Buch, das ich jemals von Opa bekam. Was, wenn es mir nicht gefiel? Ich es doof fand, obwohl es ihm so viel bedeutete? Konnte ich es überhaupt lesen, ohne ständig diesen aufwühlenden Schmerz zu empfinden? Konnte ich mich rein auf die Geschichte einlassen, um dasselbe zu empfinden, das er während des Lesens empfunden hatte?
Ich kaute auf meiner Unterlippe und bemühte mich darum, endlich Mut zu fassen. Er war sich sicher gewesen, dass es mir gefallen würde. Er wollte, dass ich dieses Buch bekam, weil er glaubte, dass es mir half, mit all dem umzugehen.
Bebend hob ich das Tuch an und schob es zur Seite. Eine vergoldete Lederecke kam zum Vorschein. Ich verhielt mich, als läge auf dem Bett vor mir Das Monsterbuch der Monster, das mich fressen wollte, anstatt eines einfachen in Leder gebundenen Buches. Ich holte noch einmal tief Luft und nahm das Buch in die Hand.
Es war schwer. Als würden viele Seiten eine Menge Wörter zu berichten haben. Vorsichtig strich ich über die eine Ecke und schob das Tuch weiter beiseite. Zum Vorschein kam braunes Leder, fein gearbeitet. Und eine goldene Schrift, die in das Leder geprägt worden war. Ich hielt den Atem an. Auch ohne mehr zu wissen, konnte ich sehen, dass dieses Buch unglaublich alt war. Mittlerweile fuhr ich andächtig über den Deckel und befreite das Kunstwerk komplett von seiner Ummantelung. Meine Finger strichen über den Titel.
»Mediocris«, raunte ich leise und versuchte die Worte zu schmecken. Ich drehte und wendete das Buch in meinen Händen. Es war so unscheinbar, dass es bei einem Diebstahl bestimmt übersehen worden wäre. Aber für mich war es jetzt schon ein besonderer Schatz.
Ich schluckte wieder und legte das Buch vor mir auf der Decke ab. Vorsichtig öffnete ich den Deckel. Mir fiel ein Brief auf den Schoß, den ich anhob und fast erschrocken wieder fallen gelassen hätte. In der Schrift meines Großvaters stand »Mia« auf das Kuvert geschrieben.
Tränen sammelten sich in meinen Augen, aber ich schloss sie und versuchte meine Sicht wieder zu klären, doch ein paar Tropfen kämpften sich hervor und fielen auf meine nackten Oberschenkel. Ich zog die Nase hoch und konzentrierte mich wieder auf den Brief in meinen Händen.
Mit fahrigen Bewegungen öffnete ich ihn.
Du fragst dich sicher, wie mir ein Buch helfen konnte. Ich habe nicht oft von deiner Großmutter gesprochen. Nicht, weil ich sie nicht liebte. Im Gegenteil: Von ihr zu erzählen, in dem Wissen, dass du dich an keine einzige atemberaubende Facette dieser beeindruckenden Frau erinnern kannst, der du so ähnlich bist, hätte mir das Herz gebrochen. Ich hoffe, das verstehst du. Dieses Buch hat mir so viel beigebracht. Ich war einmal wie du – mit einer Familie, die nicht schätzen konnte, was sie hatte. Doch mir fiel dieses Buch in die Hand und ich wusste, dass es meine Rettung war. Mit seiner Hoffnung und seiner Sicht der Dinge hat es mich gelehrt, dass das Leben weitergeht. Dort habe ich deine Großmutter kennengelernt und als sie starb, wusste ich, dass ich irgendwann wieder glücklich werden konnte. Mit Narben auf dem Herzen, aber einem Lachen in den Augen. Du bist mir das Teuerste auf der Erde und ich will und wünsche mir, dass du wieder lachen kannst. Lass dich von der Geschichte entführen. Sprich mir einfach nach und reise nach Hause: Domum me duc!
Ich konnte nichts daran ändern. Die Tränen liefen in Strömen über mein Gesicht und machten mein Sichtfeld unscharf. »Domum me duc«, wiederholte ich leise.
Ich wusste nicht, was die Worte bedeuteten, doch es fühlte sich an, als würden sie eine Tür in meinem Inneren öffnen, die lange verschlossen geblieben war. Den Brief presste ich an mich wie ein Kuscheltier. Ich hatte von diesem Buch noch kein einziges Wort gelesen und doch war es jetzt schon das Buch, das mich am meisten berührte. Einfach weil es sein Lieblingsbuch gewesen war und er es mir anvertraut hatte. Weil dieses Buch so viel für ihn getan hatte, in dem es einfach da gewesen war und ihm die Geschichte erzählt hatte, die in ihm geschrieben stand.
Bedächtig legte ich den Brief auf den Nachttisch und widmete mich dem Wälzer vor mir. Es brannte mir unter den Nägeln, die Geschichte zu erleben, von der mein Großvater meinte, dass sie ihn zurück ins Leben geholt hatte. Ich konnte das Gefühl schon fast Vorfreude nennen und schlug die erste Seite auf.
Kapitel3
Ein Stromstoß fuhr in meinen Finger und jagte durch mich hindurch. Hände griffen nach mir, umklammerten meinen Körper und zogen mich abrupt vorwärts. Ich wollte mich wehren, wollte mich zurückziehen, aber es funktionierte nicht. Die Macht, die diese fremden Hände ausübten, war zu groß. Ohne Rücksicht zerrten sie mich weiter. Mein Körper war gefangen in der Schwerkraft und wurde immer weiter nach unten gezogen. Ein Strudel aus Farben umringte mich, der genauso plötzlich wieder verschwand, wie er aufgetaucht war. Wind zerrte an meinen Haaren, meiner Kleidung. Zwang mich, die Augen zu schließen. Ich schaffte es, die Hände vors Gesicht zu heben. Angst schnürte mir die Lungen zu und plötzlich merkte ich nur noch Schmerz, als mein Körper auf einer Fläche aufschlug.
Eiskaltes Wasser umschloss mich wie eine frostige Umarmung. Mein Körper stand unter Schock. Keinen Muskel schaffte ich zu bewegen. Meine Glieder waren eingefroren. Meine Lungen verlangten nach Luft, aber hier gab es keine. Ich wusste nicht, was mit mir geschah. Ich wusste nicht, wo ich war und wie ich hierhergekommen war. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich zurück in mein Bett wollte.
Aus Angst wurde Panik und meine Glieder erwachten wieder zum Leben. Unter Schmerzen ruderte ich anscheinend sinnlos mit den Armen. Es gab kein Licht. Alles war in eine undurchdringliche Schwärze gehüllt, die mich verwirrte, ängstigte und lockte zugleich.
Dann entdeckte ich ein sanftes weißes Leuchten, das die Tiefen erhellte, die sich mir offenbarten. Endlich hatte ich ein Ziel. Meine Arme und Beine steuerten auf das Leuchten zu. Ich erkannte, dass es der Mond war, der auf mich hinabschien. Erleichterung durchfuhr mich, als ich die Wasseroberfläche ausmachen konnte. Meine Hand durchbrach sie. Kurz schloss ich die Augen, versuchte die Angst zu ignorieren, die sich wie ein Stacheldrahtzaun um mein Herz gewickelt hatte. Alles wird gut, das ist bloß ein Traum und wenn ich gleich auftauche, ist alles wie immer.
Mein Kopf gelangte an die Oberfläche und ich holte tief Luft. Meine Lungen blähten sich erfreut auf und sogen den benötigten Sauerstoff ein.
Plötzlich umfasste etwas Eiskaltes meinen Knöchel. Kälter als das eh schon frostige Wasser. Erschrocken riss ich die Augen auf. Haltsuchend patschte ich aufs Wasser, ließ meinen Blick innerhalb einer einzigen Sekunde hilfesuchend schweifen, aber nichts. Mit einem Ruck wurde ich wieder nach unten gezogen. Wasser gelangte in meine Nase und floss in meine Lungen. Ich wollte husten, erstickte das Bedürfnis aber im Keim. Ich muss Ruhe bewahren! Ich rief mir in Erinnerung, was Opa mir am Anfang gesagt hatte, als er mir das Schwimmen beibrachte: »Die meisten Menschen ertrinken, weil sie sich der Panik hingeben.«
Ich versuchte mich zu beruhigen. Versuchte zu analysieren, was hier gerade mit mir geschah. Das konnte nur ein Traum sein! Wie sollte ich von meinem Bett ins Wasser gefallen sein? Ich wurde tiefer gezogen. Mein Körper verlangte immer mehr nach Luft. Vielleicht war es bloß ein Traum. Niemand konnte in seinen Träumen sterben. Ich versuchte meine Muskeln zu entspannen und abzuwarten.
Aber meine Kraft verließ mich weiter und es fühlte sich nicht nach einem Traum an.
Ich kratzte meine letzten Energiereserven zusammen und begann mich gegen den Griff des eiskalten Etwas zu wehren. Statt aber nachzulassen, fühlte sich mein Fuß an, als wäre er in einer Presse gelandet. Schmerzen drohten mir die Sicht zu rauben, obwohl es in der unergründlichen Schwärze keinen Unterschied gemacht hätte. Einzig das fahle Licht des Mondes schien noch herunter. Verblasste aber mehr, je weiter ich hinuntergezogen wurde. Ich konnte die Luft nicht mehr anhalten. Alles in mir schien zu platzen und ich tat das, was ich reflexartig tun musste: Ich atmete. Tief sog ich das Wasser in meine Lungen. Mein Körper wehrte sich dagegen.
Ich hatte keine Luft mehr, die ich anhalten konnte, keine Kraft mehr. Das Mondlicht wurde dunkler, schien mir immer mehr zu entgleiten – wie mein Leben.
Ein Schatten erschien vor dem Mond und das war das Letzte, was ich sah, ehe sich mein Körper entspannte und alles schwarz wurde …
***
Ich spürte ein Blubbern in meiner Lunge. Fühlte, wie sich etwas einen Weg hinaufbahnte. Mehr aus Reflex drehte ich mich auf die Seite und erbrach Wasser. Immer wieder krampften meine Muskeln, bis auch der letzte Rest Flüssigkeit meinen Körper verlassen hatte.
Erschöpft schloss ich die Augen und versuchte ruhig zu atmen. Doch mit einem Mal wurde mir etwas klar. Das konnte kein verdammter Traum sein. Ich war – von meinem Bett aus – in Wasser gefallen. Beinahe wäre ich ertrunken. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war.
Vorsichtig wagte ich es, die Augen zu öffnen. Der fahle Mond schien zu mir herab, beleuchtete ungenügend die Umgebung. Doch es reichte gerade eben, um Formen auszumachen. Jemand hatte mich ans Ufer geschleift. Hinter mir ragten Bäume in den von Sternen bedeckten Himmel. Die Kälte fraß sich durch die nasse Kleidung, hinunter bis zu meinen Knochen. Bebend umschlang ich meinen Körper mit den Armen, dann stand ich auf. Argwöhnisch sah ich auf den See hinunter, der scheinbar friedlich dalag.
Was war nur geschehen? Wo war ich? Für einen Traum fühlte es sich zu echt an. Und wäre es ein Traum, wäre dann nicht ein Prinz in schillernder Rüstung hier gewesen, um mit meiner Rettung zu prahlen? Damit wir glücklich bis an unser Lebensende vereint waren?
Zähneklappernd ging ich am Ufer des Sees auf und ab, in der Hoffnung, wieder Wärme zu empfinden. Ich musste einen Platz für die Nacht finden – oder ein Telefon, am besten beides. Schwer schluckte ich und drehte mich um die eigene Achse. Überall war Dunkelheit, ein paar Bäume schimmerten sanft, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Doch ich entdeckte kein Licht, das mir eventuell den Weg in eine Stadt oder in ein Dorf zeigen konnte. Was sollte ich nur tun? Ich fühlte mich verloren. Alles schien fremd. Was durch die finstere Nacht noch verschlimmert wurde.
»Wo zum Geier bin ich hier nur?«, fragte ich leise.
Ein Kreischen, das dem eines Adlers glich, ließ mich zusammenzucken und automatisch schnellte mein Blick in den Himmel. Der abgesehen von den Milliarden Sternen und dem hell strahlenden Mond leer anmutete. Da, wieder ein Kreischen! Ich drehte mich um und entdeckte ein Wesen, das im Dunkel der Bäume stand. Mein Körper gefror bei dem Anblick. Die Raubtieraugen eines Adlers starrten mich über einen im Mondlicht schimmernden Schnabel an. Der Kopf war bedeckt mit Federn. Doch die Pranken und der Rest des Körpers glichen einem Löwen. Abgesehen von den Flügeln, die dicht an den fellbedeckten Bauch gepresst waren. Noch nie hatte ich so etwas gesehen! Angst schlug ihre Krallen in mich und ließ meinen Körper noch mehr erbeben. Mein Herz raste. Ungläubig trat ich einen Schritt zurück. Das kann nicht wahr sein! Niemals würde es solch ein Wesen in meiner Welt geben.
Beinahe geduldig schien es mich zu mustern. Als würde es auf mich warten. Es griff nicht an, sondern stand nur da. Unsicher betrachtete ich das Tier. Was wollte es von mir? Erst jetzt fiel mir auf, dass es ebenso nass war wie ich. Ich runzelte die Stirn.
»Du hast mich gerettet?«, fragte ich noch immer wispernd, als könnte der Laut meiner Stimme neue Gefahren hervorlocken. Doch sobald die Worte über meine Lippen kamen, schalt ich mich. Es war ein Tier! Wieso sollte es mit einem Menschen reden oder ihn gar retten? Abgesehen davon durfte dieses Tier nicht existieren! Es war ein Hirngespinst. Vielleicht hatte ich mir beim Sturz den Kopf gestoßen und nun halluzinierte ich. Das war die Erklärung. Bekräftigend nickte ich. Doch ein kleiner Teil in meinem Inneren schien sich gehässig über mich lustig zu machen. Ich kniff mich in meine klamme Haut. Vom Schmerz zuckte ich zusammen. Doch noch immer war ich hier. Und der Gedanke jagte mir eine Heidenangst ein.
Noch einmal kreischte das Wesen und trippelte ungeduldig auf der Stelle. Es drehte sich weg und sah über die Schulter zurück, als würde es wollen, dass ich ihm folgte.
Ich biss mir auf die Lippe. Was konnte es schaden? Wenn es eine Halluzination war, führte sie mich vielleicht zu einem Telefon, damit ich meine Eltern anrufen konnte. Dass ich mich daran erinnerte, dass aus dem Buch ein Sog gekommen war, der mich in die Seiten hineingezogen hatte, ignorierte ich gekonnt.
Ich konnte selbst nicht glauben, dass ich das tat. Aber ich folgte dem seltsamen Tier und schüttelte über mich selbst den Kopf. Das war Wahnsinn. Aber anderseits wäre ich auch beinahe im Wasser ertrunken, wäre dieses Tier anscheinend nicht gewesen.
Schritt für Schritt folgte ich ihm und versuchte nicht bei jedem Geräusch angstvoll zu kreischen und panisch davonzurennen. Dabei hatte der Wald das restliche Licht verschluckt. Das Einzige, was nun den Weg erhellte, war der vage Schimmer, der sich durch die Blätter und Wipfel kämpfte. Die Schreie von Eulen hallten durch die Nacht. Im Unterholz knackte es verdächtig und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als aufzuwachen. In meinem Bett.
Das Zittern hatte meinen gesamten Körper eingenommen. Meine Zähne klapperten so laut, dass sie wahrscheinlich jedes Raubtier verjagten. Die Finger, die ich in meine Arme gekrallt hatte, sowie meine Zehen spürte ich kaum noch, als endlich eine kleine Hütte in Sicht kam.
Das Wesen blieb davor stehen, drehte sich um und musterte mich.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte die Halluzination loszuwerden. Ich kniff meine Augen zusammen, öffnete sie wieder, nur um erneut mit dem Anblick konfrontiert zu werden. Es schien mich besorgt zu betrachten. Als könnte es selbst nicht zusammenreimen, was genau es da aus dem See gefischt hatte. Ich musste den Verstand verloren haben. Der Schlafmangel und die Trauer der letzten Wochen hatten offensichtlich ihre Spuren in mir hinterlassen.
Was mir jetzt auffiel, war, dass ich komischerweise keine Angst vor diesem Wesen hatte. Und das verwirrte mich. Es beunruhigte mich – täte es das nicht, wäre ich wohl ziemlich abgestumpft. Aber dieses Wesen … Es jagte mir keine Angst ein.
Langsam stakste ich auf das Tier zu und hielt meine Hand hoch.
»Wer bist du?«, fragte ich und hoffte, dass es mir eine Antwort geben würde – gleichzeitig hoffte ich aber auf das Gegenteil, denn wenn das Tier jetzt noch anfangen würde zu reden, wäre der Hutmacher aus Alice im Wunderland wohl im Gegensatz zu mir bei klarem Verstand.
Der Adlerkopf beugte sich zu mir und drückte den Schnabel gegen meine erhobene Hand. Die Wärme des Körpers jagte einen Schauer durch mich hindurch, als hätte ich einen Elektroweidezaun angefasst. Verwirrt blinzelte ich. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Das Tier fühlte sich zu echt für eine Halluzination an.
Panik überrollte mich und Tränen flossen über meine Wangen. Die Angst griff nun doch nach mir – aber immer noch nicht vor diesem Wesen. Sondern aufgrund der Situation. Ich konnte nichts dagegen tun. Meine Beine gaben unter mir nach. Die Knie landeten hart auf der Wiese und ich schlug die Hand vor meinen Mund, während die Tränen immer weiterliefen. Schluchzer ließen meinen Körper erbeben. Mein Blick zuckte über die mir gänzlich fremde Landschaft.
Meine Nerven waren strapaziert und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Wie ich mich verhalten sollte. Es gab keine logische Erklärung für das, was mir gerade passierte, und doch suchte mein Hirn auf eine verzweifelte Weise danach.