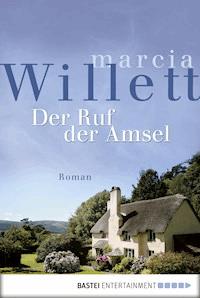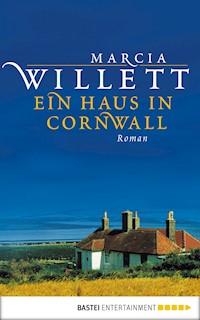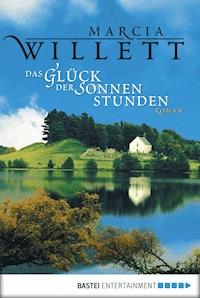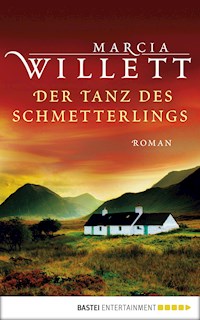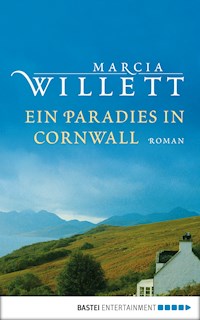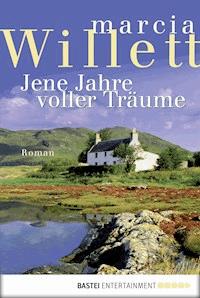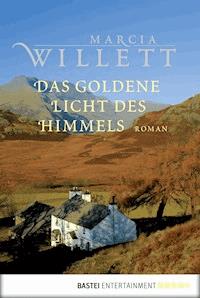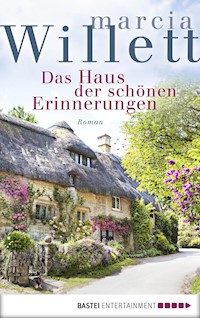4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chadwick Familiensaga
- Sprache: Deutsch
Als Felicia, Sam und Susanna durch einen tragischen Schicksalsschlag zu Waisen werden, ziehen die Kinder zu ihrer Großmutter Frederica "Freddy" Chadwick auf das malerische Anwesen "The Keep" im südenglischen Devon.
Freddy kämpft selbst mit ihrer großen Trauer, aber sie nimmt sich ihrer Enkel liebevoll an. Dabei wird sie von ihren langjährigen und herzlichen Angestellten Ellen und Fox unterstützt. Gemeinsam schaffen die Erwachsenen den Kindern ein Zuhause, in dem sie einen Weg aus der Trauer finden und ins Leben starten können.
Dieser wunderbare Familienroman über Zusammenhalt, Mut und Liebe ist das erste Buch der unvergesslichen Chadwick-Saga.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Erstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zweites Buch
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Drittes Buch
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Viertes Buch
29
30
31
32
33
34
35
36
Weitere Titel der Autorin
Jahre der Sehnsucht
Stunden des Glücks
Das Glück der Sonnenstunden
Ein Haus in Cornwall
Die Wärme eines Sommers
Das Spiel der Wellen
Das goldene Licht des Himmels
Jene Jahre voller Träume
Der Tanz des Schmetterlings
Ein Geschenk der Freundschaft
Ein Paradies in Cornwall
Ein Hauch von Frühling
Der Ruf der Amsel
Julias Versprechen
Wildblumen im Winter
Das verborgene Kind
Der Duft des Apfelgartens
Das Paradies am Fluss
Der geheimnisvolle Besucher
Der verborgene Moment
Ein Versprechen aus Liebe
Ein unverhoffter Gast
Das Haus der schönen Erinnerungen
Sommertage in der Strandvilla
Sommerglück in Cornwall
Über dieses Buch
Als Felicia, Sam und Susanna durch einen tragischen Schicksalsschlag zu Waisen werden, ziehen die Kinder zu ihrer Großmutter Frederica »Freddy« Chadwick auf das malerische Anwesen »The Keep« im südenglischen Devon.
Freddy kämpft selbst mit ihrer großen Trauer, aber sie nimmt sich ihrer Enkel liebevoll an. Dabei wird sie von ihren langjährigen und herzlichen Angestellten Ellen und Fox unterstützt. Gemeinsam schaffen die Erwachsenen den Kindern ein Zuhause, in dem sie einen Weg aus der Trauer finden und ins Leben starten können.
Dieser wunderbare Familienroman über Zusammenhalt, Mut und Liebe ist das erste Buch der unvergesslichen Chadwick-Saga.
Über die Autorin
Marcia Willett, in Somerset geboren, studierte und unterrichtete klassischen Tanz, bevor sie ihr Talent für das Schreiben entdeckte. Ihre Bücher erscheinen in 18 Ländern. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Devon, dem Schauplatz vieler ihre Romane.
Marcia Willett
Zeit der Verheißung
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Marcia Willett
Titel der englischen Originalausgabe: »Looking forward«
Originalverlag: Headline Publishing Group Limited, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG
unter Verwendung von Motiven © iStock / Getty Images Plus /victoriaashman; iStock / Getty Images Plus / Snowshill; iStock / Getty Images Plus / krzych-34;
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-1637-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für John und Graceund die Mitgliederder Mother’s Unionin Avonwick
Erstes Buch:Sommer 1957
1
Die drei Kinder standen dicht beieinander und warteten. Die anderen Reisenden waren bereits heimwärts verschwunden, sodass der winzige Bahnhof friedlich und verschlafen in der Junisonne lag. Die großen, farbenprächtigen Blüten der Stockrosen wippten immer wieder gegen den geteerten Zaun; Geißblatt und Kletterrosen rankten und dufteten neben dem Schalterhäuschen um die Wette; die Milchkannen warteten darauf, abgeholt zu werden. Der Bahnhofsvorsteher lehnte sich mit dem Telefonhörer in der Hand weit aus seiner Tür und beobachtete die kleine Gruppe. Das älteste Kind, ein etwa zehnjähriges Mädchen, war ganz offensichtlich erschöpft: Auf seinem blassen Gesicht zeichneten sich erlittene Strapazen ab. Es war mager, sein gemustertes Baumwollkleid hing zerknittert und schlaff herunter, und aus den beiden dicken, blonden Zöpfen hatten sich ein paar feuchte Strähnen gelöst. In den grauen Augen stand Verzweiflung, als das Mädchen zum Bahnhofsvorsteher aufsah, der ihm mit der freien Hand fröhlich zuwinkte. Er hatte seine Mütze so weit zurückgeschoben, dass sie jeden Moment zu Boden zu fallen drohte.
»Vor ’ner halben Stunde losgefahren«, rief er den Kindern aufmunternd zu. »Hatte bestimmt Probleme mit dem Wagen.«
Das Mädchen schluckte hörbar, zog den Jungen, der sich an seinem Rockzipfel festhielt, enger an sich heran und nickte dem Bahnhofsvorsteher zu, der daraufhin wieder in seinem Schalterhäuschen verschwand. Man konnte trotzdem noch hören, wie er mit gedämpfter Stimme weitersprach. Der Junge sah zu seiner Schwester auf, und sie lächelte ihn an, während sie gleichzeitig die Umklammerung etwas löste.
»Großmutter wird gleich hier sein«, erklärte sie ihm. »Das hast du doch gehört, Mole, oder? Du hast doch gehört, was er gesagt hat? ›Probleme mit dem Wagen.‹ Sie wird jeden Moment hier sein.«
Der Junge fixierte den Eingang. Sein schmuddeliges Baumwollhemd war aus der kurzen, grauen Flanellhose gerutscht, und aus seinen Augen sprach Angst. Seine Gedanken erratend, neigte sich das Mädchen zu ihm hinunter.
»Einfach nur Probleme mit dem Wagen«, wiederholte es. »Nicht ... Nur Probleme. Ein platter Reifen oder so. Nichts weiter, Mole. Ganz bestimmt.«
Das kleine Mädchen, das sich die ganze Zeit an der anderen Hand festgeklammert hatte, ließ auf einmal los und machte es sich auf dem Boden bequem. Es legte sich zwischen die Gepäckstücke und summte vor sich hin, während es seine Puppe hoch über sich hielt, als wolle es sie den Schwalben schenken, die kunstvoll durch die klare Luft sausten.
»Ach, Susanna«, seufzte ihre Schwester hilflos. »Du machst dich doch dreckig.«
Sie wischte sich die freigegebene, klebrige Hand an ihrem Rock ab und sah sich um. In der Nähe des Schalterhäuschens ging der Schaffner einige Pakete durch, die auf einem Gepäckwagen gestapelt lagen. Sie beobachtete, wie er leise vor sich hin pfiff und mit seinen Wurstfingern ein Etikett nach dem anderen umdrehte. Von einem Plakat an der Wand über ihm lächelte das Ovomaltine-Mädchen sein ewiges Lächeln, hielt in einem Arm die goldenen Garben und schwenkte mit der anderen Hand den Korb, in dem eine Ovomaltine-Dose lag, auf der sich eben dieses Motiv wiederholte, sodass das Lächeln des Mädchens immer kleiner wurde ... Da näherte sich ein Auto, tuckerte über den Bahnübergang und um die Ecke, und der Bahnhofsvorsteher eilte sofort aus seinem Häuschen, um mit gerecktem Hals zu sehen, wer kam. Aus seinem Rufen klang eine solche Erleichterung, dass das Mädchen instinktiv anfing, die kleine Gruppe zusammenzutrommeln.
»Steh auf, Sooz. Steh auf! Schnell. Großmutter ist da. Komm her, Mole. Halt dich hier dran fest. Steh auf, Susanna!«
Der Klang der Stimme, die draußen so atemlos geplappert hatte, kam näher, und die drei aneinandergeklammerten Kinder starrten die ältere Frau an, die auf den Bahnsteig eilte und mit einer unwillkürlichen Geste des Mitgefühls und der Trauer wie angewurzelt stehen blieb. Freddy Chadwick sah ihre drei Enkelkinder an und verspürte einen dicken Kloß im Hals.
»Ihr Lieben«, sagte sie. »Es tut mir leid. Diese Frau sollte doch dafür sorgen, dass ihr in Totnes aussteigt und dort auf mich wartet! Ihr solltet nicht nach Staverton weiterfahren. Und dann bin ich zu schnell gefahren und im Graben gelandet. Alles läuft schief. Und das ausgerechnet heute. Es tut mir so leid.«
Sie war wie besessen durch die engen Straßen gerast; das hohe Gras und die weißen Blüten der Doldengewächse hatten das Auto gestreift und Bienen durch das offene Fenster geschüttelt. Hektisch hatte Freddy sie immer wieder verscheuchen wollen. Die ganze Trauer und das Entsetzen der letzten Tage hatten sich zu diesem einen, geradezu lebenswichtigen Vorhaben verdichtet: dass sie am Bahnhof sein musste, wenn die Kinder ankamen. Die Familie war sich sofort einig gewesen, dass es das Beste wäre, die Kinder am Bahnhof abzuholen und mit ihnen auf direktem Weg nach Hause zu fahren – und dieses Zuhause hieß für sie jetzt The Keep. Sie waren davon ausgegangen, dass das erste Zusammentreffen gefühlsgeladen sein würde und es deshalb so kurz wie möglich gehalten werden sollte. Je eher sie der Öffentlichkeit entfliehen und sich alle vier in privater Umgebung entspannen konnten, desto besser. Freddy war zwar auch überzeugt, dass dies die richtige Vorgehensweise war, befürchtete aber, dass es im Grunde feige von ihr war, sich – wenn auch nur für einige Stunden – ihrer Verantwortung zu entziehen. Andererseits schreckte sie der Gedanke, mit drei unter Schock stehenden, ängstlichen Kindern eine lange Zugreise zu unternehmen. Wie konnten sie ihre gemeinsame Trauer denn nur so lange aufschieben? Andererseits: Wie konnte sie auch nur in Erwägung ziehen, die verletzten Kinderseelen den neugierigen Blicken der Mitreisenden vorzuführen? Es war alles so schnell passiert. Die Kinder – ganz benommen von ihrer jähen Entwurzelung – waren so tapfer, aber es war anzunehmen, dass sie zusammenbrechen würden, sobald sie mit ihrer Großmutter vereint waren. Ihre eigene Unentschlossenheit hatte Freddy so gequält, dass sie sich letztlich davon überzeugen ließ, dieses wichtige erste Zusammentreffen so spät wie möglich stattfinden zu lassen. Sie war jedoch fest entschlossen gewesen, die Kinder auf dem Bahnhof in Empfang zu nehmen und sie so schnell wie möglich in ihr sicheres Zuhause zu bringen. Eine weitere Verwirrung in letzter Minute in London hatte sie nicht zugelassen. Die Begleitperson der Kinder war unerwartet erkrankt, und eine gutmütige Mitreisende, die auf dem Weg nach Plymouth war, hatte sich schließlich bereit erklärt, sich der Kinder anzunehmen.
Gedankenverloren war Freddy zu schnell in die Kurve gefahren, hatte die Kontrolle über den Wagen verloren und war mit den beiden linken Reifen im Graben gelandet. Mit Tränen der Wut in den Augen, den Blick immer wieder auf die Uhr gerichtet, hatte sie versucht, das Auto wieder auf die Straße zu bekommen. Ein Bauer und seine Frau, die auf dem Weg vom Markt in Newton Abbot nach Hause waren, halfen ihr schließlich aus der Patsche, doch als sie dann in Totnes eingetroffen war, musste sie feststellen, dass man die Kinder auf der Nebenstrecke nach Staverton hatte weiterfahren lassen. Die Frau, die sich ihrer angenommen hatte, hatte sich mit dem Bahnhofsvorsteher beraten, und der war ganz sicher gewesen, dass ein Fehler vorliegen musste. Mrs Chadwick, so erklärte er ihr, reiste immer ab und zu nach Staverton, sie stieg immer in Totnes um, und darum wartete sie sicher in Staverton. Die Kinder waren in aller Eile in den Zug gesetzt worden, der gerade abfahren wollte, und dem Schaffner wurde eingeschärft, sie in Staverton aussteigen zu lassen. Freddy war außer sich vor Wut und Sorge.
»Ich hätte doch nach London fahren sollen«, warf sie sich ein ums andere Mal vor, als sie nach Staverton zurückfuhr. »Ich wusste es. Ich hätte das nicht riskieren dürfen.«
Wenigstens erlöste ihre Sorge um die Kinder sie für kurze Zeit von den immer wiederkehrenden inneren Bildern von der Ermordung ihres geliebten Sohnes, seiner Frau und seines ältesten Sohnes durch die Mau-Mau. Die entsetzliche Nachricht war anfangs zu grausam gewesen, um ihr Glauben zu schenken, zu grausam, um sie zu begreifen. Jetzt waren sowohl ihr Mann als auch ihre beiden Zwillingssöhne tot, und alle waren sie Gewalt zum Opfer gefallen. Ihr geliebter Bertie war nach einer kurzen Verschnaufpause zu Hause 1916 an die Front zurückgekehrt und wenige Tage später vor Jütland gefallen. Ihr Sohn – der liebe, gütige, humorvolle John – war im Zweiten Weltkrieg bei einem Torpedoangriff ums Leben gekommen. Und jetzt war Peter – der ruhelose, bezaubernde, kluge Peter – überfallen und ermordet worden. Wenn er nach dem Krieg doch nur bereit gewesen wäre, sesshaft zu werden, wenn er doch nur daran interessiert gewesen wäre, das Porzellanerdegeschäft weiterzuführen, das die Familie seit über hundert Jahren ernährte ...
Freddy stöhnte auf und dachte an die drei verwirrten Kinder, die in Staverton auf sie warteten. Die in Kenia geborene, knapp zwei Jahre alte Susanna hatte sie noch nie gesehen, und Sam – den die Familie immer nur Mole, »Maulwurf«, nannte, weil er so furchtbar gern unter Wolldecken, Stühle und Tische kroch und sich dort versteckte – war nicht einmal ein Jahr alt gewesen, als Peter und Alison ausgewandert waren. Felicia, Fliss genannt, war ein stilles, siebenjähriges Kind gewesen, das seinen großen Bruder Jamie vergötterte ...
Gewaltsam riss Freddy das Steuer herum, als direkt vor ihr ein Traktor aus einer Feldeinfahrt rumpelte. Vor Schreck leicht zitternd, hielt sie am Straßenrand an, um sich die Nase zu putzen und sich zu beruhigen. Jamie war genauso groß und blond gewesen wie Peter; aufgeschlossen, tüchtig, liebevoll. Er war in England zur Schule gegangen, auf ein Internat, und stets hatte er die Ferien bei seiner Großmutter auf The Keep verbracht – nur in diesen Ferien, ausgerechnet in diesen, hatte er seine Eltern in Kenia besucht. Eigentlich hätte er schon wieder im Internat sein sollen, aber da er mit einem an Masern erkrankten Freund Umgang gehabt hatte, musste er in Quarantäne bleiben. Der gute Jamie – er hatte ihr so glücklich davon geschrieben, dass er drei Wochen länger Ferien machen durfte. Jetzt war er tot und lag mit seinen Eltern in afrikanischer Erde ...
Freddy ließ den Kopf in die Hände fallen. Wie sollte sie denn nur mit ihrer eigenen Trauer und ihrem eigenen Verlust fertig werden und sich gleichzeitig um die Kinder kümmern? Der Gedanke an ihre Enkel ließ sie eilig weiterfahren. Sie holperte über die sich über den Fluss spannende Brücke, über den Bahnübergang, bog links ab, parkte hastig neben dem Tor und eilte auf den Bahnsteig zu.
In der grellen Sonne standen sie beieinander. Fliss hatte ihren Arm beschützend um Mole gelegt, und Susanna sah mit runden braunen Augen zu dieser großen alten Frau auf, die ihr seltsam bekannt vorkam. Nach diesen ersten Worten der Erklärung herrschte kurzes Schweigen.
Freddy dachte: Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich mit diesen drei Kindern fertig werden? Selbstmitleid, blankes Entsetzen und Liebe tobten in ihrer Brust. Ich kann das nicht!, schrie sie innerlich auf. Ich bin zu alt.
Fliss dachte: Sie sieht aus wie Daddy. Ich darf nicht weinen. Wie soll ich ihr das von Mole erzählen?
Mole dachte: Sie ist gesund.
Susanna sah zu der großen Gestalt auf, während sie ihre Puppe fest an sich gedrückt hielt. Sie verspürte sofort ein Gefühl der Sicherheit.
»Guten Tag, Großmutter«, sagte Fliss müde, aber höflich. »Das ist Susanna. Und an Mole kannst du dich bestimmt noch erinnern.«
»Er ist ganz schön groß geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.« Die Courage des Kindes erweckte auch Freddys Selbstsicherheit wieder zum Leben. »Und du auch. Das ist also Susanna.«
»Sie ist sehr müde«, warnte Fliss, als Freddy Susanna auf den Arm nahm. »Das sind wir alle ...«
Ihre Stimme versagte. Sie hob eine kleine Tasche auf und reichte sie Mole. Freddy sah, dass er die Tasche zwar gehorsam entgegennahm, dabei aber keine Sekunde den Rock seiner Schwester losließ. Wachsam und hoffnungsvoll beobachtete er Freddy ...
Freddy setzte sich die müde, aber friedliche Susanna seitlich auf die Hüfte und nahm den großen Koffer. »Kommt«, sagte sie sanft. »Wir fahren nach Hause.«
Anfang der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts kehrte Ernest Chadwick nach England zurück, nachdem er ein Vierteljahrhundert damit verbracht hatte, in Fernost ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen. Innerhalb einer Woche hatte er durchschaut, dass er mit der Londoner Gesellschaft wenig gemeinsam hatte und dass jener Müßiggang ihn früh ins Grab treiben würde. Er ließ sich von seinem Bankier Hoare beraten, untersuchte daraufhin verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage und entschloss sich dazu. Hauptteilhaber und Direktor einer Firma zu werden, die sich in der Gründung befand und plante, weite Flächen Land in Devon zu erwerben, um die dort vorhandene Porzellanerde abzubauen.
Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, bestand der nächste Schritt darin, ein Haus zu finden, das ihn angemessen repräsentierte und gleichzeitig seine romantische Ader befriedigte. Er suchte vergebens. Was er aber fand und kaufte, waren die zwischen Moor und Meer gelegenen Ruinen eines alten Hügelforts. Unter Verwendung der alten, herabgestürzten Steine hatte er sich einen burgartigen, dreistöckigen Turm gebaut, den er The Keep taufte.
Schon bald hatte er sich selbst davon überzeugt, dass er in den Gemäuern eines uralten Geschlechts lebte. Mithilfe seines Reichtums – und seines nicht unbedeutenden Charmes – gelang es ihm, eine Frau aus guter Familie zu heiraten, die nur halb so alt war wie er. Seine schier unerschöpfliche Energie aber investierte er erfolgreich in den Abbau von Porzellanerde, sodass sein Vermögen sich bis zu seinem Tode noch vervierfacht hatte.
Seine männlichen Nachkommen hatten zwar alle eine Laufbahn bei der Königlichen Marine eingeschlagen, sich dabei aber auch immer in die Geschicke der Firma eingemischt und außerdem The Keep weiter renoviert und modernisiert. Das Anwesen war eigenartig, aber ansprechend. Die beiden zweistöckigen, jeweils an den Seiten des ursprünglichen Gebäudes etwas versetzt angefügten Flügel waren von einer nachfolgenden Generation errichtet worden. Den von hohen Steinmauern umgebenen Hof betrat man, indem man unter einem Dach hindurchschritt, das die beiden Cottages verband, die das Pförtnerhaus bildeten. Alte Rosensorten und Glyzinien kletterten die Hofmauern und die neueren Flügel des Hauses hinauf, während der schmucklose graue Stein des Turmes selbst nackt blieb. The Keep und der Hof lagen nach Süden gewandt; zum Westen hin erstreckten sich der Zier- und dahinter der Obstgarten. Nach Norden und Osten hin fiel der Boden steil ab. Karge grasbewachsene Hänge neigten sich hinunter zum Fluss, der aus den Hochmooren talwärts toste. Das torfbraune, kalte Wasser entsprang blubbernden Quellen und raste durch enge, felsige Betten hinunter in das ruhige, fruchtbare Ackerland, wo es nach und nach langsamer floss, bis es als immer breiter werdender Fluss die Küste erreichte und sich mit dem Salzwasser vermengte.
Freddy fuhr in den Hof, wobei der Wagen über die Pflastersteine rumpelte und sorgfältig an der rechteckigen Grasfläche in der Mitte vorbeigelenkt wurde. Sie setzte den Morris Oxford rückwärts in die Garage, die sich im Pförtnerhaus befand, und stieg aus. Die drei Kinder saßen zusammen im Fond, da sie sich selbst für diese kurze Fahrt nicht voneinander hatten trennen wollen. Freddy öffnete die Tür, zog Susanna heraus und stellte sie auf ihre kurzen, dicken Beinchen. Mole krabbelte hinter ihr her und sah sich mit großen Augen um: Da waren das burgartige Gebäude auf der anderen Seite des Hofs, unglaublich hohe Mauern rundherum und die beruhigend dicken, großen Tore am Pförtnerhaus. Er betete, dass sie geschlossen würden, und als hätte sie seine Gedanken gelesen, ging Freddy hinüber und schlug die schweren eichenen Barrieren zu.
Mole atmete tief durch. Er dachte: Wir sind drinnen! – und sah erleichtert zu Fliss.
Diese mühte sich mit dem Handgepäck ab – die größeren Stücke würden später von Carter Paterson gebracht werden –, wobei Mole ihr sogleich helfen wollte. Er zupfte an ihrem Rock und zeigte auf die Tore. Sie wusste sofort, was in ihm vorging.
»Hier sind wir sicher, Mole«, flüsterte sie. »Hab ich dir doch gesagt, oder? Bei Großmutter auf The Keep sind wir sicher.«
Freddy lachte über Susanna, als diese über den Rasen lief, sich ins warme Gras warf und sich austobte. Nach entbehrungsreichen Tagen in Flugzeug, Zügen und Hotelzimmern genoss sie ganz offensichtlich die neu gewonnene Freiheit.
»Hier kommst du nicht mehr raus«, rief sie fröhlich. »Du bist drin! Hier kann dir nichts passieren. Du kannst nicht raus.«
»Und niemand«, sagte Fliss, »kann hier rein.”
Freddy sah sie an und verspürte eine intensive Spannung; als wolle Fliss ihr damit etwas sagen.
»Ganz recht«, pflichtete sie ihr bei, da ihr sofort klar wurde, wie wichtig es war, dass die Kinder sich absolut sicher fühlten, wenn sie ihren unbeschreiblichen Schock überwinden sollten. »Hier seid ihr vollkommen sicher. Nur Freunde kommen hierher. Und Ellen und Fox kümmern sich um uns. Kannst du dich noch an Ellen und Fox erinnern, Fliss?«
»Oh, ja.« Die Sorgenfalte zwischen Fliss’ Augenbrauen verschwand, und sie lächelte. »Ja, natürlich. Ellen und Fox«, wiederholte sie, als wären diese Worte eine Zauberformel. »Die hätte ich ja beinahe vergessen.«
»Na, das darfst du ihnen aber nicht sagen«, mahnte Freddy, als die Kinder ihre Sachen zusammensammelten. »Sie freuen sich so darauf, dich wieder zu sehen. Kommt schon. Sie sind bestimmt in der Küche und machen Tee.«
Während sie auf die Haustür zu trotteten, überkam Fliss wieder Besorgnis. Sie musste unbedingt unter vier Augen mit ihrer Großmutter sprechen, um ihr zu erzählen, was an jenem entsetzlichen Tag passiert war, an dem sie Cookie hatte schreien hören, an dem sie in die Küche gerannt war, wo ein Polizist Cookie geschüttelt und angeschrien hatte, sie solle sich beruhigen. Dann auf einmal hatte er ihr eine schallende Ohrfeige verpasst, nach der sie keuchte und schluckte und schließlich schwieg. Erst da hatte Fliss Mole entdeckt, der aschfahl unter dem Küchentisch gekauert und die schrecklichen Schilderungen des Polizisten mit angehört hatte.
Selbst jetzt wusste Fliss immer noch nicht genau, was Mole gehört hatte. Denn seit jenem Vorfall war Mole stumm geblieben; gefangen in seinem eigenen Schweigen. Es war zu spät gewesen, sich eine gemäßigte Version der Geschehnisse auszudenken. Der Polizist nahm an, der kleine, unter dem Tisch kauernde Junge würde die grässlichen Dinge wiederholen, die er der Köchin unvorsichtigerweise erzählt hatte, als er selbst noch unter Schock stand. Er verfluchte sich und tat sein Bestes – was nicht besonders gut war –, sodass Fliss zumindest die quälenden Einzelheiten erspart blieben, deren Zeuge Mole geworden war, als er unter dem Küchentisch gehockt hatte. Seitdem hatte Mole Fliss keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen und – soweit das möglich war – sich immer an ihr festgehalten.
Wie sollte sie bloß Gelegenheit finden, allein mit ihrer Großmutter zu sprechen, um ihr all das zu berichten? Fliss wurde fast erdrückt von der Verantwortung und der Sorge, während sie doch selbst mit Trauer und Einsamkeit zu kämpfen hatte.
»Du bist jetzt die Älteste«, hatte eine Frau gesagt, die es gut meinte. Sie war eine Freundin ihrer Mutter und hatte sich um sie gekümmert, bis sie ausreisen konnten. »Du musst deinem Bruder und deiner Schwester jetzt eine kleine Mutter sein.«
Fliss hatte sie schweigend angestarrt, während Mole sich neben ihr in den Sessel verkroch. »Aber ich bin keine Mutter«, hatte sie sagen wollen, »nicht mal eine kleine. Und ich kann auch gar nicht die Älteste sein. Jamie ist der Älteste. Dass er tot ist, ändert daran doch nichts. Man kann doch nicht einfach die Älteste werden, bloß weil jemand stirbt...«
Der Gedanke an Jamie, der so verantwortungsvoll gewesen war, sie stets alle im Griff gehabt hatte, der ihr immer ein Trost und so tüchtig gewesen war, der Gedanke an ihren großen Bruder hatte Fliss’ Lippen beben lassen und ihr die Tränen in die Augen getrieben. Sie hatte sich an Mole geklammert und in sein dunkles Haar geweint, als er so passiv an ihr lehnte und aufgrund des Schocks noch nicht einmal weinen konnte.
»Nun komm schon.« Die Frau war offensichtlich enttäuscht von Fliss’ mangelnder Selbstbeherrschung. »Du musst den Kleinen ein gutes Vorbild sein. Hier hast du ein Taschentuch. Einmal kräftig schnäuzen. Ja, so ist’s brav.«
Sie hatte sich gehorsam die Nase geputzt, Mole über die Haare gestrichen und ihn in den Arm genommen, in der Hoffnung, mütterlich zu sein. Ihre Tränen aber waren nicht versiegt, sie liefen ihr den Rachen hinunter. Jetzt, hier auf The Keep hoffte sie, dass ihre Großmutter ihr einen Teil der Last abnehmen würde; aber dazu musste sie ihr ja erst erzählen ...
Fliss seufzte schwer, hielt Moles Hand weiter ganz fest und folgte Freddy die Stufen hinauf in die Eingangshalle.
2
The Keep war gebaut worden, um darin behaglich und sorgenfrei leben zu können, und jede Generation hatte dem vorgegebenen Thema ihre eigenen Variationen hinzugefügt. Da Freddy die Zwillinge zwischen den Kriegen allein hatte großziehen müssen, hatte sie – mehr oder weniger unfreiwillig – ein eher zurückgezogenes Leben geführt. Sie stammte aus Hampshire, und Bertie war gestorben, bevor er sie – wie das in einer so ländlichen und einigermaßen abgeschiedenen Gegend nun einmal üblich war – in die hiesige Gesellschaft hatte einführen können. Viele seiner Altersgenossen waren ebenfalls im Krieg gefallen, und nur wenige von ihnen waren verheiratet gewesen. So kam es, dass The Keep sich zu einer eigenen kleinen Welt entwickelte und dass Freddy das Haus nach und nach ihren eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen anpasste. Sie liebte es: die hohen Zimmer und die Geräumigkeit; den abgeschirmten Hof; die unvergleichliche Aussicht; den riesigen Kamin am hinteren Ende der Eingangshalle; ihr kleines Wohnzimmer im ersten Stock, von dem aus sie den Hof überblicken konnte; das großzügige Schlafzimmer, in dem sie dank der Fenster zum Süden und Osten von der frühen Morgensonne geweckt wurde.
Freddys Beitrag zum Thema Behaglichkeit hatte darin bestanden, Berties Ankleidezimmer zu einem weiteren, eigenen Badezimmer umbauen und die Küche modernisieren zu lassen. Ihre Entschuldigung dafür, im ersten Stock ein zweites Badezimmer zu haben, lautete, dass sie das ursprünglich vorhandene nur ungern mit ihrer Schwiegertochter Prue teilte, wenn diese zu Besuch kam. Freddy konnte es nicht ausstehen, wenn Körperpuder den Linoleumboden bedeckte, Strümpfe den Wäscheständer zierten und Prues verschwenderisch benutztes Parfum in der Luft hing. Als die Jungs älter geworden waren, hatten sie weiter die den Kindern vorbehaltenen Räume im zweiten Stock benutzt, sodass Freddy sich daran gewöhnt hatte, das Badezimmer ganz für sich zu haben. Sie war selbst überrascht gewesen, wie sehr es ihr widerstrebt hatte, es mit Prue zu teilen – und in die Überraschung hatten sich Schuldgefühle gemischt, die sie schließlich dazu veranlasst hatten, ihren Schwager Theo Chadwick zurate zu ziehen. Theo war sechs Jahre jünger als Bertie, und er war es gewesen, der der jungen Frederica den Spitznamen »Freddy« gegeben hatte, der sie getröstet hatte, als sie im schwangeren Zustand zur Witwe, Eigentümerin von The Keep und Hauptteilhaberin einer Firma wurde, von deren Geschäften sie keine Ahnung hatte. Theo war Priester und hatte bis vor Kurzem als Marinegeistlicher gewirkt.
»Wozu brauchst du denn überhaupt eine Entschuldigung, noch ein Badezimmer zu bauen?«, hatte Theo sie verwundert gefragt. Es sah Freddy gar nicht ähnlich, ihn in solchen Dingen um Rat zu fragen. »Warum solltest du denn nicht dein eigenes Badezimmer haben dürfen?«
»Mir kommt das so dekadent vor«, erklärte Freddy. »Schließlich existiert ja ein völlig funktionsfähiges Badezimmer, und so oft kommen Prue und die Zwillinge nun auch wieder nicht.«
»Vielleicht würden sie öfter kommen, wenn sie sich nicht mehr mit dir das Badezimmer teilen müssten«, merkte Theo listig an.
Freddy runzelte die Stirn, bemerkte dann aber Theos verschlagenes Grinsen und funkelte ihn an. »Du bist ein Schuft, Theo. Jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen.«
»Mir fällt auf, dass du nie ein schlechtes Gewissen hattest, wenn die arme alte Ellen das heiße Wasser die Treppen hoch und runter schleppen musste«, stellte Theo fest. »Ich frage mich, was der Quell dieser edlen Gefühle ist.«
»Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt meine Zeit damit verschwende, dir von meinen Problemen zu erzählen«, brummelte Freddy – und erinnerte sich im gleichen Augenblick an jene frühen Jahre, als sie wohl kaum etwas anderes getan hatte, als sich an seiner Schulter auszuweinen. Sie fing an zu lachen. »Ach, hör doch auf«, sagte sie. »Ich gönne mir mein Badezimmer und werde damit glücklich!«
Jetzt, als Freddy am Fenster ihres kleinen Wohnzimmers stand und auf den Hof hinuntersah, musste sie an Theo denken. Ob Theo wusste, wie man mit einem kleinen Jungen umzugehen hatte, den eine Tragödie seiner Sprache beraubt hatte? Fliss hatte Freddy von Moles Schweigen berichten können, als Ellen ihn gebadet hatte; davon, wie er sich unter dem Küchentisch befunden hatte, als der Polizist gekommen war, und seitdem kein Wort mehr gesagt hatte. Freddy war entsetzt gewesen, zumal sie sich vorstellen konnte, was der unvorsichtige Beamte der Köchin erzählt haben mochte. Dass sie sich diese Einzelheiten immer wieder ausmalte, trug schließlich erheblich zu ihrem eigenen Schmerz bei – wie sehr also musste Mole erst leiden? Freddy hatte auch Ellen gewarnt, und die beiden Frauen hatten sich verzweifelt angesehen, da sie nicht wussten, wie sie mit diesem neuen Problem umgehen sollten. Zumindest erklärte das, warum Fliss darauf bestanden hatte, dass sie und Mole gemeinsam in einem Zimmer schliefen, sodass er sie immer sehen und berühren konnte, und warum sie so erleichtert gewesen war, als sie gesehen hatte, dass das Kinderzimmer genauso eingerichtet worden war, wie sie es erhofft hatte.
Lange Schatten legten sich auf das Gras, und Freddy hörte die schrillen Rufe der Mauersegler, die hoch über ihr in der warmen Abendluft um die Wette flogen. Rosenduft drang durch das offene Fenster zu ihr, und im Obstgarten jubilierte eine Drossel. Diese ihr so vertrauten kleinen Freuden beruhigten sie ein wenig, doch nicht weit unter der Oberfläche ihrer Gedanken beherrschte sie noch immer die Angst. Die Aussichten waren auch ohne diese neue Komplikation beängstigend genug.
Freddy wandte sich vom Fenster ab und betrachtete ihr Zimmer. Dies war so etwas wie ihr privates Heiligtum; hier hatte sie alle ihre Lieblingsstücke zusammengetragen. Mitunter erlaubte sie sich den Luxus, neue Stücke zu kaufen, um ihre Sammlung zu vergrößern. Die schweren viktorianischen Möbel der früheren Chadwicks hatte sie zugunsten der zierlichen Stücke einer etwas eleganteren Epoche abgelehnt – aber eine Puristin war sie nicht. Sie suchte sich die Dinge aus, die ihr gefielen, und ihre Vorlieben verbanden sich zu einem wunderbaren Muster. Das Zimmer war wie aus einem Guss. Der Sekretär mit den flachen Schubladen und der geschwungenen Front; das hohe Bücherregal, hinter dessen Verglasung sich ihre Lieblingsbände aneinanderreihten; ein kleiner Tisch mit Einlegearbeit, auf dem eine Vase mit Rosen stand; zwei bequeme, moderne Sessel, in denen man versinken konnte. Ein Eckregal bot einigen kostbaren Stücken Porzellan und Glas Platz; ein Radioapparat stand auf einem Hocker neben ihrem Sessel. An den blassen Wänden hingen mehrere Gemälde von Widgery – am besten gefielen Freddy seine Moormotive –, und in den schweren, moosgrünen Vorhängen wiederholte sich die Farbe, die auch in die dicken Axminster-Teppiche gewoben war.
Ihre nervöse Aufgewühltheit legte sich etwas, und sie atmete tief durch. Eigentlich hatte sie doch gerade an Theo gedacht ... Er hatte sie gebeten, ihn anzurufen, sobald die Kinder heil angekommen wären. Sofort durchzuckte sie wieder Verärgerung: Er hätte hier sein sollen, bei ihr, um sie in dieser schweren Stunde zu unterstützen! Stattdessen schloss er sich in seine paar Zimmer mit Blick auf den Kanal in der Wohnung in Southsea ein und schrieb an seinem gottverdammten Buch Die Moral des Krieges. Und doch musste Freddy lächeln.
»Kann der Krieg eine Moral haben?«, hatte sie ihn gefragt. »Ich finde Krieg ziemlich unmoralisch. Warum machst du nicht etwas Sinnvolles, wenn du dich zur Ruhe setzt?«
»Wie definierst du ›sinnvoll‹?«, hatte er sie höflich gefragt – und sie hatte keine Antwort gewusst. Nein, eigentlich hatte sie nur nicht gewagt, das auszusprechen, was ihr als Erstes in den Sinn gekommen war, nämlich: »Wenn du dich zur Ruhe setzt, dann komm hierher, wohne mit mir auf The Keep und sei einfach da. Sei bei mir und bring mich zum Lachen.«
Ihr war klar, wie egoistisch das klingen würde, und darum schwieg sie. Sie wusste, dass Theo ihre Privatsphäre niemals verletzen und sich in die Angelegenheiten, die The Keep betrafen, nicht einmischen würde; sie wusste, dass sie ihn in jenen Momenten unerträglicher Einsamkeit bei sich haben wollte, damit er sie aufheiterte. Über die Jahre hatten sie eine merkwürdige Beziehung gepflegt. Nachdem Bertie gestorben war, hatte Freddy immer wieder Theos Gott angegriffen und ihrem Schwager dargelegt, warum sie an diesen Gott nicht glauben konnte, und Theo hatte geduldig zugehört. In ihrem Schmerz nach Johns Tod hatte sie sich gegen Theos unerschütterlichen Glauben aufgelehnt und darauf bestanden, dass er ihn rechtfertigte. Theo hatte sich geweigert; er hatte den Kopf geschüttelt in der Gewissheit, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war für eine ihrer theologischen Diskussionen. Und doch empfand sie seine Anwesenheit als tröstlich. Sie brauchte Theo nur zu sehen – sein dichtes in die Stirn fallendes, dunkles Haar, seine braunen Augen –, und sie entspannte sich augenblicklich. Es war, als würde ein Teil der Last ihres Verlustes, ihres Schmerzes auf ihn übertragen.
Ein Hoffnungsschimmer erwärmte Freddy, als sie daran dachte, das neu aufgetauchte Problem mit ihm zu besprechen. Sie schloss die Wohnzimmertür hinter sich und ging nach unten in ihr Arbeitszimmer.
Die Kinder schliefen bereits. Durch die zugezogenen Vorhänge des Kinderzimmers drang das späte Licht des Mittsommerabends, und Ellen bewegte sich fast lautlos durch den Raum, um Wäsche zusammenzulegen, Handtücher aufzuheben und die Kleidungsstücke aus den Koffern zu inspizieren. Ellen: stets diskret im Hintergrund, unermüdlich im Einsatz für ihre Herrin. Ihr Stolz, als sie dazu auserwählt wurde, sich um Miss Frederica zu kümmern, sie gar zu begleiten, als sie heiratete, war eine Art Jubel gewesen, doch dieser jubelnde Stolz wurde gemäßigt durch ihren scharfen Sinn für Humor. Dieser Humor beseelte Ellens Arbeit und verlieh ihr Stärke. In jungen Jahren hatte sie über all die Qualitäten verfügt, die ein Dienstmädchen auszeichneten: Sie war farblos und unauffällig gewesen, obschon bei genauerem Hinsehen ein energischer Zug um den Mund zu erkennen war; ein durchdringender, unnachgiebiger Blick, dem keine Anmaßung standhielt; ein Entschlossenheit verratender Kiefer. Sie war immer sauber und adrett, ihr braunes Haar glatt, ihre Schürzen stets gestärkt und makellos. Sie war flink, besaß eine schnelle Auffassungsgabe, liebte Freddy – und all jene, die Freddy liebte – und schätzte sich glücklich, den Rest ihres Lebens auf The Keep verbringen zu dürfen.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg waren sie und Freddy sich sehr nahegekommen, sie hatten sich die Erziehung der Jungs und den Haushalt geteilt, wobei Fox ihnen geholfen hatte. Fox hatte als junger Kanonier unter Bertie gedient, als dieser 1915 zum Adjutanten des Artillerieoffiziers befördert wurde. Nach dem Krieg hatte Fox sich auf den Weg nach The Keep gemacht, um Berties Familie vom Mut und der Tapferkeit des Lieutenant Chadwick in seiner letzten Schlacht zu berichten. Der junge Fox und die Offizierswitwe mit ihren Zwillingen waren sich auf Anhieb sympathisch gewesen, sodass Fox The Keep nur noch einmal und gerade so lange verließ, wie es dauerte, um seine Habseligkeiten aus einer Pension in Plymouth zu holen. Von da an hatte er sich um The Keep gekümmert.
Ellen mochte Fox. Der Krieg hatte ihn über sein Alter von 26 Jahren hinaus reifen lassen; er war zurückhaltend, aber fleißig und gewissenhaft. Eine Zeit lang hatte sie mit dem Gedanken gespielt, sich in ihn zu verlieben. Das wäre im Grunde vernünftig gewesen, ja, es hätte geradezu gepasst, aber irgendwie hatte sie doch nie ausreichend Begeisterung für ihn aufbringen können, um die letzte Hürde seiner Zurückhaltung zu überwinden. Abgesehen davon genoss sie ihre Unabhängigkeit und die Freiheit, ihm sagen zu können, was sie wollte, ohne dieses schlechtes Gewissen haben zu müssen, das man durch die Eheschließung zusammen mit all den weltlichen Gütern zu erwerben schien. Wenn er mit ihr in der Küche saß und Tee trank, beobachtete sie ihn heimlich – sein spitzes Kinn, seine starken, geschickten Finger, seine lässig ausgestreckten Beine. Sie hatte ihn sich oft in etwas intimeren Situationen mit sich selbst vorgestellt, doch obwohl diese Fantasien ihren Atem etwas zu beschleunigen vermochten und ihren Unterleib wohlig erschauern ließen, reichten sie nicht aus, um ihn ernsthaft als Lebenspartner in Betracht zu ziehen.
Sie hatte sich wieder voll und ganz der Pflege der Babys zugewandt, da sie spürte, dass darin ihre wahre Bestimmung lag. Im Laufe der Jahre hatte sie sich mehrfach gefragt, ob sie ihr eigenes Glück geopfert hatte, aber diese Gedanken vergingen so schnell wie sie kamen. Sie und Fox waren auf diese Weise viel zufriedener miteinander, als sie es je gewesen wären, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgegeben hätten. Sie vergötterte die Zwillinge – und ihre Strenge und eiserne Disziplin waren das Maß ihrer Liebe für sie. Diejenigen, die Ellen liebte, maßregelte und drangsalierte sie, und die Zwillinge – und gelegentlich auch Freddy – wurden ganz besonders gemaßregelt und drangsaliert. Ellen zog keinen der Jungs dem anderen vor, sodass die Zwillinge zu selbstbewussten und glücklichen Menschen heranwuchsen. Sie wurden geliebt – und doch wurden ihnen klare Grenzen gesetzt: Sie wurden umsorgt – und doch wurden sie bestraft, wenn sie gegen die Regeln verstießen, an die man sich in einer Gesellschaft – und sei es nur in der kleinen Gesellschaft zu Hause – halten musste. Früher oder später würden sie sich der großen Gesellschaft, in der sie lebten, anpassen müssen, und je eher sie sich darüber klar wurden, desto besser war es für sie, desto größer würden ihre Freiheiten in jener Gesellschaft sein.
Und jetzt waren sie tot. Johns Kinder, die Zwillinge Henry und Katharine – Hal und Kit – kamen oft nach The Keep, wo Ellen sie umhegte, ihnen ordentlich zu essen gab und sich ihre Probleme anhörte. Jedes Mal, wenn sie wieder abreisten, war Ellen traurig, obgleich sie wusste, dass sie langsam zu alt wurde, um mehr zu sein als Köchin und Haushälterin. Diese beiden Tätigkeiten hatte sie nach und nach übernommen, als es immer schwieriger geworden war, für einen so entlegenen Flecken Personal zu finden. Also hatten sie, Freddy und Fox sich ein ruhiges, häusliches Leben eingerichtet, das durch die Besuche von Prue, den Zwillingen und Theo belebt wurde.
Und dann auf einmal diese schreckliche Nachricht, die ihren wohlverdienten Frieden zerstörte, die keine Rücksicht darauf nahm, dass sie sich gerade erst mit den früheren Verlusten abgefunden hatten, und die ihr beschauliches Hinübergleiten ins Alter jäh unterbrach. Ellen hatte die weinende Freddy umarmt, während ihr selbst Tränen über die Wangen liefen, die lautlos in Freddys ergrauendem blonden Haar landeten – doch viel Zeit für Trauer war ihnen nicht geblieben. Die Kinder sollten sofort zu ihrer Großmutter nach England geschickt werden, und gemeinsam mit Ellen und Fox hatte Freddy sich in einen Wust von Vorbereitungen gestürzt. Sie hätten alles getan, um nicht an jenen grausamen Vorfall denken zu müssen.
Ellen zog die Vorhänge noch sorgfältiger zu und sah dann nach der im großen Kinderbett schlafenden Susanna. Ihre Glieder lagen schwer und zufällig wie in Wasser gegossenes Blei – einem Seestern gleich ruhte eine Hand auf ihrer Brust, und ihre Puppe saß gegen die Gitterstäbe gelehnt. Behutsam deckte Ellen das Laken über das schlafende Kind und entfernte sich leise. An der Tür zum anderen Kinderzimmer blieb sie stehen – Stille. Und doch zog es Ellen hinein.
Fliss schlief den Schlaf der Erschöpften, runzelte aber selbst in diesem Zustand noch die Stirn. Ellen betrachtete sie nachdenklich. Sie wusste, wie sehr Fliss an ihrem großen Bruder gehangen hatte, und sie konnte sich vorstellen, wie sehr sie litt. Ratlos fragte sie sich, wie sie dem Kind nur über diesen Verlust hinweghelfen könnte ... Im Halbdunkel hinter ihr bewegte sich etwas. Ellen wollte nach Mole sehen, drehte sich zu seinem weiß gestrichenen, kleinen Eisenbett um und fuhr zusammen. Er saß kerzengerade im Bett und beobachtete sie aus großen, angstgeweiteten Augen. Ellen ging schnell zu ihm und setzte sich so auf das Bett, dass er seine Beine anziehen musste. Mole warf noch einen kurzen Blick auf Fliss und sah dann zu Ellen auf.
»Sie schläft tief und fest«, flüsterte sie. »Und das ist gut so. Weck sie nicht auf.«
Gehorsam schüttelte er den Kopf, aber er sah sehr unglücklich aus. Ellen rückte sein Kissen zurecht und strich ihm das dunkle Haar – Theos Haar – aus der weichen Kinderstirn.
Mole war schon früher erschöpft gewesen als Fliss und sofort eingeschlafen. Doch der Schlaf hatte ihm nur die inzwischen wohl bekannten Albträume beschert. Die Äußerungen des Polizisten hatten sich in Moles Kopf zu einem entsetzlichen Film zusammengefügt – Äußerungen, von herzzerreißenden Schluchzern unterbrochen, die unbarmherzig in seinen Ohren widerhallten. »... Sie hatten sich auf den Bäumen versteckt, wie dunkle Schatten haben sie bloß darauf gewartet, dass das Auto aus der Sonne in den Schatten fuhr. Oh, mein Gott! Überall war Blut. Sie hatten Macheten dabei, Beile, Stöcke ... Sie haben die Chadwicks aus dem Auto gezerrt und auf sie eingeschlagen und sie zerstückelt. Das Hemd von dem Jungen triefte vor Blut ... Sie haben seinen Kopf fast zu Brei geprügelt, so brutal, dass er sich beinahe vom Körper löste ...« In dem Moment hatte Cookie angefangen zu schreien, und Fliss war in der Küchentür erschienen ...
Mole war aufgewacht und hatte Ellen neben dem Bett seiner Schwester stehen sehen. Einen schrecklichen Moment lang hatte er vergessen, wo er war, aber seine Angst hatte nachgelassen, als Ellen sich zu ihm setzte. Nun saß sie immer noch ganz ruhig neben ihm und grübelte nach, während er sie beobachtete. Da kam ihr eine Idee.
»Komm«, sagte sie leise, schlug seine Decke zurück und nahm seine Hand. »Komm mit, ich zeig dir was.«
Er zögerte und warf einen hoffnungsvollen Blick auf Fliss, doch Ellen schüttelte unnachgiebig den Kopf.
»Nicht aufwecken«, flüsterte sie. »Das arme Lämmchen ist völlig erschöpft. Komm mit. Bei mir bist du sicher.«
Widerwillig folgte er ihr. Solange er konnte, wandte er den Kopf nach Fliss um und wünschte sich, sie zu wecken. Kaum war er jedoch in Ellens kleiner Kammer und erblickte den Welpen, der mit seiner Mutter in einem großen Hundekorb lag, vergaß er alles andere. Mole kauerte sich neben die beiden und streckte zögernd die Hand nach dem kleinen warmen Körper aus. Die große, rostfarbene Hündin hob den Kopf und sah Mole einige Sekunden unverwandt an, bevor sie sich ächzend wieder hinlegte. Der Welpe rührte sich, gähnte mit weit aufgerissenem, rosafarbenem Mäulchen und rappelte sich mühsam auf. Er tapste mit wedelndem Schwanz aus dem Korb und kletterte auf Moles Knie.
»Ist der nicht süß?«, flüsterte Ellen. »Acht Wochen alt. Die anderen haben wir weggegeben, aber den behalten wir. Es ging ihm nicht so gut, darum habe ich ihn eine Weile hier oben gehabt und gepflegt. Jetzt ist er kerngesund. Ich mache eben etwas Milch warm für ihn. Und du bekommst auch welche.«
Völlig hingerissen spielte Mole mit dem Welpen, der gierig seine Milch trank und sich danach auf einer Zeitung neben der Tür zu schaffen machte. Er rannte zurück zu Mole, warf sich gegen ihn, biss sich in seinem Schlafanzugärmel fest, zerrte daran herum und kämpfte verspielt. Einen winzigen Augenblick lang lächelte Mole. Er sah zu Ellen auf – ein ganz normaler, glücklicher kleiner Junge –, und sie empfand grenzenlose Erleichterung, als sie sein Lächeln erwiderte.
»Er ist eine Nervensäge«, flüsterte sie – und beschloss, eine ihrer eisernen Regeln zu brechen. »Hast du Lust, ihn mit zu dir ins Bett zu nehmen?«
Mole sah sie ungläubig an, und sie bejahte seine unausgesprochene Frage mit einem Nicken.
»Warum nicht? Komm schon. Ich packe euch ins Bett.«
Sie kuschelten sich in dem engen Bett aneinander. Der Welpe freute sich über Moles Wärme.
»Und jetzt keinen Piep mehr«, warnte Ellen Mole. »Sonst kriegt er Angst. Er ist ja noch ein Baby. Du musst dich um ihn kümmern und darauf achten, dass er keine Angst hat. Meinst du, du kannst das?«
Mole nickte. Ja, das konnte er wohl. Ellen lächelte und gab ihm einen Kuss.
»Schlaf gut«, sagte sie – und ging hinaus.
Vorsichtig hob Mole den Kopf und spähte hinüber zu seiner Schwester. Er hätte ihr so gerne den Welpen gezeigt, aber er wollte auf keinen Fall Ellens Zorn erregen und schon gar nicht riskieren, dass ihm der Welpe weggenommen wurde. Der kleine Hund schlummerte friedlich, und der immer noch verwirrte, doch weniger angespannte Mole streichelte ihn zärtlich, bis auch er einschlief.
3
Theo Chadwick lehnte an der Brüstung und beobachtete die Fähre, die die Isle of Wight mit Portsmouth verband. Das Wasser lief sachte auf und zerstörte langsam, aber sicher Dutzende von Sandburgen, die an milden Junisonntagen stets wie Pilze aus dem Boden schossen. Die Sonne war bereits untergegangen und nahm nun auch noch die letzten Strahlen mit sich, sodass die Insel sich nachtblau und scharf wie ein Scherenschnitt gegen den etwas helleren Hintergrund abhob – entlegen, aber doch für immer in den tiefen Wassern des Ärmelkanals verankert. Als schwarzviolette, goldgerahmte Gewitterwolken sich von Westen her auftürmten, war die Fähre auf ihrem Weg nach Ryde nur noch aufgrund ihrer Lichter zu erkennen. Ein schöner Anblick auf dem anschwellenden, dunklen Wasser, den Theo eine Weile genoss, bevor er sich vom Geländer löste und in die Stadt zurückkehrte. In Kürze würden unzählige Feriengäste den Ort bevölkern; würden Zug für Zug hier eintreffen, die Pensionen stürmen, die Erwachsenen, mit Decken und Badesachen und Picknickkörben beladen, zum Strand wackeln, während die Kinder Eimer, Schaufeln, bunte Windräder und Fähnchen mitschleppten, um die schönste Sandburg zu bauen. Theo hatte schon beschlossen, nach Devon zu flüchten, in die Ruhe und den Frieden von The Keep.
Diese Entscheidung hatte er gefällt, bevor die entsetzliche Nachricht aus Kenia sie erreicht hatte, aber Freddy hatte ihn inständig und verzweifelt gebeten, seine Pläne nicht zu ändern. Sie versicherte ihm, dass sie ihn mehr denn je brauche. Theo – der sich nie ganz sicher gewesen war, ob er eigentlich eine Belastung oder eine Bereicherung darstellte – hatte ihr versprochen, dass er kommen werde, sobald die Kinder sich etwas eingelebt hatten. Und dann hatte Freddy ihn angerufen und ihm erzählt, dass der kleine Sam – oder Mole, wie die Familie ihn nannte – seit jenem unglücklichen Tag kein Wort mehr gesprochen hatte. Diese furchtbare Neuigkeit hatte er aus Freddys wirrem Redefluss über Autounfälle, die unmögliche Reisebegleiterin der Kinder und andere kleine Dramen herausgehört, Theo konnte sich die Situation nur zu gut vorstellen: den vor Schock wie ein Wasserfall plappernden Polizisten, die hysterische Köchin und den unter dem Tisch versteckten Mole. Wie grauenvoll mussten die Details gewesen sein, die er unfreiwillig mit angehört hatte!
Theo stieg die schmalen Stufen zu seinen Zimmern hinauf, die im ersten Stock eines zu zwei Wohnungen umgebauten Hauses lagen. Er hatte die Räume von einem befreundeten älteren Ehepaar gemietet, einem ehemaligen Korvettenkapitän und seiner Frau. Es war eine nette Wohnung, die über einen ausreichend großen Schlafraum und ein geräumiges Wohnzimmer mit einem Gasofen und einem Erkerfenster mit Blick aufs Meer verfügte. Außerdem gab es einen Ankleideraum, von dem aus man in den Garten sehen konnte, eine sehr kleine Küche und ein angemessenes Badezimmer. Der Ankleideraum diente Theo als Arbeitszimmer – er hatte sehr schnell herausgefunden, dass eine zu interessante Aussicht zu enttäuschenden Resultaten seiner Arbeit führte.
Er ging in die Küche, machte den Gasherd an, füllte den geschwärzten Kessel mit Wasser und stellte ihn auf die Flammen. Der leichte Mäusegeruch und die untilgbaren Flecken auf der Holzarbeitsfläche kümmerten ihn nicht, und ebenso wenig kümmerte es ihn, was er aß und trank, wenn er allein war. Im Moment dachte er über Mole nach und erinnerte sich an die vielen unterschiedlichen Reaktionen auf Terror, Schreck und Gewalt, deren Zeuge er während des Krieges geworden war. Wenigstens war Mole noch sehr jung. Man konnte nur hoffen, dass sich sein Schock mit viel Liebe und Geborgenheit lindern ließ.
Theo nahm seine alte braune Teekanne zur Hand und brühte den Tee auf, während seine Gedanken nun um Freddy kreisten. Sie war so mutig und stark gewesen, hatte mit unvergleichlicher Tapferkeit die Schläge ertragen, die das Schicksal an sie ausgeteilt hatte.
»Warum ich?«, hatte sie ihn verzweifelt gefragt – und er war nicht in der Lage gewesen, ihr darauf zu antworten.
Theo sann über einen unerkennbaren, unsichtbaren, unvorstellbaren Gott nach. In Glaubenssachen hatte er sich schon längst von dem Bedürfnis nach Symbolen gelöst und sich der Kontemplation zugewandt, die ihn mit tiefer Seligkeit erfüllte. Hilflos musste er dabei zusehen, wie Freddy in Rage geriet und einem Gott zürnte, den sie klein und egoistisch, launenhaft und niederträchtig nannte. Er hatte versucht, ihr zu helfen. Im Laufe der Jahre hatte er von freiem Willen und der gestalterischen Macht der Liebe gesprochen, von der Torheit, Gott »verstehen« zu wollen. Er zitierte aus dem Buch Hiob – ”Wo warst du, als ich die Erde gründete?” – und versuchte, ihr das Mysterium verständlich zu machen, indem er es mit festgelegten naturwissenschaftlichen Regeln verglich: unerbittlich, unveränderlich. Freddy aber betrachtete die Dinge nur von ihrem ganz persönlichen Standpunkt aus, sodass das Einzige, was er tun konnte, war, sie weiter zu lieben.
Er nahm Tasse und Untertasse mit ins Wohnzimmer und setzte sich vor das Erkerfenster. Er sah über den Kanal, dessen glatte, ölige Oberfläche von den ersten Regentropfen durchlöchert wurde. Gleich würde er seinen Fahrplan holen und sich über die Abfahrtszeiten der Züge in Richtung Westen informieren. Vielleicht würde er seine Reise in Bristol unterbrechen und Prue besuchen. Nachdenklich nippte Theo an seinem Tee. Ob Prue wohl von Mole wusste? Eher unwahrscheinlich, entschied er. Freddy hatte bestimmt nicht an Prue gedacht. Er fand es traurig, nahm aber an, dass es normal war, dass Freddy und Prue von einem Missverständnis ins nächste stolperten. Jede von ihnen glaubte, das ausschließliche Recht zur Trauer zu haben, wenn es um John ging.
»Ich war seine Mutter«, hatte Freddy gerufen. »Er gehörte solange zu mir, bevor er zu ihr gehörte.«
»Ich war seine Frau«, tobte Prue. »Eine Frau bedeutet einem Mann viel mehr als seine Mutter.«
Theo hatte versucht zu vermitteln.
»Wundert mich gar nicht, dass du ihre Partei ergreifst«, fuhr Freddy ihn an. »Sie ist schließlich jung und hübsch. Männer sind ja so leicht zu beeindrucken. Natürlich hatte ich auf deine Loyalität gehofft, aber...«
»Habe ich mir schon gedacht, dass du auf ihrer Seite sein würdest«, schniefte Prue vorwurfsvoll. »Die Chadwicks halten natürlich zusammen.«
»Du bist doch jetzt auch eine Chadwick«, hatte Theo ruhig entgegnet. »Deine Kinder sind Chadwicks.«
Prue schnaubte. »Ich weiß nicht, wie Freddy sich vorstellt, dass ich mit diesem mickrigen Unterhalt auskommen soll. Außerdem ändert sich der Betrag von Jahr zu Jahr ...«
Theo hatte zum wiederholten Male versucht, Prue das Prinzip zu erklären, nach dem ihr von den Anteilen, die John gehört hätten, wenn er noch am Leben wäre, eine Dividende ausgezahlt wurde. Freddy war es zu riskant, Prue die Anteile zu überlassen – und das hatte sie Theo gegenüber auch so gesagt –, aber der an Prue ausgezahlte Betrag war großzügig genug, wenn man bedachte, dass Freddy außerdem das Schulgeld für Hal und Kit bezahlte und auch sonst hier und da finanziell aushalf.
Theo trank den Tee aus und stellte Tasse samt Untertasse auf dem runden Eichentisch im Erker ab, an dem er – auf das Meer blickend – die meisten Mahlzeiten einnahm. Er würde nach Devon fahren und sehen, ob und wie er helfen konnte. Und jetzt würde er Prue anrufen und sich mit ihr verabreden.
Hal ging ans Telefon. »Hallo, Onkel Theo«, sagte er fröhlich. »Wie geht’s dir? ... Uns geht es gut ... Nein, Mutter ist nicht da, tut mir leid. Soll ich ihr etwas ausrichten?«
Theo erklärte ihm, dass er sich auf seinem Weg nach Westen in der kommenden Woche gerne für eine Nacht bei ihnen einnisten würde.
»Hast du es gut«, beneidete Hal ihn. »Wenn wir doch auch schon hinfahren könnten! Bis zu den Sommerferien ist es noch soooo lang.«
Theo bedauerte Hal ein wenig und erkundigte sich dann nach Kit.
»Kit geht’s gut«, sagte Hal. Dann trat eine winzige Pause ein, und als Hal wieder anfing zu sprechen, war seine Stimme ganz verändert. »Wie geht es den anderen?«, fragte er unsicher. »Das ist ja so schrecklich. Großmutter hat angerufen, um Bescheid zu geben, dass sie heil angekommen sind ...« Die Stimme versagte ihm.
Theo versicherte ihm, dass die Kinder sich gut einlebten, trug ihm herzliche Grüße an Prue und Kit auf und verabschiedete sich. Er würde sich um die Zugfahrt kümmern und morgen mit Prue sprechen.
»Wer war das?«, fragte Kit, die an dem Frequenzregler des Radioapparates herumfummelte. »Das Palm-Court-Konzert ist zu Ende. Was wollen wir jetzt machen?«
»Das war Onkel Theo.« Hal guckte nachdenklich. »Er fährt nach The Keep.«
Kit warf sich auf das Sofa. »Hat der’s gut! Warum können wir denn noch nicht hin ... Obwohl, mit den ganzen Kindern da wird’s eh nicht mehr wie früher.«
»Ach, komm.« Hal fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. »Ihnen ist was ziemlich Schreckliches passiert.«
»Dass Daddy im Krieg gefallen ist, war auch schrecklich«, verteidigte Kit sich. »Er wurde torpediert. Ist entweder in die Luft geflogen oder ertrunken. Schrecklicher geht es doch wohl kaum. Um uns wurde nicht so ein Theater gemacht.«
»Wir hatten ja auch noch unsere Mutter«, stellte Hal verständig fest. »Und außerdem waren wir ja noch Babys. Wir können uns doch an gar nichts erinnern. Und es ist schon zwölf Jahre her.«
Kit zuckte mit den Schultern, Sie sah ihre Position auf The Keep in Gefahr und befürchtete, dass Fliss und die anderen nun statt ihr und Hal im Mittelpunkt stehen würden. Insgeheim fand sie es natürlich auch schrecklich, was mit Onkel Peter, Tante Alison und Cousin Jamie passiert war. Nach jenem Telefonanruf hatten Prue und Kit gemeinsam bitterlich geweint. Im Gegensatz zu Freddy, die nach Berties Tod an traditionellen Rollenzuweisungen festgehalten hatte, hatte Prue die heranwachsenden Zwillinge mehr wie ihre Freunde denn wie ihre Kinder behandelt. Hal und Kit nahmen ebenso Anteil an den Freuden und Kümmernissen ihrer Mutter, wie diese Anteil an ihren nahm, und die drei bildeten eine glückliche, wenn auch unkonventionelle kleine Gruppe. Disziplin war nicht gerade eine von Prues Stärken – »Sie hat keine Ahnung, wie sie sich selbst disziplinieren soll, von Hal und Kit ganz zu schweigen«, hatte Freddy schon mehr als einmal geäußert –, und die Zwillinge nutzten ihre Gutmütigkeit oft aus. Aber sie liebten ihre unkomplizierte, ein bisschen verrückte Mutter über alles und waren immer auf ihrer Seite.
Kit drehte sich auf dem Sofa, sodass die Beine über die Rückenlehne hingen, und ließ den Kopf vorne vom Sitz baumeln. Ihre Haare reichten bis zum Boden, und sie schnitt ihrem Bruder eine Grimasse, indem sie schielte und ihm die Zunge herausstreckte. Hal seufzte erleichtert. Jetzt wusste er, dass Kits kurze Schmollphase vorbei und sie wieder ganz die alte, fröhliche Kit war. Diese merkwürdigen neuen Launen, die ihre sonst so ausgeglichene Beziehung störten, waren Hal ein Rätsel. Die Zwillinge waren sich nicht sehr ähnlich. Hal ähnelte seinem Vater und seiner Großmutter. Er war groß und blond, elegant und harmonisch. Seine Schwester sah aus wie eine kleinere, jüngere Ausgabe von Prue. Sie hatte seidiges, aschbraunes Haar und rauchblaue Augen. Ihre seltsamen Launen waren auch ihr ein Rätsel, und sie war sehr froh, Hal zu haben. An ihm konnte sie ihre Ideen und Meinungen erproben, bevor sie den Rest der Welt damit konfrontierte. Und abgesehen davon war es richtig nett, einen Bruder zu haben, der von all ihren Schulfreundinnen angehimmelt wurde. Ab dem kommenden Herbst würden sie beide ins Internat gehen – Hal ins Clifton College, Kit in die Badminton School. Sie waren beide aufgeregt, aber auch etwas ängstlich ...
»Weißt du was?« Unvermittelt schwang Kit herum und ließ sich vom Sofa gleiten. »Wir spielen Monopoly. Ich nehme den Stiefel, und du kannst das Auto haben. Pudge und Binker kriegen den Hut und das Bügeleisen.«
Schon vor langer Zeit hatten Hal und Kit sich diese beiden zusätzlichen Spielkameraden ausgedacht. Niemand, nicht einmal die Zwillinge selber, wusste so recht, wer oder was diese Figuren eigentlich waren – nicht einmal ihre Namen waren immer die gleichen, sie wurden ganz nach Lust und Laune der Zwillinge erweitert, abgeändert oder gekürzt; und obwohl Hal und Kit nun langsam herauswuchsen aus solchen kindlichen Fantasien, konnten sie doch noch nicht ganz von diesen imaginären Freunden lassen.
Hal folgte Kit durch den schmalen Flur ins Esszimmer. Kit öffnete die Anrichte und suchte das Monopolyspiel, während Hal die schweren Eichenstühle unter dem Tisch hervorzog. Er war in Gedanken noch immer bei seinen Cousins auf The Keep und bei Kits Reaktion von vorher. Er konnte sich ungefähr vorstellen, was sich in seiner Schwester abspielte, wusste aber nicht, wie er ihre Bedenken zerstreuen sollte. Ihr plötzlicher Vorschlag, ihr einstiges Lieblingsspiel zu spielen, war sicher Kits banger Versuch, Geborgenheit zu finden. In ihrem Leben in Bristol fehlte es an einer ganz bestimmten Art von Geborgenheit, aber Hal wusste, dass Kit eben diese auf The Keep fand und darum Angst hatte, sie zu verlieren.
Als sie das Spiel aufbaute, summte sie vor sich hin, und Hal entspannte sich. Ihre Laune war vorbei, und auch seine Stimmung besserte sich deutlich. Er war überzeugt, dass ihre Ängste sich in Luft auflösen würden, wenn sie in den Ferien zu Großmutter fuhren, und seufzte erleichtert. Kit lächelte ihn an – sie hatte seine Besorgnis gespürt – und fühlte sich ungleich besser.
»Wer die höchste Zahl hat, fängt an«, sagte sie. »Ich werfe für Pudgie.« Und damit streckte sie die Hand nach dem Würfel aus.
»Ich muss gehen, Liebling«, sagte Prue. Sie zog eine große, eckige Krokodilledertasche auf ihren Schoß und suchte nach Puder und Lippenstift. Der Mann ihr gegenüber beobachtete sie nachsichtig, während sie sich in dem kleinen Spiegel betrachtete, konzentriert Lippenstift nachzog, kritisch ihr Gesicht prüfte und an einer Locke zog. Sie lächelte ihn kurz an, als sie die Puderdose zuklappte, die sie sodann zusammen mit dem Lippenstift in die geräumige Handtasche fallen ließ. Er lehnte sich nach vorne und legte seine Hand auf ihre.
»Musst du wirklich?«
Die Absicht hinter dieser gehauchten Frage war eindeutig, doch Prue schüttelte den Kopf. »Ich habe dir gesagt, dass ich heute nur Zeit für einen Drink habe. Die Kinder sind allein.«
»Aber sie sind doch keine Babys mehr«, sagte er. Seine Stimme klang immer noch zärtlich, allerdings zog er jetzt seine Hand zurück und richtete sich etwas auf.
»Das weiß ich.« Prue guckte besorgt. »Sei nicht böse, Tony. Aber wir haben uns diese Woche schon so viel gesehen, und wir waren uns doch einig, dass wir die Sache langsam angehen wollten, oder etwa nicht? Schon vergessen?«
»Ich muss verrückt gewesen sein.« Er trank seinen Whisky aus und war anscheinend wieder besserer Laune. »Also, wann kann ich dich sehen?«
»Ruf mich an.« Prue stand auf, und er wusste, dass er für heute verloren hatte; dass sie jetzt nur noch an die Kinder dachte. »Es ist halb elf«, sagte sie nach einem Blick auf die winzig kleine Goldarmbanduhr und wand sich den langen Chiffonschal um den Hals. »Ich habe gesagt, spätestens zehn. Du hattest versprochen, dass du mit auf die Zeit achtest ...«
»Nun sei mal nicht so hartherzig, Liebes.« Er lachte sie an, als er sein Zigarettenetui öffnete. »Du kannst doch wohl nicht von mir verlangen, dass ich derjenige bin, der unser Rendezvous abbricht! Ich sehe dich ja ohnehin schon so selten.«
»Du hattest es versprochen«, hob sie gereizt an – doch dann fiel sie in sein Lachen ein. »Du bist unmöglich!«
»Du aber auch«, murmelte er, berührte sie am Arm und bedachte sie mit einem so verschwörerischen Blick, dass sie an ungleich intimere Momente denken musste. »Gott sei Dank!«
Prue errötete und presste die Lippen aufeinander, um ihre Freude und ihre Gefühle für ihn zu verbergen. Ihr Herz hämmerte wild, als sie sich umdrehte und ihre Jacke nahm, und sie hatte Mühe, die Fassung zu bewahren. Lächelnd zündete er sich eine Zigarette an, winkte kurz dem Barkeeper und folgte ihr zwischen den Tischen hindurch zur Tür. Das Trio auf dem Podium ganz hinten in dem verrauchten Raum fing leise an, My Funny Valentine zu spielen, eines von Prues derzeitigen Lieblingsstücken ... Sehnsuchtsvoll drehte sie sich noch einmal um.
Auf dem Gehsteig zitterte sie, zog die dünne Jacke etwas enger um die Schultern und hoffte, dass er sie küssen würde, bevor er sie nach Hause fuhr. Tony legte den Arm um sie und drückte sie seitlich an sich, während sie langsam zu seinem Wagen schlenderten. Er wollte sie heiraten – aus allen möglichen Gründen –, und ihre vorsichtige Zurückhaltung fing an, ihn zu ärgern. Er konzentrierte sich auf die wesentlichen Punkte, jene kleinen, aber ausgesprochen interessanten Informationen, die sie immer wieder lieferte, wenn sie zum Beispiel ein florierendes Familienunternehmen erwähnte, das Anwesen in Devon beschrieb oder von Dividenden sprach, die ihr dieses angenehme Leben ermöglichten ... Er zog sie fester an sich, und sie sah mit einem Blick zu ihm auf, den nur wenige Männer missverstehen würden.
Sie zitterte vor Schwäche und Begierde, als er sie küsste. Johnny war seit zwölf Jahren tot, und obwohl sie seitdem ein, zwei kleine Affären – und auch einige Flirts – gehabt hatte, war das mit Tony etwas anderes. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, mit ihrer Gunst nicht zu freigebig zu sein. Das Problem war, dass Männer davon ausgingen, eine Witwe sei in diesen Dingen erfahren und ein wenig Spaß nicht abgeneigt, und dass sie mit jungfräulichem Geziere keine Geduld hatten. Die Tatsache, dass sie Mutter von Zwillingen war, hatte Prue – die von Natur aus großzügig Liebe und Zuneigung an andere Menschen weitergab und der es schwerfiel, ihre Natur zu zügeln – schon vor so mancher Unbedachtsamkeit bewahrt. Und doch zögerte sie seltsamerweise, was die Heirat mit Tony betraf. Irgendein winziger Rest des Wunsches nach Selbsterhaltung hielt sie davon ab, sich endgültig zu binden. Oder lag es vielleicht daran, dass sie Angst vor Freddys Reaktion hatte, wenn sie ihr Tony vorstellte? Prue sah Freddys geschürzte Lippen schon vor sich, ahnte, dass sie Tony mit Johnny vergleichen und Fragen stellen würde und dass sie selbst sich ihres Verlangens nach diesem Mann schämen würde.
Sie löste sich ein wenig aus seiner Umarmung, und er gab sie widerwillig frei. Schweigend, rauchend und nachdenklich fuhren sie zu ihr, und der Kuss, den sie ihm gab, als sie vor dem zu einem bezaubernden Wohnhaus umgebauten Stallgebäude aus viktorianischer Zeit ankamen, war eher flüchtig und nichtssagend. Er lehnte sich zu ihr herüber, als sie durch das Beifahrerfenster zu ihm hereinsah.
»Ich rufe dich an«, sagte er. Er wusste, dass er jetzt keinen Einfluss mehr auf sie hatte.