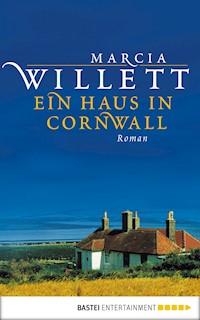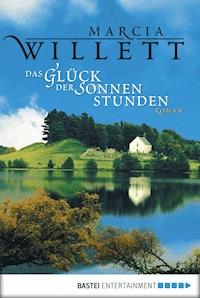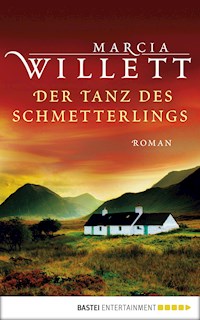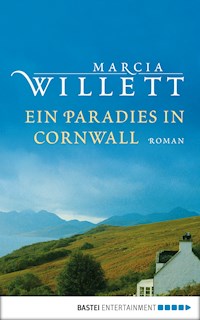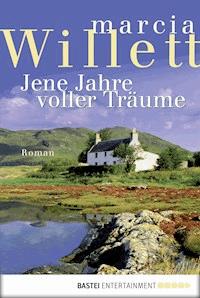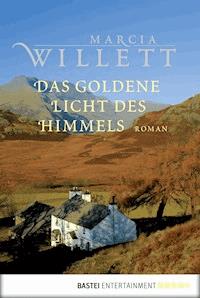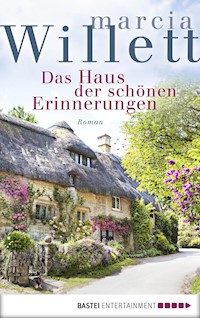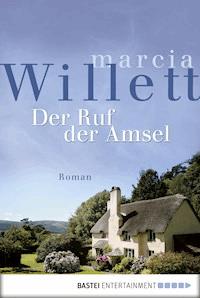
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marcia Willets Wohlfühlromane
- Sprache: Deutsch
Die ersten Primeln im Dartmoor kündigen den Frühling an - doch die Idylle ist trügerisch. Alistair hat seine Frau Phyllida so tief verletzt, dass sie mit ihrer Tochter Zuflucht im Cottage The Grange sucht. Dort bemüht sich die warmherzige Clemmie, den beiden neue Lebensfreude zu schenken - obwohl sie selbst um ihr eigenes Liebesglück kämpfen muss.
Ein einfühlsames Buch über den Schmerz enttäuschter Liebe, über Eifersucht und Verrat und zugleich eine tröstliche Geschichte über die Kraft des Vertrauens, das Glück von Freundschaft und die heilende Schönheit der Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über die Autorin
Marcia Willett, in Somerset geboren, studierte und unterrichtete klassischen Tanz, bevor sie ihr Talent für das Schreiben entdeckte und sich zu einer außergewöhnlichen Erzählerin entwickelte, die The Times als »eine authentische Stimme ihrer Zeit« feierte. Ihre Bücher erscheinen in achtzehn Ländern. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann in Devon, Südengland, dem Schauplatz vieler ihrer Romane.
Besuchen Sie Marcia Willett unter: www.marciawillett.co.uk
Marcia Willett
DER RUF DER AMSEL
Roman
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Neuausgabe der im Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Reinbek bei Hamburg, erschienenen Deutschen Erstausgabe
Titel der englischen Originalausgabe: »The Dipper«
Originalverlag: Headline Publishing,
a division of Hodder Headline, London
Copyright © 1996 by Marcia Willett
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2009/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Titelillustration: © istockphoto
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Autorenfoto: © Trevor Burrows
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-0157-1
Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Kathleen und Reg
1
Phyllida Makepeace träumte. Sie murmelte im Schlaf und tastete neben sich. Vom Gefühl des kühlen Lakens wachte sie auf, und sie kuschelte sich tiefer in ihre Decke, um die schönen Traumbilder so langsam wie möglich vor der enttäuschenden Wirklichkeit verblassen zu lassen. Sie hatte geträumt, dass Alistair sie angerufen hatte. Das U-Boot hatte einen Defekt, und sie mussten ein paar Tage an Land bleiben, hatte er ihr erzählt, und sie war herumgewirbelt, um alles für seine Ankunft vorzubereiten.
Phyllida klemmte sich die Decke fest unter das Kinn. Es war fast unmöglich, die großen, hohen Räume der viktorianischen Villa zu heizen, aber sie liebte das Haus mit seinem von Mauern geschützten Garten und der Aussicht hinüber auf Dartmoor. Sie hob den Kopf, um einen Blick auf die Uhr neben dem Bett zu werfen, und wusste, dass die vierjährige Lucy bald aufwachen würde. Trotzdem blieb sie noch einen Moment liegen. Plötzlich erinnerte sie sich an das neue Leben in ihr; ein wohliger warmer Schauder ergriff sie, und sie schlug die Decke zurück und stand auf. In einem von Alistairs alten Hemden und einem Paar dicker, warmer Socken sah sie reichlich merkwürdig aus. Aber mit ihren sechsundzwanzig Jahren war sie immer noch jung genug, seine Kleider auf ihrer Haut als Trost für seine Abwesenheit zu empfinden, und sie zog das Hemd fest um sich, als sie über den Treppenabsatz eilte.
Während sie im ungeheizten Badezimmer vor Kälte zitterte, fiel ihr ein, dass heute Valentinstag war, und sie fragte sich, ob Alistair wohl an sie gedacht hatte. Er war sehr aufmerksam, was besondere Anlässe wie Geburts- und Jahrestage anging, und unternahm große Anstrengungen, damit Karten und Geschenke pünktlich zu Hause eintrafen, wenn er auf See war. Sie liebte ihn so sehr, doch obwohl er ihre Liebe ganz offensichtlich erwiderte, war es ihr immer noch ein Rätsel, warum er ausgerechnet sie und nicht eine seiner vielen anderen Freundinnen zu seiner Frau gemacht hatte.
Ihr großer Bruder Matthew hatte Alistair einmal für ein Wochenende mit nach Hause gebracht, als Phyllida gerade die Ausbildung zur Erzieherin in Norland abgeschlossen hatte und ihre neunmonatige Probezeit absolvierte. Sie hatte sich auf der Stelle in ihn verliebt, seinen Heiratsantrag drei Monate später angenommen und sofort alle eigenen Berufspläne aufgegeben. Mit ihrer fröhlichen, offenen Art stürzte sie sich begeistert in das Marineleben und fand schnell Anschluss. Alistair war damals neunundzwanzig und gerade im Begriff, das Kommando auf einem U-Boot zu übernehmen, und die Frauen seiner Offizierskollegen waren einige Jahre älter als Phyllida. Sie mochten ihr freundliches, zurückhaltendes Wesen, fühlten sich geschmeichelt von ihrem Respekt angesichts der Erfahrung und Klugheit der älteren Frauen und nicht im Geringsten bedroht von Phyllidas Aussehen. Obwohl sie sechs bis sieben Jahre jünger war als sie, erregte ihr Äußeres durchaus keinen Neid. Phyllidas Schönheit war nicht offensichtlich. Ihre Attraktivität war von schlichter, unaufdringlicher Art, nicht so augenfällig, dass sich jemand nach ihr umdrehen würde. Ihr Gesicht war von gleichmäßiger ovaler Form, ihre Augen groß und grau, ihr Lächeln warm. Die Offiziersmesse nahm sie unter ihre Fittiche und hielt große Stücke auf sie, und die Tatsache, dass sie die Frau des Kapitäns war, verdarb sie nicht im Geringsten.
Dass Alistair sie und seine Familie vergötterte, war unschwer zu erkennen, und seine Freunde hatten erleichtert aufgeatmet, als er endlich bereit gewesen war, sesshaft zu werden. Die meisten waren der Ansicht, dass er schon viel zu lange den Herzensbrecher gespielt hatte, aber die etwas Zynischeren – und Abgewiesenen – musterten Phyllida und fragten sich, wie lange es wohl dauern würde, bis Alistair wieder ein Auge auf andere Frauen werfen würde. Was findet er bloß an ihr?, fragten sie sich. Er hatte so viele schillernde, schöne Frauen erobert, und obwohl Phyllida süß war, besaß sie doch kaum die gleiche Klasse und Schönheit wie seine sonstigen Freundinnen. Augenbrauen und Schultern wurden ratlos hochgezogen. Die etwas Gütigeren – und die, die von Phyllidas besonderem Charme bezaubert worden waren – betonten, dass ein atemberaubendes Äußeres nicht alles sei. Alistair, etwas stämmig und nicht größer als der Durchschnitt, entsprach auch nicht dem üblichen Schönheitsideal; jedoch lag etwas in seinem Blick und seinem Lächeln, was bewirkte, dass die meisten Frauen in seiner Gegenwart den Bauch einzogen und sich ärgerten, dass ihre Haare nicht frisch gewaschen waren.
Achtzehn Monate nach der Hochzeit hatte Phyllida eine Tochter zur Welt gebracht, die wie ihre Mutter mit braunen Haaren, grauen Augen und einer heiteren Art gesegnet war. Als Phyllida an diesem Valentinstag in ihr Schlafzimmer zurückkehrte und sich fragte, ob sie wohl eine Karte von Alistair bekommen würde, hörte sie, wie Lucy vor sich hin sang. Phyllida blieb wie immer am Fenster stehen. Die hohen Granitfelsen in Dartmoor waren in Sonne getaucht, obwohl der sie umgebende Boden noch im Schatten lag. Trotz des klaren hellblauen Himmels wusste sie, dass der Winter das Land noch immer fest im Griff hatte. Gerade trommelte ein Hagelschauer gegen das Fenster. Sie fröstelte und eilte ins Schlafzimmer, um sich wärmer anzuziehen.
Phyllida trug Kordhosen und einen von Alistairs Norwegerpullovern, als sie Lucy ihre wärmsten, ältesten Kleider anzog – genau das Richtige für ihren Spielgruppentag. Sie gingen gemeinsam hinunter, und während Phyllida das Frühstück machte, kam die Post, die sie sofort durchsah. Ja, Alistair hatte daran gedacht. Ein breites Grinsen überzog ihr Gesicht, als sie den Umschlag öffnete und die Karte hinauszog, noch während sie im Flur stand. Sie betrachtete den hiesigen Poststempel und fragte sich, wer von ihren Freunden die Karte wohl für ihn abgeschickt hatte. Obwohl sie ausreichend Gelegenheit hatte, sich an seine langen Abwesenheiten zu gewöhnen, vermisste sie ihn immer wieder furchtbar, aber die Karte war ein angenehmer Trost.
Sie zehrte immer noch von diesem Gefühl, nachdem sie Lucy im Dorfgemeinschaftshaus abgeliefert hatte und auf dem Weg zu einer Tasse Kaffee bei Prudence Appleby, einer Marineoffizierswitwe, war. Obwohl Prudence fast fünfzehn Jahre älter war als Phyllida, hatten sie sich auf Anhieb gut leiden können, als sie sich vor etwa vier Jahren, kurz nach Stephens Unfalltod, kennengelernt hatten. Prudence wohnte in einem viktorianischen Haus in dem Moordorf Clearbrook, und Phyllida genoss die Treffen mit ihr in ihrer schmuddeligen Küche. Heute Morgen stand allerdings Liz Whelans Auto vor dem Haus, und Phyllidas Mut sank ein wenig. Liz war zwar genauso alt wie die gütige Prudence, ansonsten aber ein ganz anderer Charakter. Sie war eine kleine Frau mit braunem Haar, die etwas Sardonisches, Verbittertes an sich hatte, das in Phyllida stets ein Gefühl des Unwohlseins weckte.
Sie parkte und ging um das Haus zur Hintertür. Sie trommelte ihr Klopfzeichen an die Tür, machte sie auf und steckte den Kopf hinein.
»Hi! Ich bin’s.«
Die Tür führte direkt in die Küche, wo Prudence schnell aufstand, um sie zu begrüßen, während Liz am Tisch sitzen blieb, lediglich leicht die Augenbrauen hob und auf Phyllidas Lächeln mit einem angedeuteten Nicken antwortete.
»Phyllida!« Prudence gab ihr ein Küsschen. »Komm rein und wärm dich auf. Was für ein Wetter! Ich habe gehört, es soll schneien.« Sie nahm Phyllida den Mantel ab und machte sich daran, noch mehr Kaffee zu kochen, wobei sie von einem Thema zum nächsten stürzte. Prudence redete immer wie ein Wasserfall, kam vom Hundertsten ins Tausendste, was je nach eigener Laune entweder lustig oder ärgerlich sein konnte. »Na los, erzähl schon! Wie geht es Lucy? Meine Güte!« Sie schüttelte den Kopf. »Das Kind wächst vielleicht!«
»Es geht ihr gut.« Phyllida nippte dankbar an dem heißen Kaffee. »Und das Kleidchen ist so reizend. Sie liebt es. Wollte es heute Morgen zur Spielgruppe anziehen.«
Prudence hatte Schneiderin gelernt. Sie arbeitete hart, um ihre Witwenrente aufzubessern, und hatte eine Menge Kunden. Ihre Tochter arbeitete in einer Werbeagentur in London, ihr Sohn studierte Medizin. Nach Begleichung aller Rechnungen wanderte jeder Penny, den sie übrig hatte, zu ihren Kindern, während sie selbst an allen Ecken und Enden knauserte und sparte. Sie war dünn, weil sie so hart arbeitete, nicht genug aß und sich zu viele Sorgen machte. Ihre warmen, dunklen, haselnussbraunen Augen spähten ängstlich durch die Hornbrille.
»Sie sah bezaubernd darin aus«, stimmte sie zu und lächelte beim Gedanken an das kleine Mädchen in dem Kleid. »Und ich kann dir die freudige Mitteilung machen, dass ich mehrere Bestellungen bekommen habe nach der Party, auf der sie es anhatte. Danke, Phyllida.«
»Ich kann überhaupt nichts dafür. Das Kleid hat sich selbst verkauft. Alle Mütter wollten so eins für ihre Tochter. Du bist ganz schön clever, Prudence.«
»Ich habe eine Menge Aufträge zurzeit.« Prudence wirkte sehr zufrieden. »Wenn es so weitergeht, brauche ich bald jemanden für die Buchhaltung. Wie wär’s, Liz?«
»Musst nur Bescheid sagen«, antwortete Liz. »Du kriegst natürlich Sonderkonditionen.« Sie sah zu Phyllida. »Und wie geht es Alistair?«
Phyllida spürte Prudences vorsichtigen Blick und runzelte ein wenig die Stirn, als sie antwortete.
»Gut, soweit ich weiß. Er ist auf See. Aber ich habe heute Morgen eine Valentinskarte gekriegt.« Unwillkürlich schlich sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. »Hat er dich gebeten, sie abzuschicken, Prudence?«
»Ja«, gab Prudence zu. »Er ist so aufmerksam«, fügte sie etwas trotzig hinzu, als sie Liz’ amüsierter Verachtung gewahr wurde.
Liz schnaubte, worauf Phyllida wieder einmal verlegen wurde und sich unwohl fühlte. Liz implizierte immer, dass Alistairs Aufmerksamkeit entweder geheuchelt war, um eventuell zu vermutendes schlechtes Benehmen zu vertuschen, oder etwas Krankhaftes, Verachtenswertes. Und ganz gleich, wie beharrlich Phyllida und Prudence versuchten, sie von diesem Thema abzulenken – Liz schaffte es stets, seinen Namen in das Gespräch einfließen zu lassen. »Valentinskarten!«, spöttelte sie jetzt, als wenn dieser alte Brauch schlecht und lächerlich wäre, aber noch bevor die anderen beiden Alistair oder seine Valentinskarte verteidigen konnten, hatte Liz auch schon ihren Kaffee ausgetrunken und war aufgestanden.
»Ich muss los«, verkündete sie. »Ich bin zum Mittagessen verabredet. Bis bald, Prudence! Danke für den Kaffee. Wiedersehen, Phyllida.«
Kaum hatte sich die Küchentür hinter ihr geschlossen, warf Prudence einen besorgten Blick auf Phyllida.
»Warum tut sie das?«, fragte Phyllida verärgert. »Sie bringt es jedes Mal fertig, anzudeuten, dass ich Alistair nicht so blind vertrauen sollte und dass er etwas vor mir verbirgt.«
»Ach, Phyllida!« Prudence sah gequält aus. »Du weißt doch, Liz ist ziemlich verbittert, und es wäre gar nicht klug, auf sie zu hören. Die Ehe mit Tony war kein Zuckerschlecken, und die Scheidung hat ihr sehr wehgetan. Sie hat ihn wirklich geliebt, weißt du. Na ja, du kannst es dir ja vorstellen …«
»Das weiß ich ja alles«, sagte Phyllida, die sich von dieser Erklärung nicht besänftigen ließ. »Aber ich verstehe nicht, warum sie andere Leute verunsichern muss. Ich kenne Alistairs Ruf. Wie denn auch nicht! Das musste mir ja jeder immer wieder erzählen.«
»Das Problem ist, dass Liz Tony immer noch liebt.« Prudence versuchte wieder einmal zu trösten, ohne ungerecht zu werden. »Er hat sie nur wegen des Kindes geheiratet, und treu ist er ihr nie gewesen.«
»Ich weiß.« Phyllida lächelte sie an. »Aber sie bringt mich halt immer wieder aus dem Gleichgewicht. Vergessen wir das! Ich hab was zu erzählen.« Prudence schaute sie erwartungsvoll an, sie schien es schon zu ahnen, und Phyllida grinste. »Du kannst es dir schon denken, oder?«
»Ich glaube schon«, sagte sie vorsichtig.
»Ich bin schwanger! Ist das nicht wunderbar? Termin ist Anfang September. Dann ist Lucy gerade fünf.«
»Herzlichen Glückwunsch!« Prudence kam um den Tisch und nahm sie in den Arm. »Weiß Alistair es schon?«
»Nein, noch nicht. Ich wollte erst ganz sicher sein. Er war so viel unterwegs in letzter Zeit, dass ich schon dachte, wir würden gar kein Zweites mehr zustande kriegen. Er wird sich wahnsinnig freuen. Ich warte aber noch, bis er nach Hause kommt, das dauert ja nur noch drei Wochen. Ich will sein Gesicht sehen, wenn ich es ihm sage.«
»Natürlich. Wie aufregend! Hast du es Lucy schon erzählt?«
Phyllida schüttelte den Kopf. »Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstellen soll, aber ich will auf jeden Fall bis nach dem Wochenende warten. Mein Bruder Matthew besucht uns mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, und ich will nicht, dass es irgendjemand vor Alistair erfährt. Lucy würde sich bestimmt verplappern, und dann müsste ich überall Erklärungen abgeben.«
»Das kann ich gut verstehen. Ich werde schweigen wie ein Grab.«
»Ich musste es nur irgendjemandem erzählen, aber bitte behalt es für dich. Erzähl es vor allem nicht Liz!«
»Wieso sollte ich? Ich werde keinen Ton sagen. Du darfst dich wirklich nicht so aus der Ruhe bringen lassen von ihr. Wahrscheinlich ist es nur der altbekannte Neid. Tony hat sich nie gewandelt so wie Alistair.«
»Gewandelt!« Phyllida lachte. »Danke, Prudence! Das hört sich an, als wäre er ein zweiter Blaubart! Jetzt werde ich wirklich langsam nervös!«
»Ach, nein«, setzte Prudence an, der ihre eigene Taktlosigkeit peinlich war, »so habe ich das doch nicht gemeint …«
Phyllida schob den Stuhl zurück und stand auf. »Ich zieh dich doch bloß auf«, sagte sie. »Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich muss unbedingt noch einkaufen, bevor ich Lucy abhole.«
Als sie zurück nach Yelverton fuhr, verspürte Phyllida aber doch einen Anflug von der Beklemmung, die ihr schon früher zu schaffen gemacht hatte, wenn sie Alistairs ehemaligen Freundinnen vorgestellt worden war. Ein paar von ihnen waren sehr freundlich gewesen, aber die meisten eher aufgebracht. Sie hatten großen Wert darauf gelegt, auf ihre Beziehungen zu Alistair hinzuweisen – sie erinnerten ihn an gemeinsame Witze, näherten sich ihm auf sehr vertraute Weise, ignorierten Phyllida –, und ihr Selbstvertrauen war auf eine harte Probe gestellt worden. Immer wieder hatte sie sich gefragt, warum er sich für sie entschieden hatte, wenn er doch eine andere, viel schönere, viel gelassenere, viel erfahrenere Frau hätte haben können. Alistairs Verhalten war tadellos gewesen. Er hatte jenen besonders entschlossenen Exemplaren klargemacht, dass er mit der Vergangenheit abgeschlossen habe und dass seine Liebe und Treue jetzt ganz Phyllida gehören würden. Er hatte sein Bestes getan, um hart, aber nicht zu verletzend zu sein, und nach und nach war die Situation akzeptiert worden, und Phyllida hatte sich entspannen können. Jetzt, sechs Jahre später, fühlte sie sich stark in seiner Liebe, sodass solche Befürchtungen sie nur noch selten überfielen – aber heute Morgen verwandelte sich der Anflug von Beklemmung in handfeste Angst. Liz’ Zynismus hatte ihre sichere Überzeugung untergraben; Phyllida ließ die Frage, ob Alistair ihr wohl jemals untreu war, tatsächlich zu. Wenn man seinen Ruf bedachte, hatte sie ihm vielleicht zu blauäugig vertraut, hatte ihm viel zu bereitwillig geglaubt, dass er mit der Vergangenheit so mir nichts, dir nichts abgeschlossen hatte. Gelegenheiten boten sich ihm jedenfalls genug. Ihr Herz fing wild an zu klopfen, als sie sich ausmalte, wo er überall in Versuchung geführt werden konnte, und sie umklammerte krampfhaft das Steuer und wehrte die Bilder ab, die sich in ihren Kopf schlichen.
Als ihr wieder einfiel, welch zerstörerische Kraft solche Ängste entfalten können, nahm sie sich fest vor, sich ihr Vertrauen nicht untergraben zu lassen, und zwang sich, an das ungeborene Baby zu denken. Ihre Laune besserte sich ein wenig, und ihr Selbstvertrauen kehrte zumindest teilweise zurück.
Blöde Liz!, dachte sie, als sie das Auto parkte und durch einen plötzlichen Hagelschauer zu den Läden eilte. Sie schnappte sich einen Wagen, kramte ihren Einkaufszettel hervor, schob den Gedanken an Liz und ihre Andeutungen entschlossen beiseite und konzentrierte sich darauf, was sie für das kommende Wochenende benötigte.
2
Quentin Halliwell machte sich gerade Frühstück, als er den Sonnenstrahl auf Clemmies Schlüsselblume bemerkte, die in einem Topf auf der breiten Fensterbank überwinterte. Es war der erste Sonnenstrahl in diesem Jahr, der es in die Küche geschafft hatte, und Quentins Herz hüpfte förmlich vor Freude, als er ihn in stiller Dankbarkeit betrachtete. Seine Seele verneigte sich tief, da es ihm vergönnt war, seinen achtzigsten Frühling zu erleben; und er sog diesen Augenblick wie ein Schwamm in sich auf, um Clemmie eingehend davon berichten zu können, wenn sie aufwachte. Steife Gelenke und ein Ziehen hier und dort führten dazu, dass Quentin selten eine schmerzfreie Nacht verbrachte und bereitwillig früh aufstand, um Clemmie noch etwas friedlichen Schlaf zu ermöglichen, ungestört von seiner Ruhelosigkeit. Jedes Mal, wenn er sie mit seiner Herumwälzerei weckte, hatte er ein schlechtes Gewissen, während sie wiederum oft wach lag und kaum zu atmen wagte, bis er endlich eingeschlafen war und sie sofort zur Toilette gehen musste. Sie lachten gemeinsam darüber und hatten auch schon die Vorteile erörtert, die getrennte Betten boten – ein jeder voller Sorge, dass der andere dies für eine vernünftige Lösung halten würde –, und waren beide unendlich erleichtert gewesen, als keiner von ihnen bereit gewesen war, diese Maßnahme ernsthaft in Betracht zu ziehen.
»Wir schlafen seit fünfundfünfzig Jahren in einem Bett«, hatte Clemmie gesagt und seine Hand einen Moment ganz fest gedrückt. »Ich wüsste nicht, warum wir diese Gewohnheit jetzt ändern sollten.«
Als er seinen Porridge aß und den Sonnenstrahl auf seiner Wanderung durch die Küche beobachtete, erinnerte Quentin sich an seine Erleichterung. Es war unvorstellbar, ohne die zu einer Kugel zusammengerollte Clemmie an seinem Rücken einzuschlafen. Während sein Toast auf der Kochplatte des Holzofens röstete, öffnete er die Hintertür und sah in den Hof. Das alte Granithaus formte ein L, das zwei der Mauern des Hofes stellte. Die dritte, südliche Mauer war ein Steinschuppen, den Quentin in eine lange Gartenlaube verwandelt hatte, und in der Mitte der vierten befand sich ein Tor zum Garten. Die Sonne stand noch zu tief, um in den Hof zu fallen, doch würde es nicht mehr lange dauern, bis Clemmie wieder in der Laube sitzen, die Sonne genießen und das Rotkehlchen beobachten konnte, das sie mit ein paar Brotkrumen fütterte.
Quentin aß seinen Toast und dachte über ein paar Sätze nach, mit denen er diesen denkwürdigen Morgen angemessen in seinem Tagebuch festhalten könnte, als ihm auffiel, dass Valentinstag war. Ihm kam ein wunderbarer Gedanke, und nachdem er seinen Toast aufgegessen und die Krümel zwischen dem Rotkehlchen und Punch, dem schwarzen Retriever, aufgeteilt hatte, nahm er seinen Mantel vom Haken und ging in den Garten. Außerhalb des geschützten Hofes wehte ein frischer, schneidender Wind über das Moor. Quentin blieb einen Augenblick stehen, um seinen Mantel richtig zuzubinden, zog seine Tweedmütze aus der Tasche und stapfte mit Punch an der Seite über die Wiese. Eine Reihe stark geneigter, verkrüppelter Bäume tat ihr Bestes, um das Grundstück vor den meist von Südwest kommenden Stürmen zu schützen, und im Norden erhoben sich steil die Tore, Dartmoors bizarre Felsformationen, doch Quentin, der eine geschütztere Umgebung vorzog, kletterte über die Trockenmauer am Ende der Wiese und marschierte flott hinunter in den Wald.
Als er den Schutz der Bäume erreicht hatte, verlangsamte er das Tempo, bis er auf dem Pfad am Ufer des Flusses gelandet war. Das tote Laub der Buchen breitete sich wie ein dicker Teppich unter seinen Füßen aus, als er zwischen den glatten Stämmen umherwanderte, bis er die Primeln wiederfand, die er bei einem früheren Spaziergang entdeckt hatte. Seine Gelenke knackten, als er in die Knie ging, um ganz vorsichtig die blassen Blüten zu pflücken und sie zärtlich in ein Taschentuch zu legen. Er setzte seinen Marsch hinter dem Wall aus Rhododendren und Lorbeerbäumen fort, der die Sicht auf den Fluss versperrte, sodass Quentin ihn durch die Zweige nur als einen hellen, im Sonnenlicht glitzernden Streifen wahrnahm. Ein Stückchen weiter, wo der Pfad etwas lichter wurde und Kieselstrand einen Teil des Ufers bildete, fand er Veilchen, von denen er einige seinem kleinen Strauß hinzufügte. Ein paar Zweige früher Weidenkätzchen vervollständigten seine Gabe zum Valentinstag. Jetzt, da seine Mission erfüllt war, nahm er sich die Zeit, die Natur um sich herum zu beobachten, das turbulente, nach wochenlangem Regen torfbraune Wasser. Zu seiner Freude erhaschte er einen Blick auf die Wasseramsel. Sie hüpfte auf einem glatten, großen Stein unter der grauen Steinbrücke umher, die ihren Namen dem neben ihr wachsenden Schwarzdorn verdankte. Entzückt beobachtete Quentin die regelmäßigen Bewegungen des Vogels. Sein runder brauner Rücken und seine schneeweiße Brust boten ihm an den graubraunen Fluten mit den weißen Schaumkronen die optimale Tarnung. Auf einmal stürzte der Vogel sich in den Fluss und verschwand vollständig, während Quentin vergeblich versuchte, ihn auszumachen. Wenige Augenblicke später saß der Vogel wieder auf dem Stein, putzte sich eine Weile das Gefieder und flog dann zielstrebig nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche flussaufwärts davon.
Seit Jahren schon war die Wasseramsel ein Symbol der Hoffnung und des Glücks für Quentin und Clemmie, und jedes Mal, wenn Quentin so einen Vogel sah, durchströmte ihn ein Hochgefühl und er schickte ein Stoßgebet der Freude und Dankbarkeit gen Himmel. Beschwingt machte er sich auf den Heimweg.
Clemmie sah ihn vom Schlafzimmerfenster aus über das Moor oberhalb des Waldes kommen, seine Beute wie einen Schatz in der Hand, Punch keuchend hinter ihm. Auf diese Entfernung, mit der Mütze auf dem Kopf, die sein weißes Haar verbarg, hätte er auch der junge Quentin sein können, der von einer seiner zahllosen Wanderungen der letzten Jahrzehnte durch diese geliebte Landschaft zurückkehrte. Sie waren vor zwanzig Jahren in dieses Haus gezogen, nach dem Tod von Clemmies Mutter, die es ihnen hinterlassen hatte, zu einem Zeitpunkt, da Quentin seine Richterlaufbahn – die ihr Sohn Gerard ebenfalls eingeschlagen hatte – gern beenden wollte.
Wie schnell diese zwanzig Jahre verflogen sind, und wie glücklich sie waren! Sie hatten früher so häufig ihre Ferien auf The Grange verbracht, dass der Einzug einer Heimkehr geglichen hatte und sie sich problemlos einleben konnten. Clemmie war es so vorgekommen, als wäre sie kaum fort gewesen, und die Erinnerung an die Jahre in London verblasste immer mehr, bis es ihr schien, als hätten sie ihr ganzes Leben hier verbracht. Selbst Quentins Mutter war nach dem Tod ihres Mannes regelmäßig mit von der Partie gewesen, wenn Clemmie und Quentin zweimal im Jahr – zu Weihnachten und im Sommer – die Ferien auf The Grange verbrachten; und ihr Sohn Gerard hatte oft seine Frau und seine Kinder mitgebracht. The Grange war ein richtiges Zuhause gewesen, doch seit die Enkelkinder das Nest verlassen und sich überall auf der Welt niedergelassen hatten und seit der verwitwete Gerard eine Frau geheiratet hatte, deren Wurzeln im Norden lagen, wurden die Besuche immer seltener und viele der Zimmer nicht mehr genutzt.
Clemmie fröstelte, als unvermittelt Hagelkörner gegen das Fenster prasselten. Sie sah Quentins große, breite Gestalt über die Wiese eilen und aus ihrem Blick verschwinden. Sie ging zurück zum Bett, kletterte hinein und zog sich die Decke bis zu den Ohren. Gott sei Dank hatten sie den Winter überlebt! Sie fürchteten beide den Tag, an dem sie ernsthaft darüber nachdenken sollten, The Grange zu verlassen. Freunde und Familie schüttelten schon seit geraumer Zeit verständnislos den Kopf und versuchten ihnen klarzumachen, dass es viel vernünftiger wäre, in der Stadt zu wohnen. Sie redeten von den Vorteilen, die es böte, die Läden, die Bücherei und den Arzt zu Fuß erreichen zu können, und schienen überhaupt nicht zu verstehen, dass nichts davon für Clemmie und Quentin die großartige Aussicht und die Spaziergänge, die sie direkt von ihrer Haustür aus unternahmen, ersetzen konnte. Doch Clemmie machte sich Sorgen. Obwohl Quentin sich körperlich ertüchtigte, litt er sehr unter seiner Arthritis, und auch sie, die nur wenige Jahre jünger war, wurde langsam erschreckend unbeweglich.
»Kein Wunder bei all dem Regen da oben im Moor und dem kalten, zugigen alten Haus!«, schimpften dieselben Freunde, die empfahlen, in die Stadt zu ziehen.
Aber wir lieben es, dachte Clemmie, als sie mit Mühe die Knie anzog und unverwandt auf das sich bis zum Fluss erstreckende bewaldete Tal und die hohen Hänge des Moors dahinter blickte. Warum können die Leute das nicht verstehen? In der Stadt würden wir eingehen.
Doch je älter die Menschen werden, desto mehr konzentrieren sich die Sorgen der anderen auf deren körperliches Wohl-ergehen, und die geistigen Bedürfnisse rücken an zweite Stelle. Selbst die engsten, besten Freunde glaubten offenbar, dass die Bequemlichkeit alles sei, was zähle. Junge Menschen akzeptierten noch eher, dass die innere Ausgeglichenheit ausgesprochen wichtig war, wahrscheinlich weil sie mit schmerzenden Gelenken und schlaflosen Nächten noch keine Erfahrungen hatten. Clemmie dachte an Quentins Patensohn Oliver Wivenhoe. Olivers Großvater, General Oliver Mackworth, war ein guter, geliebter Freund gewesen; sein Tod hatte die Halliwells erschüttert. Zwischen Quentin und dem jungen Oliver – der seinem Großvater sehr ähnlich sah und der sowohl dessen scharfen Verstand als auch dessen fürsorgliche Art geerbt hatte – hatte sich eine tiefe Beziehung entwickelt. Oliver war einer der wenigen, der verstand, was The Grange für sie bedeutete, und obwohl er in London bei einem alten Freund wohnte, während er auf Arbeitssuche war, nahm er sich immer die Zeit, Quentin und Clemmie zu besuchen, wenn er sich bei seiner Familie auf der anderen Seite des Moors aufhielt. Clemmie schüttelte ein wenig den Kopf, als sie darüber nachdachte, wie merkwürdig – und traurig – es war, dass Quentin mit Oliver mehr gemeinsam hatte als mit seinem eigenen Sohn.
Sie hing noch immer diesen Gedanken nach, als die Tür aufging und Quentin mit ihrem Morgentee hereinkam. Er lächelte, als er von ihrer kleinen, unter die Decke gekuschelten Gestalt nur die strahlenden braunen Augen und den wie ein Heiligenschein wirkenden, weil zu Berge stehenden, spärlichen Schopf sah. Er stellte das Tablett neben ihr auf dem Bett ab, und der Anblick des kleinen Straußes in der Miniaturvase entlockte ihr einen Ausruf des Entzückens.
»Die ersten Primeln«, sagte Quentin stolz und beugte sich hinunter, um sie zu küssen. »Alles Gute zum Valentinstag!«
»Ach!« Clemmie wirkte betrübt, als sie an den Veilchen schnupperte. »Das habe ich ja ganz vergessen. Tut mir leid, Liebling.«
»Hatte ich ja auch«, gab Quentin zu. »Aber als heute Morgen zum ersten Mal in diesem Jahr die Sonne in die Küche schien, habe ich über das Datum nachgedacht. Es wird Frühling, Clemmie!«
»Wie schön!« Sie strahlten einander an, beide mit dem triumphierenden Gefühl, den Winter überlebt zu haben. »Ach, Quentin! Wenn die Sonne schon in die Küche scheint, dann kommt sie auch bald in den Hof, und wir können dort am Vormittag Kaffee trinken.« Fröhlich schenkte sie Tee ein. »Es war bestimmt herrlich im Wald.«
»Ich habe die Wasseramsel gesehen.« Er warf ihr einen stolzen Blick zu, bevor er einen Korbsessel ans Bett zog und die Tasse annahm, die sie ihm entgegenhielt. Seine zweite Tasse Tee trank er immer zusammen mit ihr. »Sie war auf dem Stein unter der Brücke. Der Fluss führt viel Wasser.«
»Kein Wunder. Ich dachte schon, es würde nie mehr aufhören zu regnen.« Clemmie nippte an ihrem Tee. »Ich bin froh, dass du die Wasseramsel gesehen hast. Es ist schon Wochen her, seit wir sie das letzte Mal gesichtet haben.« Vorsichtig berührte sie die Veilchen und lächelte ihn an. Sie tauschten einen Blick, der keine Worte brauchte. »Was steht heute auf dem Programm?«
»Wenn es trocken bleibt, gibt es ein paar Dinge, die ich draußen erledigen will; außerdem dachte ich, wir könnten die Bücher in Tavistock abgeben und unsere Einkäufe erledigen. Besser, wenn die Speisekammer voll ist. Wenn wir noch mal Schnee kriegen, dann in den nächsten Wochen.«
Früher war die Vorstellung, einzuschneien, aufregend gewesen und der Winter eine Jahreszeit, die man hinnahm oder auf die man sich sogar freuen konnte und der man eigene Waffen entgegensetzte. Nahrungsmittel- und Holzvorräte waren ausreichend vorhanden, in jedem der von ihnen benutzten Zimmer stand eine Petroleumlampe, und im ganzen Haus waren Kerzen und Streichholzschachteln verteilt. Vor drei Jahren waren sie einmal mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, und als sie wieder hinauskamen, hatten sie erfahren, dass ein Sträfling aus dem Gefängnis in Princetown ausgebrochen war. In diesem Winter jedoch hatten sie bisher kein katastrophales Wetter gehabt, nur die üblichen Stürme. Dennoch hatte Quentin recht. Man musste sich auf alles gefasst machen.
»Ich schreibe einen Einkaufszettel, während ich frühstücke«, unterstützte Clemmie seinen Vorschlag. »Und du könntest nachsehen, ob noch genug Petroleum da ist.«
In trauter Zweisamkeit tranken sie den Tee aus, dann nahm Quentin das Tablett zur Hand. Clemmie schlug die Decke zurück.
»Zieh dich warm an!«, riet er ihr, in der Tür stehend. »Die Sonne scheint zwar, aber es ist bitterkalt draußen.«
Clemmie legte ihre Winteruniform an: Wollstrümpfe, einen dicken Tweedrock und einen Wollpullover. Sie ging nach unten in die Küche. Quentin war schon draußen, sie konnte ihn vom Küchenfenster aus am Ende des Gartens sehen. Wieder machte sich Besorgnis in ihr breit, und sie wünschte, sie könnten sich jemanden leisten, der ihnen ab und zu im Garten half. Sehr viel gab es da zwar nicht zu tun, denn in diesem rauen Klima gedieh ohnehin nur das widerstandsfähigste Gestrüpp, aber trotzdem … Clemmie seufzte und wandte sich vom Fenster ab. Sie sollte sich besser auf ihr Frühstück konzentrieren und den Einkaufszettel schreiben, statt sich ständig zu sorgen. Quentin zog den vermoderten Ast, der im letzten Sturm heruntergekommen war, von der Trockenmauer und begutachtete den Schaden, den er angerichtet hatte. Es war nicht zu schlimm, er würde schon damit fertig werden, aber es war sehr wichtig, die Grenzmauern immer ordentlich auszubessern, weil sonst die Schafe und Ponys vom Moor her in ihren Garten eindrangen, das Gras niedertrampelten und die wenigen Sträucher kahl fraßen, die Clemmie hier mit Mühe kultiviert hatte. Während er unter Stöhnen und mit zahlreichen Verschnaufpausen die Steine aufhob und an ihren Platz zurücklegte, fragte er sich, wo die Zeit geblieben war. Er konnte sich noch genau erinnern, wie er sich gefühlt hatte, als sie hierher gezogen waren damals, mit sechzig: stark und fit und voller Energie. Die vor ihm liegende Zeit war ihm unendlich lang vorgekommen, und er hatte gedacht, er werde ewig leben. Er dachte an seine verstorbenen Freunde: William Hope-Latymer, Oliver Mackworth, James und Louisa Morley. Sie alle waren nicht mehr, und ihre Kinder waren längst erwachsen und hatten ihrerseits Kinder. Der junge William verwaltete den Besitz der Hope-Latymers, und Henry Morley hatte auf Nethercombe die Zügel in der Hand, während Olivers Enkel Oliver Wivenhoe immer noch viele schöne Stunden mit Quentin verbrachte, in denen sie die Wälder und das Moor erkundeten. Er wünschte, Gerard würde Interesse zeigen, die Familientradition auf The Grange fortzuführen, aber er mutmaßte, dass sein Sohn das Haus als eine Belastung empfinden und so schnell wie möglich verkaufen würde. Natürlich war The Grange kein Anwesen, von dem man leben konnte, doch selbst wenn es so wäre – Quentin konnte sich nicht vorstellen, dass Gerard so einfach die Verantwortung für Land und Pächter übernehmen würde, wie William und Henry es getan hatten. Er wusste, dass Gerard eine Stadtpflanze war, die auf dem Lande nicht gedeihen würde. Trotzdem wäre Quentin glücklicher gewesen, wenn er daran hätte glauben können, dass Gerard The Grange behalten würde – zum Beispiel als Ferienhaus –, bis seine Kinder es übernehmen könnten. Der Tag, an dem das Haus in die Hände von Fremden fiel, würde ein trauriger Tag.
Quentin schüttelte den Kopf und hievte den letzten Stein an seinen Platz. Der Gedanke war unerträglich. Er streckte den Rücken und sah ins Tal hinunter. Er dachte an all die Jahreszeiten, die er erlebt hatte: kahle Zweige, die langsam grün wurden, sich nach einer Weile unter schwerem, glänzendem Laub neigten, das sich schon bald braun, orangegelb und rot färbte und schließlich abfiel und davonwirbelte, bis die Zweige wieder kahl waren. Wie schrecklich wäre es, wenn man seinen Tod voraussehen könnte und wüsste: Dies ist mein letzter Frühling oder Herbst.
Quentin dachte an seine Freude über den Sonnenstrahl in der Küche und die Primeln. Er wusste genau, wo im Verlauf der Jahreszeiten Blumen zu finden waren, wo die ersten Anemonen am Fluss blühten, wo die Glockenblumen unter den Bäumen einen Teppich bildeten und wo der erste strenge Duft des wilden Knoblauchs in der Luft hing. Er dachte an ein paar Zeilen des Dichters Housman:
Und weil, um Blühendes zu seh’n,
Fünfzig Frühjahr’ schnell vergeh’n,
Heut’ wieder ins Gehölz ich geh,
Zu seh’n die Kirsche voller Schnee.1
Manche sagten ja, Housman sei vom Tod besessen, aber vielleicht war er eigentlich vom Leben und dessen Kürze besessen. Sogar zwanzig Frühjahre waren Quentin wie die Ewigkeit vorgekommen, doch wenn man das Glück hatte, auf The Grange zu leben, war selbst die Ewigkeit nicht lang genug, um den Wechsel der Jahreszeiten zu beobachten und Gott für sein Werk zu danken.
Quentin ging langsam über die Wiese, zerrte den toten Ast hinter sich her und legte ihn neben den Schuppen für das Brennholz, wo er ihn später zersägen würde. Ohne Vorwarnung prasselten Hagelkörner vom Himmel, und er lief in den Hof und von dort in die Küche.
»Himmel!« Er klopfte sich die Eiskörner von der alten Tweedjacke und grinste Clemmie an, die am Küchentisch saß, Toast mit Marmelade aß und sich Notizen machte. »Es ist doch noch nicht Frühling.«
»Aber er kommt, Liebling, und wir werden ihn gemeinsam erleben.«
Er schaute sie kurz an und fragte sich, wie sie seine Gedanken erraten hatte. Sie stand auf, ging zu ihm und legte die Arme um ihn.
»Bist du mein Valentin?«, fragte er, und sie fing an zu lachen und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen. »Also, jemand anderes wird es wohl kaum sein, wenn ich da ein Wörtchen mitzureden habe«, sagte sie. »Und bevor wir gehen, noch einen Kaffee für dich, mein Junge. Du bist ja ganz steif vor Kälte.«
Er lehnte sich rückwärts an den Holzofen, dankbar für die Wärme, und lächelte sie an. »Da doch heute Valentinstag ist –«, sagte er, »wie wäre es mit einem Sandwich im Bedford, wenn wir fertig sind mit einkaufen?«
»Glänzende Idee!« Sie freute sich und reichte ihm eine Tasse dampfenden Kaffee. »Und ich werde uns von meiner Rente ein Glas Wein spendieren. Das ist wohl das Mindeste.«
1 Übersetzt von Susanne Steuer. In: Englische Gedichte von W. Shakespeare bis Alfred S. Housman, Hamburg 1998
3
Claudia Maynard hatte überhaupt keine Angst, dass ihr Mann Jeffrey den Valentinstag vergessen würde. Es war stets Verlass darauf, dass Jeff ihr an ihrem Geburtstag Blumen schenkte, an ihrem Hochzeitstag einen Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant reservierte und all jene eintönigen Pflichten erledigte, die an sich unwichtig waren, an denen sich aber dennoch so manches Mal ein Ehekrach entzündete, wenn sie zu häufig nicht erledigt wurden – wie zum Beispiel den Herd zu reinigen, die Arbeitsplatte abzuwischen oder die Schmutzwäsche in den Wäschekorb zu werfen. Außerdem sah Jeff ungewöhnlich gut aus, und Claudias Freundinnen beneideten sie alle um diesen dunklen Adonis. Claudia bereitete dieser Umstand eine gewisse Genugtuung, die sie weidlich auskostete. Ganz gleich, wie sehr er umschwärmt und belagert wurde, wenn sie ausgingen – Jeff wich nie lange von ihrer Seite und kümmerte sich stets rührend um sie; sehr zum Ärgernis der besagten Freundinnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!