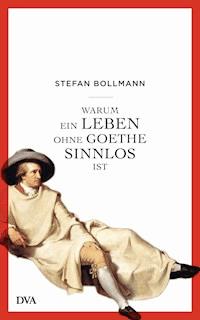21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
München 1900: Laboratorium der Moderne Franziska zu Reventlow und Frank Wedekind, Hedwig Pringsheim und Thomas Mann, Lou Andreas Salomé und Rainer Maria Rilke, Marianne von Werefkin und Wassily Kandinsky – mutig und tatkräftig brechen sie alle um 1900 in die damals modernsten deutschen Stadt auf, um ein freieres, emanzipiertes Leben zu führen und die Zukunft zu gewinnen. Ihre inspirierenden Schicksale führen uns vor Augen, dass damals so vieles begann, was bis heute fortwirkt. Ausgerechnet in der bierseligen, faschingsverwöhnten Kunststadt München kommt es zwischen 1886 und 1914 zu einem beispiellosen kulturellen Aufbruch: Psychotherapie und Jugendstil, Secession und Satirezeitschrift, Frauenemanzipation und fluide Geschlechter – das alles gedeiht hier erstmals und in beispielloser Vielfalt. In München versteht man zuerst, dass Jugend ein Lebensgefühl ist. Ein Hypnosearzt entwickelt gleichsam aus dem Nichts die Verhaltenstherapie. Um die Kunst vor Bevormundung zu schützen, entstehen die erste Secession und in ihrem Gefolge mit dem Blauen Reiter die abstrakte Kunst. Neue Zeitschriften und Kabaretts machen München zur unheimlichen Satirehauptstadt des von Berlin aus regierten Reiches. Unterdessen zeigt Franziska zu Reventlow, dass freie Liebe nicht länger Männersache ist. Und mit der Erfindung des modernen Tanzes verschwimmen die traditionellen Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten dann endgültig. Ein ebenso grandioses wie buntes Panorama des Aufbruchs und der Veränderung, in dessen Zentrum begabte Frauen und Männer stehen, die diese Verwandlung herbeigesehnt, erkämpft und gelebt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan Bollmann
Zeit der Verwandlung
München 1900 und Die Neuerfindung des Lebens
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Jimlop collection/Alamy Stock Foto/Ludwig von Zumbusch – Jugend Nr. 40, 1897.
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98677-8
E-Book ISBN 978-3-608-12242-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Die Hauptpersonen in der Reihenfolge ihres Auftretens:
Prolog
Kapitel 1
Das Ziel der Befreiten
Der Oppositions-Schwarm
Auf dem Eis
Hedwig Pringsheim
Geisterklopferei
Der Streit um die Seele
Schaudernd unter lauter Narren
Das Ziel der Befreiten
Stadt im Umbruch
Anita Augspurg und Sophia Goudstikker
Atelier Elvira
Ein Seelenflüsterer
Alfred Schrenck-Notzing
Feindliche Übernahme
Durch die Wolle zur Seele
Karl Wilhelm Diefenbach
Der Meister und sein Fidus
»Mein neuer Hut«
Berlin, diese Riesen-Nervenfolter
Ein Haus für München
Der goldene Mittelweg
Frank Wedekind
Frauen und Narren
Frühlings Erwachen
Kapitel 2
Frühlingsstürme
Besuch aus Paris
Willy Gretor
Eine Künstler-
WG
Lulu Lou
Ein Malerfürst
Franz Lenbach
Secession
»Ent-Lenbachen«
Farbe, Licht und Luft
Das Fleisch der Welt
Lovis Corinth
Frühlingsstürme
Thomas Mann
Franziska zu Reventlow
Karneval
In der Malschule
Nie hat man so viel Seele wie im Karneval
Eheleben
Kapitel 3
Der große Aufbruch
Eine weibliche Gegenkultur …
Studentinnenleben
Eine Stadt der Frauen
… und eine männliche
Ludwig Klages
Stefan George
Alfred Schuler
Theodor Lessing
Aufs Rad
Das Emanzipationsgefährt
Ein Skandal
Oskar Panizza
»Die Jugend rückt auf allen Seiten vor«
Eine neue Zeitschrift für ein neues Lebensgefühl
Der Peitschenhieb
Hermann Obrist
Zum Totlachen
Simplicissimus
Die Zeitschrift mit der Bulldogge
Albert Langen
Schriftstellerin wider Willen
Energiezentrale Stefanie
»Jetzt kann es beginnen – das Leben«
Rainer Maria Rilke
Die Russen kommen
Marianne von Werefkin
Alexej von Jawlensky
Kapitel 4
Neue Geschlechter
Lebenswende
Neujahrsnacht einer Unglücklichen
»Ein Kind, mein Gott.« Und Rilke
Amour Lou
»Summer of Love«
August Endell
Ein Mutter-Gottes-Kind
Das Über-Ornament
Der Eklat
Verse mit Folgen
Gender Trouble
Heirate oder heirate nicht
Das dritte Geschlecht
Die Revolution der Tanten
Die Rutschbahn
Fliegen können
Mutterschaft und freie Liebe
Jahrhundertwende
Monte Verità
Das neue Jahrhundert
Kapitel 5
Wahnmoching
»Wir richten scharf und herzlich«
Exekutionen im Hinterhof
Spaßmacher, tiefernst
Marya Delvard
»Eh du, mon dieu«
»So möcht’ ich lieber nicht aussehen«
Eduard von Keyserling
Die Zukunft der Malerei
Gabriele Münter
Wassily Kandinsky
München leuchtet
Die Kunst an der Herrschaft
Das Schwert Gottes
Auf der Leopoldstraße
Hohe Schule der Diskretion
Der Umzug
Noch mehr Simplicissimus
Schwabinger Kreisverkehr
Maximilian Kronberger
Karl Wolfskehl
Beim Propheten
Ludwig Derleth
Beim Propheten
Apotheose und Abgesang
Bohemeleben
Der Schwabinger Beobachter
Die Traumtänzerin
Siegestor
Kapitel 6
Die Seelensucher
Die Eroberung
Eine Verlagerung
»Absorbierende Bemühungen«
Und Katia?
»So blühe denn, Wälsungenblut!«
Der Befreier
Otto Gross
Erich Mühsam
Regina Ullmann
»Wie könnte man auch vergessen!«
Vier Seelenmaler … und ein Tänzer
Ein Murnauer Sommer
»Ich habe geschaut in Seele und musste malen rot«
Das Russenhaus
Alexander Sacharoff
Der Abschied
Epilog
Die Rückkehr
Picasso in München
Die Einberufung
Die Rettung
Traumgesichter
Bibliographie
Allgemeine Literatur zu München um 1900
Literaturauswahl zu den Hauptfiguren des Buches
Lou Andreas-Salomé
Anita Augspurg und Sophia Goudstikker (Atelier Elvira)
Lovis Corinth
Karl Wilhelm Diefenbach
August Endell
Stefan George
Willy Gretor
Otto Gross
Ludwig Klages
Albert Langen
Thomas Mann
Erich Mühsam
Gabriele Münter und Wassily Kandinsky
Hermann Obrist
Oskar Panizza
Hedwig und Katia Pringsheim
Franziska zu Reventlow
Rainer Maria Rilke
Alexander Sacharoff
Albert von Schrenck-Notzing
Alfred Schuler
Regina Ullmann
Frank Wedekind
Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky
Bildnachweise
Der Wandel war unaufhörlich, und vielleicht würde die Verwandlung nie aufhören. Hohe Zinnen des Denkens, Gewohnheiten, die so dauerhaft wie Stein gewirkt hatten, verschwanden bei der Berührung mit einem anderen Geist wie Schatten und hinterließen einen nackten Himmel, an dem neue Sterne funkelten.
Virginia Woolf, Orlando
Die Hauptpersonen in der Reihenfolge ihres Auftretens:
Franziska zu Reventlow, verarmte Gräfin und Bohemienne aus Berufung – the woman who did.
Hedwig Pringsheim, Bohemienne des Geistes und Schwiegermutter in spe von Thomas Mann – führt täglich Tagebuch.
Anita Augspurg, Fotografin, Frauenrechtlerin, Juristin – gründet zusammen mit Sophia Goudstikker das Atelier Elvira.
Sophia Goudstikker, Fotografin, Feministin, Geschäftsfrau – gründet zusammen mit Anita Augspurg das Atelier Elvira.
Frank Wedekind, der Mann mit der Gitarre, Stückeschreiber und Schauspieler, Mitbegründer der Simplicissimus, Star der Elf Scharfrichter – hat viele Talente und Probleme mit der Liebe.
Albert Langen, Verleger aus Leidenschaft – bringt mit dem von ihm gegründeten Simplicissimus viel Leben in die Münchner Bude.
Lou Andreas-Salomé, seelenoffene Russin – lässt Wedekind abblitzen, verhilft aber Rilke zu Erfahrungen.
Thomas Mann, Gründer einer Schülerzeitschrift, ein Sprachzauberer – hält sich abseits der Boheme, hat ebenfalls Probleme mit der Liebe.
Ludwig Klages, Philosoph und Seelenflüsterer mit Größenwahn – ist nicht nur in Liebesdingen ein Oberkontrolleur.
Stefan George, Poet, Prophet, Knaben-Liebhaber und Mittelpunkt eines nach ihm benannten Kreises – an dem »Meister« scheiden sich die Geister.
Hermann Obrist, Zeichner, Bildhauer, Designer – verwandelt ein biederes Alpenveilchen in einen knallenden Peitschenhieb und begründet so den deutschen Jugendstil.
Rainer Maria Rilke, der Mann, den die Frauen lieben – sendet erst Franziska zu Reventlow und später Lou Andreas-Salomé jeden Tag ein Gedicht.
Marianne von Werefkin, Tochter eines russischen Generals, eine pompöse Erscheinung, selbstbewusst, herrisch – sucht nach der emotionalen Kunst.
Gabriele Münter, quirlig, tanzbesessen, faschingsverrückt – fotografiert in Amerika, bevor sie in München zu malen und zu lieben beginnt.
Katia Pringsheim, Abiturientin, Studentin, Radfahrerin – willigt reichlich zögerlich in die Ehe mit Thomas Mann ein.
Otto Gross, einer der ersten Schüler Freuds, Anarchist und Antipsychiater der ersten Stunde – analysiert halb Schwabing.
Regina Ullmann, eine Dichterin, so still wie unterschätzt – lässt sich von Otto Gross »den Genius freimachen«.
Alexander Sacharoff, erst Bildhauer, dann Tänzer, der heimliche Held dieses Buches – entzieht sich allen gängigen Grenzen, auch den geschlechtlichen.
Prolog
Es ist ein Abend Ende November, als sie in Ascona ankommt. Die Wolken hängen so tief, dass man sie mit den Händen zu berühren meint, und die dunkelgrünen, beinahe schwarzen Wassermassen des Sees erwecken den Eindruck, als würden sie mit ungeheurem Gewicht auf dem Talboden lasten. Wenig ist zu bemerken von der besonderen Atmosphäre dieser Landschaft, von der Erich Mühsam ihr vorgeschwärmt hat – von dem Höhensee, der wie von unterirdischen Fingern emporgehoben scheine, und dass Norden und Süden des Kontinents hier einander begegneten. Eher fühlt sie sich zurückversetzt an das Meer ihrer Kindheit und Jugend mit seiner beinahe unendlichen Palette von Grautönen und seinen wechselnden Winden.
Mit der Droschke legen Mutter und Sohn die letzte Strecke vom Bahnhof Locarno zu ihrem Ziel zurück: dem malerisch am Ufer des Lago Maggiore gelegenen Ort, der irgendwo zwischen Fischerdorf und Touristendestination stecken geblieben scheint. Die Ankunft hat etwas Unheimliches; alles ist stockfinster, und die erste Herberge im Ristorante al Lago stellt sich als derart unzumutbar heraus, dass die beiden im Dunkeln weiterziehen und schließlich das Albergo Quattrini entdecken, welches ihnen dann durchaus annehmbar erscheint.
Schon am nächsten Morgen aber weicht die düstere Stimmung des Ankunftsabends freudiger Überraschung. Gleich nach dem Frühstück machen sich Mutter und Sohn auf, ihren künftigen Wohnsitz zu erkunden. Als erstes steigen sie zum Monte Verità hinauf, »wo die Vegetarier hausen«, wie Franziska zu Reventlow am Abend Franz Hessel in Paris mitteilt. Von dem oberhalb von Ascona gelegenen Hügel aus hat man einen traumhaften Blick, der von den schneebedeckten Gipfeln der Alpen bis tief in den Süden reicht, in deren Fernen sich der langgestreckte See zu verlieren scheint. Auf dem ehemaligen, von der Reblaus kahl gefressenen Weinberg haben sich seit der Jahrhundertwende Lebensreformer angesiedelt. Ein Teil von ihnen hat ein Sanatorium gegründet, das sie Monte Verità, Berg der Wahrheit, nennen, andere leben in kleinen Grüppchen verstreut meist in ehemaligen, zum Teil nur notdürftig hergerichteten Weinberghäuschen. Auch davon hat Erich Mühsam sie unterrichtet, der bereits vor einigen Jahren hier Zuflucht gefunden hat, noch bevor er schließlich nach München übersiedelte. Er hat sogar eine kleine Schrift über Ascona veröffentlicht – halb Eloge, halb Abrechnung. Dort witzelt er über den Vegetarismus als untauglichen Versuch, die bürgerliche Welt aus den Angeln zu heben. Wie will man, so denkt die Gräfin, aus einer Haltung heraus, die ihr wie Lebensfeindlichkeit vorkommt, die Kraft beziehen, sich gegen die Zumutungen des Daseins aufzulehnen?
Und doch ist es alles andere als Zufall, dass die Gräfin Reventlow Ascona als Zufluchtsort wählt, als für sie die Lebensumstände in Schwabing, nicht zuletzt unter dem Druck finanzieller Desaster, aber auch immer längerer Krankenhausaufenthalte, zusehends unzumutbarer werden. Längst hat die Schwabinger Boheme, zu der sie sich lange Zeit stolz rechnete, Ascona als preiswerte Sommerfrische entdeckt. Aussteiger, Anarchisten, Auswanderer wie Weltenbummler auf Durchreise tummeln sich hier. Bald werden die Malerinnern, die Tänzerinnen, die Dadaisten das Nest im Tessin auf halbem Wege von den Alpen nach Italien für sich entdecken. Wo Platz für Vegetarier und Anarchisten ist, dort ist auch Platz für Menschen wie sie, die sich nirgendwo mehr zugehörig fühlen, Expatriierte der Seele, denkt sie. Wenn sie eigentlich auch zwecks einer Heirat hierhergekommen ist.
Erst einmal aber spaziert sie zusammen mit dem dreizehnjährigen Rolf auf dem Hügel herum, den die Einheimischen, von den Siedlern unbeeindruckt, immer noch Monte Monescia nennen. Die erste Begegnung mit den Vegetariern verläuft angenehm, sogar vielversprechend. Ein alter Russe, der berlinerisch spricht, in einem Glashaus wohnt und für seine beiden Novembergäste Pfefferminztee kocht, »orientiert« sie über Wohnungen; ein anderer, ein »Bergesalter«, wie sie ihn nennt, bietet sich gleich an, eine Behausung für sie zu suchen. »Wahrscheinlich bekommen wir ein Häuschen für uns, und ich habe das Gefühl, daß es sich hier sehr nett bleiben läßt.« Propheten seien im Winter fast keine da, stellt sie erleichtert fest. Vor ihnen graust es der Gräfin seit ihrer Verwicklung in den Kreis um Klages und George, an deren Ende sie sich nicht schlafen legte, ohne eine Pistole in greifbarer Nähe zu wissen.
Nachdem sie zusammen mit Rolf die ersten Monate in einer kleinen möblierten Wohnung verbracht hat, findet sie etwas außerhalb des Dorfes einen alten Vogelstellerturm. Er diente einst dazu, die Reben vor Vögeln und Dieben zu schützen. Des Sommers hauste dort ein Arbeiter, der im Bedarfsfall gehörigen Lärm mit Holzrätschen schlug. Nun nutzen die beiden die drei übereinanderliegenden, mit Leitern und Luken verbundenen Räume des Turms für ihre Belange: »Im unteren Raume wird gekocht, im mittleren arbeite ich und im oberen treibt Bubi sein Wesen«, beschreibt Franziska zu Reventlow die Aufteilung. Ein in der Nähe ansässiger Vegetarier, jüdisch-polnischer Herkunft, zimmert ihnen aus alten Brettern einige Regale für Bücher und Vorräte. Beheizbar sind die Turmzimmer nicht, und auch Wasser muss aus einem benachbarten Anwesen geholt werden. Zum Schlafen dient deshalb ein fußläufig erreichbares möbliertes Zimmer am Rand des Dorfes. Jeden Morgen sieht man nun Mutter und Sohn, beladen mit den tagsüber notwendigen Dingen, zu ihrem Turm am Fuße des Monte Verità ziehen.
Rolf, den seine Mutter weiterhin selbst unterrichtet, wird bald eine Fotografenlehre bei Samuele Pisoni, dem einzigen in Ascona ansässigen Fotografen antreten. Er fotografiert auch den damals mitten in einem Weinberg gelegenen Turm. Ein besonders stimmungsvolles Foto zeigt die über eingewachsene Steinstufen erreichbare Holztür, durch die man den Turm betritt. Rolf nimmt sie im flirrenden Licht eines Sommertags auf. Im dichten Blattwerk des Lorbeerstrauchs vor der grellweißen Mauer des Turms bündeln sich die Sonnenstrahlen zu Lichtkugeln, die durch die heiße Luft zu schweben scheinen.
Unterhalb der Stufen steht eine alte Kastanie und in ihrem Schatten ein nach Tessiner Art behauener Steintisch, an dem Franziska zu Reventlow nun in den langen und heißen Sommern zuerst wieder Übersetzungen anfertigt, um Geld zu verdienen, zunehmend aber auch an eigenen literarischen Manuskripten arbeitet. Weit davon entfernt, Memoiren im konventionellen Sinne zu sein, kreist ihr Schreiben zumindest anfangs um die Vergangenheit – um die Erfahrungen und Begebenheiten der Schwabinger Zeit. »Die ganze fremdartige und intensiv bewegte Atmosphäre dieses Stadtteils mit ihren Rätseln, Geheimnissen und, ich möchte wohl sagen, auch Erleuchtungen umfängt mich immer noch – ja, eigentlich immer mehr – wie ein Traum«, schreibt sie. Anfangs sehnt sie sich nur nach Klarheit, nach Verstehen und Begreifen, konsultiert dafür mit Paul Stern eigens einen Philosophen aus dem Kreis um Stefan George und Ludwig Klages, dessen Geliebte sie eine Zeitlang war.
Schon bald aber merkt sie, dass es mit dem Begreifen allein nicht getan ist. Die Atmosphäre, notiert sie, müsse innerlich erlebt, vielleicht sogar geträumt werden. Manchmal tue es ihr förmlich weh, wenn die wache Stimme des Philosophen an ihr Ohr klinge. »Er weiß mir alles zu erklären – man könnte sagen: er beherrscht das Material vollkommen, aber er findet es nicht gut und nicht tauglich, um etwas Rechtes daraus zu bilden.« Die Menschen, mit denen sie in Schwabing verkehrt hat, nennt er »Romantiker, die allen Erkenntnissen der klaren Vernunft die instinktive Weisheit früherer Völker entgegenstellen und sich an dem Pathos dieser Dinge und an ihrem eignen Pathos berauschen. Und logisch muß ich ihm oft recht geben, aber mein Empfinden und meine Sehnsucht neigen sich doch immer wieder ihnen zu …«
»Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand«: Franziska Gräfin zu Reventlow, fotografiert von Philipp Kester, München 1905.
Kapitel 1
Das Ziel der Befreiten
1887–1890
Das sind die Jahre, in denen sich in München der große Aufbruch vorbereitet. Hedwig Pringsheim, Thomas Manns Schwiegermutter in spe, führt einen Oppositions-Schwarm an, ein lesbisches Paar gründet ein Foto-Atelier und zwei Langhaarige demonstrieren mit Kunst und Wolle für völlige Seelenfreiheit. Überhaupt ist viel von Seele die Rede, eine »Psychologische Gesellschaft« wird gegründet und ein junger Arzt beginnt das therapeutische Potenzial der neumodischen Seelenflüsterei zu ahnen. Aber erst der junge Frank Wedekind ermisst die Abgründe, die das Seelen- und das Sexualleben gleichermaßen trennen wie miteinander verbinden, und schlägt daraus literarische Funken. Und warum passiert das alles ausgerechnet in München und nicht in der Reichshauptstadt Berlin? Auch das erfahren wir von Hedwig Pringsheim.
Der Oppositions-Schwarm
Auf dem Eis
Geistesgegenwärtig weicht die junge Frau den ihr entgegenkommenden Läufern aus, während sie schwungvoll ihre schlängelnden Bahnen auf dem Eis zieht. Sie trägt einen wadenlangen dunklen Rock und dazu eine passende taillierte Jacke mit einem Pelzkragen, der sich um ihren Hals schmiegt. Ihr rötlich-blondes, am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengefasstes Haar ist kaum von dem kunstvoll drapierten schwarzen Filzhut zu bändigen, und das, obwohl sie ihn wegen der schneidenden Kälte tief ins Gesicht gezogen hat.
Hedwig Pringsheim, bemerkenswert hübsch und nie um eine geistreiche Antwort verlegen, liebt das Schlittschuhlaufen. Während andere Anstrengungen sie rasch ermüden, scheint diese ihrem Körper immer neue Schwungkraft zu verleihen. Beinahe täglich dreht sie in den kalten Januartagen ihre Runden auf der glitzernden Eisfläche des Kleinhesseloher Sees im Englischen Garten, vorwärts wie rückwärts gleitend ist sie gleichermaßen eine elegante Erscheinung. Nur wenn sie aus lauter Übermut allzu viel Tempo aufnimmt und dabei die kaum sichtbaren Unebenheiten im Eis ignoriert, kann es hin und wieder zu Stürzen kommen. Aber auch dann ist sie immer wieder schnell auf den Beinen und setzt ihre flotte Fahrt fort, als sei nichts geschehen.
Begleitet wird die Anfang Dreißigjährige von dem inzwischen neunjährigen Erik, dem Ältesten der fünfköpfigen Kinderschar, deren stolze Mutter sie ist, und der, wie sie sich eingestehen muss, auch ihr Liebling ist. Die anderen, darunter die gerade einmal dreijährigen Zwillinge Klaus und Katia, weiß sie in der Zwischenzeit gut vom Kindermädchen betreut, seit kurzem eine französische Bonne.
Oft trifft sie am See auf eine größere Gesellschaft, Freunde und Bekannte, darunter die beinahe unvermeidliche Begegnung mit Albert Schaeuffelen, Sohn des berühmten Papierfabrikanten. Dann tönen die Kaskaden perlenden Gelächters, mit denen sie ihre Rufe und Kommentare begleitet, weit über das Eis und ziehen die Aufmerksamkeit der Läuferinnen und Läufer auf sich, von denen der See bei schönem Wetter dicht bevölkert ist. So auch heute, an einem Januartag des Jahres 1887, an dem es besonders lustig zugeht – man spielt »Schwarzer Mann«. »Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann?«, ruft Hedwig gerade, abseits der anderen Mitspieler stehend. »Niemand«, schallt es ihr wie aus einer Kehle entgegen, und jetzt entsteht ein wüstes Gedränge und Gewusel. Während beide Seiten aufeinander zulaufen, um die Plätze zu tauschen, versucht Hedwig, wie es das Spiel will, durch deren Abfangen möglichst viele ihrer Gegner ebenfalls zu »Schwarzen Männern« zu machen. Schaeuffelen, der bis über beide Ohren in sie verliebt ist, legt es geradezu darauf an, von ihr erwischt und ausgezählt zu werden. Der kleine flinke Erik hingegen behauptet sich bis zuletzt tapfer gegen ihre Versuche, auch ihn einzuschwärzen. Da hält sie plötzlich inne: »Das darf doch nicht wahr sein!«
Männer in dunklen Anzügen, augenscheinlich Bedienstete, eilen in einer konzertierten Aktion aufs Eis und stecken den Teil ab, auf dem sich am besten Schlittschuhlaufen lässt. Unmissverständlich verscheuchen sie alle, die sich bislang hier getummelt haben, auch die Schar um Hedwig Pringsheim, die mittlerweile auf über zehn Mitspieler angewachsen ist. Rasch wird klar, worum es geht. Vom Seehaus her dringt eine kleine Gruppe von Damen und Herren auf die Eisfläche vor. Ihre Kleidung, die Distinguiertheit ihres Auftretens und die betonte Steifheit ihrer Bewegungen gibt sie als Aristokraten zu erkennen, wahrscheinlich Leute vom Hof. Man hat wohl im Restaurant des Seehauses gespeist und will jetzt, nach Tisch, ungestört vom gewöhnlichen Volk seine Kreise ziehen. Das arrogante, herrschaftliche Gebaren ruft auf dem Eis einen Entrüstungssturm hervor. »Das lassen wir uns nicht gefallen«, ist auch die einhellige Meinung der Schar um Hedwig Pringsheim.
Anfangs überwiegen Einzelaktionen. Als würde es sich um ein Versehen handeln, dringen Hedwig, Albert Schaeuffelen und die anderen immer wieder ins verbotene Terrain ein, versuchen sich dort an einem Sprung oder drehen eine Pirouette, um danach feixend oder eine Grimasse schneidend – sichtbar nur für die Außenstehenden – wieder abzudrehen. Dann werden sie mutiger und bilden einen »Oppositions-Schwarm«, wie Hedwig das nennt. Dicht an dicht, in chaotischer Formation stoßen sie auf das verbotene Terrain vor, und artikulieren dabei zuweilen lauthals Schlachtrufe. Das macht schon mehr Wirkung, ruft zumindest die Bediensteten wieder auf den Plan, die erneut das Repertoire ihrer Verscheuchungsgesten einsetzen und sogar mit der Gendarmerie drohen. Doch so leicht lässt sich die bürgerliche Widerstandsgruppe heute nicht einschüchtern. Ihre Kampfeslust wächst, und immer dreister und unberechenbarer werden die Vorstöße ins annektierte Gebiet. Zufrieden stellt Hedwig Pringsheim fest, dass der zur Schau gestellte Gleichmut der Besetzer zunehmend sichtbarer Frustration weicht. Schließlich löst die einbrechende Dunkelheit den Konflikt auf ihre Weise. Aber der Vorfall ist ihr wichtig genug, dass sie ihn in ihrem Tagebuch notiert, das sie gewissenhaft führt.
Eine Bohemienne des Geistes: Hedwig Pringsheim, fotografiert vom Atelier Elvira, 1887.
Hedwig Pringsheim
Hedwig Pringsheim ist seit 1878 mit dem fünf Jahre älteren Multimillionärssohn Alfred Pringsheim verheiratet, der seit kurzem eine außerordentliche Professur für Mathematik an der Universität München innehat. Die beiden leben zusammen mit ihren Kindern in einer sehr großzügigen Etagenwohnung in der Münchner Sophienstraße, direkt gegenüber dem Glasplast im Alten Botanischen Garten, tragen sich aber mit Umzugsgedanken. Alfred Pringsheim, ein kleiner, eher unscheinbarer Mann, Kettenraucher mit einer Vorliebe für sarkastische, zuweilen auch ins Kalauerhafte abgleitende Bemerkungen, ist der erstgeborene Sohn des oberschlesischen Eisenbahn- und Bergbauunternehmers Rudolf Pringsheim, eines so erfolgreichen wie schwerreichen Aufsteigers, und für die Bestreitung seines Lebensstandards nicht auf sein Professorengehalt angewiesen. Soweit seine Erinnerungen zurückreichen, schwimmt er in einem beständig fließenden Geldstrom, dessen unversiegbare Quelle der ungeheure väterliche Reichtum ist. Keineswegs ist er nur der Zahlenmensch, den man in einem Mathematikprofessor vermuten könnte. Mindestens ebenso sehr ist er »Notenfax« – glühender Verehrer der Musik Richard Wagners; er hat mit dem Meister persönlich korrespondiert und seine Opern für vierhändiges Klavierspiel bearbeitet, zu deren Darbietung er nun gerne zu sich einlädt. Obendrein ist er Sammler, mit durchaus monomanischen Zügen, wie ihm seine Frau bescheinigt. Seine Sammlung von Renaissance-Majoliken ist auf dem besten Wege, die weltweit bedeutendste Privatsammlung auf diesem Gebiet zu werden.
Hedwig Pringsheim, schlank und zierlich wie ihr Mann, ist die Tochter der bekannten Berliner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Ihr Weg nach München hat über die Schauspielerei geführt. Vor ihrer Ehe ist sie Mitglied des Ensembles des Meininger Hoftheaters gewesen, des damals führenden deutschen Regie- und Tourneetheaters – wichtig für die Durchsetzung des Naturalismus und moderner Frauenrollen, beherrscht von einem Patriarchen, dem regierenden Herzog Georg II. von Sachsen-Meininigen, Intendant, Regisseur und Kostümbildner in Personalunion. Die junge Hedwig Dohm ist in dem Metier durchaus erfolgreich gewesen. Aber auch nicht so erfolgreich, dass sich darauf eine Bühnenkarriere hätte gründen lassen. Lampenfieber und Nervosität hat sie bis zuletzt nicht abgelegt. Dennoch betrachtet sie das Engagement am Theater keineswegs als verlorene Zeit, vielmehr als Lehrjahre. Schauspielerinnen, so spürt sie, verkörpern das neue Menschenbild, das sich in dieser Zeit im Bürgertum durchsetzt. Sie verstehen es, in verschiedenen Rollen zu brillieren, zeigen sich als anpassungsfähig und flexibel, finden sich in alle möglichen Lebenslagen ein.
Die Eheleute Pringsheim sind beide jüdischer Herkunft, doch dieser Aspekt spielt weder in ihrem Leben noch in ihrem Selbstverständnis eine Rolle. Hedwig ist bereits evangelisch getauft und auch so erzogen worden – und gibt das von der Taufe bis zur Konfirmation auch an ihre Kinder weiter. Eigentlich aber steht sie allen Religionen gleichermaßen fern; Kirchen werden besichtigt, nicht zum Gottesdienst aufgesucht. Auch Alfred ist höchstens kunstreligiös, er selbst bezeichnet sich als »confessionslos«. Das ändert nichts daran, dass die Pringsheims in den Augen der anderen als typische Angehörige der gutbetuchten jüdischen Mittelschicht gelten. Typisch dafür ist, was Thomas Mann nach seinem ersten Besuch bei der Familie Pringsheim an seinen Bruder Heinrich schreiben wird: »Kein Gedanke an Judenthum kommt auf, diesen Leuten gegenüber; man spürt nichts als Kultur.« Mag die Assimilation der Pringsheims durch Kunst, Musik und Wissenschaft noch so vollständig sein – dass sie »jüdisch« sind, muss dann doch noch einmal gesagt werden, und sei es ex negativo. Es sind die anderen, die einem zum Juden machen.
Alfred Pringsheim hat seine Frau gerade in dem Augenblick kennengelernt, als diese sich nicht länger der Einsicht verschließen konnte, dass ihr keine große Karriere als Schauspielerin beschieden sein würde. In den ersten fünf Ehejahren hat sie dann gleich ihre fünf Kinder zur Welt gebracht. In ihrem Tagebuch ist danach viel von gesundheitlichen Problemen die Rede. Damit hängen wohl auch ihre plötzlichen Ohnmachtsanfälle zusammen, die mancher vergnügten Abendgesellschaft ein jähes Ende bereiten. Womöglich trägt dazu aber auch das Korsett bei, das damals noch zur eleganten Abendtoilette getragen und dann besonders stark geschnürt wurde. Die hinzugezogenen Ärzte raten ihr zu Verzicht auf Alkohol und zu »viel Bewegung«. Nicht zuletzt deshalb geht sie regelmäßig aufs Eis. Später nimmt sie Reitstunden, schließlich entdeckt sie das Fahrradfahren. Mit Alfred und Freunden, künftig mit der ganzen Familie, unternimmt sie in den Ferien sogar durchaus strapaziöse Wanderungen im Voralpenland.
Darüber hinaus hat die junge Frau den Rollenwechsel von der umherziehenden Aktrice zur sesshaften Mutter allem Anschein nach aber gut gemeistert. In »Kinderbüchlein« notiert sie akribisch alle Fortschritte in der Entwicklung des Nachwuchses und schildert auch dessen individuelle Eigenheiten – mit dem Alltag der Kinderversorgung vom Essenkochen übers Wäschewaschen bis hin zum Unterrichten ist sie hingegen weniger befasst. Nicht, dass sie keine Zeit für ihre vier Söhne und die eine Tochter hätte – sie geht mit ihnen spazieren, nimmt sie, sobald sie alt genug sind, im Winter fast täglich zum Schlittschuhlaufen mit, liest ihnen, insbesondere am Sonntag, vor, begleitet sie zu Ärzten und fühlt sich auch für ihre Erziehung zuständig – aber daneben führt sie doch ein von der Mutterrolle weitgehend unabhängiges Leben. Hedwig Pringsheim hat einen großen Freundeskreis, besucht Gesellschaften und Bälle, hat am Donnerstag regelmäßig ihren »jour fixe«, an dem sie ihre Bekannten empfängt (willkommen ist, wer gerade vorbeikommt), veranstaltet diverse »Tees«, wovon es zum Beispiel den Damen-Tee, den Musik-Tee und den Tanz-Tee gibt, geht ins Theater und in die Oper, besucht Kunstausstellungen, schreibt täglich Briefe und liest viel, nicht selten mehrere Bücher parallel – insbesondere französische und italienische Literatur im Original, daneben aber auch wissenschaftliche Texte und Sachbücher.
Mit schöner Regelmäßigkeit unternimmt Hedwig Pringsheim, was man in den besseren Kreisen »Kommissionen« nennt: Sie geht in die Stadt auf Shoppingtour, meistens begleitet von einer Freundin, manchmal auch von Albert Schaeuffelen, der zugleich der Ehemann ihrer besten Freundin Eugenie, genannt Eu, ist. Konsum und Luxus sind überhaupt nicht zu überschätzende Teile von Hedwigs Leben. Sie tragen maßgeblich dazu bei, es angenehm zu machen. Die Schwärmerei ihres Mannes für andere Frauen setzt ihr zu, doch ist sie bereit darüber hinwegzusehen, selbst wenn ihr klar ist, dass es sich um mehr handelt als um bloßes Anhimmeln. Hedwig Pringsheim führt ein Leben auch außerhalb von Ehe und Familie, leidet nicht unter einem Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung und erlebt sich selbst als Mutter von fünf Kindern als begehrte Frau. Ihre Mutter nennt sie einmal eine »Bohemienne des Geistes« und dürfte damit ziemlich genau getroffen haben, was ihre Tochter über sich selbst denkt.
Geisterklopferei
Der Streit um die Seele
Seit Anfang des Jahres 1887 scheint es auf den Jours, Tees und Festivitäten der Münchner Society nur noch ein Thema zu geben – Spiritismus. Das hat viel mit den Aktivitäten einer Gesellschaft zu tun, die sich im Sommer zuvor in einer Weinstube der Münchner Altstadt gegründet hat. Inspiriert von der wenige Jahre zuvor in London gegründeten Society for Psychical Research, der so illustre Geister wie die Philosophen Henry Sidgwik und William James angehören, trägt sie den schlichten Namen Psychologische Gesellschaft. Ihr Gründer ist Carl du Prel, ein kleiner, drahtiger, so schneidiger wie umtriebiger Mann Ende 40, einer von der Sorte, die man leicht unterschätzt, der aber gelernt hat, sich genau diese Fehleinschätzung bei der Verfolgung seiner Interessen zunutze zu machen. Als ehemaliger Soldat versteht er strategisch zu denken – und diese Stärke ist ihm geblieben, als er nach seiner Promotion über die Philosophie des Traums die militärische Laufbahn nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen für seine wissenschaftlichen und publizistischen Interessen aufgegeben hat: Stets hat er die intellektuelle Gefechtsordnung im Blick und versucht sie zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Und die sieht momentan seiner Einschätzung nach so aus:
Um die Seele des Menschen ist ein erbitterter Streit entbrannt. Auf der einen Seite stehen die Materialisten, die das Seelenleben des Menschen – wie alles andere, was ihn ausmacht – organisch erklären wollen. Für sie ist die Psychologie ein bloßer Anhang der Physiologie; die Seele als selbständige Substanz wird von ihnen aufgegeben. Diese Ansicht wird vor allem von der institutionalisierten Wissenschaft vertreten, von Ordinarien, Forschungsgruppen und Klinikdirektoren wie dem verstorbenen Bernhard von Gudden, der im Frühsommer 1886 zusammen mit dem bayerischen König Ludwig II. im Starnberger See ertrunken ist.
Die Gegner der Materialisten sind eine bunte, stark heterogene, streitbare Schar: Groß von sich reden machen die Spiritisten, die ernsthaft an eine Geisterwelt glauben und über speziell dafür befähigte Medien in Kontakt mit dem Jenseits zu treten versuchen. Eng mit ihnen verbunden, obgleich nicht mit ihnen identisch, ist die okkultistische Bewegung. Sie geht davon aus, dass es paranormale, verborgene Seelenkräfte gebe, die sich beispielsweise im hypnotischen Zustand zeigen und auf unbewusste seelische Energien zurückgehen, welche noch der Erforschung harren. Selbst die Juristen zeigen sich zunehmend an der Frage interessiert, ob die von einem zurechnungsfähigen Menschen begangenen Taten unter allen Umständen ihm zur Last gelegt werden können, oder ob man nicht auch mit Fremdbestimmung, einem Handeln etwa unter Hypnose, rechnen muss. Und schließlich gibt es die Künstler, die vom Unbewussten als Quelle ihrer Kreativität zu schwärmen beginnen oder, so der neueste Trend, die menschliche Seele mit ihren verborgenen Anteilen als Sujet der Malerei entdecken. Immer häufiger kommt es vor, dass Maler und Literaten an hypnotischen Sitzungen oder spiritistischen Séancen teilnehmen – nicht unbedingt, weil sie von der Existenz des Übersinnlichen überzeugt wären, sondern angezogen von den ästhetischen Aspekten dieser bizarren Veranstaltungen.
Du Prel selbst ist eher ein spekulativer Kopf, ein Philosoph auf dem Absprung zum Mystiker. Andererseits ist er Realist genug, um zu wissen, dass der Kampf um die Seele gegen die materialistische Wissenschaft nur zu gewinnen ist, wenn deren bunte Gegnerschar sich organisiert. Glaube oder Überzeugungen reichen hier nicht, die transzendentale Seelenlehre, wie er sie nennt, muss selbst Wissenschaft werden und sich zur Experimentalpsychologie weiterentwickeln, um gegenüber der Naturwissenschaft und deren Vorwurf der Scharlatanerie, ja der Betrügerei bestehen zu können. So hat er es im Programm der Psychologischen Gesellschaft festgehalten, das er den Einladungsschreiben zusammen mit der Vereinssatzung gleich beigelegt hat. Du Prel überlässt nur ungerne etwas dem Zufall. Den Posten des Sekretärs der Gesellschaft hat er dem jungen Albert von Schrenck-Notzing in Aussicht gestellt, ein begabter Mediziner und induktiver Geist; ihm traut er zu, der Psychologie in Deutschland energisch jenen Aufschwung zu verschaffen, den bisher noch jeder Wissenszweig nahm, sobald er experimentell wurde.
Du Prel hat der neu gegründeten Gesellschaft auch gleich eine konkrete Forschungsagenda für die nächste Zeit verordnet. In der Londoner Gesellschaft interessiert man sich aktuell stark für die Gedankenübertragung – ein Phänomen, das auch für die Hypnose konstitutiv ist. Dort hat man für die auf den ersten Blick unerklärliche Fähigkeit, Gedanken oder Gefühle per Fernwirkung auf eine andere Person zu übertragen, jüngst den Terminus »Telepathie« vorgeschlagen und sie damit in eine Reihe mit modernsten Techniken wie der Telegrafie und Telefonie gestellt. Als du Prel nun vorschlägt, die Gesellschaft solle ihre Arbeit mit Experimenten zur Telepathie aufnehmen und in diesem Zusammenhang auch den Namen des neuen Sekretärs der Gesellschaft nennt, ist Schrenck sofort Feuer und Flamme. Der junge Arzt liebt den gesellschaftlichen Auftritt und tut vieles dafür, um als Darling der Münchner Society zu gelten. Und die interessiert sich nun mal weit weniger für den wissenschaftlichen Aspekt der Seelenexperimente als für die übersinnlichen Erscheinungen, die mit ihnen womöglich verbunden sind, angefangen von der Gedankenübertragung über Geistererscheinungen bis hin zu Botschaften aus dem Jenseits.
Schaudernd unter lauter Narren
Völlig hingerissen, geradezu besessen von diesen Phänomenen ist Hedwig Pringsheims Freundin Eugenie Schaueffelen. Gleich nach der Gründung ist sie in die Psychologische Gesellschaft eingetreten und dort auf viele Gleichgesinnte gestoßen. Bei ihrem Mann hingegen haben die beinahe täglich unternommenen Überredungsversuche, die sich regelmäßig zu Vorhaltungen steigern, bislang nichts gefruchtet; standhaft weigert er sich, Mitglied zu werden. Alfred wird den Verdacht nicht los, dass die ganze »Geisterklopferei« eine Folge der Neurasthenie ist, diesem modernen Syndrom der Überforderung, das sich einstellt, wenn die Nerven den Ansprüchen der Wirklichkeit nicht mehr standhalten. Etwas, das er von seiner Frau zur Genüge kennt.
Am 8. Januar 1887 haben Schaeuffelens abends zu einer Spiritisten-Gesellschaft eingeladen. Außer Pringsheims und dem Kunstphilosophen und Sammler Konrad Fiedler und seiner Frau sind fast nur Eingeweihte zugegen – Personen, die sich mit den Gepflogenheiten solcher Veranstaltungen auskennen. Hedwig und Alfred Pringsheim tun das erklärtermaßen nicht, ihnen ist diese Welt bislang nur vom Hörensagen bekannt. Wohl hat sich Hedwig Pringsheim in den letzten Tagen redlich bemüht, ihrem Unwissen ein wenig abzuhelfen, indem sie Die Philosophie der Mystik zu lesen begonnen hat – Carl du Prels einschlägiges 500-Seiten-Werk. Es wartet gleich zu Anfang mit der Behauptung auf, das menschliche Ich sei mehr als sein Selbstbewusstsein – in vielen Belangen werde es vom Unbewussten bestimmt, was sich nicht nur an der Hypnose, sondern Nacht für Nacht im Traumleben zeige. Doch der Abend verläuft unspektakulär. In den Ecken wird zwar viel geflüstert, aber es ereignet sich nichts, Tische und Lampen bleiben dort stehen, wo sie hingehören, und beginnen auch nicht zu wackeln oder zu schweben. »Kein geringster ›Spirit‹«, wie Hedwig Pringsheim beinahe achselzuckend in ihrem Tagebuch notiert. Oder schwingt da doch Enttäuschung mit?
Kein Wunder jedenfalls, dass sich die Hoffnung der Beteiligten auf William Eglinton richtet. Bereits an besagtem Abend ist viel davon die Rede, dass das berühmte Londoner Medium in den nächsten Tagen in München zu erwarten ist. Am 21. Januar ist es dann endlich so weit: Eglinton ist am Vorabend in München eingetroffen, und im Hause Schaeuffelen steigt die lang erwartete Séance. Hedwig geht ohne Alfred hin, der sich weigert; er hat von dem ersten Abend genug. Auch der junge Schrenck ist anwesend: Er hypnotisiert Eglinton, der auf Hedwig zunächst einen passablen Eindruck macht und bald in Zuckungen verfällt. Die Anwesenden haben rund um einen großen Tisch Platz genommen, die Hände auf die Tischplatte gelegt, und berühren einander mit den Fingerspitzen. Hedwig ist zufällig direkt neben Eglinton zum Sitzen gekommen, sozusagen Fuß an Fuß mit dem Medium. Als in der gespannten Stille dann Klopfgeräusche zu vernehmen sind, erkennt sie sofort deren Quelle: Niemand anderer als der pumpend vor- und zurückstoßende, keuchende Eglinton selbst ist der Verursacher. »Erbärmlicher Schwindel!«, entfährt es ihr. Der Londoner streitet die Vorwürfe natürlich ab, versucht die peinliche Situation mit Komplimenten zu überspielen. Er spüre es, schwärmt er Hedwig an, auch sie sei mediumistisch veranlagt, »yes, I feel powers«, ihr Schutzgeist heiße – Heine! Alles das wird mit heiligstem Ernst verhandelt, Hedwig fühlt sich zusehends »schaudernd unter lauter Narren«, wie sie ihrem Tagebuch anvertraut, und klammert sich, sehr zu dessen Freude, an den Gastgeber »als einzige fühlende Brust«. Alfred gesteht ihr später, alle Anwesenden hätten Eglinton sofort durchschaut, hätten nur Komödie gespielt. Sie aber traut der Sache nicht. Ihre Freundin kommt ihr viel zu aufgeregt vor, und auch »den armen dummen Schrenck«, wie sie ihn nennt, hält sie mit seinen endlosen Fragen für »gläubig«. Um den Abend zu retten, schlägt Schrenck schließlich vor, sie, Hedwig Pringsheim, zu hypnotisieren, schließlich habe der Londoner Gast ihre Veranlagung dazu erkannt. Aber nicht einmal das gelingt: Statt in Trance, findet sie sich in einen sehr unangenehmen, körperlich regungslosen Zustand versetzt, aus dem sie nur schwer wieder zu sich selbst kommt. Der Wille des Hypnotiseurs und die von ihm verwendete Technik scheinen nicht allein ausschlaggebend dafür zu sein, dass sich die erwünschte Suggestibilität einstellt. Hedwig Pringsheim hat jedenfalls erst einmal genug von dem ganzen Seelenzirkus. Bereits um 23 Uhr geht sie, die ansonsten eher zu den Letzten gehört, heim.
Alfred – der Freund, nicht ihr Mann – besucht sie am nächsten Tag, um zu berichten, nach der Séance hätten sämtliche Beteiligten ein Protokoll unterzeichnet, in dem Eglinton als Schwindler entlarvt werde. »Tant mieux!«, »Umso besser!«, lautet Hedwigs knapper Kommentar. Doch wie sie einen weiteren Tag danach feststellen muss, als sie bei Eu vorbeischaut, hat ihr Gespür sie nicht getrogen: Weit davon entfernt, Eglinton und die Geisterklopferei aufzugeben, hat Eu nach Gesprächen mit zwei Freundinnen und dann zusätzlich noch mit Schrenck einen »Rückfall« erlitten; soeben befindet sie sich in einer intensiven Unterredung mit Eglinton, niemand sei der Zutritt gestattet.
Abermals einen Tag später, dem legendären Tag des Oppositions-Schwarms auf dem Eis, kommt auch Eu selbst wieder zu Besuch, »scheinbar kuriert, vernünftig und versöhnt«, aber nach wie vor hypersensibel, was das Thema betrifft; Hedwig erscheint ihre Freundin »partiell krank«, sogar im Theater glaubt sie Berührungen irgendwelcher Geister zu spüren. Langsam wird es Hedwigs Mann zu bunt, und als die beiden Schaeuffelens in den nächsten Tagen wieder einmal bei ihnen dinieren, knöpft er sie sich vor.
Alfred Pringsheim will keineswegs abstreiten, dass es bei den Sitzungen mit einem Medium, denen Eu beigewohnt hat, zuweilen zu so außergewöhnlichen wie faszinierenden Erscheinungen kommt. Das sei, so meint er, gerade in profanen Zeiten wie unseren Seelenbalsam. Für ihn gehe diese Wirkung von Wagner aus; seine Passion für dessen Musik sei ja hinlänglich bekannt. Doch habe sich Eu schon einmal gefragt, was hinter den spiritistischen Phänomenen stecke? Die Anhänger dieses Glaubens gingen davon aus, dass es sich um Manifestationen der Geister verstorbener Mitmenschen handele. Doch welche Bedeutung hätten die Erscheinungen gerade unter dieser Annahme? Welche Vorstellung müssten wir uns von dem Zustand der verstorbenen Mitmenschen machen, wenn die spiritistische Anschauung richtig sei? Was in den automatischen Niederschriften von sich gegeben werde, sei doch kaum mehr als Blödsinn zu nennen. Und noch nicht einmal höherer, nein inhaltsleerer, völlig banaler Blödsinn. Richtig, der Spiritismus, ja der gesamte Okkultismus wolle dem Materialismus der Gegenwart entgegenwirken. Aber indem er ein solch jämmerliches, mit Verlaub barbarisches Bild unserer Seele zeichne, die uns doch gerade über die Niederungen der Existenz erheben solle?
Alfred habe der Freundin »ihren spiritistischen Kopf gehörig« gewaschen, notiert Hedwig in ihrem Tagebuch. Tatsächlich ist sie mächtig stolz auf ihn. Zuweilen ist dieser süße kleine Mann ein richtig großer Kopf.
Das Ziel der Befreiten
Stadt im Umbruch
Während die Münchner Gesellschaft noch erregt über die Geistererscheinungen debattiert, starten hier zwei zugereiste junge Frauen eine für die damalige Zeit beispiellose Karriere. Anita Augspurg, achtundzwanzig Jahre alt, und die sieben Jahre jüngere Sophia Goudstikker haben sich in Dresden kennen- und lieben gelernt und im Sommer 1886 den Entschluss gefasst, sich gemeinsam beruflich selbständig machen. Für die Entscheidung, dafür in die bayerische Kapitale zu gehen, spricht aus damaliger Sicht sehr viel. München ist eine Stadt im Umbruch und Aufbruch, sie wächst und strahlt Lebendigkeit aus. Allein in dem Jahrzehnt zwischen 1880 und 1890 nimmt die Zahl ihrer Einwohner um 50 Prozent zu, bis 1900 dann klettert sie auf eine halbe Million. Es entstehen neue Stadtviertel, wie das proletarisch geprägte Münchner Westend; in anderen, etwa dem Lehel, wo gerade noch die Flößer angelegt und Wäscherinnen die Wiesen am Isarufer als Trockenplätze genutzt haben, entstehen nun Mietshäuser für gehobene Ansprüche. Die Baustoffe Eisen und Glas halten Einzug ins Stadtbild: Bereits in den Fünfzigerjahren sind mit der Getreidehalle am Viktualienmarkt und dem riesigen Glaspalast im Alten Botanischen Garten repräsentative, moderne Bauten entstanden, Gusseisen-Glas-Konstruktionen, die völlig auf tragendes Mauerwerk verzichten.
Neben Industrie- und Technikausstellungen werden im Glaspalast bald auch internationale Kunstausstellungen und -messen veranstaltet, die stark zu Münchens Ruf als Kunst- und Kulturstadt beitragen. Nicht minder tut das die Reproduktionsindustrie, die es den Künstlern ermöglicht, nicht nur am Verkauf der Originale, sondern auch an ihrer Verbreitung in Reproduktionen zu verdienen: München ist hier mit Franz Hanfstaengl weltweit führend. In den Achtzigerjahren entstehen auch die großen Abfahrtshallen aus Eisen und Glas des Hauptbahnhofs; beliebte Ziele im Voralpenland werden an das Bahnnetz angeschlossen, der Alpentourismus wird zum Wirtschaftsfaktor. Das von König Max II. Mitte des 19. Jahrhunderts kreierte bayerische »National-Costüm« – Dirndl für die Damen, Lederhose, Leinenhemd und Haferlschuhe für die Herren – können die Sommerfrischler schon zu Hause, etwa im Berliner Kaufhaus Wertheim erwerben; in Tegernsee oder Garmisch steigen sie dann perfekt gekleidet aus dem Zug.
Exemplarisch für den Aufschwung, den der Gewerbestandort München nimmt, ist die stark umkämpfte Konzentration vieler kleiner Brauereien auf wenige Großbetriebe, mit dem Effekt, dass sich der Bierausstoß verdoppelt und die Qualität des Münchner Bieres steigt, das zunehmend zum Exportartikel und zum Synonym für die Lebensqualität in dieser Stadt wird. Die Verbindung von Moderne mit Lebenskultur, mit Wohlsein und Behaglichkeit wird zum Markenzeichen Münchens.
Die Impulse dieser und zahlreicher weiterer Veränderungen gehen schon lange von der städtischen Bürgerschaft und nicht mehr vom Königshaus aus: Nicht in der Residenz, sondern im Rathaus am Marienplatz werden die Weichenstellungen der Stadtentwicklung vorgenommen und laufen die Fäden zusammen. Prinzregent Luitpold, seit dem Tod Ludwigs II. im Starnberger See an der Macht, tritt lediglich als Repräsentant und Gönner, nicht jedoch als Bauherr oder politischer Gestalter in Erscheinung. In den ersten Jahren wenig beliebt, vielen als »Königsmörder« verhasst, hat sich Luitpold mit der Zeit Beliebtheit durch die Zurschaustellung all dessen verschafft, was Ludwig II. abgegangen ist, insbesondere Volkstümlichkeit und Bürgernähe. Seine Leidenschaft gilt der Jagd, dem Ringen, Festen im Freien, seinen Hunden. So berühmt wie gefürchtet sind seine unangekündigten, überfallartigen Besuche von Künstlerateliers zur Unzeit der frühen Morgenstunden, stets begleitet von Medienleuten. Die Angewohnheit trägt ihm den Spitznamen »Atelierwanze« ein.
Den stärksten politischen Einfluss in München besitzen die Liberalen; die Sozialdemokraten befinden sich in Lauerstellung, vorerst noch ausgebremst durch das Mehrheitswahlrecht. Der nördliche Vorort Schwabing, kurz zuvor noch zur selbständigen Stadt erhoben, wird eingemeindet; hier, in den ursprünglich dörflichen Strukturen, die nun nachverdichtet werden, siedelt sich zunehmend eine Boheme an, die sich den Anspruch Münchens, Kunststadt zu sein, zunutze macht: Kunst kommt eben nicht nur von können, sondern auch von dürfen. Selbst wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin die eines Obrigkeitsstaats sind – Schwabing entwickelt sich in diesen Jahren zu einem einzigartigen Versuchslabor, in dem unablässig getestet wird, wie weit sich die sozialen, moralischen und sogar anthropologischen Grenzen in Richtung Freiheit verrücken lassen. Kurzum, München mutiert binnen weniger Jahrzehnte von einer behäbigen Residenzstadt zu einer modernen Metropole.
Anita Augspurg und Sophia Goudstikker
Dementsprechend hoch sind die Erwartungen, die viele, insbesondere junge Leute im Gepäck haben, die Ende der 1880er Jahre und verstärkt dann im Jahrzehnt darauf in die bayerische Landeshauptstadt kommen. Darunter sind sehr viele junge Frauen. »Von allen Großstädten erschien München als die geistig freieste, wenigstens vorurteilsfreieste Stadt«, meint Anita Augspurg im Rückblick. Gabriele Reuter, die einige Jahre später nach München übersiedelt und hier den Grundstein für ihre Karriere als damals viel gelesene Schriftstellerin legt, sekundiert ihr: München nennt sie in ihren Erinnerungen das »Ziel der Befreiten«. Schon der Aufbruch nach München gewinnt da den Charakter der Befreiung: Wer hierhin geht, tut das in der Zuversicht, die Zwänge und Versagungen der bisherigen Existenz abzustreifen und ein Leben führen zu können, das den eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht.
Anita Augspurg und Sophia Goudstikker stammen beide aus wohlhabenden, bildungsnahen Familien. Anita hat mit 21 das kleine niedersächsische Verden an der Aller verlassen, in dem sie als jüngstes von fünf Kindern aufgewachsen ist, und ist nach Berlin gezogen, um eine Ausbildung zur Lehrerin zu machen. Das war ein Kompromiss, um sich nicht mit den Eltern zu überwerfen; denn eigentlich wäre sie gerne Schauspielerin geworden. Das holt sie nach, als sie durch ein großmütterliches Legat finanziell auf eigenen Beinen steht. Nach der Ausbildung durch eine Hofschauspielerin folgen mühsame, mit vielen Ortswechseln verbundene Jahre des Engagements an verschiedenen Bühnen, zunächst dem Meininger Hoftheater. Der jungen Hedwig Dohm begegnet sie da nicht, die hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits in die Ehe mit Alfred Pringsheim verabschiedet. Nach fünf Jahren des Tingelns aber ist der Traum vom Schauspielerinnendasein ausgeträumt. Die Eltern sind inzwischen gestorben.
Vorübergehend kommt sie in Dresden bei ihrer Schwester Amalia unter, die dort eine private Malschule leitet. Noch immer ist Frauen der Zugang zu den staatlichen Kunstakademien verwehrt. Wer Malerei lernen will, geht auf eine der kostenpflichtigen Privatschulen, die jetzt überall aufmachen. Die einundzwanzigjährige Sophia Goudstikker ist kürzlich als Schülerin eingetreten. Noch im Jahr ihrer Geburt ist die Familie von Amsterdam nach Hamburg, vor sieben Jahren dann nach Dresden übergesiedelt. Der Vater, ein Kunsthändler, hat die Familie gerade in Richtung Paris für immer verlassen.
Atelier Elvira
Die beiden Frauen verlieben sich und beschließen, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Das Geld dazu, so ihre Idee, wollen sie als Fotografinnen verdienen. Das ist zu der Zeit noch ein junger Beruf, der sich relativ leicht erlernen lässt, ohne eine vorgeschriebene Ausbildung zu durchlaufen, und die Berufsbezeichnung ist auch nicht geschützt. Selbst die Investitionen sind überschaubar: alles gute Voraussetzungen, um als Frau beruflich zu reüssieren. Hinzu kommt, dass immer mehr Leute ein Fotoatelier aufsuchen, um Bilder von sich machen zu lassen; das ist weniger aufwendig und preiswerter, als einem Maler Porträt zu sitzen. Außerdem ist das Ergebnis absehbarer und, ebenfalls nicht zu verachten, es lässt sich reproduzieren. Obendrein ist die Fotografie, so sehen es die jungen Frauen, beiden Metiers, die sie jeweils aus eigener Erfahrung kennen, ein wenig verwandt: Sie ist eine neue, moderne Art, Bilder zu machen, und das Posieren und Sich-Verkleiden, um auf den Fotos gut auszusehen, hat etwas von Schauspielerei. Und schließlich sind auch Anita Augspurgs Kontakte ins Theatermilieu nicht zu verachten; Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen ständig Porträts – um auf sich aufmerksam zu machen, um sich für eine Rolle oder ein Engagement zu bewerben und schließlich für ihre Fans. Zuletzt haben sie noch eine Idee: Wie wäre es mit Fotos von Kindern, des properen Nachwuchses wohlhabender, stolzer Eltern? Solche Aufnahmen sind gefragt, aber kaum ein Fotograf bringt die Geduld auf, die temperamentvollen Kleinen für die damals noch langen Belichtungszeiten ruhig zu halten.
Im November 1886 kommen Anita Augspurg und Sophia Goudstikker nach München. Als sichtbares Zeichen des Neuanfangs haben sie sich ihr Haar kurz schneiden lassen, lange bevor die weibliche Kurzhaarfrisur in den 1920er Jahren unter dem Namen »Bubikopf« populär wird. Von Tituskopf spricht man in den 1890er Jahren und bezeichnet damit recht unspezifisch alle weiblichen Frisuren, die nicht übers Kinn hinausgehen. Die beiden jungen Frauen tragen ihr Haar für damalige Verhältnisse sogar extrem kurz, Sophia nach hinten gebürstet mit ausrasiertem Nacken. Sie verzichten auf alles Verspielte wie etwa nach vorn drapierte Locken, wie sie dann später unter dem Namen »Herrenwinker« berühmt werden. Das verleiht ihren Gesichtszügen etwas Strenges, aber auch wild Entschlossenes. Dass sie dadurch aus der Menge herausstechen, ist ihnen nur recht: Vor allem Frauen, die Frauen lieben, bevorzugen damals den Tituskopf. Doch kommt es ihnen darüber hinaus so vor, als würden sie mit ihrem kurzen Haar der Welt die Stirn bieten und zugleich auf der bloßen Stirn ihre Gedanken frei und offen tragen.
Der Männerwelt die Stirn bieten: Sophia Goudstikker, Gründerin des Ateliers Elvira und Initiatorin der Münchner Frauenbewegung.
Anfangs wohnen die beiden jungen Frauen bei Bekannten. Über den Winter absolvieren sie eine Ausbildung in einem photographischen Atelier. Und bereits in den Wochen, da der Frühling mit Macht dem Sommer zudrängt, haben sie nahe der Ludwigstraße, die von der Innenstadt Richtung Schwabing führt und die der soeben in München promovierende Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin die »monumentalste Straße Europas« nennt, ein Atelier gefunden – nahe dem Englischen Garten gelegen und bequem zu Fuß von Altstadt und Maxvorstadt erreichbar, mit einer Wohnung für sie beide darüber im ersten Stock. Die Frauen haben mit den seinerzeit üblichen Schwierigkeiten zu kämpfen: Der Vermieter möchte den Vertrag mit dem Ehemann abschließen und erkundigt sich nach dessen Einwilligung. Und auch auf der Bank verlangt man die Unterschrift des Mannes, als Anita Augspurg dort das eigene Geld abheben will. In beiden Fällen bedarf es großer Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz, um klarzumachen, dass der geforderte Ehemann gar nicht existiert und auch nicht vorgesehen ist, sondern hier zwei junge Frauen im eigenen Namen agieren und als seriöse Geschäftspartnerinnen ernstgenommen werden wollen. Kaum ist der Sommer dann tatsächlich gekommen, erscheint in den Münchner Neuesten Nachrichten vom 13. Juli 1887 eine Anzeige:
Neu eröffnet
Atelier Elvira
Photographische Anstalt
Anita Augspurg & Sophie Goudstikker
München, v.d. Tannstrasse 15
parterre.
Aufnahmen täglich von 8–6 Uhr.
Specialität: Kinderaufnahmen.
Noch im Gründungsjahr des Ateliers Elvira lässt sich der berühmte Schauspieler Richard Stury dort als Goethes junger Dichter Tasso fotografieren. Schon bald gibt sich im Atelier Elvira die Theaterprominenz die Klinke in die Hand. Für ein Starfoto der Primadonna Milka Ternina als Walküre schaffen Sophia Goudstikker und Anita Augspurg sogar ein echtes Pferd ins Atelier. Beliebt sind dramatische Posen, der Blick verzückt gen Himmel gerichtet. Die gewählte Attitüde muss gar nicht unbedingt zur jeweiligen Rolle passen, sie orientiert sich am Geschmack des Publikums, das nach irdischer Entrückung lechzt. Eine wesentliche Funktion kommt dabei auch den gemalten Hintergrundprospekten zu. Das können ein Landschaftsausblick, gerne auch mit Architekturfragment, ein Wolkenhimmel oder ein kleines Podest sein, das sich imaginär in eine nach oben führende Treppe fortsetzt. Die nicht zuletzt durch die Porträts aus dem Theatermilieu angelockten Kundinnen und Kunden des Besitz- und Bildungsbürgertums bevorzugen hingegen das Brustbild vor neutralem Hintergrund. Das fotografische Können bemisst sich nicht nur daran, die Frauen möglichst attraktiv und die Männer möglichst charakterstark zu zeigen, sondern ihnen auch die gewünschte Aura zu verschaffen: Der Übergang von Boden und Wand wird verschleiert, gegebenenfalls beim Ausbelichten des Glasplattennegativs wie in Nebel getaucht.
Zu den frühen Kundinnen des Ateliers Elvira zählt auch Hedwig Pringsheim. Dass die beiden Inhaberinnen des Fotostudios das Haar kurz tragen und keinen Hehl daraus machen, ein Paar zu sein, dass sie sich für Frauenrechte engagieren, Sport treiben, unter anderem im Englischen Garten ausreiten – das alles schreckt sie keineswegs, erhöht im Gegenteil die Neugier, sich dort fotografieren zu lassen. Angetan von der angenehmen Atmosphäre des Ateliers, auch von der Gründlichkeit und Professionalität, mit der dort gearbeitet wird, nimmt sie später auch ihren Mann mit, probiert die Spezialität des Ateliers aus und lässt ihre Kinder fotografieren.
Die Kundschaft wird in einem gemütlichen Salon empfangen. Während der Wartezeit kann man dort an den Wänden und in den ausliegenden Mappen die Porträts der Prominenz betrachten, die die Dienste des Ateliers bereits in Anspruch genommen hat. Welch ein aufregendes Spektakel der Selbstinszenierung; hier kann man sich für einen Augenblick in eine andere Identität hinüberträumen.
Im Atelier selbst dann geht es eher handfest zu. Auf der einen Seite die voluminöse, auf ein schweres Stativ montierte Studiokamera; dahinter, während der Aufnahme unter einem schwarzen Vorhang verborgen, die Fotografin. Und gegenüber, für die Sekunden der Belichtung in Bewegungslosigkeit verharrend, man selbst. Ein Sessel mit Kopfhalter hilft einem dabei, sich nicht zu rühren. Die Gefahr ist, dass man vor lauter Starre auf dem Foto das Aussehen einer Leiche annimmt. Das zu vermeiden, ist Teil der Kunstfertigkeit, mit der im Atelier Elvira fotografiert wird.
Doch es gibt noch einen dritten Raum, den man als Kundin nie zu Gesicht bekommt: die Dunkelkammer, wo die Glasplatten für die Aufnahmen vorbereitet und später entwickelt werden. Manchmal öffnet sich die Tür, die dorthin führt, für einen kleinen Moment. Dann steigen einem die Dämpfe in die Nase, die von den dort verwendeten Chemikalien ausgehen; sie sollen giftig sein. Nicht nur deswegen erinnert Hedwig Pringsheim das Atelier an eine Hexenküche – ein Laboratorium der Identitätssuche, wo man sich den möglichen Bildern seiner selbst stellt.
Ein Seelenflüsterer
Alfred Schrenck-Notzing
Im Sommer 1889 ist die Psychologische Gesellschaft München beinahe schon wieder Geschichte – jedenfalls in der Gestalt, wie sie Carl du Prel etablieren wollte. Du Prel, der Stratege, hat Schrenck-Notzing, den Jungspund, den er zum Sekretär gemacht hat, unterschätzt, und zwar so gründlich wie folgenreich. Der junge Mediziner, seit einem halben Jahr promoviert, ist keineswegs nur der gutaussehende junge Mann mit einer speziellen Wirkung auf Frauen, für den ihn die meisten auf den ersten Blick halten. Schon sein durchdringender Blick sollte sie eigentlich eines Besseren belehren. Noch als Student hat er seine Begabung entdeckt, Menschen in Hypnose zu versetzen, und ist nun berauscht von seinem Erfolg, anderen seinen Willen aufzuzwingen, und der Bewunderung, die ihm das einträgt.
Schnell beginnt er das therapeutische wie auch das monetäre Potenzial seiner Fähigkeit zu ahnen. Lassen sich mit ihrer Hilfe nicht der Wille und das Verhalten eines Menschen verändern, sozusagen umprogrammieren? In Frankreich hat man der Methode, seelische Störungen per Hypnose zu korrigieren, auch schon einen Namen gegeben: Suggestionstherapie.
Im Januar 1889 erläutert Schrenck im Münchener Kunstgewerbehaus vor einem dreihundertköpfigen Auditorium aus Wissenschaftlern, Künstlern und Ärzten, darunter vielen Direktoren und Präsidenten, die Grundlagen und Möglichkeiten der neuen Methode. Der erste Teil der gut besuchten Veranstaltung, ein fast zweistündiger, staubtrockener akademischer Vortrag des jungen Mediziners, enttäuscht mehr, als dass er die hohen Erwartungen befriedigen kann. Wie sich im Publikum zeigt, kann man nicht nur unter Hypnose, sondern auch aus Langeweile in Schlaf verfallen. Nach der Pause dann aber sind Demonstrationen angekündigt, und jetzt kann Schrenck sein Talent nicht nur als Hypnotiseur, sondern auch als witziger Conférencier unter Beweis stellen. Es beginnt eher unspektakulär: Eine von ihm hypnotisierte Frau verfällt auf seine Anordnung hin in Gliederstarre. Dann eine zweite und eine dritte. Jeder Fall etwas anders gelagert, aber im Erscheinungsbild ähnlich. Höflicher Beifall.
Doch das Programm ist auf Steigerung hin angelegt. Nun tritt ein junger Maler auf, der in Trance erst eine Madonna im Stil Raffaels malt und dann einen Afrikareisenden mimt. Währenddessen hat Schrenck bereits einen zweiten Mann hypnotisiert, der im somnambulen Zustand einen Schimmel verkauft, der gar nicht existiert. Im Alltagsleben sei der Mann eher schüchtern und zurückhaltend, erläutert Schrenck. Eine hochkomische Szene, das Publikum lacht und klatscht schon vernehmlicher.
Dann aber betritt Baron von Poissl die Bühne, ein Endvierziger mit Gehbeschwerden – Kriegsverletzung. Er wurde 1870 in der Schlacht bei Sedan verwundet und ist seither zudem autosomnambul: Der Baron kann sich selbst in Hypnose versetzen. Das tut er sogleich, nachdem er in einem Lehnsessel Platz genommen hat, und bekommt von Schrenck prompt den Auftrag, er sei Fürst Bismarck. Daraufhin hält er im somnambulen Zustand eine pathetische und zugleich ausgebuffte Rede über Kolonialpolitik, ganz im Stil des in Bayern häufig verspotteten Reichskanzlers. Das Publikum biegt sich nun vor Lachen.
Doch Schrenck hat noch ein weiteres As im Ärmel. Er fordert von Poissl auf, er möge doch darstellen, wie er bei Sedan verwundet wurde. Es ist, als habe der Baron im Schlaf ein Horn vernommen. Er springt aus dem Sessel auf, bereit zum letzten Gefecht: »Die Gräben! Die Gräben besetzen!«, ruft er: »Ob wir jetzt sterben oder später, das ist ganz gleich. Jetzt gilt’s für’s Vaterland! Hurra!« Und stürzt wie mit hoch erhobenem Säbel zur Rampe. Dort bricht er mit einem markerschütternden Schrei zusammen, als sei er getroffen. Schrenck eilt herbei, richtet ihn auf, schleppt ihn zurück zu seinem Sessel – eine Szene wie aus einem Schlachtengemälde. Das Publikum ist hingerissen, klatscht wie verrückt, trampelt mit den Füßen. »Betroffen und in Verwunderung über eine packende Naturwahrheit verließen die tieferregten Zuhörer das Haus«, berichtet am nächsten Tag die München-Augsburger Abendzeitung, die sich das Recht, Schrencks Vortrag abzudrucken, bereits im Vorfeld der Veranstaltung gesichert hat.
Feindliche Übernahme
Während der sechs Jahre ältere Sigmund Freud noch ein unbeschriebenes Blatt ist und seine Wiener Privatpraxis allenfalls spärlichen Zulauf hat – obwohl auch er seine unter seelischen Beschwerden leidenden Privatpatienten mit Hypnose behandelt –, ist der junge Schrenck in München auf dem besten Wege, ein stadtbekannter Mann zu werden, dem man zutraut, die Seelenkunde und Seelentherapie zu revolutionieren. Der Andrang zu seiner soeben eröffneten Praxis ist enorm.
Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass er in dem Ruf steht, selbst hartnäckige seelische Störungen mit der von ihm propagierten Suggestionstherapie erfolgreich kurieren zu können. So etwa auch die »konträre Sexualempfindung«, wie man die Homosexualität seit kurzem nennt, nachdem selbst Mediziner lange Zeit davon ausgegangen waren, es handle sich um eine Folge von Verführung, sexueller Übersättigung oder Degeneration. In einer Zeit, in der homosexueller Verkehr als Straftat gilt, ist diese Anerkennung der konstitutionellen Bedeutung der Homosexualität schon einmal ein Fortschritt, um den Preis allerdings ihrer fortgesetzten Stigmatisierung. Nun aber will Schrenck-Notzing sogar einen Weg gefunden haben, die »abnorme« Veranlagung zu behandeln. Sein berühmter Grazer Kollege Richard von Krafft-Ebbing, Autor des Standardwerks Psychopathia sexualis, ist den ersten Schritt in diese Richtung gegangen, indem er einem Patienten die konträre Sexualempfindung mittels Hypnose sozusagen absuggeriert hat. Mit dem Ergebnis, dass dieser nun unempfindlich gegen jeden sexuellen Reiz ist, ganz egal, ob konträr oder konform.
Schrenck-Notzings Ehrgeiz geht weiter: Er will die völlige Verlagerung des Sexualempfindens auf das andere Geschlecht erreichen. Als ihn dann tatsächlich ein »Konträrsexueller« in seiner Praxis aufsucht, macht er sich zügig ans Werk. Herr R., achtundzwanzig Jahre alt, trägt sich mit Suizidgedanken, entpuppt sich jedoch als gelehriger Patient: Schon nach fünf Hypnosesitzungen nimmt er im somnambulen Zustand Aufträge entgegen. Zwei Sitzungen später ordnet Schrenck seinem Patienten unter Hypnose zum ersten Mal den geschlechtlichen Verkehr mit einer weiblichen Person an und stellt dabei sicheres Gelingen in Aussicht. Und tatsächlich, noch am selben Abend schläft R. in einem Bordell zum ersten Mal mit einer Frau. »Von jetzt an wird der Geschlechtsverkehr R’s suggestiv geregelt«, berichtet Schrenck auf seine zupackende Art. Das bleibt auch dann so, als es zu einem »Rückfall« kommt. Dieser wird zuerst mit »energischen Gegenvorstellungen in der Hypnose« und dann auch im Bett bekämpft: R. schläft mit einer Frau, während der von ihm begehrte Mann dabei zusehen darf. Sodann wird die nächste Eskalationsstufe der sexuellen Umerziehung gezündet: Der Patient geht nun auf Brautschau, nicht zuletzt auch deshalb, weil beim käuflichen Sex die »Befriedigung des ästhetischen Bedürfnisses« zu kurz kommt und R. diese nur in einer glücklichen Ehe finden zu können glaubt. Im Mai 1889, nach insgesamt 45 Sitzungen, ist die Therapie des Patienten dann abgeschlossen: R. verlobt sich und wird bald heiraten. Schrenck setzt darauf, dass er »den sexuellen Anforderungen einer Hochzeitsreise« genügen kann und entlässt ihn als gebessert. Sollte »ungünstigen Falles ein Rückfall eintreten«, bleibe noch immer »die Wiederholung des Verfahrens«. Mit dieser frohgemuten Aussicht beschließt der Seelenflüsterer seinen Aufsatz »Ueber Suggestionstherapie bei konträrer Sexualempfindung« in der Internationalen Klinischen Rundschau.
Die öffentlichen und die therapeutischen Erfolge geben Schrencks Selbstbewusstsein mächtigen Auftrieb. Noch ist du Prel der große Wortführer innerhalb der Psychologischen Gesellschaft. Dessen metaphysische Auffassung von der Seele und dem Unbewussten ist dem Seelenflüsterer und seiner wachsenden Anhängerschar aber zunehmend ein Dorn im Auge. Als sich dann die Gelegenheit bietet, Max Dessoir zum Vortrag nach München einzuladen, greift Schrenck sofort zu. Keiner ist besser informiert über die aktuelle Hypnoseforschung als dieser blutjunge Berliner Psychologe und Philosoph. Zudem ist Dessoir für seine ablehnende Haltung gegenüber okkultistischen Theorien bekannt. Und richtig: Rasch kommt der Gast aus Berlin auf das gefährliche Erbe der Hypnose zu sprechen. Ein Jahrhundert hindurch seien die hypnotischen Erscheinungen so eng »mit unbeweisbaren Theorien« verquickt gewesen, dass es noch jetzt schwerfalle, sie davon zu lösen. Noch ärger aber sei »die heillose Sucht nach metaphysischen Deutungen«. Wer »Glaubensbedürfnisse« befriedigen will, könne ja ein Conventikel gründen – in psychologischen Gesellschaften habe er jedenfalls nichts zu suchen. Selbst wenn Dessoir an dieser Stelle seines Vortrags keine Namen nennt, können sich alle im Saal denken, wovon und von wem die Rede ist. Unter den Zuhörern kommt es zum Tumult, du Prel springt auf, gestikuliert wild mit Händen und Füßen.
Gleich im Anschluss an den Vortrag wird eine Vorstandssitzung einberufen. Zuerst müssen sich Dessoir und Schrenck schwere Vorwürfe anhören. Dessoir habe das Gastrecht missbraucht, du Prel schwer beleidigt – doch je länger die Aussprache andauert, desto deutlicher wendet sich die Stimmung zugunsten der beiden. Am Ende tritt der gesamte bisherige Vorstand zurück, du Prel aber verlässt die Psychologische Gesellschaft und gründet die alternative Gesellschaft für Experimentalpsychologie, die sich ganz auf die Erforschung mystischer und okkulter Erscheinungen fokussiert. Schrenck hat sein Ziel erreicht: Die Psychologische Gesellschaft München tanzt fortan nach seiner Pfeife. Er wird seine Karriere als Therapeut und Forscher darauf gründen.