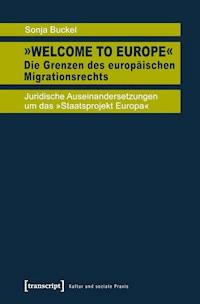Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 54/55 E-Book
Sonja Buckel
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die »Zeitschrift für kritische Theorie« ist ein Diskussionsforum für die materiale Anwendung kritischer Theorie auf aktuelle Gegenstände und bietet einen Rahmen für Gespräche zwischen den verschiedenen methodologischen Auffassungen heutiger Formen kritischer Theorie. Sie dient als Forum, das einzelne theoretische Anstrengungen thematisch bündelt und kontinuierlich präsentiert. www.zkt.zuklampen.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zeitschrift für kritische Theorie
Heft 54 – 55 / 2022
herausgegeben von Sven Kramer und Gerhard Schweppenhäuser
zu Klampen
Zeitschrift für kritische Theorie,28. Jahrgang (2022), Heft 54 – 55
Herausgeber: Sven Kramer und Gerhard Schweppenhäuser
Geschäftsführender Herausgeber: Sven Kramer, Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Geschichtswissenschaft und Literarische Kulturen
Redaktion: Roger Behrens (Hamburg), Thomas Friedrich (Mannheim), Sven Kramer (Lüneburg), Susanne Martin (Gießen), Martin Niederauer (Frankfurt/M.), Gerhard Schweppenhäuser (Würzburg, Kassel), Dirk Stederoth (Kassel)
Korrespondierende Mitarbeiter: Maxi Berger (Wismar), Rodrigo Duarte (Belo Horizonte), Jörg Gleiter (Berlin), Christoph Görg (Kassel), Johan Frederik Hartle (Wien), Frank Hermenau (Kassel), Fredric Jameson (Durham, NC), Per Jepsen (Kopenhagen), Douglas Kellner (Los Angeles, CA), Claudia Rademacher (Bielefeld), Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt/M.), Jeremy Shapiro (New York, NY), Christian Voller (Lüneburg)
Redaktionsbüro: Alle Zusendungen redaktioneller Art bitte an das Redaktionsbüro:
Zeitschrift für kritische Theorie
Leuphana Universität Lüneburg
z. Hd. Prof. Dr. Sven Kramer
Universitätsallee 1, Geb. 5
D-21335 Lüneburg
E-Mail: [email protected]
www.zkt.zuklampen.de
Erscheinungsweise: Die Zeitschrift für kritische Theorie erscheint einmal jährlich als Doppelheft. Preis des Doppelheftes: 32,– Euro [D]; Jahresabo Inland: 28,– Euro [D]; Bezugspreis Ausland bitte erfragen. Berechnung jährlich bei Auslieferung des Heftes. Das Abonnement verlängert sich automatisch, wenn die Kündigung nicht bis zum 15.11. des jeweiligen Jahres erfolgt. Fragen zum Abonnement bitte an folgende Adresse:
Germinal GmbH,
Verlags- und Medienhandlung,
Siemensstraße 16,
D-35463 Fernwald
Tel.: 0641/41700
Fax: 0641/943251
E-Mail: [email protected]
Die Ausgaben der ZkT sind auch elektronisch (im Abo oder kapitelweise) erhältlich, beziehbar über http://www.meiner-elibrary.de/zkt
Redaktionsbüro, Organisation und Lektorat: Lukas Betzler
Umschlagentwurf: Johannes Nawrath
Layout und Satz: Annika Lotter; Fakultät Gestaltung, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ›http://dnb.d-nb.de‹abrufbar.
Aufnahme nach 1995, H. 1; ISSN 0945-7313; ISBN 978-3-86674-830-9; ISSN (online) 2702-7864; ISBN (E-Book-Pdf) 978-3-98737-356-5, ISBN (E-Book-Epub) 978-3-98737-359-6
Die Zeitschrift für kritische Theorie erscheint mit Unterstützung der Leuphana Universität Lüneburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Inhalt
Vorbemerkung der Redaktion
ABHANDLUNGEN
Ulrich RuschigSystematische Skizze zum Verhältnis von Natur und Freiheit
Peter PalmeNegative Dialektik, bestimmte Negation und das Nichtidentische bei Theodor W. Adorno. Ein Beitrag zur Interpretation
Ulisses Razzante VaccariDer dämonische Engel. Walter Benjamin als Leser von Karl Kraus
Martin Mettin und Ansgar MartinsLesen, Hören, Sehen. Ulrich Sonnemann, Siegfried Kracauer und die kritische Phänomenologie des Alltäglichen
EINLASSUNGEN
Christine ReschExilanten im 19. und 20. Jahrhundert und ihre Strategien mit Kulturindustrie umzugehen. Überlegungen am Beispiel von Siegfried Kracauers »Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit«
Barbara UmrathRechtsextremismus, Autoritarismus und Geschlecht. Erkenntnisse und Forschungsdesiderate
SCHWERPUNKT
Hendrik WallatCornelius Castoriadis und die klassische Kritische Theorie. Anstöße zur Diskussion
Markus GanteNaturhaftigkeit und Transparenz. Zu einem Leitmotiv kritischer Theorie bei Hegel, Lefort und Castoriadis
DEBATTE
Sonja Buckel und Ruth SondereggerKritische Theorie ist Sorgearbeit
Asger SørensenOhne Kapitalismuskritik keine Sozialdemokratie. Über kritische Theorie, Ideologiekritik und die Notwendigkeit von Kritik
Fabio Akcelrud DurãoZur Kontinuität der Kritischen Theorie: Robert Hullot-Kentor und Roberto Schwarz
BESPRECHUNGEN
Mirko StieberZur aktuellen Rezeption von Ulrich Sonnenmanns »Negativer Anthropologie«. Ein Literaturbericht
Kritische Theorie – Neue Bücher des Jahres 2021 in Auswahl
Autorinnen und Autoren
Vorbemerkung der Redaktion
Kritische Theorie möchte erkennen, »warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt«1. Ihr Erkenntnisinteresse ist moralisch grundiert und ideologiekritisch zugespitzt. Und so sehr die Gestalten der Barbarei sich seit den vierziger Jahren, in denen Adorno und Horkheimer ihre nachhallenden Worte verfassten, geändert haben, so sehr bleibt es richtig, dass ein – technologisch möglicher – wahrhaft menschlicher Zustand für die Weltbevölkerung in weiter Ferne liegt. Herausgefordert wird jenes Erkenntnisinteresse heute von tagesaktuellen Zuspitzungen, denn neuerdings scheinen sich die katastrophischen Entwicklungen zu intensivieren. So schlagen die verheerenden Resultate der kapitalistischen Produktionsweise in der Veränderung des Weltklimas durch. Häufigere Naturkatastrophen werden nun auch hierzulande zunehmend im Alltag erfahrbar. Und der grausame Krieg in der Ukraine wird zum Menetekel größerer Konflikte. Nach einer Generation dereguliertem Weltmarkt-Chaos agiert die eurasische Mittelmacht Russland als autoritärer Staat mit imperialistischen Ambitionen und der atlantische ›Westen‹ macht seine industriell-militärischen Komplexe für eine neue Ära des Wettrüstens mobil. Die Konfiguration der antagonistischen Weltherrschaft in zwei neue Machtblöcke nimmt Konturen an. Die USA brauchen im Kampf gegen den Weltmarktrivalen China Kapazitäten im südpazifischen Raum, um Hegemonialmacht zu bleiben. Für Europa ist die Rolle des Nato-Brückenkopfs gegen Russland vorgesehen, das sich, nolens volens, China annähert. In dieser Situation stellt sich in Europa die Frage nach der Aufrüstung. In der Zeitenwende hin zur neuen Blockkonstellation wird Verantwortungsethik als Haltung der Stunde propagiert. Sie dient zugleich als Wertethik im Sinne ›westlicher Werte‹. Landes- und Bündnisverteidigung sollen wieder ernst genommen werden, immer öfter und lauter wird über eigene bundesdeutsche Atomwaffen nachgedacht. Energie-Abhängigkeit von den USA oder autoritären Regimen wird gerechtfertigt, weil sie im nationalen Interesse sei. – Diesen realpolitischen Tagesforderungen und ihren ideologischen Verklärungen widerstreitet aber die weiterhin gültige Erkenntnis, dass ein erneutes Wettrüsten und dessen Rechtfertigung nicht im vernünftigen Interesse einer selbstbestimmten Menschheit liegt. Aufrüstung würde vielmehr die Bedingungen verstetigen, die zur Realisierung jenes Menschheitsziels im Widerspruch stehen. Längst hat die Möglichkeit einer Selbstauslöschung der menschlichen Gattung durch nukleare Waffen die Annahme, Kriege könnten zweckrational sein, ad absurdum geführt. Die Herrschafts- und Verwertungsinteressen sowie -praktiken, die dem Vernunftinteresse an einer solidarischen Menschheit im Wege stehen, sind elementare Gegenstände kritischer Theorie. Wenn sie daran hindern, »den Punkt zu erkunden, an dem […] Waffenstillstand[s]gespräche Erfolg haben könnten«2, wenn sie also die Perspektive auf eine Politik des Verhandelns blockieren, ist es mehr den je Aufgabe kritischer Theorie, herrschaftspolitische und ideologische Formationen analytisch zu durchdringen.
Wie aktuelle kritische Theorie sich angesichts dieser Lage ausrichten sollte, darauf reflektieren die Beiträge in der längerfristig angelegten Reihe DEBATTE, die wir in diesem Heft fortsetzen. – Sonja Buckel und Ruth Sonderegger plädieren für eine Positionsbestimmung »aus der Mitte der Kämpfe um kritische Wissenschaft heraus« und gehen dabei vom Begriff der Herrschaftskritik aus, den sie näher spezifizieren und ausdifferenzieren – etwa in Bezug auf seine Situiertheit sowie auf Gegenstände wie Intersektionalität, ökologische und koloniale Zerstörung. Dabei denken sie die kapitalistische Vergesellschaftung als einen »multidirektionalen Herrschaftszusammenhang« und ein »Verhältnis von variabel dominanten Herrschaftsverhältnissen«. – Asger Sørensen setzt sich für die Reaktivierung einer Ideologiekritik ein, die sich in einem Bogen von der immanenten Kritik bis zu den Erkundungen emanzipatorischer Möglichkeiten gesellschaftlicher Veränderungen entfalten müsste. Er vertritt die These, dass eine zeitgemäße kritische Theorie an Marx’ Kapitalismuskritik orientiert bleiben müsse, wenn sie ein gesellschaftsveränderndes Potenzial bewahren und aktualisieren möchte. Sørensen kritisiert allzu offene, inklusive Erneuerungen der kritischen Theorie. Eine Anknüpfung an ihre linkshegelianische Tradition müsse nicht darauf hinauslaufen, kritische Theorie – wie bei Honneth – als Sozialphilosophie zu verstehen. – Fabio Akcelrud Durão grenzt sich von Historisierungen und Kanonisierungen der kritischen Theorie und von sterilen Vergleichen und Pseudo-Dialogen mit poststrukturalistischen Ansätzen ab. Einer Fortsetzung kritischer Theorie dürfe es nicht allein um Begriffsinhalte zu tun sein, die sich in propositionalen Sätzen kodifizieren lassen, sondern auch um die mimetische, objektbezogene ›Geste‹ des Gedankens. Beim Gestus kritischer Theorie gehe es um das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderen. Durão erläutert dies anhand der Adornorezeption von Hullot-Kentor und anhand von Untersuchungen des brasilianischen Literaturtheoretikers Schwarz. Letzterer öffne den reflexiven Horizont kritischer Theorie für eine dialektische Theorie der Nation, die auf dem Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie beruht.
In den ABHANDLUNGEN fragt Ulrich Ruschig in einer systematischen Skizze zum Verhältnis von Natur und Freiheit nach dem Sinn der Rede von der Naturbeherrschung. Von einem Beherrschten könne nur gesprochen werden, wenn es sich um ein Subjekt handele, dem »ein ihm fremder Wille aufgezwungen« wird. Das treffe auf die Natur, die kein vernunftbegabtes, freies Subjekt sei, nicht zu. Dennoch sei nicht zu bezweifeln, dass die Natur in der kapitalistischen Produktionsweise unterdrückt werde. Es gelte, das Verhältnis von Natur und Freiheit »als maßgeblich durch den Kapitalismus konstituiertes Verhältnis« zu begreifen. Dafür müsse die Analogie zwischen reeller Subsumtion der Arbeitskraft und derjenigen der belebten Natur begründet werden. Anhand der Agrarindustrie zeigt Ruschig – mit Rekurs auf ein aristotelisch-husserlsches Eidos-Konzept und auf das biologische der Arten –, dass der moderne Zugriff in der Zurichtung der Natur bestehe, der sich als Herrschaft erweise. – Peter Palme unternimmt eine Interpretation der Konzepte der negativen Dialektik, der bestimmten Negation und des Nichtidentischen bei Adorno, indem er sie in Auseinandersetzung mit Kants Erkenntniskritik in der Kritik der reinen Vernunft und Hegels Phänomenologie des Geistes aus deren Ansätzen herleitet und dann in dem Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden zu verorten sucht. Hierbei kommt Palme u. a. zu dem Ergebnis, dass Adornos Negative Dialektik sowie das Nichtidentische kantischer gedacht seien, als es für gewöhnlich angenommen werde. Der Text kulminiert in dem Aufweis eines positiven Momentes im »Vorrang des Objekts«, das jedoch nicht einzulösen wäre, weshalb man hier Adorno kritisch gegen sich selbst bzw. gegen das seinem Ansatz eigene Positive wenden müsse. – Ulisses Razzante Vaccari geht der materialistischen Wende Walter Benjamins nach, indem er einerseits das Bild des Engels in dessen Gesamtwerk und andererseits seinen Essay über Karl Kraus von 1931 näher untersucht. Dabei akzentuiert er die dem Engel von Benjamin im Kraus-Essay verliehenen dämonischen Züge gegen Gershom Scholems theologische Lesart. Vaccari arbeitet Benjamins dialektisches Vorgehen ebenso wie dessen sprachphilosophische Implikationen heraus. – Martin Mettin und Ansgar Martins rekonstruieren Überschneidungen im Denken von Ulrich Sonnemann und Siegfried Kracauer, die sich im Rahmen ihrer langjährigen Bekanntschaft herauskristallisierten. Beginnend im Deutschland der frühen Weimarer Republik und ihrem damaligen gemeinsamen Interesse an der Graphologie, treffen sich beide später im Exil in den USA. Inhaltlich bewegen sie sich nun auf dem Feld der kritischen Gesellschaftstheorie und Sonnemann, bekannt als Kritiker der Okulartyrannis, weiß die spezifische Fokussierung Kracauers aufs visuelle Detail zu schätzen, denn beide wollen gerade die alltäglichen Dinge und Details sichtbar (Kracauer) und hörbar (Sonnemann) machen, die durch den Geschichtsprozess verdeckt werden.
Ausgehend von dem in Briefen dokumentierten Konflikt zwischen Adorno und Kracauer bezüglich dessen Studie Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit unterscheidet Christine Resch in den EINLASSUNGEN zwei Haltungen gegenüber der Kulturindustrie: zum einen Adornos Ablehnung jeglicher kulturindustriellen Produkte als Zerstörung des emanzipatorischen Potenzials von Kunst; zum anderen den nicht zuletzt an Kracauers Offenbach-Buch sichtbar werdenden Versuch, die kulturindustriellen Produktionsbedingungen für Gesellschafts- und Herrschaftskritik zu nutzen. Sie rekapituliert letzteren auf drei Ebenen: als Musikproduktion im 19. Jahrhundert, als deren gesellschaftsbiographisch ausgerichtete Analyse ein Jahrhundert später sowie als lebensgeschichtlich bedingte Parallele zwischen Offenbach und Kracauer selbst. – Barbara Umrath untersucht, wie die Kategorie Geschlecht in der jüngsten Leipziger Autoritarismus Studie (LAS) von 2020 Berücksichtigung findet. Sie stimmt mit den Autor: innen um Oliver Decker und Elmar Bähler überein, dass die ältere Kritische Theorie weiterhin einen wichtigen Referenzpunkt in der Erforschung des Autoritarismus darstellt und erkennt an, dass Zusammenhänge der Kategorie Geschlecht mit Rechtsextremismus und Autoritarismus in der LAS zum Gegenstand wurden. Dennoch bleibe die Studie unter ihren Möglichkeiten. Die Kategorie Geschlecht werde zwar punktuell behandelt, aber nicht im gesamten Forschungsprozess reflektiert und weitgehend auf ›Frauenfragen‹ reduziert. Ebenso fehlten kritische Ansätze zur sozialen Konstruktion von Männlichkeit und Zweigeschlechtigkeit. Somit verpassten die Autor: innen die Chance, die Autoritarismus-Studien der älteren Kritischen Theorie durch systematische Einbeziehung von Erkenntnissen und Konzepten jüngerer Frauen- und Geschlechterforschung weiterzuentwickeln.
Zum hundertsten Geburtstag von Cornelius Castoriadis am 11. März 2022 erkundet ein SCHWERPUNKT die Fruchbarkeit seines Denkens für die kritische Theorie. Hendrik Wallat setzt Castoriadis’ Werke zum ersten Mal ausführlich mit denen der klassischen Kritischen Theorie in Verbindung. Wallat geht detailliert auf Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Alfred Schmidt und Oskar Negt ein und weist nach, dass Castoriadis und die Autoren der Kritischen Theorie häufig die gleichen Ziele verfolgen – etwa die Kritik des Identitätsdenkens, die philosophische Rehabilitation der Einbildungskraft und der Phantasie, die Kritik der verwalteten Welt und ihrer kapitalistischen Grundlagen sowie die Kritik an strukturalistischen und postmodernen Ideologien. Castoriadis sucht diese Ziele allerdings auf anderem Wege zu erreichen. Wallats streitbare These lautet, dass die Kritische Theorie davon lernen könne. – Auch Markus Gante lotet in seinem Text das Verhältnis von Castoriadis zur kritischen Theorie aus, wenn er die Kritik an der gesellschaftlichen Naturhaftigkeit als ein Leitmotiv der kritischen Theorie herausarbeitet. Dabei zeigt er u. a. an Castoriadis’ Marx-Kritik auf, dass geschichtliche Determinanten nicht mit einer Selbstbestimmung der Menschen in der Geschichte zusammengehen. Deshalb sei diese Selbstbestimmung durch Kritik an naturhaften gesellschaftlichen Verhältnissen freizulegen. Auf der anderen Seite dürfe menschliche Selbstbestimmung in der Geschichte auch nicht einem ursprünglichen Kontingenzparadigma geopfert werden, was Gante schließlich an der Debatte zwischen Claude Lefort und Castoriadis darlegt und auf den Diskurs radikaler Demokratietheorien bezieht. In den BESPRECHUNGEN stellt Markus Stieber neuere Forschungen über Ulrich Sonnemanns Werk vor.
Im letzten Heft (52/53, 2021) wurde Michael Schwarz, der Leiter des Theodor W. Adorno Archivs an der Akademie der Künste, Berlin, versehentlich an eine imaginäre Berliner Akademie der Wissenschaften versetzt (S. 222, Fußnote 17). Wir bitten um Entschuldigung.
ABHANDLUNGEN
Ulrich Ruschig
Systematische Skizze zum Verhältnis von Natur und Freiheit*
Die für die Menschen notwendigen natürlichen Lebensgrundlagen werden fortdauernd, in anwachsendem Ausmaße und partiell irreversibel zerstört. Worin liegen dafür die Gründe? In der kapitalistischen Struktur der Gesellschaft? In der Herrschaft über die Natur? Doch was genau meint ›Herrschaft‹? Wer oder was ›herrscht‹ da und über wen? Das Kapital? Der ›Mensch‹? Kann vernünftigerweise davon gesprochen werden, dass das Kapital über die Natur herrscht? Setzt denn der Begriff ›Herrschaft‹ nicht voraus, dass es ein Beherrschtes gebe, das unterdrückt werde? Ist die Natur als ein beherrschtes Subjekt aufzufassen, das der Herrschaft unterliege und dem ein ihm fremder Wille aufgezwungen werde? Auf der einen Seite steht die Rede von einer unterdrückten Natur – eine durchaus nachzuempfindende und recht eingängige Rede. Auf der anderen Seite steht, dass die philosophische Tradition präzise Begriffsbestimmungen zu Natur, Freiheit, Subjekt, Geist und vielen anderen mehr herausbildete und fast einhellig zurückweist, die Natur sei in einem metaphysischen Sinne als ein Subjekt aufzufassen, dem an sich Geist, Vernunft oder Freiheit zukomme. Beide Seiten – die heutige Wirklichkeit der kapitalistischen Naturaneignung und die aus der philosophischen Tradition stammenden Begriffe von Natur, Subjekt, Freiheit und Herrschaft – zusammenzubringen, das ist keine einfach zu lösende theoretisch-philosophische Aufgabe.
Genau diese Aufgabe packt Herbert Marcuse an – in dem Kapitel Natur und Revolution1 seiner Abhandlung Konterrevolution und Revolte von 1972, erschienen in einer Zeit, als ökologische Oppositionsbewegungen gerade aufkeimten. Darin fordert er ohne Umschweife: Befreit die Natur! Ohne diese Befreiung könne die Befreiung der Menschen von der kapitalistischen Herrschaft nicht gelingen. Marcuse bringt Argumente dafür vor, dass und wie von der ›Befreiung der Natur‹ in philosophisch begründeter Weise die Rede sein kann, wie diese Rede sich kritisch auf die Tradition bezieht und dass, soll Philosophie sich noch ernst nehmen und ihre Zeit in Gedanken erfassen, von der Befreiung der Natur geredet werden muss. Wer von der ›Befreiung der Natur‹ spricht, ist verpflichtet, so Marcuse, das Verhältnis von Natur und Freiheit zu bestimmen.
Marcuses Ausführungen waren eine Pioniertat, vom Wissenschaftsbetrieb links liegen gelassen und auch von den linken Bewegungen und den Nachfolgern der kritischen Theorie kaum beachtet. Heute, nach einem halben Jahrhundert, sind sie fast vergessen – und wiederzuentdecken. Marcuse war sich des tastenden Charakters seiner bahnbrechenden Abhandlung bewusst: »Das Verhältnis von Natur und Freiheit wird in der Gesellschaftstheorie selten explizit behandelt. Auch im Marxismus ist die Natur vorwiegend ein Objekt, der Widersacher in der ›Auseinandersetzung‹ des Menschen mit der Natur, das Feld für die immer rationalere Entwicklung der Produktivkräfte.«2 Mit Letzterem hatte Marcuse leider recht. Im Folgenden soll an seine Abhandlung von 1972 angeknüpft und – wie dort von ihm als fehlender Baustein einer kritischen Gesellschaftstheorie anvisiert und herbeigewünscht – das Verhältnis von Natur und Freiheit explizit zum Thema gemacht werden. Wer heute angesichts der eingetretenen Naturzerstörungen das Verhältnis von Natur und Freiheit systematisch behandeln will, muss es als maßgeblich durch den Kapitalismus konstituiertes Verhältnis begreifen. Die systematische Behandlung gebietet, die Genesis dieses Verhältnisses miteinzubeziehen. Die vorliegende Skizze beginnt deswegen mit dem Philosophen, der die ›Epochenschwelle um 1800‹ einleitete, der wie kein zweiter für die kopernikanische Wende zur Neuzeit sowie für die politisch-gesellschaftliche Wende zur bürgerlichen Gesellschaft steht und der eine das neuzeitliche Denken grundlegend umwälzende Freiheitsphilosophie entwirft, mit Immanuel Kant (§ 1 Natur und Freiheit – eine Antinomie). Natur und Freiheit sind für Kant Antipoden, gleichwohl durcheinander vermittelte Antipoden. »Kausalität durch Freiheit« und »Kausalität nach Gesetzen der Natur«3 scheinen sich einander zu widersprechen, sind jedoch, will man sie beweisen, in den jeweils negativen Beweisführungen aufeinander verwiesen, so dass die Reflexion, wie Freiheit zu begründen sei, in eine Antinomie, die Dritte Antinomie der Kritik der reinen Vernunft, sich verwickelt. Kant löste diese Antinomie in ganz besonderer Weise auf und konnte damit aufzeigen, dass und wie ›Freiheit‹ – die Annahme, der Mensch sei wesentlich Freiheitssubjekt – mit einer durch die neuzeitlichen Naturwissenschaften möglich gewordenen Erkenntnis der Natur und ihrer Prozesse zu vereinbaren sei. So verschaffte Kant der Vernunfterkenntnis der Freiheit überhaupt erst ein in der Folge die Philosophie insgesamt revolutionierendes Fundament und eröffnete zudem der nur in der philosophischen Reflexion gründenden (Idee der) Freiheit die Perspektive, verwirklicht zu werden, eine Perspektive unter den Bedingungen der am Horizont sich abzeichnenden bürgerlichen Gesellschaft.
Blickt man von heute aus, nachdem die kapitalistische Produktionsweise weltweit durchgesetzt worden ist, zurück auf deren Genese, wird man gewahr, dass in der Kant’schen Freiheitsphilosophie ein über Jahrhunderte währender Prozess bürgerlicher Emanzipation seinen ideellen Ausdruck fand und einen über die Epochenschwelle hinaus sichtbaren und beeindruckenden Kulminationspunkt hinterließ. 1789 brach ein politischer Prozess der Befreiung an, der fast alle Sphären der Gesellschaft erfasste. Von zentraler Bedeutung dabei waren zum einen die politische Befreiung von der feudalen Herrschaft und zum anderen – nicht weniger gewichtig – die Befreiung von der unwirtlichen ersten Natur, ein über Jahrhunderte währender Prozess der Naturaneignung und Naturbearbeitung, einbegreifend kontinuierlich erfolgende technische Innovationen bei der handwerklichen Tätigkeit, die Umwälzung in der Physik (die Entstehung der klassischen Mechanik) und nicht zuletzt die Herausbildung der naturwissenschaftlichexperimentellen Arbeit. Die neuzeitlichen Naturwissenschaften inklusive der experimentellen Arbeit und der spekulativ ersonnenen neuen Begriffe und Prinzipien bargen ein Emanzipationsversprechen, das sich, historisch mit dem Prozess der politischen (bürgerlichen) Emanzipation zusammenhängend, sukzessive heranbildete. Aufgrund der verblüffenden und rapiden Fortschritte insbesondere der Physik schien es um 1800 vor seiner Einlösung zu stehen – es verlieh der bürgerlichen Freiheit eine zusätzliche Strahlkraft. Doch so bahnbrechend die Kant’sche Konzeption der Freiheit als einer transzendentalen Idee auch war, so widersprüchlich geriet die Verwirklichung der Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft. Denn die Idee der Freiheit verband sich inwendig mit dem Strukturkern der kapitalistischen Produktionsweise und damit der Herrschaft über die lebendige Arbeit, der gegenständlichen Manifestation der »Kausalität durch Freiheit«. Deswegen kann eine systematische Behandlung des Verhältnisses von Natur und Freiheit, soll sie erfassen, was heutzutage die Wahrheit dieses Verhältnisses ist, nicht bei der Kant’schen Fassung dieses Verhältnisses stehen bleiben. Mit der bürgerlichen Gesellschaft betrat eine ganz besondere Gestalt des Verhältnisses von Natur und Freiheit die historische Bühne. Die mit dem bürgerlichen Zeitalter anbrechende Verwirklichung der Freiheit setzte eine fatale Dialektik in Gang, die Dialektik der Aufklärung, der Freiheit, der Vernunft und der Moral (§ 2 Freiheit und ihre Dialektik).
Wird unter dem § 2 behandelt, was jene besondere Gestalt des Verhältnisses für dessen eine Seite, die Freiheit, so unter dem nächsten Paragraphen, was diese besondere Gestalt für die Natur bedeutet: Der bürgerliche Zugriff auf die Natur (§3). Das bürgerliche Freiheitssubjekt greift in bürgerlich-freiheitlicher Weise auf die Natur zu. Unter dieser Vorgabe »erscheint Natur als das, was der Kapitalismus aus ihr gemacht hat: Materie, Rohmaterial für die anwachsende und ausbeuterische Verwaltung von Menschen und Dingen.«4 Die ›bürgerlich-freiheitliche Weise‹ regelt das bürgerliche Recht. In diesem Fall kann jeder Gegenstand in der Natur Privateigentum werden, was insbesondere für die belebte Natur unheilvolle Folgen zeitigt, weil das Rechtsinstitut ›Privateigentum‹ dem Kapitalzweck ungehinderten Zugriff ermöglicht. Dem Verwertungsprozess des Kapitals eignet eine sich beschleunigende Dynamik.
Aufgrund dessen wird aus dem zunächst (§3) lediglich abstrakt und quasi statisch bestimmten Zugreifen auf die Natur ein dynamisches und eingreifend sich beschleunigendes Zurichten der Natur. Ist das Objekt für das Zurichten nicht bloß Natur schlechthin, sondern belebte Natur, entpuppt sich das Zurichten dieser belebten Natur als Herrschaft über sie, als die Herrschaft über das die Lebewesen spezifisch bestimmende eidetische Moment derselben (§4).
Eine Analogie scheint auf: Ebenso wie die lebendige Arbeit, so werden auch die Lebewesen unter das Kapital subsumiert. Die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit bewirkt eine grundlegende Umgestaltung der technischen Seite des Arbeitsprozesses – mit ruinösen Folgen für die arbeitenden Subjekte. Die reelle Subsumtion der Lebewesen zeitigt einschneidende Folgen für diese Lebewesen, weil das Kapital ein Moment des Subjektiven in der Natur umformt. So wie der Angriff auf die lebendige Arbeit, so ist auch der Angriff auf die Lebewesen ein »processirende[r] Widerspruch«5, denn sowohl die lebendige Arbeit als auch die Lebewesen werden zu Momenten der Bewegung des Kapitals, dessen zerstörerische Dynamik Menschen und Lebewesen zu spüren bekommen (§5).
Das die Lebewesen kennzeichnende eidetische Moment begründet Moralität diesen Lebewesen gegenüber (§6). Ganz im Geiste der Kant’schen Moralphilosophie wird ein den Kant’schen kategorischen Imperativ erweiternder Imperativ formuliert: Das Leben der Lebewesen insgesamt in deren jeweils spezifisch bestimmten Daseinsweisen als Arten soll nicht bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als ein durch besondere, ansichseiende Zweckmäßigkeit ausgezeichnetes Leben geachtet werden.
Auch die Natur »wartet auf die Revolution«6, wartet auf ihre Befreiung. Befreit werden soll ein Moment des Subjektiven in der Natur, jenes eidetische Moment der Lebewesen, welches durch das Kapital beherrscht wird. Ohne solche Befreiung der Natur kann die Emanzipation der Menschen nicht gelingen (§7).
§ 1 Natur und Freiheit – eine Antinomie
Auf die Frage, was Natur ist, antworten vornehmlich Physik und Chemie: Die Gegenstände der Natur bestehen aus Atomen und Molekülen, bestimmt durch Masse, Kräfte, Energie, Felder, Ladungen usw. Folgend den Gesetzen der Naturkausalität können wir an einem Schwefelkristall dessen Eigenschaften und Reaktionen aufdecken. ›Freiheit‹ kommt dort nicht vor. Doch es gibt auch Naturwesen, denen wir Freiheit zusprechen. Wollen wir solche Freiheitswesen verstehen, müssen wir eine gänzlich andere Kausalität annehmen, eine »absolute Spontaneität« oder eine »Kausalität durch Freiheit«.7 Beide Kausalitäten, erforderlich, um die Naturprozesse insgesamt und in Besonderheit die vernunftbegabten Naturwesen zu verstehen, widersprechen einander. Da sie in ihren Begründungen aufeinander verweisen, ergibt sich eine Antinomie. Diese löst Kant – und kann (nur) so begreifen, warum wir Menschen Naturwesen und zugleich Freiheitswesen sind. In dem Begreifen, dass und wie Natur und Freiheit durcheinander vermittelt sind und im Menschen zusammen bestehen, liegt ein Fortschritt für die Menschheit. Allerdings geht dieser Fortschritt, folgt man der Kant’schen Beweisführung, damit einher, dass Pflanzen und Tiere aus einer solchen Vermittlung von Natur und Freiheit herausfallen. Pflanzen und Tieren komme, so Kant, »Kausalität durch Freiheit« nicht zu. Ergo sind sie Sachen, determiniert durch die Kausalität nach Gesetzen der Natur. Von daher rührt eine folgenschwere Dichotomie: Allein der Mensch habe eine Würde; Tiere und Pflanzen hingegen haben keine, vielmehr einen Preis. Was einen Preis habe, an dessen Stelle könne ein Äquivalent gesetzt werden. Was hingegen über allen Preis erhaben sei, mithin kein Äquivalent verstatte, das habe eine Würde.8 Die Würde gründe in der Vernunft. Mit der Zusprechung von Würde geht einher, dass diejenigen, die sich diese Würde zusprechen, qua Reflexion sich eine ihrer Vernunft entstammende Verpflichtung auferlegen, die Idee der Menschheit in der Person eines jeden, der menschliches Antlitz trägt, zu achten.9 Diese Begründung von Moralität hat zur Konsequenz, dass die qua Dichotomie von den Menschen geschiedenen Tiere und Pflanzen keine Würde haben, schon gar nicht eine der menschlichen ebenbürtige Würde, aber auch nicht eine Würde, die in ihrem Spezies-Sein liegt – also zum Beispiel die ›Schweinheit‹ im einzelnen Schwein zu achten. Damit lässt sich kein Grund finden, Achtung vor den Lebewesen zu fordern. Folglich könne, wie es bei Kant heißt, ›der Mensch‹ alles zum Mittel machen, allein die Würde-Subjekte sollen ihrerseits als Zwecke an sich geachtet werden. Folglich seien Pflanzen und Tiere grundsätzlich Mittel und unterliegen der uneingeschränkten Be- und Vernutzung durch ›den Menschen‹. Ebenso wie die bürgerliche Philosophie (gemeint: insbesondere Kant) mit liberté, égalité und fraternité das geistige Fundament für die politische Konstitution des Kapitalismus legt, legt sie auch das Fundament für dessen Zugriff auf die Natur. Mit der bürgerlichen Gesellschaft betritt eine ganz besondere Gestalt des Verhältnisses von Natur und Freiheit die historische Bühne. Zunächst soll erörtert werden, welche Rolle die Freiheit dabei spielt.
§ 2 Freiheit und ihre Dialektik
Wenn Menschen als Naturwesen und ohne Begriff der Naturprozesse auf Naturgegenstände einwirken, dann bleiben sie, wo sie doch auf die Bearbeitung der Natur angewiesen sind, dem ihnen undurchsichtigen und für sie übermächtigen Naturzusammenhang ausgeliefert. Unter solchen Bedingungen ist die gesellschaftliche Verwirklichung menschlicher Freiheit unmöglich. An die Herausbildung der neuzeitlichen Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert knüpfte sich ein Emanzipationsversprechen: Gerade indem grundlegende mechanische Vorgänge (fallende Steine, rollende Kugeln auf der schiefen Ebene, Bewegungen der Himmelskörper) mithilfe einfacher, abstrakter Prinzipien (Masse, Kraft, Differentialgleichungen) verstanden werden konnten, schien die Befreiung der Menschen von der unwirtlichen und übermächtigen ersten Natur greifbar geworden zu sein. Revolutionär war der Anspruch der neuzeitlichen Naturwissenschaften auf Wahrheit und Objektivität der Erkenntnisse.10 Auf für jedermann zugänglichen und durchsichtigen Prinzipien gegründet, zersetzten sie den »perlmutternen Dunst von Aberglauben und alten Wörtern«11. Die ersten Naturwissenschaftler verstanden sich als Repräsentanten eines Gattungsinteresses, nämlich der Naturerkenntnis durch die allgemeine Vernunft, und als Opponenten gegen eine auf falschen Grundsätzen basierende feudale Ordnung. »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. […] Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«12 So formulierte Kant den Wahlspruch der Aufklärung. Die Naturwissenschaften blamierten drastisch die alten Lehren. Die glänzenden theoretischen Erfolge der Newton’schen Mechanik waren Bestätigung der sich emanzipierenden Vernunft und begründeten den Anspruch, diese Vernunft zu verwirklichen, i. e. nach ihr die Gesellschaft einzurichten. Die auf unbegründeter Herrschaft beruhende alte Gesellschaft sollte dadurch einstürzen, »daß der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt, und die [gesellschaftliche, U.R.] Wirklichkeit nach diesem erbaut.«13 Mit der Befreiung von der ersten Natur und mit der politischen Befreiung von feudaler Herrschaft sollte in der Morgenröte von liberté, égalité und fraternité ein neues Zeitalter anbrechen. Doch als das Zeitalter erwachte, herrschten die bürgerliche Gesellschaft, die kapitalistische Produktionsweise und der bürgerliche Staat – die Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sah anders aus als erträumt. Freiheit erwies sich bei ihrer Verwirklichung als Freiheit des Kapitals und als Freiheit des in doppelter Hinsicht freien Lohnarbeiters. In diesem Verwirklichungsprozess verband die Freiheit sich mit der Unfreiheit derer, die zum Zwecke der Geldvermehrung am fremden Eigentum zu arbeiten gezwungen wurden. Die Freisetzung aus feudaler Abhängigkeit bedeutete die Installierung bürgerlicher Freiheitsrechte und die Befreiung der Produzenten von ihren Produktions- und Konsumtionsmitteln. Der Arbeiter wurde »von der Natur als seinem natürlichen Laboratorium«14 losgelöst, getrennt von den objektiven Bedingungen der Verwirklichung seines Arbeitens (von dem Arbeitsmittel und dem Arbeitsmaterial) und damit von seinem unmittelbaren Verhältnis zur Natur befreit. Was im Programm der ersten Naturwissenschaftler so verheißend klang – die Befreiung von der unwirtlichen ersten Natur – entpuppte sich in der Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft als der bürgerliche Zugriff auf die Natur. So wie die Befreiung der Arbeit aus deren feudaler Beherrschung sich mit der Genesis der bürgerlichen Gesellschaft als gedoppelte erwies, einerseits als die Befreiung zu bürgerlichen Rechtssubjekten und andererseits – und zugleich – als die Befreiung von den Produktions- und Konsumtionsmitteln, wodurch die Herrschaft des sich zum Selbstzweck aufwerfenden Kapitals installiert wurde, so erwies sich auch die Befreiung von der unwirtlichen ersten Natur als eine gedoppelte, einerseits als das in der Herausbildung der neuzeitlichen Naturwissenschaften liegende Emanzipationsversprechen und andererseits – und zugleich – als die Befreiung der Lebewesen von deren Eingebunden-Sein in ihren Artzusammenhang – eine Befreiung der Lebewesen von ihrem (vormaligen) Leben gemäß ihrem eidetischen Moment (§4). Dass die Befreiung der Natur sich als gedoppelte herausstellte, dass Befreiung nämlich bedeutete, eine bis dato unbekannte Herrschaft über die Lebewesen zu installieren und deren Leben der kapitalistischen Aneignung zu subsumieren, hängt mit der spezifischen Form bürgerlicher Herrschaft zusammen, nämlich damit, dass die Befreiung der Natur unter bürgerlichen Konditionen und auf bürgerliche Weise stattfand: unter der Dominanz des bürgerlichen Zugriffs auf die Natur und unter dem Rechtsinstitut ›Privateigentum‹ (§3). Jene aus der bürgerlichen Philosophie stammende Idee der Freiheit, wenn verwirklicht durch die Einrichtung von bürgerlicher Gesellschaft und kapitalistischer Produktionsweise, wird zur bürgerlichen Freiheit.15 Diese nimmt das Moment des Subjektiven (sowohl in den Menschen als auch in den Lebewesen), welchem Moment sie sich letztlich verdankt, in Beschlag und generiert eine in sich widersprüchliche Verdoppelung: Freiheit und Unfreiheit zugleich. Insgesamt tritt mit dem neuen bürgerlichen Zeitalter eine fatale Dialektik auf den Plan: die Dialektik der Aufklärung, die Dialektik der Freiheit, der Vernunft und der Moral. Diese Dialektik ist nicht aus sich selbst, i. e. aus ihrem Begriff, verständlich. Vielmehr wird sie durch den Zweck, Mehrwert aus der Benutzung der Arbeit zu schlagen, gestaltet und befeuert.
§ 3 Der bürgerliche Zugriff auf die Natur
Das Verhältnis von Natur und Freiheit nimmt in der bürgerlichen Gesellschaft eine für diese charakteristische Gestalt an: Auf die Natur wird zugegriffen – von einem Freiheitssubjekt und in einer besonderen, nämlich der bürgerlich-freiheitlichen Art und Weise. Diese besondere Gestalt des Verhältnisses von Natur und Freiheit ist Resultat der Geschichte. In der Tradition der Aufklärung stehend, bedeutet der bürgerliche Zugriff auf die Natur ein Stadium in der Entwicklung der Freiheit, der Befreiung von Unvernunft und Aberglaube und der Befreiung von der Übermacht der ersten Natur. Für diesen Zugriff entwirft die bürgerliche Philosophie die Prinzipien:
A. Die Natur ist für das zugreifende Freiheitssubjekt ausschließlich Objekt und passives Material. Für die belebte Natur, also für Pflanzen und Tiere, soll gelten, dass ihnen keine Würde zukomme und sie folglich keine Achtung eines in ihnen zu verortenden Zwecks verdienen.
B. Die Art und Weise des Zugriffs auf solcherart Würde-lose Sachen regelt das bürgerliche Recht. Alle diese Sachen dürfen und können zu Privateigentum, zu dem ›Meinigen‹ der Würde-Träger, werden, sollen es sogar. Dass die Sachen herrenlos, also frei von diesem herrschaftlichen Zugriff, sein können, wird ihnen nicht zugestanden, und zwar im Grundsatz nicht, wie Kant argumentiert.16 Der privateigentümliche Zugriff auf die Sachen sei Verwirklichung von vernünftiger Freiheit. Solcherart philosophische Rechtfertigung des Privateigentums ist ein Eckpfeiler des bürgerlichen Rechts, welches, wenn installiert durch den bürgerlichen Staat, zur unerlässlichen Voraussetzung für die Herrschaft des Kapitals über die Natur wird. Unter dem Banner, vernünftige Freiheit solle nun endlich uneingeschränkt verwirklicht werden, erobert das Kapital den Planeten und insbesondere dessen Flora und Fauna. Alle äußeren Gegenstände werden zu Privateigentum und zu Waren gemacht und damit der rentierlichen Benutzung durch die Privateigentümer ausgesetzt. Und genau darin liegt das bürgerliche Emanzipationsversprechen: Freiheit für die als Privateigentümer sich verwirklichenden einzelnen Bürger und Befreiung von den Zwängen der ersten Natur durch deren kapitalistische Aneignung.
C. Die Natur wird vorgestellt, als bestehe sie aus nichts anderem als aus Materie und Energie. Eine solche Natur gilt als wertfrei, als frei von moralisch relevanten Werten; moralisch hier gemeint im Sinne der Bestimmung der Freiheit durch die Vernunft. Und eine solche Natur gilt als frei von ideell zu erfassenden Entitäten, von den ›alten‹ Substanzen oder den εἴδη der Metaphysik. Vor dem Richterstuhl aufklärerischer Vernunft lösen die εἴδη, entstammend einer überholten Zeit, sich in Aberglauben auf; die neu aufkommenden Naturwissenschaften (Modell war die klassische Mechanik) verfolgen das Ziel, die Natur strikt ohne die Annahme dubioser metaphysischer Substanzen zu erklären. Fazit: Im bürgerlichen Zeitalter wird die Natur so aufgefasst und dementsprechend auch so behandelt, als habe sie selbst keinen moralischen Wert und als enthalte sie an sich keine ideellen Zwecke. Doch für die belebte Natur trifft das nicht zu. 150 Jahre nach Kant erkennt die Biologie, dass der für die belebte Natur zentrale Begriff, der Art-Begriff, ohne den allein ideell bestimmbaren Begriff des Zwecks nicht gedacht werden kann.17Was eine Art ist, kann nicht allein durch physikalische und chemische Begriffe (Masse, Kraft, Energie, Mol usw.) erklärt werden. Dieses Was-Sein einzelner Lebewesen (ihr Wesen) fasste Aristoteles als objektives, mit ihnen existierendes εἶδος. Darwin, indem er aufzeigte, dass es Evolution gibt, widerlegte die Vorstellung eines metaphysisch verankerten, gegen empirische Veränderungen konstanten εἶδος. Der moderne biologische Art-Begriff – »Arten sind Gruppen sich miteinander kreuzender natürlicher Populationen, die hinsichtlich ihrer Fortpflanzung von anderen derartigen Gruppen isoliert sind«18 – findet heraus, dass es einen objektiven Zweck gibt, die Erhaltung der Art. So werden die Lebewesen einer Population durch ein Ideelles zu ihrer objektiven Einheit als Art geformt. Was die Einheit der Art und damit deren Bestimmtheit und Abgrenzung gegen andere Arten gewährleistet, sind Isolationsmechanismen und Einpassung in eine ökologische Nische. Das, was das Eidetische der Art ausmacht, ihre dreifach bestimmte integrierte Einheit – Arten sind Reproduktionsgemeinschaften, ökologische Einheiten und genetische Einheiten –, wird in dem Prozess der Fortpflanzung der Lebewesen herausgebildet und erhalten. Traditionell nannte man das, was eine Fortpflanzungsgemeinschaft zur Art prägt, deren substantielle Form. Modern muss formuliert werden: Die Arten enthalten ein eidetisches Moment. Darin ist jenes objektive εἶδος der Tradition aufgehoben – negiert und aufbewahrt zugleich. Als eidetisch bestimmte Einheiten – traditionell: als Wesenheiten oder substantielle Formen – sind die Arten Bausteine der Evolution.
Die Kant’sche Philosophie, bürgerliche Philosophie par excellence und Wegbereiterin der bürgerlichen Revolution, weist einen an sich seienden, die belebte Natur formenden objektiven Zweck zurück und bestimmt die Natur als bloßes Material, als unbestimmte Projektionsfläche und passiv bleibende Grundlage für den Zugriff des Subjekts oder der Vernunft. Die bürgerliche Gesellschaft, verwirklichend jene bürgerliche Philosophie, setzt an die Stelle von ›Subjekt‹ oder ›Vernunft‹ das wirkliche Kapital und den wirklichen bürgerlichen Staat. Mit ihrem Naturbegriff spricht die bürgerliche Philosophie der Natur jeglichen Eigensinn, also eine zu achtende, in eigenen Zwecken gründende Eigenständigkeit, ab und liefert eine auf solche Weise ideell depravierte Natur der uneingeschränkten und absolut gesetzten bürgerlichen Freiheit aus. Die bürgerliche Konstruktion insgesamt – auf der einen Seite die Überhöhung des Subjekts, auf der anderen die Herab- oder gar Ent-Würdigung der Natur – dient dazu, den Zugriff des Kapitals auf die Natur mit der Gloriole zu versehen, die fortschreitende kapitalistische Entwicklung sei Fortschritt in weltbürgerlicher Absicht. Doch was bürgerliche Philosophie als die politische Emanzipation des Subjekts von feudaler Herrschaft (liberté, égalité und fraternité der Französischen Revolution) und als die auf die materiellen Lebensbedingungen zielende Emanzipation der gegenständlichen Arbeit vom Naturzwang pries, erwies sich durch die mit der bürgerlichen Revolution in Szene gesetzte kapitalistische Produktionsweise in Wahrheit als Unterwerfung der Subjekte unter den von ihnen im Lohnarbeitsverhältnis produzierten Mehrwert und als Unterjochung der Natur genau für diesen Zweck der Mehrwertproduktion – auch dies eine Gestalt der Dialektik der Aufklärung.
Kommunisten wie Marcuse aufbegehren nicht nur gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern ebenso sehr auch gegen das Privateigentum an der Natur. Bürgerliche Philosophie indes gibt den privateigentümlichen Zugriff auf die Natur als die Verwirklichung von vernünftiger (eben bürgerlicher) Freiheit aus. In einer prominenten Variante des Marxismus, welche damit in fataler Weise das bürgerliche Erbe antrat, wurde und wird das ähnlich gesehen. Auch dort soll die Natur bloßes Objekt, eben Substrat für die Entwicklung der Produktivkräfte sein.19 Weder, so diese Variante, werde die Natur beherrscht (nicht durch das Kapital, auch nicht durch das Politbüro und dessen oberste Planungsbehörde) noch sei sie selbst der Emanzipation fähig oder bedürftig. Die Entwicklung der Produktivkräfte, wenn nicht mehr vom Kapital gefesselt, verspreche per se Emanzipation. Doch stimmt es denn, dass die Natur lediglich das passive Material für die Entwicklung der Produktivkräfte sei? Ist die Natur bloß dazu da, um von der eminent von ihr unterschiedenen menschlichen »Kausalität durch Freiheit« benutzt zu werden, oder besteht die Natur – und das wäre dann eine Wesensbestimmung der Natur, die in der befreiten Gesellschaft historisch zum ersten Male zur Entfaltung käme – »auch ›um ihrer selbst willen‹ und – in dieser Daseinsweise – für den Menschen?«20
§ 4 Das Zugreifen auf die Natur wird zu dem Zurichten der Natur, das Zurichten der belebten Natur entpuppt sich als Herrschaft über sie
Die bürgerliche Freiheitsphilosophie rechtfertigt den Zugriff auf die Natur. Mittels des Privateigentums geraten die Lebewesen unter die von moralischer Rücksicht befreite, schrankenlose Verfügungsgewalt der Subjekte. In der Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft tritt an die Stelle des von jener Philosophie exponierten ›Subjekts‹ das Kapital. Als alleinigen und an sich maßlosen Zweck kennt das Kapital nur die Vermehrung seines Werts. Dieser Zweck abstrahiert von jeglichem Gebrauchswert und ist deswegen gleichgültig gegen dessen besondere Gestalt. Mithin abstrahiert das Kapital, dem es nur um sich selbst, nämlich um die Vermehrung abstrakten Reichtums, geht, insbesondere davon, dass die Lebewesen durch ein sie artspezifisch formendes, eidetisches Prinzip bestimmt werden und dass ihr Leben in Populationsgemeinschaften und in einem wechselwirkenden Zusammenhang mit anderen Populationsgemeinschaften anderer Spezies stattfindet. Folge dieses Abstrahierens ist zunächst die Gleichgültigkeit des Kapitals gegen das eidetische Prinzip. Doch dabei bleibt es nicht. Da der Verwertungsprozess sich selbst notwendigerweise als die Naturzusammenhänge beherrschend setzt, geht er zum Angriff auf das artspezifische Leben über. Er nimmt Rücksicht weder auf die substantielle Bestimmtheit der Arten (das Kapital nutzt die durch die Gentechnik sich eröffnenden Möglichkeiten, um die Arten dem Verwertungszweck gemäß zu modellieren) noch auf das Zusammenleben der Lebewesen in Populationsgemeinschaften (das Kapital unterbindet artspezifisches Verhalten in der Massentierhaltung, entfernt solche Arten, welche die Verwertung behindern, aus dem Ensemble von Populationen – durch Lebensraumzerstörung, Pestizid-Einsatz u.v.a.m.). Das Kapital kann die belebte Natur nicht belebte Natur sein lassen. Genauso wenig – und darin liegt die Analogie – wie das Kapital die lebendige Arbeit in den über Jahrhunderte herausgebildeten Formen handwerklichtechnischer Tätigkeit sein lassen kann. Die innerhalb der Bewegung des Kapitals notwendig gesetzte Kollision mit den in Relation zur Dynamik des Kapitals vergleichsweise unverändert verharrenden eidetischen Formen der Lebewesen führt zu deren Zurichtung nach Maßgabe des abstrakten Kapitalzwecks, was für die so spezifischen und eigentümlichen Formen bedeutet, dass ihre Eigenständigkeit gebrochen, ihre widerborstigen Eigenheiten abgeschliffen und insgesamt die Lebewesen für die Rentabilität des Kapitals passend und gefügig gemacht werden. Die Lebewesen werden dem Kapital reell subsumiert.21
§ 5 Eine Analogie: Die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit unter das Kapital und die reelle Subsumtion der Lebewesen unter das Kapital
Marx unterscheidet formelle und reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital. Generell gilt im Kapitalismus, dass der Arbeitsprozess zum Mittel des Verwertungsprozesses wird und deswegen der Zweck des Kapitals, Mehrwert zu produzieren, den Arbeitsprozess und den Arbeiter beherrscht: »Das Capitalverhältniß [ist, U.R.] Zwangsverhältniß, um Mehrarbeit zu erzwingen […]«22. »Der Arbeitsproceß wird zum Mittel des Verwerthungsprocesses, des Processes der Selbstverwerthung des Capitals – der Fabrikation von Mehrwerth. Der Arbeitsproceß wird subsumirt unter das Capital (es ist sein eigner Prozeß) und der Capitalist tritt in den Proceß als Dirigent, Leiter; es ist für ihn zugleich unmittelbar Exploitationsproceß fremder Arbeit. Dieß nenne ich die formelle Subsumtion der Arbeit unter das Capital.«23 »Der Arbeitsproceß, technologisch betrachtet, geht grad vor sich wie früher, nur jetzt als dem Capital untergeordneter Arbeitsproceß.«24 Dessen gesellschaftliche Form wird durch den Zweck bestimmt, aus Geld mehr Geld zu machen. Allein die gegenständliche Seite oder die technische Basis des formell subsumierten Arbeitsprozesses betrachtet, bleibt es beim »handwerksmässige[n] Betrieb, worin die mehr oder minder kunstmässige Handhabung des Arbeitsinstruments der entscheidende Factor der Production ist«.25 Doch das kapitalistische Prinzip, wenn erst einmal installiert, erfasst die gegenständliche Seite und wälzt den Arbeitsprozess um: eine »([…] sich beständig fortsetzende und wiederholende) Revolution in der Productionsweise selbst«.26 Angetrieben durch die Produktion des relativen Mehrwerts wird »die ganze reale Gestalt der Productionsweise [ge]ändert«27. Erst dann, wenn die »reale Natur des Arbeitsprocesses und seine realen Bedingungen« umgewandelt worden sind, herrscht die eigentliche »capitalistische Productionsweise«28. In dieser »findet statt reelle Subsumtion der Arbeit unter das Capital«29.
Im Einzelnen bedeutet reelle Subsumtion: »Es werden die socialen Productivkräfte der Arbeit entwickelt und es wird mit der Arbeit auf grosser Stufenleiter die Anwendung von Wissenschaft und Maschinerie auf die unmittelbare Production.«30 Die reelle Subsumtion ist »eine veränderte Gestalt der materiellen Production«, »eine Productionsweise sui generis«31. Der »Arbeitsproceß« streift seinen »individuellen Charakter« ab, es wird auf »gesellschaftlicher Stufenleiter« produziert, die »gesellschaftlichenProductivkräfte der Arbeit« werden enorm gesteigert, desgleichen die »Masse der Production«32.
»›Production um der Production‹ willen – Production als Selbstzweck – tritt zwar schon ein mit der formellen Subsumtion der Arbeit unter das Capital, sobald es überhaupt unmittelbar Zweck der Production wird, möglichst grossen und möglichst viel Mehrwerth zu produciren […]. Indes realisirt sich diese dem Capitalverhältniß immanente Tendenz erst in adaequater Weise – und wird selbst eine nothwendige Bedingung, auch technologisch – sobald sich die spezifisch capitalistische Productionsweise und mit ihr die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Capital entwickelt hat.«33
Fazit: Die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit unter das Kapital bewirkt eine grundlegende Umgestaltung der technischen Seite des Arbeitsprozesses. Dadurch wird es dem Kapital möglich, dem arbeitenden Subjekt die Verfügung über den Arbeitsprozess zu entwinden. Nicht mehr das in langer Erfahrung entwickelte Geschick, die Intuition und eine vom Kapital nicht beherrschbare Eigensinnigkeit der Handwerker inmitten ihrer handwerklichen Tätigkeit zählen, sondern allein der Kapitalzweck, der sich vermittels der wissenschaftlichen Durchdringung des Arbeitsprozesses durchsetzt. Die Produktivkraft der Arbeit wird zur Produktivkraft des Kapitals; die kapitalistische Maschinerie wendet den Arbeiter an. Das Kapital verringert die notwendige Arbeit, um die Surplus-Arbeit, die Basis für den Mehrwert, zu vergrößern – mit ruinösen Folgen für die arbeitenden Subjekte. Damit untergräbt es tendenziell die Grundlage seines Produzierens, nämlich dass der geschaffene Reichtum sein Maß in der verausgabten Arbeit hat.
Führt man sich vor Augen, in welch radikaler Weise die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit in deren erscheinende Wirklichkeit eingreift, dann liegt es nahe, eine Struktur-Ähnlichkeit bei der durch die kapitalistische Landwirtschaft bewirkten Umgestaltung der Lebensprozesse der Lebewesen zu vermuten. Von daher rührt die zentrale These des Aufsatzes:
Analog zur lebendigen Arbeit werden die Lebewesen unter das Kapital reell subsumiert.
Ebenso wie der Arbeitsprozess werden auch die Lebensprozesse derjenigen Lebewesen, die zu Waren gemacht wurden, zum Mittel des Verwertungsprozesses. Der Zweck des Kapitals, aus vorgeschossenem Geld einen Profit zu erzielen, beherrscht das Leben dieser Lebewesen. Die Lebensprozesse werden unter das Kapital subsumiert; in der Folge werden sie zum »eigne[n] Prozeß« des Kapitals, das als »Dirigent, Leiter« des Lebens der Lebewesen auftritt. Letztere sind Material für das Profite-Machen. Dies kann – analog zur lebendigen Arbeit – als die formelle Subsumtion der Lebewesen unter das Kapital begriffen werden. Betrachtet man diese Subsumtion in einem theoretisch-systematischen Sinne, also ohne ihr empirisch-historische Prozesse zuzuordnen, kann man als ersten Schritt und (theoretischen) Ausgangspunkt konstruieren: Das Leben der Lebewesen »geht grad vor sich wie früher« (das heißt wie vor der Subsumtion), nur jetzt als ein der Rechnungsweise des Kapitals unterstelltes Leben. Doch bei einem artgemäßen, das eidetische Moment achtenden Leben kann es für die Lebewesen nicht bleiben, wenn sie erst einmal Privateigentum des Kapitals geworden sind. Das kapitalistische Prinzip erfasst Leben und Lebensbedingungen und wälzt all dieses völlig um. Was Marx und Engels insgesamt für die revolutionäre Umwälzung durch die Bourgeoisie konstatieren – »Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht«34 – gilt auch hier. Die Lebewesen und ihre besonderen, durch die Evolution entwickelten Formen sind ganz und gar nicht ›heilig‹. Keine ›Einzelheit‹ ihres Lebens und nicht zuletzt auch ihres Verhaltens bleibt unangetastet, wenn Änderungen Profit versprechen: die Länge des Lebens der Tiere, die Qualität ihrer Nahrungsmittel, die Art ihrer Nahrungsaufnahme, der ihnen noch vergönnte Lebensraum, ihr Leben in ökologischen Zusammenhängen usw. Der Lebewesen »reale Natur« (ihre genetische Substanz, der Genpool, die eidetischen Momente) gerät ins Fadenkreuz der Optimierung für den Kapitalzweck. Genau dies – der alles umwälzende, modellierende Zugriff – macht die eigentliche oder spezifische kapitalistische Produktionsweise in der Sphäre der Landwirtschaft aus. Darin findet ›reelle Subsumtion der Lebewesen unter das Kapital‹ statt.
Im Einzelnen bedeutet diese reelle Subsumtion: »[D]ie Anwendung von Wissenschaft und Maschinerie auf die unmittelbare Production«35, »eine veränderte Gestalt der materiellen Production«, »eine Productionsweise sui generis«, »[…] ein bestimmtes und stets wachsendes Minimum an Capital in der Hand des einzelnen Capitalisten [sind, U.R.] einerseits nothwendige Voraussetzung, andrerseits beständiges Resultat der spezifisch capitalistischen Productionsweise«36. Die Tierhaltung in der kapitalistischen Landwirtschaft streift ihren »individuellen Charakter« ab, gleiches gilt zum Beispiel für die Obstplantagen. Es wird auf »gesellschaftlicher Stufenleiter« produziert, die »gesellschaftlichen Productivkräfte der Arbeit« werden enorm gesteigert, desgleichen die »Masse der Production«37. »›Production um der Production‹ willen – Production als Selbstzweck – […] wird selbst eine nothwendige Bedingung, auch technologisch – sobald sich die spezifisch capitalistische Productionsweise und mit ihr die reelle Subsumtion der [Lebewesen (analog zu: Arbeit), U.R.] unter das Capital entwickelt hat.«38 – Wie »die spezifisch capitalistische Productionsweise« und mit ihr die reelle Subsumtion der Lebewesen unter das Kapital in concreto aussehen, das führt die kapitalistische Milchproduktion vor Augen39: Seit der Jahrtausendwende wurde die ›Milchleistung‹ pro Kuh von durchschnittlich 7000 Liter pro Jahr auf 9150 Liter gesteigert; das ist doppelt so viel wie noch vor 40 Jahren. Inzwischen werden auf erhöhte ›Milchleistung‹ gezüchtete Rassen in die Ställe eingestellt. Die Turbo-Milchkühe geben nur Milch, wenn sie Nachwuchs haben. Damit die Milch stetig fließt, werden die Kühe zwei, drei Monate nach der Geburt ihres Kalbes erneut besamt, so dass jedes Jahr ein Kalb zur Welt kommt. Dieser Eingriff in die natürlichen Abläufe der Art Bos taurus macht sinnfällig, dass die Lebensprozesse der Hausrinder vom Kapital subsumiert und zu dessen »eigne[m] Prozeß« gemacht wurden. Ist die Milch Warenkapital, wird es zur question de vie et de mort für das Kapital, die Milchproduktion auszuweiten. Dementsprechend wandelt es die natürlichen Abläufe um und optimiert sie. Marx legt dar, dass das Kapital den Zweck seiner Vermehrung selbst setzt und mithin die Produktion um der Produktion willen »eine nothwendige Bedingung, auch technologisch«, wird und dass genau dies die reelle Subsumtion charakterisiert. Und noch ein zweiter Punkt wird an dem ausgeführten Demonstrationsbeispiel deutlich: Die kapitalistische, sich als Selbstzweck setzende Produktion gerät in Widerspruch zu der die Art Bos taurus spezifisch auszeichnenden, besonderen Zweckmäßigkeit. Für letztere ist ein eidetisches Moment, ein Moment des Subjektiven, konstitutiv. Sind die Hausrinder Eigentum des Kapitals, wird diese besondere Zweckmäßigkeit in eine widersprüchliche Einheit mit dem Selbstverwertungszweck gezwungen. Letzterer gewinnt so viel Macht über das Leben der Hausrinder, dass diese innere Widersprüchlichkeit eine an der natürlichen Zweckmäßigkeit des Bos taurus gemessen aberwitzige Erscheinungsform bekommt: Der durch den Kapitalzweck umgestaltete Lebensprozess der Hausrinder produziert Wegwerfkälber. Geschuldet der aufgrund der akkumulierenden Verwertung des Werts ausgeweiteten Milchproduktion kommen ›zu viele‹ Kälber auf die Welt. Etwa die Hälfte dieser Kälber ist (naturgemäß) männlich. Die auf Milcherzeugung spezialisierten Landwirte können mit Bullenkälbern, die schließlich keine Milch geben, nichts anfangen. Etwas, das für eine Art der Säugetiere natürlicherweise nicht nur dazugehört, sondern wesentlich ist, nämlich dass es männliche Tiere gibt, erscheint, wenn der Lebensprozess der Art zum eignen Prozess des Kapitals geworden ist, als verkehrt: Die Bullenkälber sind auf einmal überzählige Lebewesen.40 Hinzu kommt, dass Bullenkälber von auf Milchleistung hochgezüchteten Rassen weniger Fleisch ansetzen. Solche ›zu dürren‹ Bullenkälber kosten in der Aufzucht mehr, als ihr Verkauf bringt. Häufig werden sie vernachlässigt, schlechter versorgt als die weiblichen Kälber und bei Krankheiten nicht behandelt. Von den Kuhkälbern braucht der Betrieb nur gut die Hälfte als Nachwuchs für wegen abfallender Milchleistung ›ausscheidende‹ Milchkühe. Die restlichen sind gleichfalls überflüssig, ebenso wie insgesamt die Bullenkälber. Ihre Ernährung produziert Kosten, faux frais. Ob männlich oder weiblich, die Kälber werden schon wenige Tage nach ihrer Geburt von den Mutterkühen strikt getrennt. Sie bekommen nicht die Milch der Mütterkühe, vielmehr Milchersatz auf der Basis von Pflanzenfetten und billigem Eiweiß, zusammen mit Kraftfutter. Zehn Prozent der Kälber sterben in den ersten drei Monaten. Eilends werden die elend lebenden41 Kälber verkauft. Nachdem sie in Lastwagen gezwängt und über die Autobahn nach Spanien und Nordafrika transportiert worden sind, setzen sie ihr elendes Leben in Massenproduktions-Mästereibetrieben fort. Da dort sehr viele Kälber, die von jeweils verschiedenen Milchproduktionsbetrieben stammen, auf engstem Raum, dabei die Minimalgrenzen der staatlichen Vorgaben ausschöpfend, zusammengepfercht werden – auch dort herrscht das Prinzip ›Produktion um der Produktion willen‹ –, werden in das Futter der Tiere vorbeugend Antibiotika gemischt usw. usf.
Werden zwei verschiedene Prozesse miteinander verglichen und werden beide als zueinander analog erkannt, dann liegt die Vermutung nahe, in den Verglichenen könne derselbe λόγος aufzufinden sein. Dieser λόγος, der in den gerade behandelten Fällen der Subsumtion der lebendigen Arbeit und der Subsumtion der Lebewesen analog von ›reeller Subsumtion‹ sprechen lässt, ist: die Herrschaft des Kapitals über ein ›Subjektives‹ und die dadurch in Gang gesetzte Umformung des Beherrschten (sowohl der Arbeitsprozesse als auch der Lebewesen). Urteilt man über die ökonomische Funktion, welche die lebendige Arbeit und welche die Lebewesen für den Kreislauf des Kapitals haben, und folgt dabei der Systematik des ersten Bandes des Kapital, dann fungiert die lebendige Arbeit als variables Kapital – die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit fällt systematisch in den Abschnitt Produktion des relativen Mehrwerts42; die Lebewesen hingegen fungieren als konstantes Kapital – die reelle Subsumtion der Lebewesen fällt systematisch in das fünfte Kapitel des ersten Abschnitts im dritten Band des Kapital: Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals.43 In der ökonomischen Funktion für das Kapital gibt es die gewichtige Differenz: Die Benutzung der lebendigen Arbeit durch das Kapital ist die Quelle des Mehrwerts. Die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit ist daher Mittel für das Kapital, um die Rate des Mehrwerts zu erhöhen, was Marx unter ›Produktion des relativen Mehrwerts‹ behandelt. Hingegen ist die Benutzung der Lebewesen durch das Kapital nicht Quelle von Mehrwert, sondern eine Quelle von Profit. Dass die Lebewesen als Quelle von Profit dienen, bekommen sie an ihrem eigenen Leibe zu spüren. Die Macht des Kapitals ist nicht weniger zupackend, wenn der Antrieb, das Leben der Lebewesen umzuwälzen, in der Erhöhung der Profitrate liegt und nicht in der Erhöhung der Mehrwertrate. Was in beiden Fällen von ›reeller Subsumtion unter das Kapital‹ sprechen lässt und die Analogie ermöglicht: Das Kapital herrscht über ein Subjektives. Dieses Subjektive wird bis in sein Innerstes hinein umgeformt und dem Verwertungszweck passend gemacht. Bei Marx ist der Begriff ›reelle Subsumtion‹ auf die reelle Subsumtion der lebendigen Arbeit restringiert; die hier vorgeschlagene Erweiterung des Begriffs auch auf Lebewesen findet sich nicht in seinen Schriften. Allerdings konnte Marx den erst hundert Jahre später entwickelten biologischen Artbegriff – ein immenser theoretischer Fortschritt der Biologie! – nicht vorausahnen, und vor allem kannte er nicht die Wirklichkeit der reellen Subsumtion von Lebewesen der Art Gallus gallus domesticus und deren Zurichtung zu Masthühnern in den kapitalistischen Hähnchenfleischfabriken. Eine Vorstellung dessen, was der bürgerliche Zugriff auf die Natur für dieselbe bedeutet, hatte Marx allerdings schon – mag sein, dass vor seinem inneren Auge die englischen Kohlengruben und die Baumwollplantagen in Indien erschienen waren: »Die kapitalistische Produktion entwickelt […] nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.«44 Der bürgerliche Zugriff auf die Natur untergräbt deren Grundlagen. Was untergraben wird, droht einzustürzen. Marx verwendet für die Folgen, welche die Zugriffe des Kapitals auf den Arbeiter und auf die Natur nach sich ziehen, ein und dasselbe Verb (›untergraben‹) – ein Indiz dafür, dass er in diesen Zugriffen eine ›Verwandtschaft‹ sah.
Die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital enthält einen Widerspruch, den Widerspruch zwischen dem Kapital und der lebendigen Arbeit. Warum? Wo liegt der Widerspruch? Der Zweck, der das Kapital charakterisiert (die Vermehrung abstrakter Arbeit, des Werts) und der Zweck, der den Menschen und dessen Arbeitsvermögen charakterisiert (die Entfaltung menschlicher Wesenskräfte), stehen, logisch betrachtet, im Verhältnis des Gegensatzes: Arbeit ist nicht Kapital, sie ist das Nicht-Kapital par excellence. Ist jedoch die Arbeitskraft zur Ware geworden, kann sie vom Kapital gekauft werden. Geschieht dies, wird das Arbeitsvermögen des Arbeiters zum Eigentum des Kapitals (zu ›v‹, dem variablen Kapital, einem Bestandteil des Kapitals) und damit dem Kapital inkorporiert. Mit dem Kauf der Ware Arbeitskraft erlangt der Kapitalist die Verfügung über die lebendige Arbeitstätigkeit und wird Dirigent und Leiter des Arbeitsprozesses. Dadurch, dass die Arbeitskraft, die lebendige Arbeitstätigkeit und deren Produkte zu Momenten der Bewegung des Kapitals und mithin letzterem unterworfen werden, werden Kapital und Nicht-Kapital (lebendige Arbeit) in eine Einheit versetzt. Mit dieser Einheit wird für beide Seiten, die zuvor im Verhältnis des Gegensatzes standen, ein Widerspruch generiert, den es erst durch die kapitalistische Produktionsweise gibt. Marx sagt dazu: Die Arbeit werde unter das Kapital reell subsumiert – die Unterordnung unter das Kapital ergreife die ›Realität‹ der Arbeit, menschliche Zwecke werden passend zugerichtet oder unterbunden. Also ist die reelle Subsumtion der Arbeit ein in der Wirklichkeit stattfindender Prozess, dem zugrunde liegt, dass Kapital und Nicht-Kapital (lebendige Arbeit) in eine in sich widersprüchliche Einheit gebracht worden sind. Aufgrund dessen, dass der Trieb des Kapitals nach Verwertung grundsätzlich maßlos ist, stellt sich diese Einheit – und damit die reelle Subsumtion der Arbeit – als »processirende[r] Widerspruch«45 heraus. Es ist der Widerspruch zwischen »der auf eine reine Abstraction reducirten Arbeit und der Gewalt des Productionsprocesses[,] den sie bewacht«46. »Das Capital ist selbst der processirende Widerspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduciren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maaß und Quelle des Reichthums sezt. […] Nach der einen Seite ruft es [das Capital, U.R.] also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Combination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichthums unabhängig (relativ) zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der andren Seite will es diese so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit, und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffnen Werth als Werth zu erhalten [und zu vermehren, U.R.].«47
Indem das Kapital den Wert als einziges Maß und Quelle des gesellschaftlichen Reichtums setzt und zugleich die Loslösung von dieser Basis initiiert, untergräbt es die lebendige Arbeit: Die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital ist die Verlaufsform, mithin die Wirklichkeit jenes »processirende[n] Widerspruch[s]«.
Auch die reelle Subsumtion der Lebewesen unter das Kapital enthält einen Widerspruch. Warum? Worin liegt er? Den Lebewesen eignet eine an sich seiende Zweckmäßigkeit: die den Lebewesen eigentümliche – ihre eidetische – Form, ihre ›Eigensinnigkeit‹, welche Zweckmäßigkeit, logisch betrachtet, im Verhältnis des Gegensatzes zum abstrakten Zweck der Kapitalvermehrung steht. Das Kapital bezieht sich notwendig auf Lebewesen, eine Notwendigkeit, die nicht im Verwertungsprozess, sondern in der Gebrauchswert-Seite der gesellschaftlichen Produktion gründet. Letztere ist auf Lebewesen angewiesen. Sind sie zu Waren gemacht worden, und kauft ein Kapitalist solche Lebewesen, wird ihre eigentümliche ›Eigensinnigkeit‹ (ihre ansichseiende Zweckmäßigkeit) zum Eigentum des Kapitals. Damit sind die Lebewesen zu konstantem Kapital (und zu Warenkapital) geworden. Der Kapitalist erlangt die Verfügung über ihr Leben und wird ihr Dirigent und Leiter. Dadurch, dass die Lebewesen zu Momenten der Bewegung des Kapitals und mithin letzterem unterworfen werden, wird der Kapitalzweck in eine Einheit mit der in den eidetischen Formen gründenden Zweckmäßigkeit der Lebewesen versetzt. Mit dieser Einheit wird für diejenigen Zwecke, die zuvor im Verhältnis des Gegensatzes standen (abstrakter Zweck der Kapitalvermehrung versus konkrete Zweckmäßigkeit der eidetischen Formen) ein Widerspruch generiert, der das Verhältnis des Kapitals zur belebten Natur charakterisiert. Analog zur reellen Subsumtion der Arbeit kann man sagen: Die Lebewesen werden unter das Kapital subsumiert – die Unterordnung unter das Kapital ergreift die ›Realität‹ ihres Lebens. Dem Begriffe nach betrachtet ist diese Subsumtion zunächst formell. Zwangsläufig, da die formelle Subsumtion lediglich formale Voraussetzung, nicht aber ein in der (empirischen) Wirklichkeit fixierbarer Zustand ist, verwandelt sich die formelle Subsumtion in die reelle. Das kapitalistische Prinzip, wenn einmal installiert, erfasst die gegenständliche Seite, i. e. die Wirklichkeit des Lebens der Lebewesen, und wälzt dieses Leben radikal um. Die Zwecke der Lebewesen werden passend zugerichtet oder unterbunden. Die reelle Subsumtion der Lebewesen ist ein in der Wirklichkeit stattfindender Prozess, dem zugrunde liegt, dass der abstrakte Zweck der Kapitalvermehrung und die konkrete Zweckmäßigkeit der Lebewesen in eine in sich widersprüchliche Einheit gebracht worden sind. Aufgrund dessen, dass der Trieb des Kapitals nach Verwertung grundsätzlich maßlos ist, stellt sich diese Einheit – und damit die reelle Subsumtion der Lebewesen – als ein »processirende[r] Widerspruch« heraus. Die auf eine reine Abstraktion reduzierte Arbeit und der unendliche Reichtum der lebenden Organismen, wenn in das Kapital inkorporiert, widersprechen einander. Prozessierend ist dieser Widerspruch, weil auf der einen Seite das Kapital die Produktion von Lebewesen schrankenlos ausweitet. Dazu ruft es alle Mächte der Wissenschaft ins Leben, um die artspezifischen Besonderheiten von Tieren und Pflanzen zu nutzen und dabei fortlaufend, in experimentierender Weise verfahrend, zu modellieren. Doch damit einhergehend – und das ist die andere Seite – greift solcherart Ausweitung die natürliche Grundlage der Produktion an. Angetrieben durch den abstrakten Zweck der Kapitalvermehrung, stößt die schrankenlose Ausweitung auf das endliche und distinkte eidetische Moment, das eo ipso ihr widerstreitet und deswegen nicht dem maßlosen Zweck passend zugerichtet werden kann. Beispiele: Die Verkürzung der Umschlagszeit des Kapitals führt dazu, die Hähnchenfleischproduktion so zu optimieren, dass passgenaue Rassen gezüchtet und diese einer Turbomast ausgesetzt werden; die bedauernswerten Lebewesen können schon nach 35 Tagen geschlachtet werden – und müssen dies auch, denn viel länger können sie nicht leben, weil ihr Skelett das schnell wachsende Körpergewicht nicht mehr tragen kann. Die Ausweitung der Mastbullen-Produktion erfordert einen wachsenden Antibiotika-Einsatz, der gefährlich ansteigende Resistenzen erzeugt. Insgesamt betrachtet werden Tiere und Pflanzen – extensiv und intensiv – immer rigoroser zu Momenten der Kapitalverwertung gemacht. Dabei kennt das Kapital keine Moral, weder den Menschen noch den eidetischen Formen von Pflanzen und Tieren gegenüber. Deren eidetische Formen halten der unbarmherzigen Dynamik des Kapitals nicht mehr stand. Im Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 202148 wird auf das dramatische Ausmaß des Biodiversitätsverlustes hingewiesen. Bereits eine Million der geschätzt acht Millionen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten auf der Erde ist vom Aussterben bedroht. Das Kapital weitet die natürlichen Grundlagen der Produktion (Lebewesen) aus und greift sie zugleich an. So entpuppt sich das Verhältnis des Kapitals zur belebten Natur – ganz analog zum Verhältnis des Kapitals zur lebendigen Arbeit – als ein »prozessierende[r] Widerspruch«. Das Kapital untergräbt sowohl die Arbeit als auch die belebte Natur.
Die Analogie der Aneignung und Zurichtung der belebten Natur durch das Kapital zur reellen Subsumtion der lebendigen Arbeit unter das Kapital gründet darin, dass das Kapital über ein Subjektives herrscht: zum einen über die lebendige Arbeit, zum anderen über das eidetische Moment der Lebewesen. Der Kapitalzweck setzt sich durch, indem er dieses Moment des Subjektiven in der Natur umformt – gleichgültig dagegen, was diese Umformung für die Lebewesen bedeutet und gleichgültig dagegen, ob diese Umformung ökologische Zusammenhänge derart ramponiert, dass Arten massenhaft aussterben. Dass es eine solche Analogie gibt, ist nicht ohne politische Bedeutung. Wenn die Arbeiter begreifen, dass auch die Lebewesen vom Kapital reell subsumiert werden, können sie einem Gemeinsamen auf die Spur kommen: Die Befreiung der belebten Natur und die Befreiung der lebendigen Arbeit sind miteinander verwandt. Ohne den Kampf gegen die zerstörerische Herrschaft des Kapitals über die Natur ist die »menschliche Emancipation«49 zum Scheitern verurteilt.
§ 6 Warum das die Lebewesen kennzeichnende eidetische Moment Moralität ihnen gegenüber begründet
Dass die kapitalistische Benutzung die belebte Natur zurichtet, wird oftmals festgestellt. Dass diese Zurichtung in Wahrheit sich als Herrschaft des Kapitals über die Natur erweist, ist weniger geläufig. Herrschaft setzt voraus, dass es ein herrschendes und ein beherrschtes Subjekt gibt. Ersichtlich ist die Natur kein Subjekt. Aber damit ist die Frage, ob es eine Herrschaft über die Natur gebe, nicht vom Tisch. Die menschliche Vernunft begreift, dass, um zu erkennen, was ein Lebewesen ist