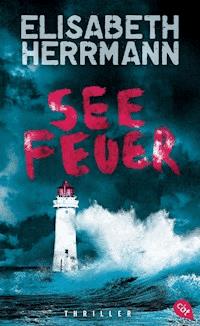9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Judith-Kepler-Roman
- Sprache: Deutsch
Judith Kepler ist ein Cleaner. Sie kommt, wenn die Spurensicherung geht. Sie macht aus Tatorten wieder bewohnbare Räume. Doch dann begegnet sie in der Wohnung einer grausam ermordeten Frau ihrer eigenen Kindheit. Es ist Judiths verschollene Heimakte. Als kleines Mädchen wurde Judith unter nie geklärten Umständen in ein DDR-Waisenhaus gebracht. Judith dunkelstes Geheimnis – in den Händen einer Fremden? Als Judith herausfindet, dass sie nicht nur die Akte mit der Toten verbindet, beginnt eine grausame Jagd auf sie. Denn sie stellt Fragen nach ihrer Vergangenheit, die ihr nur der Mörder beantworten kann. Und beide wissen: es gibt kein Vergessen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Judith Kepler ist ein Cleaner. Sie reinigt Tatorte. Sie putzt die Wohnungen der Toten. Sie löscht die Erinnerung an Tod, Verwahrlosung und Mord.
In der Wohnung einer Toten stößt Judith Kepler auf Bruchstücke ihrer eigenen Vergangenheit – sie findet ihre Heimakte. Judith kam als Kind unter nie genau geklärten Umständen in ein Erziehungsheim der DDR, nach Sassnitz auf Rügen. Die Akte wurde manipuliert, und zum ersten Mal hat Judith den Beweis in ihren Händen, dass sie als Kind vertauscht wurde. Eine Fremde hat ihr Leben gelebt. Ist diese Fremde auch ihren, Judiths, Tod gestorben? Auf der Suche nach Antworten macht Judith sich auf den Weg nach Sassnitz. Nicht ahnend, dass jeder ihrer Schritte beobachtet wird. Sie findet heraus, dass ihre Herkunft mit einem bis heute verschleierten Geheimnis zu tun hat – einer missglückten Republikflucht, einem verratenen Hochverrat, einem Versagen von gleich drei Geheimdiensten: dem BND, der CIA und der Stasi. Mikrofilme mit den Klarnamen aller DDR-Spione sollten in einer Nacht vor über fünfundzwanzig Jahren in Sassnitz den Besitzer wechseln. Im Tausch gegen zwei Pässe – die Freiheit für eine Mutter und ihr Kind. Diese Filme sind bis heute verschwunden, und die Spur der Beteiligten verlor sich, in einem Kinderheim, auf einem Friedhof und … in Schweden. Doch je näher Judith der Wahrheit kommt, desto mehr schwebt sie in Gefahr, denn das gefährliche Netz der Vergangenheit zieht sich immer enger zusammen …
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Zeugin der Toten
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe Dezember 2020
Copyright © der Originalausgabe 2011
by List Verlag, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Goldmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Hayden Verry / Arcangel
CN · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26379-9V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Shirin
Les Négresses Vertes
Face à la mer
Sur le sable, face à la mer
Se dresse là, un cimetière
Où les cyprès comme des lances
Sont les gardiens de son silence
Sur le sable, des lits de fer
Sont plantés là, face à la mer
Mon ami, la mort t’a emmené
En son bateau pour l’éternité
Si on allait au cimetière
Voir mon nom gravé sur la pierre
Saluer les morts face à la mer
Ivres de vie dans la lumière
Dans la chaleur, le silence
A l’heure où les cyprès se balancent
Les morts reposent au cimetière
Sous le sable, face à la mer
Helno de Loureacqua
† 1993
Kinderheim Juri Gagarin, Sassnitz (Rügen), 1985
Martha Jonas stand vor ihrem geöffneten Kleiderschrank und presste die Bakelit-Hörer noch fester an die Ohren. Das Rauschen wurde stärker. Der Sender verschwand hinter anderen elektromagnetischen Wellen. Stimmen und Musikfetzen aus benachbarten Kanälen legten sich pulsierend über die Frequenz. Sie hielt den Atem an und drehte den Sendersuchlauf um eine Winzigkeit nach rechts, dann nach links, vergeblich. Sie hatte ihn verloren.
Der Empfänger war ein kleines Stern-Radio Ilmenau, versteckt hinter einem Stapel ordentlich gebügelter und nummerierter Bettwäsche. Hektisch tastete sie nach der Antennenschnur. Die Zeit lief ihr davon.
Für einen kurzen Augenblick klang Barrys tiefe, sonore Stimme durch den Äther. Martha zerrte die Schnur in Richtung Fenster. Der Seewetterdienst eroberte sich die Frequenz zurück und gab in monotoner Endlosschleife die Windstärken in der Deutschen Bucht bekannt. Ein paar Sekunden später drängelte sich DT 64 dazwischen und machte sich breit. »Sieben dunkle Jahre überstehn, sieben Mal wirst du die Asche sein …« Aus. Ende. Vor Wut hätte sie das Gerät am liebsten aus dem Schrank gerissen und an die Wand geworfen.
Ein Lichtstrahl fiel durch das Fenster und geisterte über die fast kahlen Wände. Martha zögerte. Dann streifte sie die Kopfhörer ab und verstaute sie gemeinsam mit der Antennenschnur im Schrank. Sorgfältig schloss sie ihn ab, auch wenn das gegen die ungeschriebenen Vorschriften war. Sie trat ans Fenster und warf einen ärgerlichen Blick hinauf in den sternenklaren Nachthimmel. So nah am Meer leuchteten Sterne und Mond heller als irgendwo auf der Welt. Es hätte fast romantisch sein können. Doch Martha Jonas hatte keinen Sinn für Romantik. Nicht sonntagabends zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Wolken waren ideal. Warum, wusste sie nicht. Offenbar leiteten sie die Kurzwellen besser. Es war August, und sie wünschte sich nichts mehr als Wolken und Regen. Sie würde es in einer Stunde noch einmal versuchen.
Wieder blendeten die Scheinwerfer. Das Auto fuhr zweihundert Meter entfernt über die holprige Landstraße Richtung Mukran. Gerade wollte sie den Vorhang ganz zuziehen, da bog es ab und steuerte auf das Eingangstor des Kinderheims zu. Direkt davor hielt es an. Die Scheinwerfer gingen aus.
Das war so ungewöhnlich, dass Martha instinktiv hinter den Vorhang trat und nur noch durch einen Spalt hinausspähte. Jemand musste den Besucher erwarten, denn ganz leise hörte sie das Quietschen der Haustür im Erdgeschoss, und eine dunkle, hochgewachsene Gestalt lief eilig, als ob sie sich nicht länger als unbedingt nötig dem verräterischen Mondschein aussetzen wollte, auf das eiserne Tor zu mit seinen wie Sonnenstrahlen verlaufenden Streben.
Es war die stellvertretende Heimleiterin, Hilde Trenkner. Eine Frau Ende fünfzig, die mittlerweile mehr Macht und Einfluss hatte als ihre Vorgesetzte. Trenkner pflegte enge Beziehungen zum Rat des Kreises und anderen, namenlosen Herren. Männer, vielleicht wie dieser da unten, der gerade seinen dunklen Wartburg startete und langsam durch das Tor fuhr, das die Frau genauso leise und vorsichtig hinter ihm schloss, wie sie es geöffnet hatte. Das Auto hielt zwischen Spielplatz und Treppe. Der Mann stieg aus. Er trug einen hellen Staubmantel über seinem Anzug und öffnete die Beifahrertür. Er holte ein großes, in Decken gewickeltes Bündel heraus und folgte Trenkner ins Haus.
Langsam, um kein unnötiges Geräusch zu verursachen, schlich Martha durch ihr Zimmer und öffnete die Tür einen winzigen Spalt. Vor ihr lag der dunkle, hohe Flur. Durch ein Fenster an der Stirnseite fiel bleiches Mondlicht auf das Linoleum, das den Schatten des Fensterkreuzes grotesk in die Länge zog. Links und rechts befanden sich zwei große Schlafsäle. Vor den Eingängen standen lange Holzbänke. Nichts deutete darauf hin, dass dies etwas anderes als eine ganz normale Nacht war. Um sieben ging das Licht aus, um acht wurden die Letzten verwarnt, um neun war Ruhe. Wer sie danach noch stören wollte, musste einen guten Grund haben oder große Sehnsucht nach einer eiskalten Dusche im Keller. Alles war still, bis sie leise Schritte hörte und Trenkner die Treppe hochkommen sah.
Die stellvertretende Heimleiterin kündigte sich normalerweise mit stechendem Schritt und dem Klirren der vielen Schlüssel an, die sie bei sich trug. Nun aber sah sie sich vorsichtig um, bevor sie mit einer Kopfbewegung den Unbekannten zu sich befahl, der nach wie vor das Bündel auf seinen Armen trug. Martha konnte sein Gesicht in der Dunkelheit nicht erkennen. Er musste fast einen Kopf kleiner sein als Trenkner, machte aber einen kräftigen Eindruck, auch wenn die Decke jetzt verrutschte und er das Ganze nur mühsam wieder in den Griff bekam. Sie fiel herab, und für einen Moment sah Martha das blasse Gesicht eines schlafenden Kindes.
Das war es also. Ein Neuzugang. Vorsichtig schloss sie die Tür und ging zu ihrem Bett. Sie setzte sich auf die Kante und überlegte, ob sie sich zeigen sollte oder nicht. Wahrscheinlich eine Notaufnahme. Ab und zu kam das vor, wenn die Polizei in Familien eingreifen musste, die es laut einschlägiger sozialistischer Vorschrift gar nicht geben durfte. Verwahrlosung wurde totgeschwiegen, und die lebenden Beweise verschwanden in Spezialheimen wie diesem, wo man mit aller Macht und leider, wenn es gar nicht anders ging, manchmal auch mit Gewalt versuchte, aus ihnen doch noch etwas Anständiges zu machen. Merkwürdig war nur, dass es kein Polizeiwagen war, der unten vor dem Haus stand.
Ein Wartburg. Martha starrte auf den Boden und wartete darauf, dass der ungewöhnliche Besuch wieder ging. Um Mitternacht war alles zu spät. Die ganze lange Woche würde sie warten müssen, bis zum nächsten Sonntag.
Eine Tür wurde vorsichtig ins Schloss gedrückt, leise Schritte entfernten sich. Martha wartete. Nach ein paar Minuten begann sie sich zu fragen, warum das Auto nicht wegfuhr. Was machte Trenkner so lange? Vielleicht war sie mit dem Mann noch ins Büro gegangen, Papierkram erledigen. Einweisungsprotokolle unterschreiben. Das konnte man auch noch am nächsten Tag. Dann, wenn das neue Kind den anderen vorgestellt und eingewiesen wurde.
Dein Schrank, dein Bett, deine Kleider, deine Schuhe. Hier die Schulsachen, da die Kittel. Und ordentlich. Im Kinderkollektiv ist kein Platz für Unordnung. Genau wie im Leben. Kindheit ist Lernzeit. Auch du wirst verstehen, was das heißt.
Trenkner hatte eine kräftige Stimme. Ihre ungewöhnliche Größe schüchterte die meisten ein. Aber sie hatte noch ganz andere Methoden, von denen der Keller eine der harmlosesten war. Martha war kein Freund von Schlägen. Sie hatte studiert, weil sie Pestalozzi mochte, Korczak, Blonskij, Suchomlinski und natürlich Makarenko und, ja, auch Kinder. Brave Kinder. Vom Weg abgekommene Kinder. Verirrte Kinder. Kinder, denen sie eine Chance geben konnte, doch noch Teil der großen Gemeinschaft zu werden. Zwanzig Jahre später war sie eine Frau von Mitte vierzig, die viele Illusionen verloren und nur den Verlust von einigen wenigen wirklich bedauert hatte. Es war eine bittere Erkenntnis, dass man ein Kind mögen konnte. Vielleicht auch zwei, drei, ein Dutzend. Aber niemals zweihundertdreiundzwanzig. Die bekam man nur mit festen Strukturen und der konsequenten Einhaltung von Regeln in den Griff.
»Mama?«
Die Stimme war leise und angsterfüllt. Sie klang so nahe, weil das Haus still war.
»Mama!«
Martha sprang aus dem Bett und öffnete die Tür. Das Mädchen trug nur einen Schuh. Die fast weißblonden Locken fielen ihm wirr ins Gesicht, und über ein kurzes Sommerkleidchen hatte es eine dünne Strickjacke gezogen, ganz eng um die mageren Schultern. Mit weit aufgerissenen Augen starrte es die Erzieherin an. Es sah anders aus als die anderen Kinder, die hier ankamen. Vielleicht lag es an der Haltung – nicht gedemütigt, sondern eher zu Tode erschreckt, vielleicht auch an der Art der Kleidung, die gepflegter wirkte als das, was bei Asozialen üblich war. Sie erinnerte Martha an die Rauschgoldengel aus dem Erzgebirge, die in einer Kiste im Keller lagen, seit sie Ostern und Pfingsten abgeschafft hatten und statt Weihnachten das sozialistische Friedensfest gefeiert wurde.
»Ich will zu meiner Mama.« Tränen liefen ihm die Wangen hinunter. Die Unterlippe des Kindes bebte.
»Still!«
Sie ging auf das Mädchen zu. Es wich zurück und presste die Strickjacke noch fester an die Brust.
»Geh wieder ins Bett.«
Es schüttelte trotzig den Kopf. Mit einem ärgerlichen Seufzer ging Martha in die Knie, um auf Augenhöhe mit dem Kind zu sein. Das machte sie selten, weil es nicht gut war bei ihrem Bluthochdruck. Aber das Kind sah aus, als würde es jeden Moment die letzte Beherrschung verlieren. Es schwankte, als ob es sich kaum auf den Beinen halten könne und gegen eine bleierne Müdigkeit ankämpfte. Es war vielleicht fünf, höchstens sechs Jahre alt.
»Wie heißt du denn?«
»Christel.«
»Und wie weiter?«
»Christel Sonnenberg. Wo ist meine Mama?«
»Komm mit.« Martha richtete sich langsam auf und versuchte, das Mädchen am Handgelenk zu greifen. Doch die Kleine riss sich los. Dabei fiel ein Spielzeugtier zu Boden. Groß wie ein Teddybär, schwarz wie ein Waldkater.
»Gib das her!«
Wie ein Wiesel stürzte sich das Mädchen auf Martha. Doch sie war schneller und hielt das Plüschtier außer Reichweite. Im Dämmerdunkel konnte man kaum etwas erkennen, aber dieses Ding hätte sie selbst blind allein durchs Tasten erkannt, so oft hatten die Kinder es heimlich gemalt.
»Schsch. Du kriegst es ja wieder. Das ist ein Monchichi. Wo hast du das denn her?«
»Von meiner Mama.«
Unsicher sah Martha sich um. Schwererziehbare Kinder aus asozialen Familien hatten selten Westspielzeug. Meistens hatten sie gar keins. Das waren schon wieder zwei Verstöße gegen die Norm, und langsam geriet Martha ins Schwitzen.
»Du darfst das nicht behalten. Aber vielleicht kriegst du ein Tiemi.«
»Ich will kein Tiemi! Gib her!«
»Ruhe«, zischte Martha. »Wenn das einer sieht, ist es sowieso weg. Die Tiemis sind genauso schön. Ach was, viel schöner! Sie kommen nämlich aus der DDR. Wo ist dein Bett?«
Alle Neuankömmlinge wurden als Erstes zu ihrem Bett geführt. Was für den Mantel der Haken, war für das Kind sein Bett.
»Ich hab kein Bett.«
»Aber natürlich hast du eins.«
»Da liegt schon jemand drin.«
Schlafsaal IV war zurzeit mit achtzehn Mädchen belegt. Neun links, neun rechts. Neuzugänge und Abgänge wurden bei der täglichen Lagebesprechung im Büro der Heimleiterin erörtert. Also könnte das Mädchen recht haben. Es fehlte ein Bett. Vorsichtig öffnete Martha die Tür zum Schlafsaal und spähte hinein.
Die Fenster waren, im Gegensatz zum Erdgeschoss, nicht vergittert. An der Stirnseite hing ein Porträt des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Daneben, nicht ganz so groß, ein Bild von Juri Alexejewitsch Gagarin, dem so früh verstorbenen sowjetischen Kosmonauten, dem ersten Menschen im All.
»Wohin solltest du denn?«, flüsterte sie.
»Dahinten.«
Das Kind deutete auf das letzte Bett auf der linken Seite. Martha straffte die Schultern und betrat den Raum, wie sie das bei ihren Kontrollgängen immer tat. Sie überzeugte sich, dass die Kinder schliefen und nicht nur so taten, zupfte hier eine Decke zurecht, stellte dort ein Paar nachlässig abgeworfene Pantoffeln ordentlich mittig unter das Bett und ging dann in die Ecke, in der Nummer 052 lag – Judith Kepler.
Aber da lag niemand. Die Decke war zurückgeschlagen, sogar die Pantoffeln standen noch da, und auf dem Boden lag ein Tiemi. Ein dunkelbraunes abgezotteltes Plüschtier, doppelt so groß wie das, das Martha immer noch in der Hand hielt. Und, leider, auch doppelt so hässlich.
Das musste ein Irrtum sein. Hilflos sah sie sich um, aber 052 war nirgendwo zu sehen. Vielleicht war sie im Waschraum? Sie überzeugte sich, dass die Gemeinschaftsduschen und die Toiletten leer waren. Als sie wieder bei dem rätselhaften Neuzugang angekommen war, bemerkte sie, dass einige Mädchen im Schlafsaal aufrecht in ihren Betten saßen und sich die Augen rieben.
»Hinlegen!«
Sie fielen um wie erschossen. In Martha breitete sich die unangenehme Hitze aus, die sie immer spürte, wenn eine Situation außer Kontrolle geriet. Der halbe Schlafsaal war schon wach. Ein Kind war verschwunden. Ein anderes stand im Flur. Was zum Teufel war hier los? Und wo steckte Trenkner? Sie beugte sich zu der Kleinen.
»Ich werde das klären«, flüsterte sie. »Das hat schon alles seine Richtigkeit.«
Das Mädchen schüttelte wild den Kopf. »Ich will zu meiner Mama.«
»Wo ist die denn?«
»Bei Lenin.«
»Wo?«
»In einem Palast mit Gold und Fenstern aus Edelsteinen.«
»Lenin hatte keinen Palast. Nicht so einen.«
»Aber ich hab ihn gesehen!«
Martha hatte schon zu viele Lügen gehört, um nicht zu wissen, dass sie bei Kindern dieses Alters immer ein Körnchen Wahrheit enthielten. Wahrscheinlich hatte die Mutter dieses Märchen erzählt und das Kind ausgesetzt oder hilflos alleingelassen. Solche Fälle gab es immer wieder. Sie hatten schon einige Kinder von Republikflüchtlingen vorübergehend aufgenommen. Sie blieben nie lange. Martha wusste nicht, wohin sie geschickt wurden, aber man hörte, dass sie, anders als die Schwachsinnigen und Asozialen, ganz gut vermittelt werden konnten.
»Wo kommst du denn her?«
»Aus Berlin.«
Woher auch sonst. Und immer wieder die See als Fluchtweg in das, was für diese Menschen die Freiheit bedeutete. Die Küste war keine zehn Minuten Fußmarsch entfernt. Wahrscheinlich hatten sie das Mädchen streunend aufgegriffen, während seine Mutter das Weite suchte. Nachdem sie endlich eine plausible Erklärung für die nächtliche Ruhestörung hatte, fiel Martha das Radio wieder ein, und dass sie vielleicht kurz vor Mitternacht noch einmal Glück haben könnte.
»Gib mir mein Äffchen wieder.«
»Nein.«
»Ich will mein Äffchen wiederhaben!«
Martha wollte gerade Luft holen, um dem Kind unmissverständlich klarzumachen, dass die Zeit der Sonderwünsche vorbei war. Da sah sie, wie die Augen des Mädchens sich vor Schreck weiteten, und hörte hinter sich eine leise, nicht unfreundliche Stimme.
»Guten Abend, Judith.«
Das Flurlicht flammte auf. Zu Tode erschrocken fuhr sie herum. Das Mädchen suchte Schutz hinter ihr und klammerte sich an ihrem Rock fest.
Er war ungefähr Mitte vierzig und mittelgroß. Er hatte das runde, helle Gesicht eines Norddeutschen, doch seine Haut war für diese Jahreszeit ungewöhnlich fahl und blass und von Sommersprossen bedeckt. Als er die Hand nach dem Kind ausstreckte, wich es noch ängstlicher zurück.
»Wer sind Sie?«
Eine hagere, hochgewachsene Gestalt tauchte hinter ihm auf. Trenkner.
»Das hat alles seine Richtigkeit.«
Die stellvertretende Heimleiterin hielt dem Mädchen einen Schlafanzug hin. Er sah weder neu noch gebügelt, sondern ziemlich zerknittert aus.
»Zieh das an.«
Martha konnte hinter ihrem Rücken spüren, dass das Kind den Kopf schüttelte.
»Zieh das an!«
»Nein!«
Trenkner hob ruckartig den Kopf. In drei Schritten war sie an der geöffneten Schlafsaaltür. Sie ging hinein, sah sich um und zog im Hinausgehen sorgfältig die Tür hinter sich zu. Martha holte tief Luft.
»Frau Trenkner, dieses Kind hier …«
»Judith. Ja.« Über das hagere, lange Gesicht der Frau huschte ein flüchtiges Lächeln. »Du sollst nachts nicht im Flur herumspazieren. Weißt du, was mit Kindern passiert, die das machen? Die holt der Schwarze Mann.«
Das Mädchen presste sich noch enger an Martha.
»Verzeihung, aber das ist nicht Judith, Frau Trenkner.«
Die stellvertretende Heimleiterin und der Unbekannte sahen sich kurz an.
»Folgen Sie uns ins Büro. Und du«, Trenkner sah das Kind streng an, »gehst in dein Bett. Und wenn ich dich noch einmal nachts im Gang erwische, kommst du in den Keller. Für immer.«
Sie hielt dem Mädchen wieder den Schlafanzug hin. Als drei Sekunden vergangen waren und es sich immer noch nicht rührte, ließ sie ihn fallen. Dann drehte sie sich um und ging demonstrativ voran, die Treppe hinunter, durch die Eingangshalle in das Büro der Heimleiterin.
Trenkner, die Stellvertreterin, nahm so selbstverständlich hinter dem großen, alten Schreibtisch Platz, als hätte sie hier schon immer gesessen. Die kleine Arbeitslampe verbreitete ein diffuses gelbliches Licht. Vor ihr lag eine dünne Akte, die sie zu sich heranzog und öffnete.
»Setzen Sie sich.«
Es war nicht klar, wer gemeint war, denn es gab nur einen weiteren Stuhl im Zimmer. Der Unbekannte nickte Martha zu. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie einen rosafarbenen Hausanzug trug und sich vor dem Schlafengehen weder abgeschminkt noch gekämmt hatte. Den Stoffaffen hielt sie genauso eng an sich gepresst wie zuvor das Mädchen.
»Judith Kepler, geboren am 22. September 1979«, begann Trenkner mit ihrer emotionslosen, kühlen Stimme. »Antrag der Schule und der Kaufhalle ›rationell‹ auf Unterbringung des Kindes in geordneten Verhältnissen. Die Organe der Jugendhilfe fanden eine verwahrloste Wohnung vor, die Kleidung des Kindes war liederlich und schmutzig. Die Mutter Hilfsschülerin, später in der Pfandflaschenannahme der Kaufhalle beschäftigt. Wird als schwachsinnig und alkoholabhängig beschrieben. Sie äußerte sich negativ, bösartig und zerstörerisch gegenüber den Kräften von Schule und Gesellschaft. Heimerziehung wurde vorerst für die Dauer von zwei Jahren angeordnet.«
Sie sah hoch. Ihr Blick fiel auf Martha, die genau denselben Vortrag einige Wochen zuvor schon einmal gehört hatte. Lagebesprechung, in diesem Zimmer. Die Heimleiterin auf dem Platz, auf dem nun Trenkner saß. Die Erzieherinnen vor dem Tisch, in einer Reihe nebeneinander. Sie hatten überlegt, in welchem Haus Judith am besten untergebracht wäre. Letzten Endes lief es darauf hinaus, wo noch Platz war. Martha hätte gerne auf dieses Kind verzichtet. Der Bericht des Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses klang nach mehr als schwererziehbar. Das bedeutete in der Praxis: harte Herangehensweise und Unruhe in der Gruppe. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass Trenkner sie auf dem Kieker hatte. Denn es war Trenkner und nicht die Heimleiterin, die schließlich entschied, dass Kepler, Judith die Nummer III/052 erhielt – Haus drei, Kind 52, verantwortliche Erzieherin: Martha Jonas.
»Das Mädchen da oben …«, begann Martha, doch sie wurde von dem Mann unterbrochen.
»Das Mädchen da oben ist wiederholt ausgebüxt. Es stand unter Ihrer Aufsichtspflicht. Wie können Sie sich erklären, dass wir Judith mitten in der Nacht in Mukran aufgegriffen haben?«
»Judith?«
Judith war ein braunhaariges stämmiges Kind mit Stupsnase. Sie hatte Sprachschwierigkeiten, stammelte oft, wirkte teilnahmslos und geistig wie körperlich retardiert. Aber sie hatte in den sechs Wochen, die sie hier verbracht hatte, erstaunliche Fortschritte gemacht. Essgewohnheiten und Tischsitten hatten sich deutlich verbessert. Die Körperhygiene war dank penibelster Kontrolle mittlerweile im durchschnittlichen Bereich. Den normwidrigen Umgangston hatte ihr Trenkner mit ihrer speziellen »Trinkkur« abgewöhnt: Seifenlauge. Es waren nicht gerade die reformpädagogischen Grundsätze, von denen Martha einmal geträumt hatte, aber sie brachten Zucht und Ordnung ins Leben der Kinder. Nach einer sehr kurzen Eingewöhnungsphase hatte Judith sich problemlos ins Kinderkollektiv eingefügt. Sie hatte das Gelände ausschließlich in der Gruppe und beaufsichtigt verlassen. Weggelaufen war sie noch nie. Judith war ein Kind, das sich unterordnete. Keins, das sich auflehnte, so wie das Mädchen oben im Schlafsaal.
Der Mann setzte sich lässig auf die Schreibtischkante. Martha wunderte sich, dass Trenkner das zuließ. Er wirkte ruhig und gelassen. Nur das minimale Wippen seiner Fußspitze verriet ihn.
»Wo waren Sie heute Abend um 22 Uhr?«
»In meinem Zimmer. Ich hatte vorher meine Runde gemacht und nachgesehen, ob auch alle in den Betten liegen und schlafen.«
»Wann wäre die nächste Runde fällig gewesen?«
Sie schwieg.
»Hören Sie schlecht? Die nächste Runde?«
»23 Uhr«, sagte sie leise. Wieder spürte sie, wie die Hitze langsam in ihrem Körper aufstieg.
»Haben Sie Ihren Rundgang vorschriftsmäßig um 23 Uhr durchgeführt?«
Es war eine rhetorische Frage. Der Mann kannte die Antwort. Langsam schüttelte sie den Kopf.
»Und wo waren Sie stattdessen?«
Trenkner lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. In dem ältlichen Gesicht mit dem zusammengekniffenen Mund war nicht das kleinste Zeichen von Mitgefühl zu entdecken.
»In … meinem Zimmer.«
Der Mann wechselte einen Blick mit der Heimleiterin. Martha spürte, wie ihr die Kehle eng wurde. Sie wissen es.
»Sie sind jeden Sonntagabend zwischen 22 und null Uhr in Ihrem Zimmer. Was tun Sie da?«
»Ich lese.«
»Und?«
»Ich wasche meine Wäsche. Die feine, meine ich.«
»Und?«
Martha sah auf die Spitzen ihrer Hausschuhe. »Ich höre Radio.«
»Welchen Sender?«
»DT 64. Stimme der DDR. Und im Sommer die Ferienwelle.«
»Schauen Sie sich das hier mal an.«
Er griff in seine Jackentasche und streckte ihr einen geöffneten, mit Quartalsstempeln übersäten Ausweis an einem Lederband entgegen. Einen Moment wurde ihr schwindlig, sie fühlte sich, als würde sie ins Bodenlose fallen.
Er steckte den Ausweis wieder ein. »Also noch mal. Welche Sender?«
»DT 64«, flüsterte Martha.
Sie konnte spüren, was der Mann davon hielt, dass die etwas füllige, nicht mehr ganz junge Frau vor ihm ausgerechnet die Jugendwelle des Staatsrundfunks hörte. Das klang so unwahrscheinlich, dass sie gleich die nächste, ebenso durchschaubare Lüge hinterherschob.
»Und Stimme der DDR.« Die hörte erst recht keiner freiwillig.
»Ich bitte Sie! Dafür hätten Sie ohne weiteres die Hausempfänger benutzen können.«
Auf dem Fensterbrett stand einer dieser kleinen Holzkästen mit fünf Stationstasten und Strichen auf der Skala, damit auch ja keiner versehentlich den falschen Sender erwischte. Der Mann sah zu Trenkner, die wie ein steinernes Monument der Unbarmherzigkeit hinter dem Schreibtisch thronte. Honecker hing im Halbdunkel an der Wand und beobachtete sie. Immer und überall. Martha spürte, wie das Blut in ihren Ohren rauschte und ihr Schweißperlen auf die Stirn traten. Trenkner räusperte sich leicht.
»Mir ist Ihre Mentalitätsstruktur nicht ganz klar. Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass Ihr politisches und pädagogisches Verantwortungsbewusstsein gelitten hat.«
Sie wissen alles.
»Vor allem sonntagabends vernachlässigen Sie Ihre Pflichten.«
Ich war doch so vorsichtig. Keiner hat was gemerkt. Ich habe meine Rundgänge gemacht und nur den einen ein bisschen vor und den anderen ein bisschen weiter nach hinten gelegt.
»Frau Jonas«, sagte der Mann. »Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal: Welchen Sender haben Sie heute gehört?«
»Radio … Radio Luxemburg, London«, stammelte Martha.
Der Mann hob die Augenbrauen.
»Und den Seewetterbericht.«
Sie knetete das Äffchen mit ihren feuchten Händen. Es hatte weiches Fell und einen straffen, harten Bauch. Ganz anders als die Tiemis, die verfilzten und irgendwann ihre Form verloren. Jetzt, wo alles aus war, spürte sie plötzlich, was so ein Ding für ein Kind bedeuten musste. Hatte sie nicht selbst auch einmal eine Puppe gehabt? Nicht so was Schönes wie dieses Äffchen, dazu war kurz nach dem Krieg kein Geld da gewesen, und andere Sorgen hatten sie auch gehabt. Eine Puppe, eine mit blonden Haaren und großen blauen Kulleraugen. Ein bisschen sah sie aus wie Christel, nein, Judith …
»Den Seewetterbericht«, wiederholte der Mann. »Frau Jonas.«
»Ich wollte das nicht!«
Verzweifelt sah Martha hoch. In ihren Augen sammelten sich Tränen. »Ich bin da so reingerutscht! Man denkt an nichts Böses, und plötzlich … ich kann nichts dafür …«
Was würde jetzt kommen? Das Haftarbeitslager? Würde man sie verhören? Geständnisse aus ihr herausprügeln? Hätte sie sich doch bloß nie darauf eingelassen.
»Ich werde Ihnen sagen, was Sie tun. Als Erzieherin in einem Kinderheim haben Sie sich heimlich einen leistungsstarken Empfänger angeschafft, um die britische Hitparade zu hören, nehme ich an.«
Martha war sich nicht ganz sicher, ob sie das alles nur träumte.
»Stimmt’s?«
»Ja.«
»Die höre ich auch manchmal.«
Mit tränenblinden Augen starrte sie auf den Mann, der jetzt mit einem zufriedenen Lächeln ein Päckchen Casino aus der Jackentasche zog und sich eine Zigarette anzündete. Dabei sah er auf seine Armbanduhr, als ob er sich in dieser Sekunde an eine Verabredung erinnern würde.
»Diese Woche ist diese Cyndi Lauper auf Platz eins. Ich mag ja die alten Sachen lieber. Und Sie?«
Martha wusste nicht, ob das ein schlechter Witz war.
»Die …«, sie musste sich räuspern, so trocken war ihre Kehle, »die Bee Gees.«
»Die Bietschies«, wiederholte der Mann. Er sprach die Namen aus wie jemand, der sie nicht oft in den Mund nahm. »Da vergisst man schon mal, dass man eigentlich ein Vorbild sein sollte. Verstehe.«
Ganz langsam nickte Martha. Sie verstand das alles eben nicht. Worauf wollten die beiden bloß hinaus? Die Trenkner schob dem Mann einen Aschenbecher hinüber, ohne die Angeklagte aus den Augen zu lassen.
»Dabei hat man Ihnen doch die Kinder anvertraut, um Symptome einer sozialistischen Fehlentwicklung schon im Keim zu ersticken. Oder sind Westsender hier im Heim erlaubt? Sind das ganz neue Methoden?«
»Natürlich nicht«, giftete die Trenkner.
»Und dann das.«
Er schüttelte unendlich bedauernd den Kopf. Verunsichert grub Martha ihre Hände noch tiefer in den weichen Plüsch. Sie beobachtete, wie er die Asche abstreifte und dann einen Blick in die Heimakte warf, die immer noch offen vor Trenkner auf dem Tisch lag. Nachdenklich nahm er den Einweisungsbogen in die Hand.
»Judith Kepler. Das ist doch unsere kleine Ausreißerin, oder?«
Er hielt ihr das Blatt entgegen. Auf dem Bogen klebte ein Foto von Christel. Der Mann musste ihr ihre Bestürzung ansehen, denn ein leichtes Lächeln umspielte seine schmalen, blassen Lippen.
»Keine Verwechslung? Schauen Sie genau hin!«
Martha gehorchte. An den beiden Längsseiten war das Foto perforiert. In der linken unteren Ecke erkannte sie den Teilabdruck eines Stempels. Es musste aus einem Ausweis herausgelöst worden sein.
»Judith Kepler«, las sie vor. »Bachstraße 17, Saßnitz …«
Der Mann legte das Blatt wieder zurück. Ein Türmchen Asche fiel von seiner Zigarettenspitze auf die Tischplatte. Trenkner beugte sich vor und pustete es entschieden über die Tischkante.
Was passiert hier?
Der Mann nahm einen tiefen Zug und sah dem Rauch, den er anschließend wieder ausstieß, nachdenklich hinterher.
»Was machen wir jetzt mit Ihnen?«
Was machen sie jetzt mit mir?
Trenkner schaltete sich wieder ein. »Ich wäre im Interesse aller Beteiligten dafür, die Sache schnell hinter uns zu bringen.«
Dann lächelte sie. Es war ein Lächeln von der Art, bei dem es Martha eiskalt den Rücken hinunterlief. Sie hatte es schon so oft auf diesem Gesicht gesehen.
»Was haben Sie da eigentlich?«
Martha schaute auf ihren Schoß. Langsam, fast zögernd gaben ihre Hände das Stofftier frei.
»Ein Monchichi.«
Der Mann streckte die Hand aus. Sie reichte es ihm widerspruchslos.
»Westsender, Westspielzeug … was läuft hier eigentlich noch alles aus dem Ruder?«
Einen Moment lang verlor Trenkner die Beherrschung. Das Lächeln verschwand, und die blanke Wut sprang sie an, die sie nur mühsam beherrschen konnte.
»Das hat selbstverständlich Konsequenzen.«
»Es gehört nicht mir!« Martha verschluckte sich fast vor Aufregung. »Es gehört …«
Beide starrten sie an. Der Mann beugte sich leicht vor, um sie besser verstehen zu können. Plötzlich sah Martha einen dunklen Fleck auf seinem Mantelsaum. Ihr Blick huschte hinunter zu seinen Schuhen, sie waren staubig und verdreckt.
»Nun?«, fragte er leise.
Er schlug den Mantel zurück, der Fleck verschwand in einer Falte. Martha hätte schwören können, dass es Blut war. Reflexartig sah sie zu Trenkner, doch die verengte ihre Augen zu schmalen Schlitzen. Hatte sie den Fleck auch bemerkt? War ihr aufgefallen, dass Martha ihn gerade entdeckt hatte? Die Stellvertreterin fixierte sie mit ihrem stechenden Blick. Plötzlich wusste sie, dass das der Moment war, in dem sie sich entscheiden musste. Und sie tat, was sie immer getan hatte, wenn sie zwischen Anspruch und Loyalität stand. Zwischen Pestalozzi und Semiliwitsch. Zwischen Beziehung und Erziehung.
»Judith«, vollendete sie den Satz.
Der Mann hob das Äffchen hoch und musterte es interessiert. »Unserer Ausreißerin? Das ist aber ein ungewöhnliches Stück.«
Martha nickte. Er wechselte einen schnellen Blick mit Trenkner. Täuschte sie sich, oder drückte er seine Zigarette wesentlich nervöser aus, als er sie angezündet hatte? Er stand auf.
»Sie haben recht, es ist spät, ich werde noch erwartet. Frau Jonas, wir sind keine Unmenschen. Im Gegenteil. Wir können Ihnen einfach nur das Leben angenehm oder unangenehm machen. Was wäre Ihnen lieber?«
»Angenehm«, antwortete Martha zögernd.
»Dann einigen wir uns darauf, dass Sie in Zukunft besser auf Judith achten werden. Das Kind braucht besondere Aufmerksamkeit. Es scheint verwirrt zu sein.«
»Verwirrt«, wiederholte Martha und nickte.
»Es darf das Gelände vorerst nicht verlassen. Es sollte von den anderen ferngehalten werden, bis sich die Aufregung um seinen Ausflug gelegt hat.« Er sah zu Trenkner. Die spitzte die Lippen und parierte seinen Blick, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann wandte er sich wieder an Martha. »Der Staat hat Ihnen dieses Kind voller Vertrauen in die Hände gelegt. Enttäuschen Sie ihn nicht.«
Martha nickte. Sie fühlte noch die Wärme in ihrem Schoß, da, wo sie das Stofftier an sich gepresst hatte, und begann plötzlich zu zittern.
»Dann enttäuscht der Staat Sie nämlich auch nicht. Er wird Ihnen eine Chance auf Wiedergutmachung geben. Ich glaube, Ihnen würde ein neues Radio gefallen. Und ein paar Schallplatten. Haben Sie einen Plattenspieler?«
Martha schüttelte den Kopf.
»Dann werden wir Ihnen einen geben. Und was von diesen Bietschies dazu. Nehmen Sie nächste Woche einen Tag Urlaub und holen sich alles bei uns in Schwerin ab. Am Demmlerplatz.«
»Vielen Dank«, sagte sie leise. »Bei wem darf ich mich melden?«
»Fragen Sie nach Hubert Stanz.«
Er nickte und ging. Martha hörte seine Schritte auf dem Flur. Erst waren sie langsam, dann, als er wohl glaubte, außer Hörweite zu sein, wurden sie schnell, beinahe hastig. Unsicher erhob sie sich. Die Trenkner nahm den Einweisungsbogen, legte ihn in die Aktenmappe und klappte sie zu.
»Bringen Sie Ihr altes Radio zur Verwahrung. Sonst noch was?«
Martha wusste nicht, ob sie damit entlassen war, und schüttelte den Kopf. Die Trenkner öffnete eine Schublade und legte die Akte hinein. Dann nahm sie ihren gewaltigen Schlüsselbund und hatte mit einem Griff den passenden gefunden.
»Sie haben gehört, was Herr Stanz gesagt hat.«
»Ja.«
»Dann hoffe ich, dass Sie es auch verstanden haben.«
Am Fuß der Treppe blieb Martha stehen. Der Wartburg draußen vor der Tür sprang an und fuhr leise davon. Ihr Herz klopfte schwer und dröhnend wie ein Schmiedehammer. Mit zitternder Hand tastete sie nach dem Lichtschalter und legte ihn um. Das Klacken war so laut wie ein Schuss.
Du bist noch einmal davongekommen.
Schwerin. Demmlerplatz. Sitz der Abteilung XV des MfS und seines berüchtigten Gefängnisses. Hubert Stanz. Langsam ging sie die Treppe hoch, darauf bedacht, mit der knappen Luft in ihrer Lunge zu haushalten. Vor der Tür zu Saal IV blieb sie stehen. Dann drückte sie langsam die Klinke hinunter.
Leises Atmen und Schnaufen, mehr war nicht zu hören. Vorsichtig, um kein unnötiges Geräusch zu verursachen, tastete sie sich durch die Reihen. Ihre Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Ein schmaler Streifen Licht erhellte den Schlafsaal nach hinten nur so viel, dass sie die Umrisse der Betten und die beiden großen, dunklen Vierecke an der Wand erkennen konnte. Vor Nummer 052 blieb sie stehen. Das Mädchen lag auf dem Rücken und starrte an die Decke.
Zweihundertdreiundzwanzig Kinder. Sie kamen und gingen. Manche kehrten zurück zu ihren Eltern, die meisten aber wechselten nur das Haus, die Jahrgangsstufen, die Schule, kamen in andere Heime, zogen irgendwann aus, und ihre Spuren verloren sich und verschwanden wie die Farbe aus uralten Klassenfotos, wurden blasser in der Erinnerung, bleicher und durchsichtiger, lösten sich auf und mündeten im Fluss des Vergessens, der alles mit sich forttrug – Namen, Nummern, Gesichter und zuletzt die Hoffnung auf etwas Besseres, das man einmal hatte aufbauen wollen, damals, als alle jung waren und voller Zuversicht, auf der richtigen Seite im richtigen Land zu sein.
»Judith?«
Das Kind weinte mit offenen Augen. Es blinzelte nicht und wischte auch die Tränen nicht fort. Sie rannen einfach aus den Augenwinkeln über die Schläfen und versickerten im Haar. Es sah Martha nicht an.
»Wo ist mein Äffchen?«
»Es ist fort.«
Martha setzte sich auf die Bettkante. Sie nahm das Tiemi, das auf den Fußboden gefallen war, und legte es neben das Kopfkissen.
»Ich will zu meiner Mama.«
»Judith, deine Mama …«
»Ich heiße Christel!«
Marthas Hand schnellte vor und presste sie auf die Lippen des Mädchens. Zum Glück schliefen die anderen inzwischen wieder.
Du bist wahnsinnig. Mach, dass du verschwindest. Du setzt alles aufs Spiel.
Aber Martha verschwand nicht. Vielleicht lag es an diesem seltsamen Lächeln auf Trenkners Gesicht und dem dunklen Fleck auf einem Staubmantel und der eiskalten Angst und diesem Gefühl von Ohnmacht, das sich da unten im Büro der Heimleiterin über sie gestülpt hatte wie eine schwarze Kapuze, unter der sie fast erstickt wäre. Oder weil aus Nummer 052 plötzlich etwas anderes geworden war. Martha hätte nicht sagen können, was. Ihr war klar, dass sie ab sofort unter Beobachtung stand und dass diese Minuten die letzten waren, in denen der richtige Name des Mädchens noch existierte. Ganz vorsichtig zog sie die Hand zurück, beugte sich vor und flüsterte dem Kind ins Ohr.
»Das ist ab jetzt unser Geheimnis. Das wissen nur du und ich. Du musst jetzt sehr brav sein. Verstehst du? Sehr, sehr brav. Und wenn du alles tust, was wir dir sagen, dann kommt eines Tages deine Mama und holt dich ab.«
Das Mädchen wendete endlich den Kopf und sah sie an.
»Schwörst du das? Bei Gott?«
Bei was auch immer. Wenn es nur vergessen würde. Das war alles, was Martha noch den Kopf retten konnte.
»Ich schwöre. Wenn du brav bist.«
»Dann werde ich brav sein.«
Das Mädchen schloss die Augen. Martha legte ihm das Tiemi in den Arm. Dann stand sie auf, strich ihm über den Kopf. Langsam ging sie hinaus, schaltete das Flurlicht aus und schlich leise hinüber in ihr Zimmer. Erst als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, breitete sich in ihr ein vages und zögerliches Gefühl von Sicherheit aus.
Das Gerät stand noch genau so hinter dem Stapel Bettwäsche, wie sie es verlassen hatte. Sie wollte gerade den Stecker aus der Dose ziehen, da hielt sie inne. Es war kurz vor Mitternacht. Und sie hatte von Stanz persönlich die Erlaubnis, die britische Hitparade zu hören. Sie drückte den Knopf, setzte die Kopfhörer auf und wartete, bis das Radio warm gelaufen war und der Sender das Brummen überlagerte. Sie sah auf die fluoreszierenden Zeiger ihres Weckers. Es war so weit. Zeit für die Nummer eins.
»… if you’re lost you can look and you will find me …«
Das Brummen wurde lauter. Es knackte und rauschte, und plötzlich verschwand Cyndi Lauper.
»… Deutsche Bucht: östliche Winde um drei, zeitweise umlaufend. See null Komma fünf bis ein Meter. Die Aussichten: Südost sieben bis fünf, Westteil zunehmend. Belte und Sund: Nordost drei … time after time …«
Sie nahm den Kopfhörer ab. Aussichten sieben bis fünf. Sie atmete tief durch. Der tote Briefkasten war frei und konnte belegt werden. Mit einer Nachricht, die diesmal nichts mit Manövern der russischen Streitkräfte zu tun haben würde. Sie holte leise ihren Mantel und die festen Schuhe aus dem Schrank.
1
Es war kein guter Ort zum Sterben.
Judith Kepler zog die Handbremse an und stellte den Motor ab. Sie betrachtete das graue Mietshaus durch die Frontscheibe des Transporters und spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Ihre Handflächen, die das Lenkrad umklammerten, wurden feucht. Und ausgerechnet an diesem Morgen hatte sie einen absoluten Anfänger dabei.
Entlang der dichtbefahrenen Straße reihten sich Discountkleiderketten, Puffs und dubiose Gebrauchtwagenhändler aneinander. Eine Ecke für alles, was billig zu haben war: Frauen, Autos, auch Wohnungen. Einige Fenster des Hauses waren blind. Vor anderen hingen anstelle der Gardinen ausgeblichene Decken und Handtücher.
Ihr Beifahrer schaute begehrlich auf einen heruntergerittenen Ford Fiesta, der für die monatliche Rate von neunundneunzig Euro gleich mitgenommen werden konnte. Vorausgesetzt, man hatte einen festen Arbeitsplatz. Kai hatte weder das eine noch das andere. Keine neunundneunzig Euro und auch keinen Job. Er war ein breitschultriger, großgewachsener Junge mit einer dieser neumodischen, ins Gesicht gekämmten Pilzkopffrisuren. Sie verlieh seinen kräftigen Zügen etwas ungewollt Poetisches, von dem er selbst wahrscheinlich keine Ahnung hatte.
Sie klappte die Sonnenblende herunter und sah in den Spiegel. Was hielten Einundzwanzigjährige von Frauen über dreißig? Jenseits von Gut und Böse wahrscheinlich. Sie strich sich eine Haarsträhne zurück und merkte im gleichen Moment, wie eitel das in seinen Augen wirken musste. Dabei machte sie das jedes Mal, bevor sie an einen Einsatzort kam. Hände gewaschen, Haare gekämmt. Der erste Eindruck war entscheidend. Das galt für Wohnungen, für Jobs, für Männer und für alles andere, das korrekt erledigt werden sollte.
Judith verkniff sich die Frage, wann sie das letzte Mal einen Mann korrekt erledigt hatte. Ein seltsamer, absurder Gedanke. Sie sollte in Zukunft weniger Selbstgespräche führen.
Kai riss sich los von dem Auto, hob die dichten Augenbrauen bis unter den Ansatz seines Ponys und fragte mürrisch: »Geht es jetzt da rauf oder was?«
Du bist korrekt erledigt nach der ersten Schicht, dachte sie und versuchte, ihrem Lächeln das Hinterhältige zu nehmen.
Sie stieg aus. Hinter ihrem Rücken hörte sie, dass er den Wagen ebenfalls verließ. Er folgte ihr wie ein Welpe. Wahrscheinlich würde er auf dem Absatz kehrtmachen, sobald er mitbekam, auf was er sich eingelassen hatte, also konnte sie ihn auch gleich mit vorauseilender Rücksichtslosigkeit behandeln.
Am Hauseingang stieg ihr der stechende Geruch von Urin in die Nase – ein untrügliches Zeichen, dass die Schattengewächse der Metropole diese Ecke erobert und ihr Revier markiert hatten. Die Tür war eine Fünfziger-Jahre-Scheußlichkeit mit Aluminiumrahmen und mehrfach gebrochenem Sicherheitsglas. Sie wurde von innen geöffnet. Ein Mitarbeiter des Bestattungsinstituts trat heraus und arretierte den Flügel. Er nickte Judith kurz zu.
»Mensch, Mädchen.« Er griff in die Jackentasche und hielt Judith eine kleine Metalldose hin. Die Geste war die wortlose Zusammenfassung dessen, was sie oben erwartete.
»Danke.«
Judith rieb sich die Mentholpaste unter die Nase. Dann reichte sie die Dose an Kai weiter, der ratlos daran schnupperte und sie ihr zurückgab. Er hatte keinen Schulabschluss, und die Arbeitsagentur hatte ihm dieses Praktikum als letzte Chance verkauft. Statt um sieben war er um halb neun zur Arbeit erschienen und hatte eine vage Entschuldigung gemurmelt, in der ein kaputter Wecker und einige Lebensjahre vorkamen, in denen Wecker überhaupt keine Rolle gespielt hatten. Dass er trotzdem mit von der Partie war, lag daran, dass der Arzt noch einen Notfall gehabt hatte und sie auf die Leichenschau und die Freigabe hatten warten müssen. Und daran, dass Judith vielleicht die Einzige bei Dombrowski Facility Management war, die die Sache mit dem Wecker verstand. Sie hatte vier. Verteilt an strategisch wichtigen, weil schwer zu erreichenden Punkten in ihrer Wohnung und so programmiert, dass sie im Abstand von jeweils einer Minute klingelten. Der letzte stand im Bad.
»Nimm es.«
Aber Kai begriff entweder nicht, oder er hielt Mentholpaste für Kinderkram. Seine Entscheidung. Judith gab dem Bestattungshelfer die Dose zurück. Er schenkte ihr ein knappes Nicken und zündete sich eine Zigarette an, während er mit einem Blick den Himmel dieses Sommertages prüfte, der sich gerade von seinem dunstigen Morgen löste.
»Sechs Wochen unterm Dach, und das bei dem Wetter. Wir sind froh, dass wir sie in einem Stück in die Kiste bekommen haben.«
Sie kannten sich. Nicht gut genug, um zu wissen, wie der andere hieß. Aber so, wie man alle irgendwann kennenlernte, die in diesem merkwürdigen Gewerbe arbeiteten: der Verwaltung des Todes. Jeder war an seinem Platz. Der Arzt, der den Totenschein ausstellte. Die Bestatter, die die Leiche abholten und herrichteten. Die Cleaner, die ein Haus wieder bewohnbar machten. Man redete in einer zweckorientierten Sprache miteinander, die auf alle falschen Zwischentöne des Jammers verzichtete und sich aufs Wesentliche konzentrierte: den Job.
Kai wurde noch blasser, als er es schon war. Darauf hatte ihn die nette Sachbearbeiterin auf dem Amt wohl nicht vorbereitet. Gebäudereinigung. Putzen. Kann doch jeder. Geh mal hin und schau es dir an. Und dann das, gleich am ersten Tag. Polternde Schritte näherten sich. Der Arzt, erkennbar an der beflissenen Eile und einer ausgebeulten Ledertasche, kam die Treppe herunter. Ihm folgten zwei Bereitschaftspolizisten.
»Wir sind fertig da oben.« Wie so viele seiner Zunft redete er von sich in der Mehrzahl. »Natürliche Todesursache, sanft entschlafen. Mein Gott!«
Zwei LKW donnerten vorbei. Der Arzt trat auf den breiten Bürgersteig und zog die Melange aus Ammoniak und Diesel tief in seine Lunge. Dann schüttelte er den Kopf und eilte zu seinem Wagen. Die beiden Beamten folgten ihm. Der Bestatter rauchte.
»Dann mal los.« Judith machte eine Kopfbewegung, mit der man Hunde bei Regen ins Haus trieb. Kai trottete hinterher.
Sie stiegen die Treppen hoch. Kinderwagen standen im Flur, Schuhe, Gerümpel. Mit jedem Stockwerk entfernten sie sich mehr vom Straßenlärm und kamen dem Vergessen näher. Ganz oben waren es nur noch zwei Türen. Eine stand offen. Trotz Menthol roch Judith die schwere, süßliche Ahnung des Todes. Sechs Wochen, hatte der Mann gesagt. Und das Einzige, was den Nachbarn irgendwann aufgefallen war, war der Gestank.
Kai keuchte.
»Was riecht hier so?«, fragte er und ahnte die Antwort bereits.
Judith hatte nicht vor, ihn zu schonen. Wer mit ihr unterwegs war, musste sich darauf gefasst machen, mehr über seine eigenen Grenzen zu erfahren, als ihm lieb war. Das Gesundheitsamt hatte Dombrowski angerufen. Und Dombrowski schickte Judith. Und Judith nahm eben keine Rücksicht auf Anfänger.
»Hier lang.«
Ein enger Flur mit abgetretenem Läufer, alter Tapete, trotz Hochsommer Wintermäntel an der Garderobe. Vier offene Türen. Links das Wohnzimmer. Der erste Eindruck: Enge und Armut. Sie hatten das Leben von Gerlinde Wachsmuth bestimmt.
Und die Einsamkeit, dachte Judith, als sie das Schlafzimmer betrat. Über dem schmalen Bett hing ein schlichtes Holzkreuz. Der zweite Bestattungshelfer verschloss gerade den Zinksarg und tat das mit ganz besonderer Sorgfalt. Auch das Treppenhaus war eng, sie würden die Leiche an manchen Stellen hochkant transportieren müssen. Sein Kollege kam vom Rauchen zurück. Beide stellten sich neben den Sarg, falteten die Hände und murmelten ein leises Gebet.
Judith fragte sich, ob sie das auch taten, wenn keine Zeugen in der Nähe waren. Sie wollte Kai gerade ein Zeichen geben, dass auch er sich der Situation gemäß pietätvoll zu verhalten hatte, als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkte. Er starrte an ihr vorbei auf das Bett. Seine Unterlippe begann zu zittern. Er schluckte krampfhaft, der Adamsapfel hüpfte seinen kräftigen Hals entlang wie ein Gummiball. Er schlug die Hand vor den Mund, drehte sich um und taumelte aus dem Zimmer.
»Sein erstes Mal?«
Die beiden hatten ihr Gebet beendet. Judith nickte. Sie sah auf ihre Armbanduhr und hoffte, Kai würde sich mit dem Kotzen beeilen. Sie hatten schon zu viel Zeit verloren. Aber die Geräusche, die aus dem Badezimmer drangen, hörten sich mehr nach einem ausgiebigen Hustenanfall an, waren also eher Vermeidungstaktik als echte Not. Am liebsten hätte sie den Jungen sofort nach Hause geschickt. Vor der Toilettentür trennte sich die Spreu vom Weizen.
»Ich fang schon mal an«, rief sie. »Geht alles von deiner Pause ab.«
Ein Argument, das bei Leuten wie Kai oft Erstaunliches bewirkte. Vielleicht hätte ihm jemand raten sollen, vor diesem Einsatz nichts zu essen.
Als Erstes prüfte sie das Bett und den Zustand der Matratze. Es stand mit dem Kopfende mittig an der Wand. Kissen und Decke lagen links auf dem Boden, rechts stand der Sarg. Von Gerlinde Wachsmuth war nur der Abdruck ihres Körpers auf dem Laken geblieben. Sie musste eine kleine Person gewesen sein, die sich zum Schlafen hingelegt hatte und nicht wieder aufgestanden war. Ein ruhiger Tod. Ein sanfter, erwarteter Abschied. Ein stiller Gang. Judith spürte den Frieden und die Abwesenheit von Angst. Manchmal war der Tod der einzige Freund, von dem man nicht vergessen wurde.
Und dann hatte Gerlinde Wachsmuths Leiche sechs Wochen Zeit gehabt, sich im Hochsommer im fünften Stock einer schlecht isolierten Wohnung aufzulösen. Die Silhouette ihres Körpers war aus einem zarten Gelb, dort, wo Arme, Beine und Kopf gelegen hatten. Doch zur Körpermitte hin verdunkelte sich der Ton, bis er in der Mitte eine tiefviolette, fast schwarze Färbung erreichte. In dieser dunklen Mulde bewegten sich weiße Punkte.
Judith musste nicht unter das Bett schauen, um zu wissen, dass sich darunter die Flüssigkeit gesammelt hatte, die die Luft verpestete. Obwohl die Bestattungshelfer das Fenster geöffnet hatten und die Mentholpaste auf ihrer Oberlippe brannte, bohrte sich dieser Geruch wie mit einem Sandstrahler in alle Poren.
Die beiden Männer hoben den Sarg hoch und trugen ihn, so vorsichtig es ging, aus der Wohnung. Judith wartete, bis sie die Toilettenspülung hörte.
»Alles okay?«, rief sie in den Flur.
Die Tür öffnete sich. Kai kam herüber und sah sie mit diesem Ich-will-nach-Hause-Blick an, den alle hatten, die zum ersten Mal hinter die schöne Fassade vom Ende aller Dinge geblickt hatten.
»Ich brauche Schutzbrille, Vollanzug. Desinfektions- und Reinigungsmittel. Plastikfolie. Sprühkanister, Formaldehydverdampfer, Thermal- und Kaltnebelgerät. Die abgeschlossene Giftkiste – Larvizide und Akarizide, Monophosphan und Blausäure. Und natürlich die Kästen mit Scheuersand, Kernseife, Bürsten und Schrubbern. Verstanden?«
Kai schüttelte den Kopf.
»Es liegt alles griffbereit auf der Pritsche.«
Statt einer Antwort stolperte er wieder ins Bad und schlug die Tür hinter sich zu. Judith zählte von zehn bis eins und wartete. Das Würgen ließ nach. Natürlich hätte sie selbst hinuntergehen können. Doch das wollte sie nicht.
»Sind wir jetzt langsam so weit?« Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Ich gebe dir noch genau eine Minute. Dann rufe ich Dombrowski an und sage ihm, er soll dich abziehen.«
Die Klospülung rauschte. Kurz darauf plätscherte der Wasserhahn. Als Kai ein zweites Mal die Tür öffnete, drehte sie sich um und erwartete seinen Abschied.
»Gibt’s was für die Nase?«, fragte er.
»Atemschutzmasken.«
»Doppelt, wenn’s geht.«
Judith grinste und zog zwei aus ihrer Hosentasche.
»Na also. Nie ohne.«
Judith ging vor dem Bett auf die Knie. Sie trug ebenso wie Kai ellenbogenlange Gummihandschuhe und einen Papieroverall. Sie deutete auf den Fleck, der sich auf dem Teppichboden ausgebreitet hatte.
»Chlor und Sauerstoff. Aber du kriegst den Gestank trotzdem nicht weg. Der Teppich muss raus. Mit Glück ist ein Holzfußboden darunter, den man abschleifen kann.«
Sie stand auf. Kai starrte immer noch auf die weißen Punkte in der Mitte der Matratze. Sie hatten aufgehört sich zu bewegen, seit Judith sie mit dem Larvizid besprüht hatte. Sie nahm die Atemschutzmaske ab.
»Maden. Mit ein bisschen Liebe betrachtet, sind es auch nur Lebewesen. Zumindest waren sie es. Die Folie?«
»Mo… Moment.«
Kai schlüpfte in den Flur und kam mit der schweren Rolle zurück. Glücklicherweise hatte Gerlinde Wachsmuth in einem Einzelbett das Zeitliche gesegnet. Die Matratze war nicht schwer. Nur das Geräusch, als ein Teil der Maden hinunter auf die ausgebreitete Folie fiel, machte Kai zu schaffen. Es klang wie eine Handvoll Rosinen.
»Ist es immer so ekelhaft?«
»Nein«, log sie. »Meistens muss man nur die Betten abziehen und gründlich saubermachen.«
Das hier war harmlos. Nichts im Vergleich zu dem, was Cleaner sonst noch zu sehen bekamen. Wahrscheinlich war er nur deshalb noch dabei, um abends seinen Freunden von dieser Freakshow erzählen zu können, bei der er wie ein Komparse einmal durchs Bild huschen durfte. Wow, Maden. Leichen. Totengräber. Nennt mich Held. Judith nahm das Teppichmesser aus der Werkzeugkiste und schnitt die restliche Folie zu.
»Mann, was für ein Job. Warum machst du das?«
Sie dachte kurz nach. Wahrscheinlich war es in einem Beruf, der unter Nachwuchsmangel litt, nicht ratsam, die Wahrheit zu sagen.
»Weil ich es kann. Und viele andere eben nicht.«
Sie schnitt das letzte Stück Folie ab, fuhr die Klinge des Messers ein und ging zum weit offenen Fenster. Die Mittagshitze hatte sich wie eine Glocke über die Stadt gelegt. Von hier konnte sie bis zur Autobahn sehen. Sie bewunderte die symmetrischen Halbkreise der Ab- und Auffahrten, über die sich die Blechlawinen wälzten. Den besten Ausblick hatte man vom Funkturm. Manchmal gönnte sich Judith einen Ausflug auf die Plattform. Dann starrte sie von oben auf die Stadt und war überwältigt von ihrer rastlosen Schönheit. Sie dachte daran, dass sie am Abend mit dem Teleskop in die Lausitz fahren wollte, auf der Suche nach dem ultimativen dark spot, dem Ort mit der geringsten Lichtverschmutzung. Sie wollte endlich einmal wieder einen richtigen Sternenhimmel sehen. August. Die Wochen der Perseiden, des Meteorstromes, der die ewig hoffende Menschheit mit einer Fülle von Versprechungen beschenkte, die sich Sternschnuppen nannten.
Sie öffnete den Reißverschluss ihres Overalls und holte ein Päckchen Tabak heraus, in dem sie immer eine kleine Anzahl vorgedrehte Zigaretten aufbewahrte. Sie bot Kai eines der krummen Stäbchen an.
»Woher wusstest du, dass du das kannst?«, fragte er. »Hast du einen Eignungstest auf dem Arbeitsamt gemacht?«
Er gab ihr Feuer. Sie beugte sich vor und sah seine Hände, die er schützend um die Flamme hielt. Es waren junge Hände, mit schmalen Fingern und breiten Knöcheln. Noch zehn Jahre, und es wären die Hände eines Mannes. Sie inhalierte den Rauch und blies ihn an ihm vorbei aus dem Fenster hinaus. In zehn Jahren würde er frühestens verstehen.
»Es gibt Jobs, auf die bewirbt man sich nicht. Die kommen zu einem.«
»Einfach so?«
»Vielleicht hast du es noch nicht begriffen. Das hier ist eine Chance.«
Kai stützte die Unterarme auf das Fensterbrett und sah aus, als ob er sich mit dem Begreifen gerne noch ein bisschen länger Zeit lassen würde. Sie standen Schulter an Schulter, und die einzigen Geräusche waren der Verkehrslärm von unten und das leise Rascheln ihrer Overalls. Sie rauchten, und Judith blinzelte in das helle Tageslicht und zählte die Jahre rückwärts, die sie trennten. Sie kam auf elf. Er war zu jung für alles, was einem an so einem Tag in den Sinn kommen konnte, wenn die brodelnde Hitze das Blut in den Adern zum Kochen brachte und man in der Wohnung einer Toten plötzlich an Sternschnuppen dachte. Sie drückte die Zigarette auf dem äußeren Fensterbrett aus, setzte die Maske wieder auf, die auch nicht viel half, und ging ins Zimmer zurück. Fünf Minuten an der frischen Luft hatten gereicht, um den Geruch der Hölle zu vergessen. Er traf sie wie ein Schlag in die Magengrube.
»Und die Toten?« Er ließ nicht locker. »Wie kommst du mit den Toten zurecht?«
»Wir pflegen keinen allzu engen Umgang, wenn du das meinst.«
Natürlich meinte er das nicht. Sie hörte sich so abgebrüht an wie eine Ärztin aus einer dieser amerikanischen Serien, die im Privatfernsehen rauf und runter liefen. Dabei ging es einfach nur darum, dass Menschen auch nach dem Tod für sie Menschen blieben. Man erwies ihnen einen letzten Dienst. Sie traten von beiden Seiten an das Bett. Kai bückte sich und hob die Matratze auf der einen Seite hoch, sie auf der anderen.
»Ich habe noch nie eine Leiche gesehen.«
»Das kommt noch.«
»Vielleicht hättest du zu den Bullen gehen sollen. Wenn du so auf Tote stehst.«
Die Matratze knallte auf den Boden. »Da ist die Tür«, sagte sie.
Kai starrte sie mit großen Augen an.
»Ich meine es ernst. Du kannst gehen.« Sie griff nach der Rolle mit dem Klebeband, das sie auf dem Nachttisch abgelegt hatte. »Ich will mit Leuten wie dir nicht zusammenarbeiten.«
»Wie meinst du das?«
»Wie ich es sage.«
Kai warf einen unschlüssigen Blick in Richtung Flur, den Weg in die Freiheit und einen netten Nachmittag im Strandbad.
»Und was sagst du dem Chef?«
Sie riss einen halben Meter Klebeband ab und trennte es, weil sie Kai nicht um das Teppichmesser bitten wollte, mit den Zähnen von der Rolle ab.
»Dass du ein Vollidiot bist.«
»Warum das denn?«
Judith hatte keine Lust, ihm auch das noch zu erklären. Sie schlug die Folie über der Matratze zusammen, und das Klebeband verhedderte sich. Kai ging neben ihr in die Hocke und bändigte die Plastikplane mit zwei Griffen.
»Sorry«, sagte er. »Wird nicht wieder vorkommen.«
Wütend riss sie noch ein Stück Klebeband ab und hielt es ihm entgegen. Er schnitt es durch. Die nächsten Minuten arbeiteten sie schweigend.
Judith geriet ins Schwitzen. Das Versiegeln einer Matratze, auch wenn sie zu einem Einzelbett gehörte, war bei diesem Wetter keine leichte Sache. Der Overall war wie eine Sauna, und die Schutzmaske erleichterte das Atmen auch nicht gerade.
»Ich hab eigentlich gemeint, du bist doch eine Frau.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Was sagst du denn den Kerlen, wenn dich einer fragt, was du machst?«
»Kommt darauf an, ob ich ihn loswerden will oder nicht.«
Sie erkannte an seinen Augen, dass er lächelte. Machte sich wahrscheinlich Hoffnung, dass alles doch gar nicht so schlimm war.
Sie drehte die Matratze, damit Kai das Klebeband einmal um alle Seiten herum abrollen konnte. Das Band riss, die Folie rutschte ihr unter den Händen weg, und die Matratze fuhr quer über den Nachttisch und räumte alles ab, was darauf gestanden hatte. Glas klirrte. Judith unterdrückte einen Fluch. Es gab ein Gesetz, das nicht gebrochen werden durfte: Eine Wohnung war sauber, aber unversehrt zu verlassen. Kai bückte sich.
»Nur ein Bilderrahmen. Und die Glühbirne von der Lampe.«
»Stell sie wieder hin.«
Sie nahm ihm den Rahmen ab. Das Glas war gesprungen. Dahinter eingeklemmt das Foto eines ungefähr dreißigjährigen Mannes. Die verblassenden Farben verrieten, dass die Aufnahme mindestens zwei Jahrzehnte alt sein musste. Vorsichtig zog sie die Scherben aus dem Holz und stellte den Rahmen wieder auf den Nachttisch.
»Was machen Sie denn da?«
Judith fuhr herum. Sie hatte den Mann nicht kommen hören, aber der Tonfall seiner Stimme und der erste Eindruck passten zueinander. Er war schmächtig, fast ausgezehrt, und die ungesunde rote Gesichtsfarbe verriet, dass er sich entweder mit dem Aufstieg übernommen hatte oder Alkoholiker war. Ein Blick in seine gelblichen Augen genügte Judith, um der zweiten Annahme die höhere Wahrscheinlichkeit einzuräumen. Sie entdeckte eine vage, fast karikaturhafte Ähnlichkeit mit dem Mann auf dem Foto.
»Guten Tag. Wir sind beauftragt, die Wohnung zu entwesen.«
»Was?«
»Ent-wesen. Das Gegenteil von Ver-wesen.«
»Also von mir nicht. Verschwinden Sie.«
»Nach dem Bundesseuchengesetz muss diese Wohnung ordnungsgemäß gesäubert und desinfiziert werden. Ich weiß nicht, ob Sie die nötige Qualifikation dafür besitzen.«
»Ich zahle nicht. Damit Sie das gleich wissen. Was haben Sie da am Nachttisch meiner Mutter gemacht? Ich hab genau gesehen, wie Sie da dran waren.«
Sein Blick irrlichterte durch den Raum, blieb schließlich an der verpackten Matratze hängen.
»Und die lassen Sie hier. Hier wird nichts angefasst, verstanden? Ich ruf sonst die Polizei.«
»Ihre Mutter war das, die sechs Wochen hier gelegen hat?« Judith streifte die Gummihandschuhe ab. »Mein Beileid.«
»Raus hier. Sofort.«
Kai machte einen Schritt auf den Mann zu. Judith griff nach seinem Arm, ließ ihn aber sofort wieder los.
»Nein. Sie gehen«, sagte sie. Ihre Hand erinnerte sich noch an den Griff, doch ihr Kopf schaltete den Gedanken an Berührung aus. »Ich kann Ihnen nicht gestatten hierzubleiben, solange wir nicht fertig sind.«
Mit Widerspruch hatte der Mann nicht gerechnet. Erst jetzt fiel ihm die veränderte Chemie im Raum auf. Er zog Luft durch die Nase ein. Sein Gesichtsausdruck machte in erstaunlicher Wandlungsfähigkeit deutlich, was er dabei empfand: Überraschung, Erkennen, Ekel.
»Was ist los?«
»Die Leiche Ihrer Mutter wurde vor zwei Stunden abgeholt. Das Beerdigungsunternehmen wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie eine lange Reise hinter sich hätten. Also hören Sie auf, den besorgten Sohn zu spielen, und lassen Sie uns unsere Arbeit tun.«
»Sie ist tot«, wiederholte der Mann. »Die Leute nebenan haben das gesagt.«
Er drehte sich um und ging hinaus. Eine Weile hörten sie ihn leise schluchzen.
Judith wies Kai an, die Matratze zum Wagen zu bringen. Während er damit unterwegs war, begann sie mit der Desinfizierung des Raumes. Der Einsatz von weiterem Gift war nicht nötig, so weit war die Verwesung noch nicht fortgeschritten. Jedes Mal, wenn sie sich durch den engen Flur ins Badezimmer kämpfte, sah sie den Mann auf der Couch sitzen, weit vornübergebeugt, als würde er etwas auf dem ausgetretenen Teppichboden suchen. Beim vierten oder fünften Mal blieb sie stehen und beobachtete ihn. Er suchte nichts. Er bewegte sich nur mit der fahrigen Motorik des Süchtigen.
»Wir sind bald fertig«, sagte sie.
Der Mann sah auf.
»Ich hab sonst niemanden mehr.«
Judith zuckte mit den Schultern. Sie wollte sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen.
»Ich weiß, was Sie denken«, sagte der Mann. »Ich hätte mich mehr um sie kümmern sollen. Und Sie haben recht. Ja. Sie haben recht.«
Er fing wieder an zu wippen. Sie ging zurück ins Bad und ließ Wasser in den Eimer laufen. Natürlich hatte sie recht. Aber es stand ihr nicht zu, darüber zu urteilen, was im Leben von Gerlinde Wachsmuth und ihrem Sohn schiefgelaufen war. Sein Foto hatte neben ihrem Bett gestanden. Er war in ihrem Leben gewesen, sie aber nicht in seinem. So einfach und brutal war das. Die alte Wut stieg wieder in ihr hoch, aber sie hatte gelernt, sie zu beherrschen. Man musste unterscheiden zwischen dem, was richtig, was nötig und was sinnlos war. Es war absolut sinnlos, Männern wie ihm die Wahrheit zu sagen. Sie würde an ihm abperlen wie Regen an schmutzigen Scheiben.
Sie drehte den Wasserhahn zu und ging dann, ohne einen weiteren Blick auf den Heuchler im Wohnzimmer zu werfen, zurück ins Schlafzimmer. Wenig später kam Kai dazu, und sie arbeiteten, ohne hochzusehen, bis zum frühen Nachmittag.
Judith streifte den Overall ab und stopfte ihn in die blaue Mülltüte. Ihre Arbeit war getan. Sie war zufrieden. Sie wies Kai an, die Säcke nach unten zu bringen, und folgte ihm in den Flur.
»Herr Wachsmuth?«
Die Tür zum Wohnzimmer war geschlossen. Sie öffnete sie und stieß einen leisen Laut der Überraschung aus. Kai, schon fast draußen, drehte sich um und kam zu ihr zurück.
»Ist nicht wahr«, sagte er nur.
Die Türen des Wohnzimmerschrankes standen sperrangelweit offen. Die Schubladen waren herausgezogen, ihr Inhalt lag verstreut auf dem Boden. Mehrere Bilderrahmen waren achtlos auf den gekachelten Couchtisch geworfen worden. Die aufgerissenen Rückseiten verrieten, dass hier jemand etwas in großer Hast und ohne Rücksicht gesucht hatte. Wo sie einmal gehangen hatten, leuchteten helle Flecken auf der Tapete. Judith nahm einen von ihnen hoch. Es war ein schlechter Druck von Spitzwegs armem Poeten.
»Das Schwein ist weg.« Kai, der noch einmal die ganze Wohnung inspiziert hatte, kam zurück. »Und jetzt?«
Judith hielt das Bild vor einen Fleck, der der Größe nach passen konnte. »Wir müssen das aufräumen. Sonst hängt man uns das noch an.«
»Ich denke, wir haben Feierabend.«
Sie stellte das Bild ab, ging in die Knie und fing an, die Schubladen wieder einzuräumen. Schnapsgläser, Schuhlöffel, halb abgebrannte Kerzen, Spitzendeckchen, eine Schachtel mit Fotos. Alles achtlos hingeworfen und bis unter die Couch verstreut. Kai seufzte, hob ein Sofakissen vom Boden auf und puffte es mehrfach zusammen.
»Wenn der mir noch mal über den Weg läuft. Erst lässt er die Alte vermodern, und dann beklaut er sie auch noch.«
»Gerlinde«, sagte Judith. »Die Alte hieß Gerlinde Wachsmuth.«