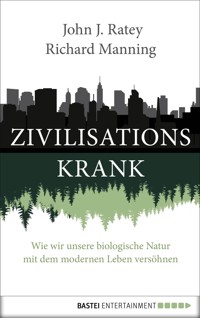
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Seit 40 000 Jahren haben sich unser Körper und Gehirn kaum, unsere Lebensweise durch die Zivilisation jedoch dramatisch verändert. Das tut uns nicht gut. Krankheiten wie Diabetes, Stress oder Burnout nehmen zu.
Wir leiden an einer Naturdefizit-Störung, sagt der renommierte Psychiater und Mediziner John Ratey. "Raus in die Wildnis! Weniger ist mehr!", lautet daher sein Rat. Schalten Sie Fernseher und Smartphone aus, bewegen Sie sich im Grünen.
Anhand neuester Wissenschaftserkenntnisse zeigen Ratey und Co-Autor Manning, wie Aufenthalte in der Natur, mehr Schlaf, gezielte Ernährung und Achtsamkeit unser Wohlbefinden und die Gesundheit steigern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
Über das BuchÜber die Autoren TitelImpressumVorwortEinleitungKapitel 1 – Homo Sapiens 1.0Die Evolution prägt uns bis heuteZum Laufen prädestiniert?BrennstoffEmpathieKapitel 2 – Woran wir leidenKrankheiten sind weniger das Problem, sondern alle möglichen WehwehchenAlles dreht sich um GlukoseAutoimmun Kapitel 3 – ErnährungDie Wirkung von Kohlenhydraten FallstudieMary Beth StutzmanKohlenhydrate zu ZuckerWie die Fettphobie entstandWarum Abwechslung in der Ernährung so wichtig istZurück zu Mary Beth StutzmanAber Vorsicht: Auch die Evolution kann eine zweischneidige Sache seinKapitel 4 – Der Körper in Bewegung Gehirnaufbau durch BewegungDer Aufbau des Gehirns Erziehung ist in erster Linie KörperertüchtigungEin Lauf im FreienKluge BewegungDie Entdeckung einer neuer BewegungsartTiefenschichtenKapitel 5 – Der Körper in RuheWarum Schlaf uns so guttutDie Geschichte von Beverly TatumSchlaf und GemeinschaftSprechen wir noch einmal von Abwechslung Kapitel 6 – AchtsamkeitWas der ungezähmte Geist enthülltDie Wissenschaft entwickelt sichDie Verbindung zum StressGehirnaufbauAchtsamkeit für jedermannKapitel 7 – Biophilie Wie wir unser besseres Ich in der Natur finden könnenWeitere Verstärkungseffekte Die Launen der NaturKapitel 8 – Sippen und StämmeDas Molekül, das uns aneinander bindetBewegung in GemeinschaftDas BindemittelDie menschliche KerneigenschaftKapitel 9 – ZentralnervensystemWie der Körper Gesundheit und Glück miteinander verbindetDer altertümliche NervVerbindung zu körperlichem WohlbefindenTraumatische Belastungen Jenseits von StressKapitel 10 – Persönliche Bemerkungen Was wir gemacht haben und was Sie tun könnenJohn RateyRichard ManningUnsere Vorschläge für SieDanksagungenJohn RateyRichard ManningRegisterÜber das Buch
Seit 40000 Jahren haben sich unser Körper und Gehirn kaum, unsere Lebensweise durch die Zivilisation jedoch dramatisch verändert. Das tut uns nicht gut. Krankheiten wie Diabetes, Stress oder Burnout nehmen zu. Wir leiden an einer Naturdefizit-Störung, sagt der renommierte Psychiater und Mediziner John Ratey. »Raus in die Wildnis! Weniger ist mehr!«, lautet daher sein Rat. Schalten Sie Fernseher und Smartphone aus, bewegen Sie sich im Grünen. Anhand neuester Wissenschaftserkenntnisse zeigen Ratey und Co-Autor Manning, wie Aufenthalte in der Natur, mehr Schlaf, gezielte Ernährung und Achtsamkeit unser Wohlbefinden und die Gesundheit steigern.
Über die Autoren
Richard Manning ist ein preisgekrönter Journalist und Autor zahlreicher Bücher. Seine Artikel erscheinen in Best American Science and Nature Writing, Harper´s, New York Times und Los Angeles Times.
John Ratey ist Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. Er ist Autor zahlreicher Bestseller über das Gehirn und zu Gesundheitsfragen, u.a. (gemeinsam mit Edward M. Hallowell): Zwanghaft zerstreut oder die Unfähigkeit, aufmerksam zu sein, TB 11,99 Euro.
John J. RateyRichard Manning
Zivilisationskrank
Wie wir unsere biologische Natur mit dem modernen Leben versöhnen
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Seidel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Go Wild«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Little, Brown And Company, Hachette Book Group, New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Barbara van Benthem, Tutzing
Foto S. 22 © Getty Images/Nat Farbmann
Umschlaggestaltung: Bürosüd, München
Einband-/Umschlagmotiv: © www.buerosued.de
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-1315-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
VORWORT
Jeder Autor sieht mit etwas Bangen einer Übersetzung seiner Texte entgegen, denn einiges von dem, was er in seinen gedruckten Zeilen zum Ausdruck bringen möchte, steht auch zwischen den Zeilen. Das ist unausweichlich so, denn sprachlicher Ausdruck ist immer rückgebunden an die spezifischen und einzigartigen Möglichkeiten der jeweiligen Sprache, und das ist zunächst die Muttersprache des Autors. Dies gilt umso mehr für einen Text und ein Buch, das bis in die Gefühlswelt hinein die Komplexität der eigenen Lebensweise zum Gegenstand hat. Doch bei der Vorbereitung dieser Ausgabe ging es uns zu unserer Überraschung einmal ganz anders. Wir haben im Gegenteil den Eindruck gewonnen, dass durch die Übersetzung nichts verlorengegangen ist, sondern dass durch die Übertragung in die deutsche Sprache und durch den Zusammenhang mit der Kultur in Deutschland einige uns wichtige Gedanken noch besser und anschaulicher zum Ausdruck kommen.
Das wurde uns klar, als der Übersetzer unseres Buches, Wolfgang Seidel, uns einen Hinweis auf Fußball übermittelte, auf den er offensichtlich im Laufe seiner Arbeit am Text gestoßen war. Im Urtext, in unserer amerikanischen Originalausgabe, wird Fußball gar nicht erwähnt, aber Seidel konnte zwischen den Zeilen lesen, dass davon sehr wohl die Rede war. In dieser Sportart und in der damit verbundenen Fußballbegeisterung ist so viel von dem enthalten, was das Thema und das Hauptanliegen des ganzen Buches darstellt. Im Buch werden eine ganze Reihe von Themen erörtert wie Ernährung, Bewegung, Evolution, archaische Hetzjagden und sehr viel komplexere Konzepte wie Empathie und sozialer Zusammenhalt; wir glauben, dass all diese Themen auch Kernpunkte der menschlichen Evolution sind, dass sie die wilde, ungezähmte Seite in uns grundlegend geprägt haben. Und wie Seidel ganz richtig erfasst hat, kommt all dies im Fußballspiel anschaulich und nachvollziehbar zusammen.
Wenn die Menschen Fußball spielen, dann bewegen sie sich natürlich sehr intensiv, es ist ein Laufsport, und er wird praktisch immer draußen, im Freien ausgeübt, also nicht in Hallen oder Fitness-Studios. Es ist ein Mannschaftsspiel, vergleichbar mit einem Jägerstamm bei einer archaischen Hetzjagd. Und wie diese Jäger sind die Spieler auf Empathie angewiesen, um miteinander kommunizieren zu können – so wie es seit mehr als 50 000 Jahren in unsere Gene eingeprägt wurde. Eine Fußballmannschaft ähnelt solch einer Jägergemeinschaft, sie leben oder trainieren gemeinsam, sie lernen, wie jeder andere Mitspieler »tickt«, wann der andere nur antäuscht, wie die Mitspieler reagieren. So werden sie quasi zu Empathie-Experten. Fußball zu spielen stellt für das Gehirn sicherlich eine noch größere Herausforderung dar als beispielsweise ein Dauerlauf im Freien – es greifen noch mehr Rückkoppelungseffekte ein; dadurch werden wir noch besser auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet und können uns noch besser an Veränderungen anpassen. Alle diese Dinge stehen im Zentrum unseres Buches, und sie sind gleichzeitig die Grundlage dafür, dass sich so viele Menschen für Fußball begeistern. Das ist keineswegs zufällig so.
Die tiefe Bindung des Menschen an die Natur, ja das Eingebundensein in die Natur und die Vorgaben der Natur für die Art und Weise, wie wir leben sollen, sind unserem Körper und Geist tief eingeprägt, ja geradezu genetisch codiert. Unsere Leidenschaften, das, wofür wir uns begeistern, folgen diesen Vorgaben unwillkürlich. Es ist Teil unserer Evolution, die Natur zu lieben und zu respektieren und allem Natürlichen leicht zu folgen. Dieser Gedanke ist keineswegs neu, vor allem auch in der deutschen Kultur. Genau aus diesem Grund sehen wir der deutschen Ausgabe unseres Buches mit großer Erwartung entgegen. Daher möchten die Autoren die Gelegenheit gerne nutzen, eine intellektuelle Dankesschuld abzustatten in Anerkennung dessen, was das amerikanische Denken dem Denken der Deutschen verdankt.
In den Vereinigten Staaten gibt es immer noch riesige Gebiete praktisch unberührter Natur, reine Wildnis also, die auch durch Gesetze geschützt und bewahrt werden soll. Wilde, unberührte Natur ist einer der grundlegenden Faktoren, welche die amerikanische Kultur und Zivilisation nachhaltig geprägt haben. Diese Wertschätzung alles Wilden und Ungezähmten und der Lektionen, die die Wildnis für unser modernes Leben bereithält, ist einerseits wirklich etwas spezifisch Amerikanisches. Andererseits ist den Autoren sehr wohl bewusst, und sie wissen es auch sehr zu schätzen, dass wir Amerikaner die sinnhafte Wahrnehmung dafür wesentlich aus Deutschland übernommen haben. Das lässt sich sehr gut belegen.
Der Vater der amerikanischen philosophischen Ideen vom Leben im Einklang mit der Natur ist Henry David Thoreau. Für uns Autoren war er beim Verfassen dieses Buches sozusagen im Hintergrund immer präsent, und von ihm stammt der Satz: »Die Bewahrung der Welt liegt in der Wildnis.« Wir hätten es selbst nicht besser ausdrücken können. Genauso wie Thoreau selbst sprechen wir dabei nicht nur von der äußeren Welt, sondern auch von der inneren Welt. Naturbelassene Wildnis ist das beste Ökosystem, und wenn wir uns in der Wildnis aufhalten, sorgt die gleichzeitig für unser inneres Ökosystem.
Thoreau gehörte zum Transzendentalismus. Diese geistige Bewegung entwickelte sich in Amerika in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich in Boston. Sie war entstanden, nachdem etliche Amerikaner extra Deutsch gelernt haben, um anschließend Deutschland, Österreich und die Schweiz zu bereisen und bei Schlüsselfiguren der deutschen Romantik und des deutschen Idealismus wie Immanuel Kant, Friedrich Heinrich Jacobi, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling und Johann Wolfgang von Goethe zu studieren. So wurden diese zu den eigentlichen Urhebern der amerikanischen Idee von der Wildnis.
Noch grundlegender sogar von der Vorstellung »des Wilden«. Sogar das Wort selbst, das Wort wild im Englischen, geht auf das deutsche Wort Wald zurück, beide haben einen gemeinsamen Ursprung.
Im Lauf der Zeit haben sich diese gedanklichen Pfade und dieser geistige Austausch wieder getrennt, und sie haben in den beiden unterschiedlichen Kulturen ihre je eigene Entwicklung genommen. Deswegen sind wir beide gespannt, wie sich die Diskussion entwickeln wird, wenn wir beides in unserem bescheidenen Rahmen wieder zusammenbringen. Auf jeden Fall zeigt sich unser geliebter Fußball nun auch in einem ganz neuen Licht.
EINLEITUNG
Go Wild. Wenn man den amerikanischen Originaltitel hört, denkt man im ersten Moment vielleicht an Schulkinder, die außer Rand und Band herumspringen, wenn der letzte Schultag vor den großen Ferien vorbei ist. Daher ist es durchaus berechtigt, erst einmal zu fragen: Was ist damit gemeint? Wenn nicht ausflippende Schulkinder, dann vielleicht irgendwelche Nudisten oder Sonnenanbeter auf einer einsamen Insel oder urzeitliche Jäger im Lendenschurz, die ihre Speere nach Antilopen werfen oder Löwen verscheuchen? An so etwas Aufregendes ist nicht gedacht, aber man kommt der Sache schon näher. »Wild« ist heutzutage ein ziemlich überstrapaziertes Wort, das mit einer Fülle von Bedeutungen aufgeladen sein kann. Wir hingegen wollen uns auf seine ursprüngliche Bedeutung besinnen, um es sinnvoll benutzen zu können – sinnvoll für unser persönliches Wohlbefinden.
Was wir damit meinen, ist einfach zu erfassen. Man denke an »wild« im Gegensatz zu »zahm«, an einen Wolf im Gegensatz zu einem Hund, an ein Bison im Gegensatz zu einer Kuh. Behalten wir für einen Moment die gleiche Art der Unterscheidung im Hinterkopf, wenn wir dies auf den Menschen übertragen und an »die Wilden« denken. Das ist nicht ganz so abwegig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn wenn man in längeren geschichtlichen Zeiträumen denkt – wenige zehntausend Jahre zurück genügt schon –, dann waren alle Menschen »Wilde«. Die gleichen Umstände und Kräfte, durch die Wolfshunde zu Haushunden domestiziert wurden, zähmten auch die »wilden« Menschen. Dies ist der Prozess der Zivilisation, und es liegt auf der Hand, dass er der Menschheit viele Vorteile gebracht hat. Wir wollen das keineswegs abstreiten. Das, worum es uns geht, hat mehr mit Genen, Evolution und Zeit zu tun. Die Evolution des Menschen vollzog sich fast ausschließlich unter den Bedingungen des Lebens in der freien Wildnis. Auch der moderne Mensch lebt genetisch noch unter den annähernd gleichen Bedingungen. Unsere Gene sind auf ein Leben und Überleben in freier, wilder Natur programmiert. Wenn wir es uns mit diesem Genprogramm in gezähmten, domestizierten, zivilisierten Lebensumständen bequem machen, machen wir uns krank und unglücklich.
Wir werden Ihnen eine ganze Reihe faszinierender Details aufzeigen, die sich aus diesem Genprogramm ergeben: dass Menschen dazu geboren sind, sich mit Anmut zu bewegen, dass es sozusagen in unseren Genen steckt, uns für Neues zu interessieren, dass wir uns von Natur aus zu offenen Räumen hingezogen fühlen, und vor allem, dass wir zur Liebe geboren sind. Eine weitere grundlegende Tatsache der menschlichen Existenz ist die Fähigkeit zur Heilung im Sinne der Selbstheilung. Dahinter steckt das Konzept der sogenannten Selbstregulierung, ein ganz fabelhaftes Reparatursystem angesichts des Verschleißes und des Stresses des alltäglichen Lebens. Daran denken wir im Wesentlichen, wenn wir von Go Wild sprechen.
Zu Beginn unseres Plädoyers für Go Wild zeigen wir Ihnen die wahrhaft dramatischen Folgen des Zivilisationsprozesses auf, die in mancher Hinsicht in die Katastrophe führen. Die weltweit wichtigsten Krankheits- und Todesursachen – Killer wie Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Depression, Krebs – sind der Preis, den wir zahlen, wenn wir unser eigenes Genprogramm ignorieren. Dabei ist es gar nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, diese Fehlentwicklung ganz individuell, durch persönliches Verhalten, wieder einzurenken. Das bewirkt das Wunder der Selbstregulierung. Die Aufgabe besteht darin, gewohnte Trampelpfade zu verlassen, um es dem Körper zu ermöglichen, seine Selbstheilungskräfte zu entfalten. Sie sind ein Geschenk der Evolution. Die Schritte dorthin sind leicht nachzuvollziehen, selbst in der modernen Zivilisation. Wir tragen hier keine bloßen Theorien oder Vermutungen vor. Viele Menschen haben diese Schritte bereits vollzogen, auch die Autoren dieses Buches. Wenn Sie unseren Gedanken folgen, werden Sie eine ganz neue Einstellung zu den natürlichen Lebensumständen des Menschen gewinnen. Dazu sollte unter anderem die Erkenntnis zählen, dass alles, was wir tun und denken, miteinander verbunden ist. All das beeinflusst unser Wohlbefinden. Diese an sich einfache Erkenntnis widerspricht in geradezu eklatanter Weise den grundsätzlichen Kategorien westlichen Denkens in den Wissenschaften und vor allem in der modernen Medizin. Die wissenschaftlichen Prinzipien fordern, ein Problem analytisch in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen, die fehlerhafte Komponente zu definieren, zu reparieren oder zu ersetzen. Das funktioniert bei Maschinen tadellos, aber wir sind keine Maschinen. Wir sind Geschöpfe der Wildnis, wilde Tiere. Und das oberste Prinzip der Wildnis lautet: Stelle dich auf Komplexität ein.
Es ist eine Tatsache, dass Ihre depressive Stimmung nicht nur ein bestimmter Geisteszustand ist, der sich irgendwo im Gehirn lokalisieren lässt. Sie kann direkt mit Ihren sportlichen (vielmehr: unsportlichen) Gewohnheiten zu tun haben oder damit, welche Gemüse oder Proteinarten Sie zu sich nehmen. Die Ursache für Ihre Fettleibigkeit könnte mit Ihrer Ernährung zu tun haben, aber genauso gut mit einer Infektion oder Schlafmangel – oder, selbst das ist denkbar, mit dem zu geringen Geburtsgewicht Ihrer Großmutter mütterlicherseits. Möglicherweise lassen sich Ihre beruflichen Probleme durch lange Spaziergänge in den Bergen mit Ihrem Hund lösen.
Jeder weiß, dass der Oberschenkelknochen mit dem Hüftknochen verbunden ist. Diese Erkenntnis wollen wir sehr viel weiter ausdehnen, um Ihnen eine Vorstellung von der enormen Komplexität und der Vernetzung verschiedener Aspekte des menschlichen Lebens zu geben.
In den folgenden Kapiteln werden wir das Thema Schritt für Schritt aufrollen, indem wir die relevanten Hauptpunkte in Unterthemen aufgliedern; darunter finden sich dann auch einige der üblichen Verdächtigen. Wir beginnen mit einigen grundlegenden Sachverhalten wie Ernährung und sportlichem Training, aber das soll nicht bedeuten, dass wir hier in gängiger Weise Ratschläge erteilen wollen – nach dem Motto: Tu das! oder: Iss nicht jenes! Vielmehr wollen wir auf bestimmte grundlegende Einsichten hinwirken, auf eine neue innere Einstellung zur menschlichen Lebensweise. Darauf aufbauend sollen weitere Verhaltenssituationen und Aspekte betrachtet werden, wie Schlaf, Achtsamkeit, Gemeinschaft, menschliche Beziehungen und Biophilie. Im weiteren Verlauf werden Sie sehen, dass eine ganze Reihe von Themen zur Sprache kommen, und Sie werden schnell feststellen, dass unsere Untergliederung, die Eingrenzungen und Abgrenzungen zwischen verschiedenen Teilen des Buches durchlässig sind, sich überschneiden und wiederholen. So werden wir uns als Erstes mit Ernährungsfragen beschäftigen. Dabei kommt man fast unausweichlich auf Dinge wie Hirnfunktion oder Immunsystem zu sprechen, die jedes für sich ein eigenes Thema bilden können. Darin spiegelt sich eben auch die Realität in all ihrer Komplexität.
Viel wichtiger aber ist es zu sehen, dass jedes dieser Themen einen bestimmten Verlauf hat und jeder dieser Verläufe irgendwann im Gehirn und im Bewusstsein endet. Das ist keineswegs überraschend. Schließlich ist das Wohlbefinden eine Sache des aktiven Bewusstseins. Dies wiederum führt zu einer Reihe von Grundsätzen oder Theorien, die den weiteren Gedankengang prägen. Manche dieser Theorien oder Behauptungen widersprechen einander. Aber jede hat etwas für sich, und man kann viel daraus ableiten und lernen.
Der erste Grundsatz taucht in der einen oder anderen Form immer wieder auf. Seine beste Formulierung findet sich in einem Satz, der amerikanischen Ureinwohnern zugeschrieben wird: »Jedes Tier weiß mehr als wir Menschen.« Die gegenteilige Behauptung hat eine lange, ungebrochene Tradition im westlichen Denken: Es ist die Vorstellung vom Menschen als »Krone der Schöpfung«, die in der jüdisch-christlichen Tradition tief verwurzelt ist. Danach stehen die Menschen an der Spitze der Evolutionspyramide, deutlich getrennt vom Tierreich und allen anderen überlegen.
Vielleicht ist es am besten, für den erstgenannten Standpunkt die Stimme eines Feldbiologen zu hören. Oftmals haben solche Forscher das beste Verständnis dafür, ähnlich einst die Indianer. Die genaue Beobachtung einer beliebigen Wildtierart ermöglicht vor allem ein tiefes Verständnis für die im Tier angelegten subtilen Möglichkeiten, wie es sich an seine Umgebung anpasst. Ein Biologe hat dieses Konzept der bestmöglichen Anpassung an eine gegebene Umwelt einmal als treffsichere Replik auf die herausfordernde Frage »Wenn Eulen angeblich schlau sind, wie Sie behaupten, warum bauen sie dann keine Häuser, Autos oder Computer?« auf den Punkt gebracht: »Sie sind so schlau, dass sie diese Dinge nicht brauchen.«
Die gleiche Vorstellung lässt sich aus viel alltäglicheren Zusammenhängen ableiten. Man muss nicht unbedingt studierter Biologe sein, um das Verhalten von Tieren zu beobachten. Viele Menschen machen das im normalen Leben ganz unwillkürlich, indem sie beispielsweise ihre Hunde beobachten. Schon viele Hundehalter haben gesehen, wie ihr Haushund einen Wurf Junge zur Welt brachte. Als verantwortungsbewusste Hunde-Übereltern bereiten wir uns so gut wie möglich auf das Ereignis vor. Wir konsultieren den Tierarzt, wir lernen etwas über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sicherstellt, dass die Jungen anfangen zu atmen; man muss eine Reihe von Dingen beachten, damit die Ankunft der Kleinen auf dieser Welt gelingt: etwaige Gegenstände, die die Atemwege verstopfen und Schleim wegwischen und dann durch sanftes Streicheln und Massieren den kleinen Körper so stimulieren, dass die Atmung in Gang kommt, dieser magische Augenblick, wenn sie erstmals Luft holen. Wir glauben, dass wir selbst all diese Vorbereitungen treffen müssen, weil unsere Hündin, auch wenn sie noch so schlau ist, beim ersten Wurf ihres Lebens nicht allein zurechtkommt, da sie ja vorher keine Ratgeberbücher oder Internetausdrucke lesen kann. Doch kaum sind die Jungen auf der Welt, führt diese angeblich so unwissende junge Tiermutter ohne zu zögern und mit traumwandlerischer Sicherheit sogleich alle notwendigen Schritte zur Atemstimulierung durch. Dann sieht sie ihr Herrchen oder Frauchen mit einem fragenden Blick an, der zum Ausdruck bringt: »Und was habt ihr hier zu schaffen?« Unsere Hündin braucht kein Handbuch zu lesen, denn jedes Tier weiß längst mehr als wir. Dieses Beispiel ist unter anderem deshalb besonders wichtig, weil hier Hormone eine Rolle spielen, in diesem Fall vor allem Oxytocin. Bei Hunden kommt es genauso vor wie bei allen anderen Tieren, einschließlich beim Menschen. Das »Geburtshormon« Oxytocin wird in diesem Buch noch öfter erwähnt werden – und zwar in Zusammenhängen, wo man es nicht erwarten würde, wie Geschäftstransaktionen, Sporttraining und Gewalt.
Wenn wir das Instinktwissen hinsichtlich dessen, was für einen gut ist, berücksichtigen, brauchen wir uns keine Beschränkungen auferlegen. Das ist übrigens eine unserer Kernthesen. Anscheinend sind wir heute an einem Punkt angelangt, wo viele glauben, für ihr Wohlbefinden alle möglichen Maßnahmen ergreifen und Verrenkungen machen zu müssen. Davon zeugen ganze Regale voller Ratgeberbücher, Mitgliedschaften in gleich mehreren Fitness-Studios, weltraumtaugliche Kleidung, neuerdings Self-Tracking, Lektüre der Gesundheitstipps in den Zeitschriften, Selbsthilfegruppen und ständiges Kalorienzählen. Stellen Sie sich im Gegensatz dazu eine Gruppe Massai-Männer vor – die legendenumwobenen Viehnomaden Afrikas –, wie sie in leichtem Trott über die Serengeti traben, durchtrainierte Körper mit perfekter Ausdauerkondition und einer Schönheit und Ökonomie der Bewegung, um die sie jeder Fitness-Freak beneiden würde. Hat man je gehört, dass die Massai Kalorien zählen oder Gesundheitsratgeber lesen? Oder dass sie Personal-Trainer beschäftigen? Wie erklärt man sich eigentlich den offenbar völlig zufriedenstellenden Gesundheitszustand von Jäger- und Sammler-Gruppen, wie er schon in der Kolonialzeit von Anthropologen immer wieder untersucht und überall auf der Welt bestätigt wurde: Diese Menschen seien fit, schlank und glücklich. Jäger und Sammler sind »Wilde« im wohlverstandenen Sinn des Wortes. Ebenso wie wilde Tiere wissen sie sehr viel mehr, als wir wissen: ein schlagender Gegenbeweis gegen die »Krone der Schöpfung«-Sichtweise. Auch wir wenden uns gegen diese Sichtweise, zumindest am Anfang. Der Schaden, den wir uns selbst und anderen und nicht zuletzt der Natur zufügen, hat seinen Ursprung zu einem Großteil in dem überheblichen Postulat von der Ausnahmestellung des Menschen.
Ob das menschliche Gehirn wirklich den Höhepunkt der Evolution darstellt, ist noch keineswegs endgültig geklärt. Dieses Experiment der Natur ist nämlich erst seit vergleichsweise wenigen Millionen Jahren in der Erprobung, und wir haben noch längst nicht alle Nachteile erkannt, auch wenn einige nun deutlicher in Erscheinung treten. Selbstverständlich bestreitet niemand die Tatsache, ja das Wunder, dass es sich beim menschlichen Gehirn um das komplexeste Organ überhaupt handelt. Seitdem die verschiedenen Aspekte der menschlichen Evolution ernsthaft erörtert und weiter erforscht werden, stehen bis zum heutigen Tag die kognitiven Fähigkeiten unseres Gehirns im Mittelpunkt – also Werkzeuggebrauch, die Fähigkeit zu vorausplanendem Denken, die menschliche Intelligenz; all diese Dinge, welche unsere Ausnahmestellung begründen. Natürlich sind das ganz einzigartige und wunderbare Fähigkeiten. Wir wollen sie keineswegs unterschätzen oder kleinreden, aber es könnte hilfreich sein, auch einmal intensiver über andere Fähigkeiten des Gehirns nachzudenken. Sinn und Zweck aller Gehirne, nicht nur der des Menschen, sondern aller empfindungsfähigen Wesen, ist es, Bewegung und Ortsveränderung zu ermöglichen sowie Koordination und »Handhabung« im ursprünglichen Sinn des Wortes. Auch diese Dinge beherrschen wir außerordentlich gut.
Dabei sind Gehirnfunktionen wie Intelligenz, Erinnerung, Lernen und das geistige Erfassen von Tatsachen gar nicht so übermäßig vielschichtig, wie man vielleicht denkt. Mittlerweile wissen wir dank raffinierter Mess- und Beobachtungsmethoden, dass bestimmte Fähigkeiten, die wir für selbstverständlich halten (Empathie, Sprache, alltägliche soziale Kompetenzen), viel komplexerer Natur sind. Wenn es um diese Dinge geht, ist das gesamte Gehirn involviert, da summen die Drähte und sprühen die Funken in unvorstellbar dichten neuronalen Netzwerken. Diese Dinge beherrschen wir im Gegensatz zu allen anderen Spezies. Wir werden das noch eingehender analysieren, können aber jetzt schon die Feststellung vorausschicken, dass unsere sonst nirgendwo zu findende Fähigkeit, Gemeinschaften zu bilden, das wesentliche Kriterium des Menschlichen ausmacht. Dass Menschen mit anderen Menschen zurechtkommen, ist unsere größte Leistung.
Solche Phänomene bilden die Parameter für unseren Ansatz, der diesem Buch zugrunde liegt. Wir werden uns mit bestimmten Aspekten menschlichen Verhaltens wie Ernährung, Schlaf und Bewegung näher befassen. Jede dieser Aktivitäten unterstützt das Gehirn. In konkret messbarer, geradezu begreifbarer und benennbarer Weise wird das Gehirn von solchen eher rein körperlich anmutenden Aktivitäten beeinflusst und unterstützt und seinerseits aktiviert, indem die neuronalen Verbindungen ständig befeuert werden. Sie sind der eigentliche Ort unseres Wohlbefindens und damit letztlich unserer Fähigkeit, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Wenn Sie dieses ganze System anregen, dann werden Sie sich besser fühlen.
Die einzelnen Kapitel folgen diesem grundlegenden Gedankengang. Wir beginnen mit einer Zusammenfassung dessen, was man über die ursprünglichen Lebensbedingungen und über die wichtigsten Stufen der Evolution des Menschen weiß. Wodurch ist die Lebensweise des Menschen im Grundsätzlichen bestimmt, und welche Erkenntnisse ziehen wir daraus für die Bestimmung der menschlichen Art oder der menschlichen Natur? Ein themenübergreifender Ansatz wird sein, das seit etwa hundert Jahren diskutierte Thema »Zivilisationskrankheiten« auf den neuesten Stand zu bringen und neu zu beleuchten. In der Tat liegt die Ursache für das, was uns krank macht, in unserer Zivilisation, in der Missachtung grundlegender Einsichten und Regeln unserer ursprünglichen, evolutionsgerechten Lebensweise. Heutzutage leiden wir nämlich hauptsächlich unter Zivilisationskrankheiten. In einem abschließenden, zusammenfassenden Kapitel werden wir praktische Ratschläge zum persönlichen Gebrauch geben.
Momentan kann man überall auf der Welt einen Trend beobachten, durch Rückbau nach ökologischen Gesichtspunkten wieder ursprüngliche Lebensbedingungen herzustellen. Die Europäer nennen diesen Prozess »Renaturierung«. Das ist eine sinnvolle und notwendige Bewegung, die immer mehr Anhänger gewinnt. Wir übernehmen gerne dieses Bild und stellen uns den menschlichen Körper genauso komplex und artenreich vor wie andere im Naturzustand belassene Ökosysteme. Wie diese funktioniert auch der Körper am besten, wenn er in seinem Ursprungszustand belassen wird. Betrachten Sie dieses Buch daher gerne als Anleitung zur Renaturierung Ihres Lebens. Vielleicht können Sie ihm sogar ein paar Gedanken entnehmen, die Ihre innere Einstellung zum Leben verändern wird.
Für den Anfang dürfte es allerdings genügen, wenn Sie sich drei verschiedene Situationen vorstellen. Es wird Ihnen helfen, wenn Sie sich bei der Lektüre ab und zu daran erinnern. So wie bei der früher üblichen chemischen Entwicklung von Fotos die Details erst allmählich zum Vorschein kamen, sollten durch das Buch immer mehr Details wahrnehmbar werden, je weiter die Lektüre voranschreitet. Zunächst mögen diese Bilder ganz verschwommen und zusammenhanglos erscheinen. Aber wenn wir unseren Job auf den nachfolgenden Seiten richtig gemacht haben, enthüllen sie sehr viel über die Lebensumstände des Menschen. Das erste Bild zeigt eine Gruppe von Khoisan, das sind Buschleute im südlichen Afrika, also typische Jäger und Sammler, damals noch im sozusagen urwüchsigen Zustand, unberührt von der Zivilisation. (Nachdem sie stärker mit der Zivilisation in Berührung kamen, wurden diese Menschen in kurzer Zeit genauso krank wie wir alle.) Diese Khoisan haben sich zu einem Palaver versammelt oder, noch wahrscheinlicher, lauschen sie einem Geschichtenerzähler. Das Zusammenrücken, um einem Erzähler zuzuhören, ist eine von den zutiefst menschlichen Aktivitäten, die uralt sind und sehr charakteristisch für unser Menschsein.
Was uns auf dem Foto als Erstes auffällt, ist, dass die Menschen nackt sind. Nacktheit war über den weitaus längsten Teil der Menschheitsgeschichte der vollkommen natürliche Zustand. Achten wir ab jetzt auch darauf, was uns der unbekleidete Zustand alles vor Augen führt: Wir sehen schlanke, geschmeidige Körper, in aufrechter Haltung, gut durchtrainiert. Betrachten wir den Geschichtenerzähler etwas eingehender: seine Lebendigkeit und ausdrucksvolle Gestik, die innere Erregung, wie er völlig in der Erzählung aufgeht. Insbesondere sein Gesichtsausdruck hat eine ganz besondere Ausstrahlung, mit der er die Gruppe in Bann schlägt und den gesamten Zuhörerkreis eng zusammenhält. Wer von uns heutigen Menschen könnte so gut kommunizieren? Und die Gruppe selbst? Die meisten sind Kinder. Ganz offensichtlich besteht zwischen den Zuhörern eine enge innere Verbindung, ein gemeinsames Band. Hier herrscht Vertrauen.
Unser zweites Bild stammt aus einem Video auf Youtube; jeder, der sich schon einmal mit Entwicklungspsychologie beschäftigt hat, kennt es. Es zeigt und erklärt einen zentralen Vorgang in der Entwicklung des Menschen. Die Szene ist völlig alltäglich und kommt bei jedem Kleinkind vor, sofern es sich ganz normal entwickelt. Man kann es sich leicht vorstellen: Eine Mutter und ihr Kleinkind befinden sich alleine in einem Raum voller Dinge, die eine magische Anziehungskraft auf Kleinkinder haben – leuchtend buntes Spielzeug und was diese Kleinen sonst so fasziniert. Trotzdem hat der Raum eine etwas unheimliche Atmosphäre. Der Kleine klammert sich an seine Mutter, schaut aber immer wieder zu den faszinierenden Spielsachen. Allmählich fasst er etwas Mut und Zutrauen, ermuntert von seiner Mutter. Schließlich löst er sich von ihr, um nach einem der Gegenstände zu greifen, beispielsweise einem großen Würfel. Aber der Würfel poltert mit dementsprechender Geräuschentwicklung zu Boden, und der Kleine rennt zurück zu seiner Mutter. Sie beruhigt und tröstet ihn eine Weile, bis er wieder genug Mut fasst, es erneut zu probieren, erneut zur Erkundung des Unbekannten aufbricht.
Das ist ein ganz elementarer Vorgang, wie er sich immer abspielt und immer schon abgespielt hat, seit Anbeginn der Menschheit. Hier zeigt sich das Grundmuster, wie unser Gehirn arbeitet und sich entwickelt, indem das Gleichgewicht zwischen Sicherheitsgefühl und Geborgenheit auf der einen Seite und Neugier und abenteuerlustigem Forscherinteresse immer neu austariert wird. Die in der Gegenwart der Mutter verkörperte Zuneigung und Unterstützung ist dafür unerlässlich. Das ist der ganz normale Gang der Entwicklung; wir werden auf dieses Bild später zurückkommen, weil es nicht nur auf Kleinkinder zutrifft, sondern auf uns alle.
Das dritte Bild scheint auf den ersten Blick nur ganz wenige Menschen zu betreffen – ein Sonderfall. Unserer Auffassung nach ist Wohlbefinden eine allgemein menschliche Kategorie, Autismus jedoch ist kein universelles Phänomen. Die meisten kennen es nur indirekt und betrachten es als Schicksalsschlag einiger weniger Menschen, möglicherweise verursacht durch einen Gendefekt. Was hat das mit mir zu tun?, fragen sie. Wir sind der Auffassung, dass die Bedeutung dieser neurologischen Störung den Aufwand, den die Gesellschaft treibt, bei Weitem übersteigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei Autismus ebenfalls um eine Zivilisationskrankheit handelt, weswegen er zu den Kernthemen dieses Buches gehört.
Ein Besuch im Center for Discovery außerhalb von New York hat uns tief beeindruckt; es handelt sich um ein Pflegeheim für etwa 360 autistische Menschen, die so gewalttätig oder verhaltensauffällig sind, dass sie in einer normalen familiären Umgebung nicht leben können. Bei unserem Besuch wurden wir durch verschiedene Klassenzimmer geleitet und kamen auch mit einigen ins Gespräch. Die Mitarbeiter des Heims erklärten uns, dass ein solch offener Zugang nur einen Monat früher gar nicht möglich gewesen wäre; man hätte immer damit rechnen müssen, dass der eine oder andere plötzlich ausrastet. Die Ursache für diese geradezu dramatische Veränderung der Gesamtsituation lag wohl hauptsächlich in einem neuen Bewegungsprogramm für die Insassen: Es bestand in einem Lauf- und Hüpftraining, bei dem auch miteinander getanzt wurde. Dieses neue Element in der Behandlung trat zu der in diesem Heim bereits seit Langem angebotenen besonders gesunden Ernährung und vielen Aktivitäten in der freien Natur.
Eine Schlüsselszene trug sich in einem winzig kleinen Klassenzimmer zu, wo vier Teenager gegenüber einer Glocke und einem Klangholz nebeneinander saßen. Abwechselnd spielte jeder von ihnen mit diesen Instrumenten. Eine schlanke Frau mit einem engelsgleichen Gesicht und Pagenhaarschnitt saß an einem kleinen Elektroklavier, klimperte eine einfache Melodie und sang dazu einen immer gleichen kurzen Refrain; die unendliche Melodieschleife brachte die Jungen dazu, aufzustehen und selbst die Glocke zu läuten oder auf das Klangholz zu schlagen; jeder hielt sich dabei streng an den einfachen Rhythmus, der von der Melodie der Klavierspielerin vorgegeben war. Auch der Refrain, das unablässig wiederholte »Läute die Glocke, läute die Glocke« forderte die Jungen dazu heraus und unterstütze sie dabei. Rhythmus und Musik, Melodie, Takt, Zeitmaß. Mit dieser einfachen Rhythmus-Übung lässt sich ein Geist wiedererwecken, der wie alle mitmenschlichen Regungen durch den Autismus gekappt wurde.
Bei der Klavierspielerin fiel uns auf, dass sie die einfache Tonfolge immer und immer wieder spielen musste – stundenlang, tagelang, dafür war sie angestellt. Dann fiel uns bei ihr aber auch auf, dass sie die kleine Melodie nicht einfach stur wiederholte, sondern jedes Mal etwas Eigenes hineinlegte, kleine Improvisationen oder Verzierungen, dass sie aus ihrer inneren Mitte heraus sang, wie alle guten Sänger aus innersten Gefühlen heraus. Sie versah ihr Spiel mit einem Hoffnungsschimmer – nicht nur Töne oder Geräusche, nicht nur Melodie und Rhythmus, sondern wahrhafte Musik. Sie tat es wieder und wieder, noch dazu in einer Situation, die die meisten Menschen als hoffnungslos ansehen würden. Sie war gegenüber ihren Zuhörern genauso engagiert und brachte sich genauso ein wie der Geschichtenerzähler der Khoisan.
Noch im Nachhinein hielten wir es für vollkommen richtig und angemessen, welchen nachhaltigen Eindruck diese Szene im Center for Discovery auf uns gemacht hatte. Es war für uns einer der beiden Wendepunkte in unserem eigenen Leben. Wir waren uns immer einig, dass es keinen Sinn ergibt, ein Buch zu schreiben, wenn sich dadurch nicht auch im Leben des Autors etwas ändert. Wir werden später darüber berichten, wie es für jeden von uns dazu kam. Nur so viel sei bereits verraten, dass Richard Manning 25 Kilo Gewicht verloren hat und Ultramarathonläufer geworden ist. John Ratey hat ebenfalls einiges an Gewicht verloren und hat seine Essgewohnheiten umgestellt – doch bei ihm bestand die größte Veränderung in einer grundlegenden Erweiterung dessen, worüber er sich Gedanken macht und worüber er schreibt. Bisher war er als Autor über Themen wie Sporttraining und Hirnforschung bekannt; aber seit dem Besuch im Center for Discovery interessiert er sich viel umfassender für Themen wie Schlaf, Ernährung, Natur, Achtsamkeit und vor allem wie all diese Faktoren zusammenwirken, um uns ein Gefühl des Wohlbefindens zu geben. Aber nicht nur der Besuch im Center for Discovery wirkte auf John Ratey bewusstseinserweiternd. Es gab noch ein weiteres Ereignis, eine spontane rein zufällige Begegnung mit ähnlicher Wirkung. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
Kapitel 1
HOMO SAPIENS 1.0
Die Evolution prägt uns bis heute
Gesundheit und Glücksempfinden sind durch die Evolution aufs engste miteinander verknüpft. Glücksgefühle stellen sich demzufolge viel leichter ein, als wir gemeinhin annehmen – jedenfalls dann, wenn man es auf aktive und ruhig ein bisschen abenteuerliche Weise angeht. Wenn es wirklich drauf ankommt, brauchen wir keinen Rat von anderen Menschen, um unseren Glückszustand zu definieren (und übrigens auch nicht die Hilfe von Büchern wie diesem hier). Das macht unser Gehirn ganz von selbst. Die gesamte Art und Weise, wie wir verdrahtet und durch die Evolution geprägt sind – all das läuft darauf hinaus, dass unser Gehirn aufpasst, ob es uns gut geht. Unser Überleben hängt schließlich davon ab, dass wir gesund und munter sind.
Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn das Körperfeedback aufgrund falscher oder fehlgeleiteter Signale auf einmal nicht mehr funktionieren würde; wenn es uns suggeriert, alle Systeme arbeiten normal, obwohl es uns physisch-medizinisch gesehen schlecht geht: Obwohl wir hungern, frieren, erschöpft oder seelisch am Ende sind, sagt uns das Gehirn, alles sei in bester Ordnung. Man kann sich leicht ausmalen, welche Überlebenschance ein Tier mit einem solchen Feedbacksystem hätte. Stellen Sie sich dann auch noch vor, ein solches dysfunktionales System wäre in Genen verschlüsselt und würde an die nächste Generation weitergegeben. Aber man braucht es sich gar nicht vorzustellen. Drogenabhängige stehen unter dem übermächtigen Einfluss genau solch eines fehlgeleiteten Systems, das ihnen signalisiert, es ginge ihnen gut, während gleichzeitig jeder leicht erkennt, dass dem nicht so ist. Welche Überlebenschancen haben diese Menschen? Wir kennen die Antwort, ohne dafür umfangreiche Feldstudien durchführen zu müssen.
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig es ist, verstehen zu lernen, dass unser Glück in allererster Linie von unserem körperlichen Wohlbefinden abhängig ist. Die Voraussetzungen für dieses Wohlbefinden wurden durch die Evolution nach Maßgaben für das schiere Überleben festgelegt. All das bedeutet auch, dass wir uns die Voraussetzungen und Grundlagen der menschlichen Entwicklungsgeschichte bewusst machen müssen, um uns des Glückzustands dauerhaft zu versichern. Davon sind wir heute weit entfernt. Die weitverbreiteten, geradezu »populären« Vorstellungen von der Evolution des Menschen beruhen auf mehr oder weniger falschen Voraussetzungen. Viel schlimmer ist allerdings, dass unsere Lebensweise schon seit Langem eindeutig gegen alle Regeln menschlichen Wohlbefindens verstößt, und das ist es, was uns krank macht.
Wenn wir über die Evolution des Menschen nachdenken, kommt uns beinahe unweigerlich als Erstes jenes Ablaufbild in den Sinn, jene Reihe von gezeichneten Figuren, erst der Affe, dann der Höhlenmensch, dann wir modernen Menschen und dann … Diese sehr bekannte Illustration löst immer viel Heiterkeit aus; ihr Grundgedanke ist in einem wichtigen Punkt allerdings ganz falsch. Genauso wie das Postulat von dem angeblich noch nicht entdeckten Bindeglied, dem »missing link«. Die Illustration mit den immer aufrechter gehenden Figuren suggeriert, dass die Evolution in einem langen Prozess immer wieder kleine Veränderungen am Gen-Design des Menschen vorgenommen habe. Demnach vollzog sich dieser Prozess mit einer eindeutigen Zielvorgabe von unseren affenähnlichen Vorfahren bis zu uns heutigen Menschen und schreitet weiter voran. Aber das stimmt so nicht.
Schon zu Darwins Lebzeiten gab es unter den Evolutionstheoretikern eine lebhafte Debatte, in der Darwin selbst den Standpunkt vertrat, dass sich die Evolution früher wie heute in allmählichen, kaum wahrnehmbaren Übergängen und Veränderungsschritten vollzieht. Die andere Fraktion vertritt eine Minderheitsmeinung, wonach die Evolution durch erratische Sprünge und Veränderungen gekennzeichnet ist. Diese Ansicht ist von den durchaus umstrittenen Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould und Niles Eldredge als »Punktualismus« bezeichnet worden. Im Hinblick auf die Evolution des Menschen neigt die Mehrheit inzwischen diesem letzteren Standpunkt zu – und wir tun das auch.
Danach erschien jenes Wesen, das wir als Homo sapiens bezeichnen, vor rund fünfzigtausend Jahren praktisch fix und fertig in Afrika. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Das wäre also Homo sapiens 1.0, dem keine weiteren nennenswerten Upgrades mehr folgten.
Diese Mehrheitsmeinung wurde von Gould folgendermaßen formuliert: »Während der letzten 40 000 bis 50 000 Jahre hat es beim Menschen keine nennenswerten biologischen Veränderungen mehr gegeben. Jede einzelne kulturelle und zivilisatorische Errungenschaft seither entstand auf der Grundlage gleichartiger Körper und Gehirne.«
In der oben zitierten figürlichen Ablaufzeichnung wie im Trivialverständnis von Evolution steckt außerdem eine zweite falsche Vorstellung, nämlich die der »missing links«. So etwas wie eine direkte Linie menschlicher Vorfahren, in der sich Schritt für Schritt der moderne Mensch immer deutlicher herausgeschält hat, existiert einfach nicht. Der Stammbaum des Menschen ähnelt keineswegs einer pyramidalen Tanne mit einem starken Stamm. Wenn man schon so ein Anschauungsbild aus der Botanik bemüht, dann müsste das Gebilde eher einem Gebüsch mit vielen schmalen Verästelungen und toten Zweigen gleichen. Das bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang sind die Neandertaler, die aus Fossilienfunden in Europa, Asien und dem nördlichen Afrika schon seit Langem bekannt sind. Neandertaler wären die langarmigen Gestalten in der Ablaufzeichnung. Den Begriff »Neandertaler« benutzen wir auch gerne, wenn wir in geringschätziger Weise von Mitmenschen reden, die wir für reichlich unzivilisiert oder regelrecht »unterentwickelt« halten; so steht es empörenderweise tatsächlich in einem der grundlegenden Werke zur Evolution. Die hierbei mitschwingende Unterstellung ist völlig klar. In dieser Sichtweise gelten die Neandertaler lediglich als Zwischenstation auf dem Weg zur Krone der Schöpfung, zu uns.
Die Evolution des Menschen verlief keineswegs in linearen Fortschritten. Vielmehr entwickelten sich im Lauf von Jahrmillionen – also über einen viel längeren Zeitraum, als unsere Art und Gattung Homo sapiens jemals bestand – eine ganze Anzahl anderer lebenstüchtiger Hominiden mit großem Gehirnvolumen, aufrechtem Gang, handwerklichem Geschick und jägerischen Fähigkeiten, die sich als gesellige Primaten zu ihrer Zeit, an ihrem Platz oder in ihrer Nische durchaus behaupteten. Der moderne Homo sapiens hingegen erschien erst auf der Bildfläche, nachdem neunzig Prozent der Zeit, die die Evolution von Hominiden in Anspruch genommen hatte, bereits verstrichen war. Und mit Homo sapiens kam etwas Neues in die Welt, eine neue Art. Ziemlich rasch verschwanden alle anderen dieser vollkommen lebenstüchtigen Hominiden, jede einzelne. Wir sind in der Tat die einzige überlebende Art der Gattung Homo.
Interessanterweise gab es gleichzeitig nicht nur eine dramatische Abnahme von Homo-Arten, sondern auch in der genetischen Vielfalt innerhalb der Homo-sapiens-Gruppen selbst. Alle Hominiden, nicht nur Homo sapiens, haben ihren Ursprung in Afrika. Das wird von niemandem ernsthaft bestritten. In Afrika selbst gibt es auch nach wie vor eine gewisse genetische Vielfalt unter den dort lebenden Homo sapiens – wie man es am Ursprung einer Art auch erwarten würde. Aber außerhalb Afrikas sind die genetischen Variationen bei den Menschen vergleichsweise gering. Dafür gibt es eine gute Erklärung. Wenn sich Bevölkerungsgruppen aufteilen, ist das stets ein Anlass für die Entwicklung weiterer Vielfalt und der Bildung von Unterarten. So bilden sich Abzweigungen vom evolutionären Stammbaum, wenn sich aufgrund von durchaus denkbaren natürlichen Ereignissen dauerhafte Unterpopulationen herausbilden, die sich genetisch eigenständig weiterentwickeln. Ein Anstieg des Meeresspiegels, der zu Inselbildung führt, oder ein Gletschervorstoß, der vormals zusammenhängende Gebiete trennt, können solche nachhaltig wirksamen natürlichen Ereignisse sein. Seit Zehntausenden von Jahren standen alle menschlichen Wesen durch Reisen, Handelsaustausch oder Migration irgendwie immer miteinander in Kontakt. Und das Ergebnis ist eine genetisch weitgehend einheitliche Weltbevölkerung. Wenn wir also hier von der Natur des Menschen sprechen, dann sind wirklich alle Menschen gemeint, die seitdem auf der gesamten Erde gelebt haben. Aufgrund dieser weit zurückreichenden Verbindungen und Gemeinsamkeiten der menschlichen Art entstand nie ein evolutionärer Druck, eine ganz neue Art zu bilden oder sich zu einer »Über-Art« weiterzuentwickeln.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Variationen und Innovationen. Diese kleinen Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind aus kulturellen Gründen, tief eingeprägten Vorurteilen, die nichts mit Genetik zu tun haben, enorm aufgeblasen worden. Betrachten wir nur einmal die in der Evolutionsgeschichte relativ »junge« Variante mit heller Haut und blondem Haar. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch waren ungefähr 80 Prozent der Individuen überall auf der Welt dunkelhäutig. Das evolutionäre Experiment, es mal mit heller Haut zu probieren, begann erst vor etwa zwanzigtausend Jahren in Europa als eine Adaption an das Leben in einer Umgebung, wo die Sonne nicht so oft scheint. Was für ein Gewese machen die Menschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart um diese winzige, geradezu insignifikante Variante im Gesamtspektrum der genetischen Ausstattung unserer Art, die so geringfügig ist, dass man sie im gesamten Genom nicht einmal eindeutig identifizieren kann. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Konflikte in der Geschichte lässt sich damit in Verbindung bringen, wer »es« hat und wer nicht.
Andere Varianten, mit denen die Evolution auch erst seit entwicklungsgeschichtlich kurzer Zeit »spielt«, sind die Laktosetoleranz und die Malariaresistenz, wie sie sich im tropischen Afrika als eine natürliche Vorkehrung gegen Sichelzellenanämie manifestiert.
In solchen Punkten hat es auch bei Menschen eine evolutionäre Veränderung gegeben, doch diese Veränderungen sind so marginal, dass man sie guten Gewissens vernachlässigen kann. Jedenfalls unterscheiden wir uns im Hinblick auf unsere genetische Ausstattung in nichts von den ersten Homo sapiens, denn wir sind weder größer noch schneller noch langsamer noch intelligenter als diese. Im Kern sind wir die gleichen Typen, denen es irgendwie gelungen ist, eine ganze Handvoll recht ähnlicher, aufrecht gehender Affenarten zu überleben und im Evolutionswettbewerb zu besiegen und etwas zu erreichen, was vorher noch keiner anderen Art der Welt gelungen ist: jeden einzelnen Quadratmeter unseres Planeten zu besiedeln.
Doch egal, was immer der Auslöser gewesen sein könnte – klar ist, dass mit dem Homo sapiens etwas völlig Unvorhersehbares und Unerwartetes erschienen ist. Dieses Wesen, das wir »Mensch« nennen, ist ziemlich unvermittelt aufgetreten. Die evolutionären Änderungen, die dazu geführt haben, zählen auch heute noch zu den Hauptstärken unserer Art, und es sind genau diese Eigenschaften, denen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen. Welche sind es?
Zum Laufen prädestiniert?
Fangen wir mit dem aufrechten Gang an und der Fähigkeit, schnell zu laufen. Diese Fähigkeit, auf zwei Beinen zu gehen, ist sehr aufschlussreich. Man kann daraus sehr interessante Erkenntnisse gewinnen, wenn man das Thema einmal ganz unvoreingenommen betrachtet.
Unter dem Schreibtisch von David Carrier in seinem Büro an der Universität von Utah gammelt ein Paar ziemlich ausgelatschter Inov-8-Laufschuhe vor sich hin. Menschen mit einem geübten Blick können aus diesen Schuhen genauso viele Informationen ablesen wie solche, deren Blick für die Form von Oberschenkelknochen geschult ist. Bei Inov-8 handelt es sich um eine britische Marke, die von solchen minimalistischen Läufern bevorzugt wird, die sich gerne auf schwierigen Bergtrails tummeln. Carrier, ein drahtiger Mann in mittlerem Alter mit einem imposanten Schnauzbart und welligem Haar, blickt uns durch seine ovale Metallbrille freundlich lächelnd an und versichert seinen Besuchern, dass er in der Tat gerne Gebirgstrails läuft. Doch sein Ruhm gründet nicht auf seinen läuferischen Aktivitäten – jedenfalls nicht in der einschlägigen Szene –, und sein Ruhm in der Wissenschaft ist in der Tat von anderer Art. In der Welt der Sportläufer ist er bekannt, weil er in Wyoming einmal versucht hat, eine Antilope zu Tode zu hetzen, was ihm zunächst allerdings nicht gelungen ist. Erst als er sich dafür Rat bei afrikanischen Buschleuten geholt hatte, schaffte er es. Allerdings stellte sich dabei heraus, dass es gar nicht um Lauftechnik ging, sondern um Empathie.
Carriers Forschungen und die seiner Kollegen, darunter sein Mentor Dennis Bramble, der ebenfalls an der Universität von Utah lehrt, sowie David Lieberman in Harvard, haben über die Technik des Hetzens von Antilopen hinaus eine hervorragende Bedeutung sowohl für aktive Läufer als auch für diejenigen, die mehr Laufsport betreiben sollten. Ihre Ergebnisse stehen im Mittelpunkt bei einer leider ganz alltäglichen Erfahrung: Ein Jogger geht wegen Schmerzen oder einer Verletzung zum Arzt und muss sich dabei das Doktor-Mantra anhören: »Wissen Sie, der menschliche Körper ist eben nicht zum Laufen gemacht.« Dank der Forschungsergebnisse von David Carrier kann der Jogger mit vollem Recht seinem Arzt darauf mit »Nonsens« antworten. Denn Menschen sind in Tat und Wahrheit die besten Ausdauerläufer auf dem gesamten Planeten. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Kann die überragende Stellung von Homo sapiens auf der Erde etwas damit zu tun haben, dass wir die einzigen überlebenden zweibeinigen Affen sind?
Immer wieder bekommt man zu hören, dass die Affen unsere nächsten Verwandten in der Tierwelt seien, als ob die Menschen eine Art Verwandte dritten Grades der Schimpansen wären. Damit im Zusammenhang steht die ebenfalls falsche Vorstellung, Menschen seien nichts anderes als Affen mit etwas eleganteren Gesichtszügen und besseren Proportionen. Nur ein paar neue Tupfer, kein neuer Farbanstrich. Doch die Ergebnisse aus der Forschung über das Ausdauerlaufen sprechen eine ganz andere Sprache. Zwischen der Gattung Mensch und der Gattung Schimpansen bestehen fundamentale Unterschiede.
In ihrer bahnbrechenden Arbeit zu diesem Thema, erschienen in der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature, untersuchten Bramble und Lieberman den ganzen Komplex gleichberechtigt sowohl unter dem Aspekt »Laufen« als auch unter dem Aspekt »Gehen«. Schon durch diese Herangehensweise wurde die herrschende Grundvorstellung, die natürliche Fortbewegungsart des Menschen sei das Gehen, nicht das Laufen, in Frage gestellt. Alle Affen können sich mehr oder weniger rennend fortbewegen, aber nicht besonders schnell und nicht besonders weit und ganz bestimmt nicht besonders elegant. Menschen sind zu alldem viel besser in der Lage. Diese einfache Tatsache ergibt sich ganz klar aus unserer anatomischen Struktur; sie steckt sozusagen in den Knochen. Die Forscher wiesen allein im menschlichen Skelett sechsundzwanzig Adaptionen auf, die ausschließlich für das Laufen geeignet sind, nicht für das Gehen. Etliche davon betreffen, wie man es nicht anders erwarten würde, die Beine und die Füße. Beispielsweise benötigt man zum Schnelllauf einen elastischen, gebogenen Fuß – den die Menschen haben, aber nicht die Affen. Ebenfalls unabdingbar sind unsere viel längeren Achillessehnen und viel längeren Beine im Vergleich zum übrigen Körper. Im Gegensatz zum Gehen benötigen wir beim Laufen Vorkehrungen, die eine Gegenrotation ermöglichen. Beim Laufen dreht sich der Oberkörper stets in der Gegenrichtung zur Bewegung des Unterkörpers, was durch einen Drehpunkt in der Hüfte ermöglicht wird. Beim schnellen Laufen ist der Oberkörper bei weitem mehr involviert als beim bloßen Gehen, und es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten im menschlichen Körper, die nur dazu da sind, diese ständige rotierende Gewichtsverlagerung zu bewerkstelligen.
Alle diese speziellen »Stellschrauben«, die für den Schnelllauf benötigt werden, finden sich im Übrigen auch bei allen anderen Vierbeinern, die sehr schnell unterwegs sein können, namentlich bei Hunden und bei Pferden.
Keine einzige dieser Besonderheiten findet sich hingegen bei den Affenarten – also bei denjenigen Gattungen, die uns am Evolutionsstammbaum am nächsten stehen. Um die Menschheit zum Laufen zu bringen, griff die Evolution auf einige ältere Anpassungsleistungen kaum verwandter Arten zurück. Das geschah ziemlich unvermittelt vor ungefähr zwei Millionen Jahren mit dem Auftreten der Hominiden, der taxonomischen Familie, zu der auch unsere Gattung und Art gehören. Dies alles bedeutet, dass wir nicht nur genetisch an den Schnelllauf angepasst sind, sondern dass wir durch diese Laufart definiert sind.
In der Wissenschaft sind die meisten dieser Erkenntnisse schon seit Langem bekannt, aber es ist Carriers Verdienst, aufgezeigt zu haben, worin die überragende Bedeutung dieser plötzlichen evolutionären Neuorientierung weg von der Affenlinie liegt. Seine Arbeitshypothese trug die Bezeichnung »Hetzjagd«. Zweifellos sind viele Säugetierarten – und besonders solche, die als Nahrungsquelle eine wichtige Rolle für den Menschen spielten – ganz hervorragende Schnellläufer. Auch für sie hat die Evolution vorgesorgt. Diese Tiere, meistens handelt es sich um Huftiere wie Hirsche oder Antilopen, sind als Sprinter blitzschnell, aber sie haben keine Ausdauer. Wenn der Schnelllauf so wichtig war, dass er eine Art Wasserscheide in der Evolution darstellt, dann müssen die Menschen diese Fähigkeit zur Nahrungsgewinnung genutzt haben, indem sie den Wildtieren so ausdauernd nachgelaufen sind, bis diese vor Erschöpfung zusammenbrachen, schlussfolgert Carrier. Das Töten der Beute war für die Jäger anschließend ein leichtes Spiel.
Carrier machte dann seinen Versuch in Wyoming, wo es viele Antilopen gibt. Es gelang ihm in der Tat, ein einzelnes Tier von der Herde zu isolieren, die Verfolgung aufzunehmen und es über eine längere Strecke zu jagen. Doch als dieses Tier erste Ermüdungserscheinungen zeigte, schlug es einen Bogen zurück zu seiner Herde, wo es in der Menge verschwand. Carrier hätte ein frisches Tier isolieren und bei diesem die Verfolgung aufnehmen müssen. Was zu tun war, um bei dieser Art von Jagd erfolgreich zu sein, lernte Carrier schließlich (eher durch Zufall) von Buschleuten in Südafrika. Er ließ sich beibringen, worauf es ankam; selbstverständlich spielte ausdauernder Schnelllauf dabei eine wichtige Rolle, aber man benötigt auch ein großes Erfahrungswissen über die Beutetiere und ihr Verhalten. Dieses Wissen grenzt schon an die beinahe übernatürliche Fähigkeit, vorausahnen zu können, was das Tier als Nächstes tut. Ohne ein großes Gehirn wäre die Fähigkeit zum Schnelllauf bedeutungslos gewesen. Dieser Verbindung lohnte es sich nachzugehen (wenn nicht nachzurennen), aber die Jagderfolge der Buschleute ermöglichten es Carrier, Bramble und Lieberman immerhin, für ihre Hypothese den Beweis zu erbringen. Menschen sind in der Tat Born to Run, zum Laufen prädestiniert, wie der Titel von Christopher McDougalls populärem Buch lautet, in dem ihre Forschungen allgemeinverständlich zusammengefasst sind. Zu laufen ist der eigentliche Daseinszweck des Menschen.
Sind wir damit schon am Ende angelangt? Keineswegs. Bei unserem Gespräch erwähnte Carrier fast nichts von alledem, sondern befasste sich vielmehr mit anderen Themen von Bramble und Lieberman, wonach angeblich der menschliche Gluteus maximus (zu Deutsch: Arschbacken) der Hauptgrund für unsere ausgeprägten schnellläuferischen Fähigkeiten sein soll. Carrier hingegen meint, dass der Pomuskel für das Laufen selbst so gut wie keine Rolle spielt, sondern bei einer ganzen Reihe anderer Bewegungen. Und es seien diese Aktivitäten und Bewegungen, mit denen er sich mittlerweile intensiv befasst. Daran knüpft er eine ganze Kette von Gedanken, die schon in dem Ursprungskonzept seiner Forschungen eine entscheidende Rolle spielten – und die ein wirkliches Rätsel darstellen: ein Konzept, das er mit dem Begriff »Transportkosten« bezeichnet.
Es handelt sich um ein relativ einfaches Konzept, mit dem man direkt zur Effizienz von Fortbewegung vorstößt. Stellen Sie sich ein Kurvendiagramm vor, bei dem auf der einen Achse die erreichte Geschwindigkeit eingetragen wird und auf der anderen die Energie, welche das jeweilige Wesen dafür aufwenden muss. Bei den meisten Arten wird diese Kurve u-förmig sein, wobei der unterste Punkt des U das Optimum bezeichnet. Bei dieser Geschwindigkeit legt das Tier die größte Distanz mit dem geringsten Energieaufwand zurück, genauso wie bei einem Auto der beste Verbrauchswert bei, sagen wir, neunzig Stundenkilometern liegen könnte. Dieser Punkt bezeichnet die größte Effizienz, die optimale Geschwindigkeit, die pro eingesetzter Energieeinheit erreicht werden kann. Allein die Tatsache, dass eine solche u-förmige Kurve existiert, zeigt, dass die Körper der meisten Tiere für eine bestimmte Geschwindigkeit ausgelegt sind, bei der der Energieverbrauch am geringsten ist.
Diese Regel ist auch auf den Menschen anwendbar, aber wie sich schnell herausstellt, bezieht sie sich nur auf das Gehen. Konkret bedeutet das, dass die Energie-/Geschwindigkeitskurve beim Menschen ihren optimalen Punkt bei ungefähr 1, 3 Metern pro Sekunde erreicht, das ist normale Gehgeschwindigkeit. Bei dieser Geschwindigkeit wird am wenigsten Energie verbraucht, um eine bestimmte Strecke zu überwinden. Beim Schnelllauf, zumindest bei dem des Menschen, ergibt sich jedoch keine solche Kurve mit einem gut definierbaren Optimum. Was sich zeigt, ist ein flacher Kurvenverlauf. Es gibt also bei uns keine optimale Geschwindigkeit in Relation zur verbrauchten Energie. Bei allen anderen Tieren mit Schnelllauf-Fähigkeiten wie Pferde, Hunde oder Hirsche zeigt sich aber sehr wohl die u-förmige Kurve, wenn sie laufen. Wenn des Menschen genetische Bestimmung also der Schnelllauf sein soll, wo ist dann das Optimum? Die Evolution liebt nichts so sehr wie Energieeffizienz. Ganze Arten leben und sterben fast nur unter diesem Aspekt – warum sind die Schnelllauffähigkeiten des Menschen also nicht auf maximale Energieeffizienz abgestimmt?
Dieser ganze Komplex eröffnet eine weitere Forschungsrichtung, diesmal nicht im Vergleich der verschiedenen Arten, sondern im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper. Darauf zielt Carrier durchaus ab, aber zunächst erinnert er daran, dass sich der flache Kurvenverlauf beim menschlichen Schnelllauf nur dann ergibt, wenn man die Daten mehrerer Testpersonen zusammenfasst. Wenn man hingegen die Individuen betrachtet, ergibt sich für jeden Einzelnen in der Tat eine individuelle U-Kurve, wobei das Optimum bei jedem Menschen verschieden ist. Das wiederum gilt nicht für andere (Tier)Arten, mit anderen Worten, bei Menschen liegt in diesem Punkt eine viel größere Variabilität vor, und das hat natürlich seine Ursache in unserer unterschiedlichen Kondition und Lauferfahrung.





























