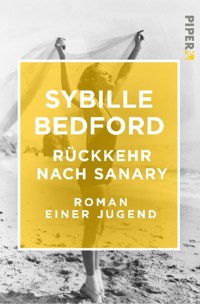9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das erste Werk von Sybille Bedford: ein bedeutendes und beglückendes Reisebuch Sybille Bedford will noch etwas mehr von der Neuen Welt sehen, bevor sie nach Kriegsende die Rückkehr in die Alte Welt plant. Ihre Reise nach Mexiko mit ihrer Freundin ist ganz spontan. Was sie sehen, hören und schmecken, wen sie treffen und was sie Aufregendes erleben in diesem schönen, rauen Land, erzählt Sybille Bedford mit der für sie typischen Frische und mit feinem Humor. »Man muss sich keineswegs für Mexiko interessieren, und man darf Reiseliteratur für ein hybrides, ja im Grunde überflüssiges Genre halten, um dieses Buch trotzdem herzlich zu lieben.« Eva Menasse, »Südddeutsche Zeitung«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Übersetzt aus dem Englischenvon Christian Spiel
© Piper Verlag GmbH, 2020© 1953.1960 Sybille BedfordTitel der englischen Originalausgabe: »A Visit to Don Otavio«© 1960 William Collins Sons & Co. Ltd., London© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München (2009)Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorwort von Bruce Chatwin
Erster Teil
Auf der Suche einer Reise
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zweiter Teil
Don Otavio
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Dritter Teil
Reisen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Vierter Teil
Das Ende eines Besuchs
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Vorwort von Bruce Chatwin
Zu den vielen Geheimnissen der Verlegerei im 20. Jahrhundert gehört jenes: Wie konnte es möglich sein, dass Sybille Bedfords Zu Besuch bei Don Otavio jemals vergriffen war? Wird Sybille Bedford doch in die englische Literaturgeschichte als eine der glänzendsten Stilistinnen unserer Zeit eingehen. »Reisebücher« (was für eine aussagelose Kategorie!) erlebten zugegebenermaßen eine Konjunkturschwäche in den sechziger Jahren, während viele prätentiöse und unlesbare Romane lieferbar blieben. Aber Don Otavio ist genauso wenig ein Reisebuch, wie Turgenjews Aufzeichnungen eines Jägers ein Buch über das Waldschnepfen-Jagen ist. Nein, es ist ein Roman, a novel, im besten Wortsinn – im Sinne von etwas »Neuem und Frischem« –, und als solches gehört Don Otavio zu ihren drei mehr oder weniger autobiografischen Romanen, deren erster Ein Vermächtnis ist. Don Otavio ist eine Geschichte der Befreiung aus der klaustrophobischen Lebenssituation im New York der Kriegsjahre; es wagt sich an eines der komplexesten Themen, Mexiko (an dem so viele Literaten scheiterten); und schließt mit dem Porträt eines unvergesslichen Mexikaners, Don Otavio de XyXyXy.
»Natürlich ist es ein Roman«, sagte Mrs. Bedford einmal zu mir. »Ich wollte etwas Leichtes, Poetisches schreiben … Ich habe mir keine einzige Notiz gemacht, während ich in Mexiko war …Wenn man sich mit Notizen blockiert, geht alles verloren. Aber ich habe Postkarten an meine Freunde geschickt, und als ich anfing zu schreiben, habe ich sie mir alle wieder zurückschicken lassen.«
Sybille Bedford ist die lebhafteste und wortgewandteste Person, die ich kenne; sie ist absolut resistent gegen jede Art von Gemeinplatz, und ihre drei voneinander untrennbaren Leidenschaften sind Schreiben, Freundschaften und ein gutes Glas Rotwein. Zwar ist sie in Deutschland kurz vor dem Ersten Weltkrieg geboren, aber es scheint, als sei sie unterwegs geboren. Ihre Mutter war eine ewig Rastlose mit dem Temperament einer Bohemienne und vielfältiger Nationalität. Ihr Vater war ein süddeutscher Baron, »befreundet mit den besten Köchen von London und Paris«, der ihr, als sie sechs Jahre alt war, beibrachte, wie man grüne Bohnen nicht verkocht und wie man einen guten Jahrgang erkennt. »Meinem Vater wäre nie in den Sinn gekommen, warum ein sechsjähriges Kind keinen Geschmack haben sollte.«
Er starb ein Jahr später – woraufhin sie zu ihrer Mutter nach Italien verschickt wurde und dann nach England, »zur sogenannten Erziehung, die nie stattfand«. Später, als junges Mädchen in Südfrankreich gelandet, vertiefte sie sich aus eigenen Stücken in Baudelaire, Stendhal, Flaubert und las keinen der großen englischen Klassiker. Aldous Huxley war der erste, der sie ermunterte zu schreiben, und unter seinem Einfluss verfasste sie drei (nie veröffentlichte) »selbstherrliche Ideenromane«. Als der Krieg ausbrach, floh sie von Frankreich nach Amerika; und als der Krieg vorbei war, reiste sie südwärts nach Mexiko: »Ich hatte großes Verlangen nach einer Ortsveränderung, wollte eine andere Sprache hören, neues Essen kennenlernen; wollte in einem Land mit einer langen, hässlichen Geschichte und so wenig Gegenwartsgeschichte wie möglich leben. Kurzum, ich sehnte mich danach zu reisen. Sicherlich war die Neue Welt, die die Fantasie der Elisabethaner beflügelt hatte, groß genug.«
Es wäre sinnlos zu versuchen, all die Aufregungen, Ansichten, Geschmackserlebnisse und köstlichen Überraschungen von Mrs. Bedfords »Wunderreise« zusammenzufassen oder die unverstellte Klarheit ihres Stils zu kommentieren. Es ist ganz einfach ein Buch, das in Staunen versetzt, das man wieder und wieder lesen kann. Niemals lässt Sybille Bedford sich zur Satire hinreißen. Sie ist niemals derb, niemals überheblich, gestattet sich niemals ironische Randbemerkungen, wie es klassischerweise so viele Reiseschriftsteller tun. Selbst wenn sie die düsteren Chroniken Mexikos aufrollt – wo es um Montezuma und Cortés geht, den Kaiser Maximilian und Benito Juárez oder um die weniger weit zurückliegenden marxistischen Revolutionäre –, moralisiert sie nicht, noch bezieht sie einen politischen Standpunkt. Was sie vermittelt – hier und in all ihren Romanen –, ist die Tatsache, dass alles fraglich ist; dass die Conditio humana darin besteht, dass Abermillionen Menschen auf der Erde hin und her geschubst werden und vergeblich versuchen, Halt zu finden, aber irgendwie immer wieder daran gehindert werden.
(1986)
Erster Teil
Auf der Suche einer Reise
Erstes Kapitel
Von New York nach Nuevo Laredo
Ô le pauvre amoureux des pays chimériques!
Der obere Teil der Grand Central Station ist groß und prächtig wie die Caracallathermen.
»Ihre Zimmer sind an der Isabel de la Catolica«, sagte Guillermo.
»Wie nett von Ihnen«, sagte ich.
»Pension Hernandez.«
»Wie ist’s denn dort?«
»Der Manager ist sehr unfreundlich. Er wollte mich nicht mal meine Kleider mitnehmen lassen, als ich verhaftet wurde. Aber Sie werden keinen Ärger haben.«
»Sonst noch was?« sagte ich.
»Schwer zu sagen«, meinte Guillermo. Seine Mutter war eine mexikanische Dame; sein Vater, so sagt Guillermo, war Schotte gewesen. Guillermo sah aus wie ein streunender Kater, nicht eben gepflegt; die Kunst des Überlebens schien seine einzige Stärke. »Freunde werden sich um Sie kümmern.«
»Was für Freunde?«
»Freunde. Sehr lieb und hilfreich.« Seine fiesen Fliegenaugen schweiften über den Boden. »Erwähnen Sie meinen Namen in der Pension nicht.«
»Ja, das wird wohl besser sein.«
»Viel besser«, sagte Guillermo.
Nach etlichen Jahren in den Vereinigten Staaten, wo man eine Eintrittskarte für einen erfolgreichen Film sechs Wochen im voraus bestellen muss und die Reservierung eines Hotelzimmers viel Geduld und Geschick verlangt und dann doch nur in letzter Minute und mit viel Glück gelingt, erwartet man schon nicht mehr, dass man sich wieder würde frei bewegen können. Nicht einmal für viel Geld und gute Worte könne man im Reforma in Mexiko-City etwas bekommen, hieß es beim American Express. Man wolle ja gar nicht ins Reforma, erklärte man. Ja, aber im Ritz sei es genauso schlimm. An diesem Punkt gab man auf Daher also Guillermo, daher die Pension Hernandez. Guillermo war einsam und diensteifrig und überschlug sich, jeden unerdenklichen Wunsch auf eine denklich unerwünschte Weise zu erledigen.
»Wie wär’s mit einem Gläschen?« fragte er.
Wir saßen in der Bahnhofsbar und warteten. Zeit hatten wir genug. Die Koffer waren in den Händen von Gepäckträgern, und nach tagelangem Gehetze gab es mit einem Mal nichts mehr zu tun. Wir empfingen. Das heißt, alle möglichen Leute kamen vorbei, um uns zu verabschieden und uns und einander auf ein Glas einzuladen. Leute, die wir seit Jahren nicht gesehen hatten. Ankunft und Abreise sind die beiden großen Angelpunkte, um die sich in Amerika das gesellschaftliche Leben dreht. Man kommt an. Man hat sein Empfehlungsschreiben parat. Man ist augenblicklich von einer großen, vagen Erwartung umgeben. Man mag berühmt sein; man mag schön sein, geistvoll oder reich; vielleicht sogar liebenswürdig. Was jedoch zählt: man ist neu. In Europa, wo menschliche Beziehungen ebenso dauerhaft sein sollen wie Kleider, muss man etwas aushalten können. In Frankreich muss man interessant, in Italien angenehm sein, in England muss man »sich einfugen«. Hier, wo der Umgang von Mensch zu Mensch keine Abstufungen kennt, sans lendemain ist, wo ausländische Besucher Konsumgüter sind, ist es eine Sache des Umsatzes. Man wird aufgenommen, ausgeführt, mitgenommen, eingeführt, Partys werden für einen gegeben, und schwupps, bevor man noch sagen kann, man lebt in Amerika, sind schon die Abschiedspartys und die Proviantkörbe für den Dampfer da. Es werden einem die Wangen geküsst, die Schultern geklopft, die Hände gedrückt; man bekommt Flaschen, Präsente und Blumen geschickt, denn man »segelt« ab. Das große, leere Rad der Gastfreundschaft hat seine Umdrehung vollendet.
Diese letzten Tage haben Atmosphäre und Intensität, alles nimmt quantitativ zu, die Partys, die Menschen, die Drinks. Und bei all ihrer oberflächlichen Herzlichkeit ist diese Betriebsamkeit doch nicht ohne Bedeutung. Die Wärme, die plötzliche Intimität, die Gefühle sind nicht unecht, sondern Ritual. Für die Amerikaner ist das »Segeln« ein Symbol. Symbol vergangener und künftiger Reisen, ihrer Fahrnis und ihrer Sicherheit, Symbol für Isolierung und Flucht. Sie bleiben und sind in Sicherheit; aber sie können auch das Land verlassen und sich selbst beweisen, dass sie frei sind. Der gefährliche, der ersehnte, der verachtete und bewunderte Kontinent Europa liegt nur ein paar Tagereisen jenseits des Meeres. Das tritt ins Bewusstsein, wenn man wieder einmal »segelt«. Abschiede sind Ersatz für Magie: In Amerika hält man noch immer viel vom adieu suprême des mouchoirs.
Zwischen Ankunft und Abreise liegt – falls man taktlos genug ist zu bleiben – ein gesellschaftliches Niemandsland, in dem es einem selbst überlassen ist, sich Freunde zu suchen und sein Leben zu führen. Das Land ist groß, und ebenso groß ist die Auswahl. Selten lebt und findet man seine Freunde unter den gastfreundlichen Gestalten der ersten, turbulenten Wochen. Manche verschwinden einfach, und wenn man sie zufällig wiedertrifft, versagen sie sich aus Freundlichkeit die Frage: »Was, immer noch hier?« Statt dessen heißt es: »Rufen Sie doch mal an.« »Ja, das werd’ ich tun«, sagt man, und dabei bleibt es, auf ein weiteres Jahr.
Andere werden zu Inventarstücken, zu den Gesichtern, denen man den Winter über auf denselben New Yorker Partys begegnet, ohne sie wahrzunehmen. Man spricht sie beim Vornamen an, man reicht einander Gläser, aber man bleibt sich fern.
Wenn man schließlich abreist, macht man eine gesellschaftliche Auferstehung durch. Es schneit Einladungen und Delikatesskörbe für den Dampfer, als wäre man die Sitwells und nur fünf Wochen geblieben. In meinem Fall nur eine teilweise Auferstehung, weil eine Abreise zu Lande nicht ganz das Richtige und mit Mexiko nicht viel Staat zu machen ist: derselbe Kontinent, oder doch beinahe.
Die Bar war klimatisiert. Was bedeutet, dass man zuerst fröstelt, dann friert und schließlich vor Kälte zu zittern beginnt. Dann wird einem wieder warm, und man fühlt sich ziemlich klebrig; dann beginnt die Luft nach Stahlmessern zu schmecken, in den Ohren fangt es zu summen an, das Atmen fallt schwer; dann bricht einem kalter Schweiß aus, und dann ist es Zeit, aufzubrechen.
Wir stiegen in die Mosaikenhalle hinauf. Hier dampfte es wie in einer chinesischen Wäscherei, und die Hitze fiel wie mit Keulenschlägen über uns her. Der Sommer in den großen amerikanischen Städten ist eine üble Sache. Er ist negativ, gnadenlos und tot. Er ist überaus heiß. Die Hitze, die von Beton und Stahl ausstrahlt, ist synthetisch, unfreiwilliges Menschenwerk, eines der vielen Abfallprodukte der industriellen Revolution. Diese Großstadthitze lässt nichts wachsen; sie wärmt nicht, sie peinigt nur. Man kann kaum glauben, dass sie vom Himmel kommt. Sie hat nichts vom Zauber, nichts von der Kraft der Sonne in einem heißen Land. Sie gehört weder zur Natur noch zum Leben, das Leben ist nicht auf sie eingerichtet, und die Natur zieht sich zurück. Dem Geist und der Wirklichkeit, der Architektur und den Gewohnheiten nach ist die Ostküste der Vereinigten Staaten ein nördlich-raues, ein kaltes Land geblieben, das unter der Geißel der Hitze leidet.
Tagsüber drückt ein grauer, bleierner Deckel auf New York. Auch der Sonnenuntergang bringt keine Linderung. Die Nacht ist ein luftloser Schacht; in der Dunkelheit steigt die Temperatur noch an; von überallher strömt unsichtbar die Hitze aus; sie kommt von unten, von oben, von den düsteren Brutöfen aus hitzegesättigtem Stein, erhitztem Metall. In der Mitte der Nacht erreicht sie ihren Höhepunkt; jeder Bewohner liegt, da menschliche Berührung unerträglich ist, für sich allein auf einer Matratze, eingeschlossen in einem schwarzen Hitzeloch, bis in den unratbedeckten Straßen und in den Zimmern über den Unerfrischten die Dämmerung heraufzieht wie ein besudelter Vorhang.
Solches Dulden ist ganz ohne Sinn. Es kräftigt den Körper nicht, es ermattet ihn nur. Und doch duldet man weiter. Büroangestellte träumen von tiefen, kalten Seen, von einem Zeltplatz in den Adirondacks oder einer Fischerhütte in Maine, wo man, der Sage nach, unter einer Decke schlafen muss, um nicht zu frieren. Aber niemand tut etwas dagegen. Niemand weiß, was man dagegen tun könnte. Es sind schon zu viele Schafe im Stall.
Wir gingen nach unten, wo unter der Erde in grauen Betontunnels die Züge ungeduldig warteten. Guillermo war noch immer an unserer Seite. Obwohl er keineswegs abreiste, trug er eine braune Reisetasche in der Hand. Ein Gepäckträger wollte sie ihm abnehmen, Guillermo wehrte ab. In der Tasche klirrte etwas. Er spähte hinein.
»Ich hätte ein bisschen Papier mitnehmen sollen«, sagte er. Ich spähte ebenfalls hinein. Drinnen lagen, von einer Badematte halb bedeckt, ein paar Zahnputzgläser, etliche Kleiderbügel, einzelne Mottenkugeln, eine metallene Teekanne, Glühbirnen und eine Rolle Löschpapier.
»Guillermo?«
»Aus Ihren Zimmern«, sagte er. »Machen Sie sich keine Gedanken, meine Liebe, Ihr Vermieter legt bestimmt keinen Wert darauf«
Guillermo verwaltet seinen Kaninchenbau von Zimmern in einem abbruchreifen Sandsteinhaus in den East Thirties. Und auf diese Weise möbliert er sie wohl.
Die zwischen den Flüssen liegende Insel Manhattan ist keine Durchgangsstation, sondern ein Sackbahnhof. New York mit der Eisenbahn zu verlassen hat etwas vom Krebsgang an sich. Unser Fahrtziel liegt im Südwesten, aber wir müssen die Stadt in nördlicher Richtung unterfahren. In der 96. Straße taucht man an die Oberfläche. Der Saint-Louis-Express rollt über dem Straßenniveau auf einer Art Rampe dahin wie eine Hochbahn. Harlem. Bahnhof 125. Straße, dieser absurde, kleine, wellblechüberspannte Haltepunkt dicht über den Dächern der Häuser. Die Straßen der einfachen Leute. Niedrige Backsteinhäuser, in den Fenstern Wäsche zum Trocknen, Männer in Unterhemden, die den langen Abend schwitzend in Zimmerenge erdulden. Drunten auf dem Straßenpflaster Kinder, die wie eh und je über Kreidekreise hin und her hüpfen. 205. Straße. Ein Mann rasiert sich am offenen Fenster. Wenn man mit dem Schiff reiste, würde man jetzt den Hudson hinunterfahren. Man würde die Geräusche der Schiffe und des Flusses hören. Vielleicht läge die Queen Elizabeth im Hafen. Man würde an Werften, Docks und Speichern vorübergleiten und die Namen von Überseedampfern lesen, die nach Rio und nach China gehen. Man würde das Meer riechen und Fernweh bekommen. Dann würde man die Battery passieren und die berühmte Skyline erblicken, gerade wenn die Lichter aufgehen. Das wäre das New York der glanzvollen Silhouette, nicht das New York der trübseligen Einzelheiten, und vermutlich hätte man Tränen in den Augen.
Immerhin, man fühlt sich recht behaglich. Und ungestört. E. und ich hatten es fertiggebracht, ein Schlafabteil für uns allein zu bekommen. Sie kosten nur etwa einen Dollar mehr als ein Platz im gemeinsamen Schlafwagen, sind aber sehr schwer zu ergattern. Endlich unterwegs. Ich holte ein Fläschchen Gin heraus, eine Thermosbox mit Eiswürfeln, etwas Angostura und aus einem Lederetui die Woolworth-Gläser, die längst die silbergefassten, geschliffenen Reisebecher abgelöst haben, mit denen unsere Vorväter durch eine bessere Welt gereist sind, und mixte uns zwei große pink-gins.
»Hat der Junge von Bellows ein Trinkgeld bekommen?« fragte E.
»Von mir nicht. Hast du Mr. Holliday das Buch zurückgegeben?«
»Oh, nein. Wie peinlich.«
»Jetzt können wir daran nichts mehr ändern.« Wie erholsam, endlich frei zu sein! Wir waren in anonymen und, wie man voraussetzte, fähigen Händen, in denen der Great Eastern and Missouri Railroad. Die nächsten vier Nächte und fast vier Tage. Vier Stunden aufrecht auf einem Platz im Zug zu sitzen ist langweilig; acht Stunden sind verdammt lang, zwölf entsetzlich. Ein gradueller Unterschied ist ein wesentlicher Unterschied: Vier Tage auf der Bahn sind ein Waffenstillstand mit dem Leben. Und immer gibt es etwas zu essen. Ich hatte einen Korb und einen Karton vollgepackt. Wenn es mir irgend möglich ist, nehme ich meinen eigenen Proviant mit; man bleibt unabhängig und angenehm beschäftigt, es ist billiger und meist viel besser. Ich hatte uns ein paar Dosen Thunfisch, ein Glas geräucherten Rehfleischs, eine Salami und ein großes Stück Provolone besorgt; dazu Roggen- und Schwarzbrot, zum Frischbleiben in Zellophan verpackt. An diesem ersten Abend gab es frisches Essen. Ein Hühnchen, am Nachmittag bei Freunden gebraten und noch leicht warm; ein paar Scheiben von dem wunderbaren amerikanischen Virginiaschinken, murmelgroße, dunkelrote Tomaten, an den Ständen in der Second Avenue erstanden; Brunnenkresse, ein Baguette, ein Eck Rahmkäse, eine Tüte Kirschen und eine Flasche rosafarbenen Weins. Der Wein hieß »Lancer’s Sparkling Rosé«, doch sollte man sich an dem Namen nicht stoßen. Er kommt aus Portugal und ist köstlich. Ein leuchtender, klarer Wein, fast vollmundig, der nicht wie so viele Roses dünn und fade wird, wenn man mehr davon trinkt. Er hat außerdem den Charme, in einen Steingutkrug abgefüllt zu sein, und einmal gekühlt, bleibt er auf Stunden angenehm frisch. Ich öffnete den Krug mit meinem französischen Korkenzieher. Der angenehmste Ton der Welt.
»Nimm doch eine Olive«, sagte ich.
Mit einem silbernen Klappmesser halbierte ich die Tomaten. Ein dünner Strahl Öl aus einem Fläschchen, zwei zerriebene Basilikumblätter. »Hast du den Pfeffer gesehen?«
Ich nahm die hölzerne Pfeffermühle aus dem Etui. Sie war mit trüffelschwarzen Tellicherykörnern gefüllt. Ich schnupperte daran. Diese Pfeffermühle war gewiss zu viel des Guten. Die Götter konnten nicht darüber lächeln. Ein Freund hat mir einmal von einem Dackel erzählt, der an einer roten Leine durch die Straßen von Paris geführt wurde. Er trug ein fesches rotes Mäntelchen, und an dem Mantel war eine Tasche, und aus der Tasche spitzte ein Ziertüchlein mit dem Monogramm des Dackels. Das war, wie sich zeigte, für einen Hund von echtem Schrot und Korn dann doch zu viel. Ein Hund ohne Halsband fiel den Dackel an und biss ihm das Genick durch. Ich habe oft voller Mitgefühl dieses Dackels gedacht.
Zu unserer Reise hatten wir uns im letzten Augenblick entschlossen. Ich war überhaupt nicht auf Mexiko vorbereitet. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals nach Mexiko zu kommen. Ich hatte ein paar Jahre in den Vereinigten Staaten verbracht und war im Begriff, nach Europa zurückzufahren. Ich hatte großes Verlangen nach einer Ortsveränderung, wollte eine andere Sprache hören, neues Essen kennenlernen; wollte in einem Land mit einer langen, hässlichen Geschichte und so wenig Gegenwartsgeschichte wie möglich leben. Kurzum, ich sehnte mich danach zu reisen. Sicherlich war die Neue Welt, die die Fantasie der Elisabethaner beflügelt hatte, groß genug. Kanada? Wer verfällt schon auf Kanada? Argentinien war mir zu neu und Brasilien zu weit. Guatemala zu modern, San Salvador zu begrenzt, Honduras zu britisch. Ich entschied mich für Peru.
Es genügte den Ansprüchen und hatte für mich die beglückendsten Assoziationen. Die heilige Rosa von Lima. Peruanische Architektur: reiche Fassaden, glühend und bröckelnd, wie Kekse, eingeweicht in Romanée-Conti. Dies waren wahrscheinlich irgendwelche Illustrationen – doch zu welchem Buch? Massine in seiner besten Zeit, als er in Gatte parisienne den Peruaner tanzte. Er trat mit schwarzen Ringellocken und Kniehosen aus weißem Satin auf trug in einer Hand einen Papageienkäfig und in der anderen eine Reisetasche, worauf das Wort PERU mit Perlen gestickt war, und alles geriet vor Entzücken außer sich. Es gab auch eine Gestalt, mit der ich mich auf Jahre hinaus identifizierte. »Sie werden mich unter dieser geringen Verkleidung nicht erkennen, aber ich bin Don Alonzo d’Alcantarra, der Sohn von Don Pedro. Eines Tages wird man mich an die Tore von Lima pochen hören, und die edle Jugend von Peru wird wissen, dass Don Alonzo in die Stadt seiner Väter heimgekehrt ist!« Ich war mit sieben Jahren auf dieses erregende Meisterwerk gestoßen und konnte es aus irgendeinem Grund – ich weiß nicht mehr, ob Erwachsene dazwischengegangen waren oder ob Seiten fehlten – nie zu Ende lesen. Vorläufig also tat ich es Don Alonzo nach, der die »absolute Unbeweglichkeit seiner Gesichtsmuskeln übte, um seine edle Absicht der Welt zu verbergen«. Ich nahm an, das bedeute, man dürfe sein Gesicht überhaupt nicht bewegen, und pflegte, wie es mir vorkam, lange Zeit dazusitzen, angestrengt bemüht, nicht einmal ein Lid zuzuklappen. Es war sehr schwer und gelang mir auch nicht.
O ja, Peru, ich war entschieden für Peru. Ich machte mich auf und klapperte voller Energie die Reisebüros ab. Das war nicht sehr ergiebig, bis auf ein Flugticket nach Lima, das sich als ungemein teuer erwies. Ich konnte es mir nicht leisten. Im nächsten halben Jahr würde kein Schiff nach Chile ablegen. Woraufhin ich mit dem Gedanken spielte, nach Uruguay zu fahren. Ein Bekannter aus Montevideo, der Italien liebte, hatte davon erzählt und in mir die Vorstellung von Opernbesuchen und rotem Plüsch, langen Abenden und köstlichem Essen erweckt, den Eindruck, dass diese Stadt die Bürde ihrer Urbanität mit ähnlich lässiger Grazie trage wie Rom. Der Bekannte hatte auch von einem Frachter gesprochen. Der Frachter ließ sich nicht ausfindig machen. Mexiko hatte damals nicht sehr viel Verlockendes für mich, ja ich war durch die folkloristische Reiseliteratur eher abgestoßen. Als ich schon völlig entmutigt war, beteiligte sich E. M. A. an meiner Jagd nach einem Land. Ihr Eifer war maßvoll. E.s Leben besteht aus Geschichte und Politik; früher nahm sie an Gesprächsforen im Rundfunk teil, wo sie als Reisende und Kommentatorin angekündigt wurde. Sie verabscheut das Reisen, oder, besser gesagt, sie besitzt nicht das Talent, den Mechanismus des Reisens, wenn man erst einmal unterwegs ist, zu ertragen.
»Vielleicht sollte ich mir was von meinem Heimatkontinent anschauen«, sagte sie; »obwohl ich nicht die geringste Lust verspüre, Lateinamerika kennenzulernen.«
Ein Reisebüro, bei dem ich mich hatte vormerken lassen, bot uns reservierte Plätze in einem Zug an, der Ende der Woche nach Mexiko-City ging. Wir nahmen sie.
An diesem Nachmittag ging ich zur Public Library in der 42. Straße und kehrte mit dem Tagebuch von Madame Calderón – Fanny Inglis – zurück, der Schottin, die den ersten spanischen Botschafter in Mexiko geheiratet und in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts zwei Jahre als erstaunte Beobachterin in diesem Land verbracht hatte. Später wurde Madame Calderón Erzieherin eines der zahlreichen Kinder der Königin Isabella. Sie hielt dem Hof von Madrid zwanzig Jahre lang die Treue und folgte einer Infantin ins Exil, und als die Bourbonen nach Spanien zurückkehrten, wurde sie, wie jene andere königliche Erzieherin, Madame de Maintenon, zur Marquise erhoben. Sie starb im Alter von einundachtzig Jahren im Schloss von Madrid an einer Erkältung, die sie sich bei einem Diner zugezogen hatte. Ihr mexikanisches Tagebuch ist aus demselben Stoff Mit vollem Titel heißt es: Life in Mexico, during a residence of two years in that country, von Madame Calderón de la Barca. Es erschien 1843 England, mit einem Vorwort des berühmten Historikers Prescott, wurde sogleich ein Bestseller und in der Edinburgh Review gepriesen. Ich las das Leben in Mexiko bis zum Morgengrauen und habe seitdem nicht mehr an Peru gedacht.
In den Ebenen von Indiana ist die Natur wahrhaftig Herrscherin. Wir fahren seit Stunden durch Weizenfelder; Meilen um Meilen üppiger gelber Ähren, die unter einem hellwachen Himmel sichtbar reifen. Ein Bild barbarischen Reichtums. Es gibt nur wenige Anzeichen von menschlichem Leben und Wohnstätten, keine Farmhäuser, keine Tiere neben der Bahnstrecke.
Welche Rolle spielt der Mensch bei der Bewirtschaftung dieser Felder? Pflügt er die Erde, oder hält er sie in Betrieb? Ist er Bauer, Mechaniker oder Geschäftsmann? Vielleicht ist hier der Schauplatz seiner letzten Niederlage: wie er in einem Holzhaus Gemüse aus Konservendosen isst, mit einem Traktor hinausfahrt, sich um seine nie wechselnde Ernte zu kümmern, die an die Banken verpfändet ist, ein Opfer der monströsen Paarung von Natur und Maschine.
Berichtigung: Wenn in Kanada, im Mittleren Westen, in Argentinien und in der Ukraine die Felder so bewirtschaftet würden wie in den »Home Counties« um London, würden wir alle Hungers sterben. O doppelgesichtige Wahrheit, o Malthus, o Kompromiss – es sind nun einmal zu viele Schafe im Stall.
Der Bettler zu Talleyrand: »Monseigneur, il faut que je mange.« Talleyrand zum Bettler: »Je n’en vois pas la necessité.« Ja, so steht Talleyrands Wort gegen das des Bettlers.
E., die Gesellige, ist in den Clubwagen gegangen, auf der Suche nach Kaffee, wie sie behauptet. Ich liege auf dem unteren Bett, meine Reiseutensilien um mich verstreut, und versuche nicht daran zu denken, dass wir später am Nachmittag in Saint Louis umsteigen müssen. Patiencekarten, Schreibbrett, Mineralwasser, Kognakflasche, Bücher. Terry’s Guide to Mexico; Ivy Compton-Burnetts Elders and Betters; Howard’s End; Decline and Fall; Horizon und die Partisan Review, ein Spanischlehrbuch; The Unquiet Grave; zwei Kriminalromane, einer von Agatha Christie und, eine Seltenheit bei mir, noch ungelesen. Ich weiß, ich habe es gemütlich, bin zur Ruhe, zu mir gekommen. Ich weiß, das ist ein Sieg oder eine Unverfrorenheit. Genieße ich diesen Augenblick? Ich bin mir seiner bewusst, vielleicht ist das genug.
Noch immer dehnen sich weithin die Felder von Indiana. Die Vergangenheit ist überall; die zerbrechliche Gegenwart bereits Vergangenheit. Paul Pennyfeather wandert wie Candide durch die ungerechte Welt; die Tragödien bei Ivy Compton-Burnett werfen ein sophokleisches Licht auf das Treiben von Männern und Frauen, das Wirken des Schicksals; Palinurus fühlt unseren matten Puls, und E. M. Försters Verknüpfungen scheinen die letzte Antwort zu sein. Sie haben alle die Wahrheit berührt.
E. ist aus dem Clubwagen zurückgekommen, sehr verdrossen. Es scheint, dass dieser Bundesstaat auf eine sehr gründliche Weise »trocken« ist. Nicht nur, dass es in diesem Zug keinen Alkohol gibt, man kann nicht einmal einen sogenannten set up, Sodawasser und Eis, bestellen, als ob es dafür nur einen einzigen Verwendungszweck gäbe. E. wurde nahegelegt zu warten, bis wir die Staatsgrenze hinter uns hätten. Es ist alles sehr verwirrend. Oklahoma und Kansas sind strikt »trocken«, und natürlich trinkt jeder wie ein Loch. In Vermont ist man auf eine Ration von monatlich zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols gesetzt. In Pennsylvania bekommt man sonntags keinen Alkohol; in Texas darf man nur zu Hause trinken, in Georgia nur Bier und leichte Weine, in Ohio alles und soviel man will, aber man muss es auf dem Postamt kaufen. Arizona und Nevada sind »flüssige« Staaten, doch steht der Ausschank von Alkohol an Indianer unter Strafe. In New York kann man Sonntag vormittags in keinem öffentlichen Restaurant ein Glas trinken, sich aber Alkohol aufs Hotelzimmer bringen lassen. Und nirgends, in den ganzen Vereinigten Staaten nicht, kann man am Wahltag für Geld und gute Worte einen Tropfen bestellen.
Der Mississippi – für welches Kind, für welchen jungen Menschen ist dieses Wort nicht erfüllt von exotischen Sehnsüchten? Eine Flusswelt des Reisens und ferner Morgendämmerungen …
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:
Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayants cloués nus aux poteaux de couleurs.
…
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais …
Und nun, hier, durch die Fenster unseres geschlossenen Wagens, unerbittlich davon getrennt, sehen wir den breiten, langsamen Strom, wie er ruhevoll zwischen seinen weidenbestandenen Ufern durch ein Land von weltferner und heroischer Schönheit dahinfließt. Unberührt gleitet die weite, traurige Landschaft still an dem Zug vorüber; ernst, von dunklem Grün, pastoral, dabei erhaben dringt sie mit ihrer Melancholie, ihrer bedeutungsschweren Abgeschiedenheit ins Herz. Niemals werden wir so sein. Will dieser Junitag nicht enden? Ach, die lastende, so lange währende Einsamkeit des amerikanischen Abends!
Ein alter Mann kommt schlurfend durch den Mittelgang. Er sucht an unserem Tisch Halt. »Nimm einen Schluck, Schwester« – er hält eine Flasche Bourbon hoch –, »mir scheint, du hast’s nötig.«
»Danke«, sage ich, »das stimmt«, und greife mit der allgegenwärtigen, der obligaten nächtlichen Geste des Landes nach der Flasche.
Wir sitzen jetzt im durchgehenden Zug nach Mexiko-City. Er heißt »Sunshine Special« und ist ein ziemlich schäbiger Bummelzug. Wir haben nun nicht mehr ein Abteil für uns, sondern zwei Plätze im Schlafwagen, das heißt, ein unteres und ein oberes Bett in einem dieser leicht komischen »Schlafsäle«, wie man sie aus dem Film kennt, wo Männer und Frauen hinter zugeknöpften Bettgardinen sich ausziehen und schlafen. Tagsüber sind Bett, Vorhänge und Trennwände auf eine umständliche, doch erfindungsreiche Art irgendwie zusammengeklappt und verstaut, und der Waggon nimmt sich dann wie eine Straßenbahn mit Tischen aus. Diese Einrichtung ist so alt wie die amerikanischen Eisenbahnen. Die großen Entfernungen machten es notwendig, eine billige Möglichkeit zu entwickeln, damit während der vielen Nächte jeder Reisende im Zug das Haupt niederlegen kann. Es ist durchaus nicht schlecht. Die Luft ist kühl und neutral, und obwohl sich an die vierzig Personen in einem Waggon befinden, ist man so anonym und halbwegs für sich, wie man es in einem großen Reisebus wäre.
An diesem Abend war uns nach warmem Essen zumute, und wir gingen zum Speisewagen, der sich als ein mit maschinell fabrizierten spanischen Renaissanceschnitzereien von erstaunlicher Hässlich- und Düsterkeit dekorierter Raum erwies. Das Essen, das man wie ein Taubstummer zu bestellen hat, indem man seine unerfüllbaren Wünsche auf einen Block kritzelt, war eine kaum zu beschreibende Travestie der Kochkunst, serviert mit der geradezu fantasievollen Missachtung dessen, was zueinander passt, wie sie Tradition der amerikanischen table d’hôte zu sein scheint. Die einzigen Beilagen des Tages sollen zu jedem Hauptgericht gegessen werden, das auf der Speisekarte steht. Wenn es also Blumenkohl und Pommes frites gibt, dann erscheinen Blumenkohl und Pommes frites auf dem Teller, gleichgültig ob man den gebratenen Heilbutt, das Corned-Beef-Haschee, das Omelette oder die Hammelkoteletts isst. Ich habe solche genialen Mesalliancen wie Spargelspitzen aus der Dose im Verein mit Spaghetti, die zierlich um eine gebratene Makrele garniert waren, gesehen, wenn auch nicht gegessen. Und das ist nicht etwa ein Reisemärchen.
In der letzten Nacht brach irgendwo tief in Arkansas die Stromzufuhr zusammen. Irgendetwas war mit dem Kühlsystem nicht in Ordnung. Es arbeitete nicht mehr, und da keine Möglichkeit bestand, von außen Luft hereinzulassen, stieg die Temperatur binnen Kurzem auf 43 Grad Celsius, wie uns später erzählt wurde. Als ich aufwachte, glaubte ich mich im Inneren eines Heuhaufens und war natürlich nicht bei klaren Sinnen. Was für ein Schauspiel! Hinter den Vorhängen spähten Gesichter hervor, man rief nach Leitern und Erklärungen; dunkelrot angelaufene Gesichter, kurz vor dem Schlaganfall, bläuliche Gesichter, die nach Luft schnappten; schreiende Babys, Männer in Unterwäsche, die in den oberen Betten zappelten, und engelsgeduldige schwarze Träger, die Damen im Morgenrock durch den Gang stützten. Eine Frau ließ sich von alledem nicht im Schlaf stören. »Lady, Lady«, flehte ein Träger sie an, »wachen Sie doch auf sonst haben Sie morgen früh ’ne Lilie in der Hand.« Schließlich hatte man uns alle in einem eiskalten Sitzwaggon einquartiert, unsere Kleider und Habseligkeiten um uns aufgestapelt. Wir würden uns vermutlich eine Lungenentzündung holen, aber für den Augenblick waren wir dem Tode entronnen. Währenddessen wurde es draußen hell, und jemand machte den Vorschlag, Coca-Cola mit Riechsalz zu trinken. Das war neu für mich. Es wirkte tatsächlich Wunder. Am meisten hatten die Mütter zu leiden, denn die Nahrung in den Babyflaschen war sauer geworden, und die Kleinen schrien wie am Spieß. Kein Speisewagen bis Texarcana. Ich erbot mich, auf meinem Spirituskocher alles warm zu machen, was warm gemacht werden musste.
»Schau dir das an«, sagte eine Mutter, »die kann jederzeit Wasser kochen.«
Ein zusammengesunkener Geschäftsmann beglückte einen anderen zusammengesunkenen Geschäftsmann mit einem lehrreichen Vortrag über unser rollendes Material. E. gesellte sich zu ihnen.
»Auswechseln –«
»Stahl –«
»Prioritäten –«
»Verpflichtungen –«
»E. R. P. –«
Auf den Galeeren Spaniens hat man Zeit zum Nachdenken.
Herrschaft über seine Umwelt, hieß es früher, sei das Markenzeichen des Menschen. Heute wird diese Herrschaft fast völlig stellvertretend ausgeübt, beruhend auf dem Erfindungsgeist vergangener Generationen. In städtischen oder industriellen Lebensgemeinschaften ist sie niemals direkt, körperlich oder spontan. Unsere Gerätschaften sind uns aus der Hand geglitten, und es mag dahin kommen, dass am Ende jeder für sich in seiner Thermosflasche lebt. Man tut vielleicht gut daran, sich zu erinnern, wie man mit einem Paar Holzstöcken und einem Stein umgeht.
Man hat uns einen neuen Schlafwagen ab San Antonio versprochen.
Wir haben Verspätung. Der Zug wird lange hin und her rangiert, und jedermann ist müde. Seit dem ersten Hahnenschrei fahren wir nun durch Texas. Texas ist so groß wie Frankreich, die Britischen Inseln, die Niederlande, Spanien und Portugal zusammengenommen, wie man in der Schule gelernt hat. Oder waren es Frankreich, die Britischen Inseln und Italien? Auf jeden Fall kommt es einem unwahrscheinlich groß vor. Und flach. Und leer. Aber reich, wie ich heute schon mindestens sechs verschiedene Male belehrt wurde. Öl, Rindfleisch, Getreide. E. erzählte mir, dass die »Lone Star Republic« nach der Loslösung von Mexiko eine Abordnung zu Königin Viktoria entsandte und Texas der britischen Krone antrug. Palmerston lehnte ab.
Der neue Waggon ist angekuppelt worden. Der Schaffner hat die Plätze zugewiesen, und wir fahren wieder weiter. Es sieht jedoch so aus, als müssten wir bis zur Zollkontrolle in Laredo aufbleiben. Offensichtlich können wir von der Passabfertigung nicht in unseren Liegestätten inspiziert werden. Wir haben mehrere Stunden Verspätung, und niemand scheint zu wissen, wann wir an der Grenze ankommen werden. Wir fahren an einzeln stehenden Holzhäusern vorüber, jedes Haus mit eigener Veranda, und auf jeder Veranda sitzt ein zerknautschter Mann im Schaukelstuhl, der genauso erschöpft aussieht, wie wir uns fühlen.
Turmspitzen steigen am flachen Horizont auf Eine Kathedrale? Es stellt sich heraus, dass es Bohrtürme sind.
Wieder ein Abendessen im Speisewagen, das uns keine Freude machte. Es ist Mitternacht. Noch immer keine Grenze. Noch immer Texas.
Die amerikanische Passabfertigung ist eben vorüber. Zwei Männer in Hemdsärmeln, zwanglos, freundlich.
Sie begannen damit, dass sie die US-Bürger nach dem Geburtsort fragten. Amerikaner brauchen keinen Pass, um die Staatsgrenzen innerhalb des Kontinents zu überschreiten.
»Birmingham, Alabama, Mister.«
»Terra Haute, Indiana.«
»Las Vegas, Nevada.«
»Walla Walla, Washington.«
»Little Temperance, Iowa.«
Die Reisenden, die einen zu merkwürdigen Akzent hatten oder, wie man das hier nennt, gebürtige Ausländer waren, legten Geburtsurkunde oder Führerschein vor. Niemand wurde absichtlich so behandelt, dass er sich unbehaglich fühlte. Die Beamten verrichteten nur ganz sachlich ihre Arbeit.
Sie haben den Zug versiegelt.
Nach nochmaligem Aufenthalt, dem sinnlos unruhevollen Warten an der Grenze, wobei es für alle, außer für die Reisenden, gemütlich zugeht, überquerten wir die Internationale Brücke über den Rio Grande. Wir sind jetzt eigentlich in Mexiko. Es ist zwei Uhr morgens, und wieder passiert nichts.
Wir sind in den Speisewagen beordert worden, der mexikanischen Passkontrolle wegen. Die amerikanischen Behörden wollten uns nicht im Bett sehen, die mexikanischen können es nicht ertragen, uns sitzend zu sehen. Wir müssen uns in einer Reihe anstellen. Und da steht man nun, gelangweilt und müde und immer wieder mit einem Anflug von Furcht. Tischtücher und Bestecke sind weggerafft worden, der Speisewagen hat den Charakter eines Kriegsgerichtssaals angenommen. Die Atmosphäre ist feindselig. Die Beamten tragen Militäruniform. Bewaffnete Wachen sind da. Zwei mit Riemen und Schnallen beladene Offiziere, die Mütze auf dem Kopf, sitzen hinter einem Tisch. Schließlich kommt jeder der Wartenden an die Reihe. Die Offiziere weigern sich ostentativ, Englisch zu sprechen. Jede einzelne Touristenkarte – die Einreisegenehmigung nach Mexiko erhält man automatisch zusammen mit der Fahrkarte – wird genau begutachtet, obwohl eine aussieht wie die andere. Dann und wann legt sich ein Finger auf ein Geburtsdatum. Aber nichts Furchterregendes passiert, kann gar nicht passieren, wie man sich die ganze Zeit einzureden versucht; dies soll ja eine Grenze ohne große Bedeutung sein, alles gute Nachbarn, die Wege für die Touristen, die man mit Reklame lockt, geebnet.
Wieder im Schlafwagen erhalten wir Weisung, zur Zollkontrolle auszusteigen. Ja, mit dem gesamten Handgepäck. Auch die Mäntel und die Waschbeutel. Eine Schar von Gepäckträgern erscheint, um die Sachen für uns herunterzuzerren. Für diese nächtlichen Dienstleistungen wird, wie wir feststellen, ein besonderer, horrender Tarif verlangt. So steigen wir also aus, in die subtropische Nacht. Wieder ist die Hitze entsetzlich. Man lässt uns zwei volle Stunden auf einem schmutzigen Bahnhof herumstehen, während indianische Pygmäen, Männer und Frauen, in unseren Sachen kramen wie eine Horde Terrier, die sich ein Loch buddeln.
Die Reisenden beginnen unter der Belastung zu leiden. Viele sind ältere Leute oder haben kleine Kinder dabei, und die meisten wähnten sich auf einer Vergnügungsreise. Die Reisebüros mit ihren Prospekten hatten sie dazu verlockt: ein lächelnder Mexikaner mit einem Hut, so groß wie ein Wagenrad, der ein Keramikgefaß hochhält; ein lächelnder brauner Junge in der Brandung von Acapulco, der einen aufgespießten Fisch hochhält; eine lächelnde Frau im rebozo, die ein rebozo hochhält. In Nuevo Laredo lächelt weit und breit kein Mensch. Die amerikanischen Eisenbahner jenseits des Flusses in Laredo verachten die »Greasers«, die Mexikaner in Nuevo Laredo hassen die »Gringos«. Die Reisenden, umhergeschubst und grollend, erinnern sich an die Namen, die sie in der Schule denjenigen gaben, die von anderer Hautfarbe und kleiner als sie selbst sind. Die Mexikaner verstehen die Reisenden überhaupt nicht – meist riesengroße Frauen, die ohne Begleitung und Hut im Zug umhergehen, und so unverschämt obendrein: Warum sie eigentlich die Reise machen? Eines Gelübdes wegen bestimmt nicht, Ketzer, die sie sind. Niemand traut dem anderen über den Weg.
Diese Zollkontrolle ist eine sinnlose Böswilligkeit. Man versteht nicht, was damit bezweckt werden soll. Der Peso gilt als harte Währung, und in Mexiko gibt es keine Beschränkung für Bargeldeinfuhr. Zigaretten, Spirituosen, französisches Parfüm, Textilien, Tee und Kaffee, all dies ist in Mexiko so viel billiger als in den Vereinigten Staaten, dass sich niemand die Mühe machen würde, desgleichen ins Land zu schmuggeln. Ohnehin hat jedermann seinen unübersehbaren Fotoapparat angegeben. Es zeigt sich denn auch, dass wenige dieser hoffnungsfrohen alten Jungfern viel mehr dabei haben als gemusterte Kleider, ein einziges warmes Kostüm und den Regenmantel, empfohlen von Terrys Reiseführer, der den durchaus vernünftigen Rat gibt, mit leichtem Gepäck zu reisen, und der Verdacht, sie könnten Näh-, Mäh- oder Waschmaschinen ins Land schmuggeln, scheint recht absurd. Sie haben nichts anderes im Sinn, als ihre Dollars für eine Unmenge mexikanischen Kunstgewerbes auszugeben und ihre Beute in original mexikanischen Körben nach Hause zu schleppen. Das Gepäck dieser Wohltäterinnen einer solch gründlichen und verletzend indiskreten Durchsuchung zu unterziehen kann keinen anderen Grund haben, als dass die augenblicklich Mächtigen die augenblicklich Machtlosen ihre Macht spüren lassen und ihnen Unbehagen bereiten wollen.
Britische Passbeamte spielen bisweilen ihre bessere Kleidung und ihren besseren Akzent gegenüber der älteren Emigrantin aus, die in der Handtasche nach der schriftlichen Einladung kramt, die sie von der Dame aus Great Marlborough erhalten hat. Doch hier werden die Passinhaber von Unterbezahlten, Rohlingen, Ignoranten schikaniert. Es ist fast, als wäre man auf dem Balkan oder im Orient. Dort besteht für das Individuum mehr Gefahr, mehr Entwürdigung, mehr Zeitverlust, aber auch mehr Hoffnung – es gibt ja die Möglichkeit der Bestechung. Hier aber gibt es überhaupt keine Hoffnung. Bei angelsächsischen Beamten wird oft anständige Behandlung durch übermäßige Korrektheit ersetzt; hier gibt es keinen Anstand, weder von Bürger zu Bürger noch von Mensch zu Mensch. Hier herrscht Korruption, aber sie ist alltäglich, hier herrscht gedankenloser Zynismus, Böswilligkeit ist die erste Reaktion, Leben und Schmerz gelten wenig, und wieder trifft man auf die unbesiegbare Unkenntnis des Menschen vom Menschen.
Für E. und mich ist diese Nacht noch nicht ausgestanden. Als wir zu unseren Plätzen zurückkehren, sind die Betten aufgeschlagen, und zwei Fremde schlafen darin. Langsam sickert durch, dass das mexikanische Zugpersonal nicht gesinnt sei, sich an den Wagenwechsel zu halten, den die Amerikaner in San Antonio vorgenommen haben. Aber was sollen wir tun? Wo sollen wir hin? Es sind noch immer an die dreißig Stunden Fahrt bis Mexiko-City. Wir erwischen den Schaffner auf dem falschen Fuß, er zuckt nur die Achseln. Wir laufen hinaus auf den Bahnsteig und verlangen den Bahnhofsvorsteher zu sprechen. E. kehrt die Amerikanerin heraus: »Drittklassiges Land … Wollte von Anfang an nicht herfahren … Der Präsident der Missouri-Pacific wird was zu hören bekommen. Mrs. R. …« Keiner verzieht eine Miene. Der Zug fährt jeden Augenblick ab. Verständlicherweise ist uns nicht sehr daran gelegen, in Nuevo Laredo hängenzubleiben, und wir lassen uns in einen mexikanischen Sitzwaggon dritter Klasse schieben. Wir stolpern in ein stinkendes, enges Abteil. Hinter uns schließt sich die Tür, und wir finden uns im schwachen Licht des dämmernden Morgens zwischen zusammengekauerten Gestalten in einer Art tropischer Gefängniszelle.
Zweites Kapitel
Mesa del Norte – Mesa Central – Valle de Mexico
Regardez, après tout; c’est une pauvre terre.
Es ist heller Tag. Wir erwachen in einer rehfarbenen Wüste von sonnengebranntem Lehm und Stein. Dies ist wahrhaft ein reiner Tisch, eine kahle neue Welt, gebildet aus kärglichen Bestandteilen – hie und da ein hoher Kaktus, wie eine Kerze, Lehmhütten, gleichmäßig wie Maulwurfshügel, und immer wandert ein einsamer Mann mit einem Esel eine Kammlinie entlang.
Wir fahren nach Süden, und es geht bergauf Langsam, sehr langsam windet sich der Zug zum Plateau der Sierra Madre hinauf Mit einem Mal erste Anzeichen mexikanischen Lebens; Kinder, Schweine und magere Hunde wühlen bunt durcheinander neben den Hütten im Staub. Wovon existieren sie? Es sieht nicht so aus, als wüchse hier etwas Essbares für sie.
E. und ich waren frühmorgens freigelassen worden. Der Gefangenenwärter erschien, winkte uns und führte uns durch den Zug zu zwei oberen Betten in einem Schlafwagen. Wir haben nicht lange gefragt, warum. Er hielt die Leiter, wir kletterten hinauf zu unseren Liegestätten und sanken in Schlaf Jetzt befinden wir uns in einem Wagen voll blonder Buben und Mädchen in knappen Shorts und frischen Sommerkleidern. Es ist ein Privatwaggon, den eine Schule in New Orleans für einen Ausflug gemietet hat. Ein Kavallerieoffizier und zwei überelegante mexikanische Damen sind gleichfalls bei ihnen einquartiert worden. Diese hübschen, manierlichen Kinder aus dem Süden und ihre Begleiter nehmen es mit Engelsmiene hin.
Der erste Halt ist eine Stadt namens Saltillo, die Hauptstadt eines dieser einsamen, riesigen Gebiete, die sich von der US-Grenze bis ungefähr zum Wendekreis des Krebses erstrecken: die Bundesstaaten Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora und Durango, Vorzimmer und Vorhölle von Mexiko. Ihre Gesamtbevölkerung liegt noch um einiges unter der Einwohnerzahl von Birmingham, was bedeutet, dass auf jede Quadratmeile des unfruchtbaren Bodens gerade etwa ein Mensch kommt. Es ist ein heißes, steiniges, trockenes Land, fast ohne Flüsse und Regen, teils Wüste, teils Bergland, teils Grubengegend. Unberührt von Kunst und Architektur, doch auch unberührt von ihren Annehmlichkeiten, sind diese Staaten sozusagen unverbildete arme Verwandte der westlichen US-Staaten jenseits der Grenze und erinnern daran, dass ein sehr großer Teil der Erdoberfläche, wenn auch nicht unbewohnbar, so doch wenig reizvoll zu bewohnen ist. Manche sind hier geboren, aber niemand geht nach Sahuaripa oder Santa Maria del Oro, es sei denn, um einen Schacht zu bohren, eine Bahnlinie anzulegen oder eine Rebellion niederzuschlagen.
Wir steigen alle aus auf den langen, staubigen Bahnsteig voller Indios, die Esswaren feilbieten – Männer und Frauen kauern auf dem Boden und rühren in irdenen Töpfen irgendetwas Dunkles, das über winzigen Kohlenbecken schmort, Jungen tragen ganze Türme von Pfannkuchen auf dem Kopf kleine Kinder schleppen Stauden von Mangofrüchten und Bananen. Das geht ohne Lärm vor sich. Alles wird stumm angeboten, sobald man näher herantritt. Wohin ich mich auch wende, hält eine braune Hand einen einzelnen runden, weißen Käse auf einem Blatt hoch.
Seit der Sezession von Spanien, 1810, hat Mexiko ein volles Dutzend ausgewachsener Verfassungen und eine größere Anzahl von Unabhängigkeits- und Reformerklärungen erlebt. Viele der Verfassungen waren nach dem Vorbild der nordamerikanischen entworfen. Zu ihrer Zeit wurden manche liberal, manche radikal und manche zentralistisch genannt. Alle waren sie Wunder theoretischer Perfektion; alle waren zugleich Ergebnis und Ursache großen Blutvergießens. Die verfassunggebende Versammlung pflegte in einer belagerten Stadt im Gebirge zu tagen, indes zwei Rebellengenerale mit ihren Truppen von Norden anmarschierten; ein dritter General von noch ungewisser Loyalität rückte von der Küste heran; in Vera Cruz saß ein Gegenpräsident, und in Mexiko-City herrschte eine Revolte. Es gab eine Konstitutionelle Partei und eine Reformpartei, eine Agrarpartei und eine Liberale Partei, es gab die Interessen der Kirche, die Interessen der Grundbesitzer, die Interessen der Kreolen sowie die Interessen des ausländischen Kapitals. Manche dieser Interessen verbündeten sich, andere wieder nicht. Dann gab es einen gewählten Präsidenten, dessen Wahl rechtswidrig war, einen verfassungsmäßig gewählten Präsidenten, der nach seiner Wahl ermordet wurde, und einen Präsidenten, der seine Stellung einem Putsch verdankte. Der eine wurde von der nordamerikanischen Regierung nicht anerkannt, der andere hatte die britischen Ölinteressen nicht hinter sich, ein dritter wurde von den Franzosen bekriegt. Zwischen Belagerungen und regelrechten Schlachten hetzten Volksbefreier, Reformer und Verteidiger des Glaubens mit bewaffneten Banden durchs Land, verbrannten Ernten und Dörfer und mordeten alles, was ihnen unter die Augen kam. Und dabei wurde das Volk immer ärmer und verwirrter und seinerseits abwechselnd zorniger, fatalistischer, mordlustiger oder verängstigter.
Dieses Millennium währte hundertzwanzig Jahre, beginnend mit Hidalgos Aufstand gegen die spanische Herrschaft bis zum Jahre 1929, als Calles die Frühjahrsrevolution niederschlug. Zuweilen kam es vor, dass ein General siegreicher war als gewöhnlich und die Möglichkeit hatte, in Ruhe um sich zu blicken und Ordnung zu schaffen; zuweilen waren mehr Menschen in die Metzeleien verwickelt, zuweilen weniger, aber nie gab es frieden. Nur zwei Atempausen waren dem unglücklichen Land vergönnt: der Krieg von 1848 zwischen Mexiko und den USA, in dem die Mexikaner unterlagen und die Hälfte ihres Staatsgebiets einbüßten, und die vierzig Jahre währende Despotie des Diktators Díaz.
(Noch einmal war die Vorsehung Mexiko gnädig. Im Ersten Weltkrieg schlug die deutsche Regierung in einem geheimen Notenentwurf ein Bündnis gegen die Vereinigten Staaten vor und bot als Gegenleistung die Rückgliederung von Gebieten an, die schwerlich das mexikanische Elsass-Lothringen genannt werden konnten – die Staaten Texas, Arizona, Neu-Mexiko, Kalifornien, Utah und Nevada. In einem Augenblick der Zerstreutheit ließ Dr. Albrecht, ein Angehöriger der Deutschen Botschaft, in einem Wagen der Third Avenue Elevated Railway of New York City den Aktenkoffer mit dem Entwurf liegen. Der Inhalt wurde in der New York World veröffentlicht. Mexiko blieb neutral.)
Den ganzen angenehmen, trägen Tag hindurch geht es in langsamem Anstieg südwärts; und während des Anstiegs entfaltet sich allmählich das Land, vervielfachen sich die Einzelheiten. Es gibt jetzt Bäume, vom Regen gewaschen, und Felder; auf kleinen Ackern an den Hängen steht junges Getreide; und am Horizont zeichnet sich zart eine Bergkette ab, eine zweite dahinter.
Dies ist der Bundesstaat, der den Namen eines Heiligen trägt: San Luís Potosí. Schon sieht man, wenn auch nur bruchstückhaft, hin und wieder Kirchen und Ruinen. Wir sind noch immer in unserem klimatisierten Waggon eingeschlossen, aber man kann auf den Plattformen zwischen den Wagen die warme, lebendige Sommerluft einatmen. Jeden Augenblick werden wir jetzt den Wendekreis des Krebses passieren. Und nun kommen wir in die Tierra Templada, die milde Region, und hier beginnt auch das Mexiko, wie man es kennt, das Mexiko des wunderbaren Klimas, das Mexiko der Geschichte und der Archäologie, das Mexiko des Reisenden. Hier, zwischen dem zweiundzwanzigsten Breitengrad und der Landenge von Tehuantepec, zwischen Pazifik und Golf, auf der Mesa, den beiden Sierras, drunten in den heißen Küstenstreifen und im Flachland von Yucatán, hat sich alles abgespielt: das Aztekenreich und die Eroberung durch die Spanier, der Silberrausch und die spanische Kolonialherrschaft, die Inquisition und der Unabhängigkeitskrieg, das 19. Jahrhundert mit seinen Revolutionen und dem Leben auf den Haziendas, die übermütige und die bedrängte Kirche; General Santa Anna, immer Verräter und immer Verlierer, wie er amtsgierig mit seinem klappernden Holzbein Reklame für sich machte, und der zähe Juarez mit seiner Robespierreschen Starrköpfig- und Tugendhaftigkeit; die schattenhafte Herrschaft Maximilians und die strenge Herrschaft von Díaz mit ihrer Wirtschaftsblüte; Bürgerkrieg, Banditentum, Bodenreform, Präsident Calles und Präsident Cardenas, der Ölrausch und der Anbruch des »amerikanischen Zeitalters«.
Hier ist es also, das Herzland von Mexiko, das älteste Land der Neuen Welt, wo Montezuma zwischen den Lilienteichen und Vulkanen von Tenochtitlán in üppiger Blumenpracht lebte; wo eine despotische, pedantische und unmenschliche Ideenwelt zu steinernen Pyramiden erstarrte, die zu den furchteinflößendsten der Welt gehören; wo Cortés ein volles Jahr ins Unbekannte zog, in die leeren, grenzenlosen Weiten ohne Wiederkehr, mit einer Kühnheit, die einem Zeitalter des Zweifels unvorstellbar ist; wo das Silber entdeckt wurde, das die Armada bauen half und die spanischen Vizekönige und königlichen Richter steif vor Gold und Würden und unbeweibt inmitten des Reichtums, der Verschwendung und der Unbeweglichkeit von Neuspanien thronten; wo die Schwerfälligkeit des Gesetzes vier Jahre des Wartens auf ein Schreiben aus Madrid bedeutete, wo die Gipsengel aztekischen Federschmuck trugen, wo Bischöfe auf öffentlichen Plätzen mathematische Formeln verbrannten und Priester eine »Boston Tea Party« anzettelten, weil ihnen die Seidenraupenzucht untersagt war; wo Wegelagerer ihre Beute mit Ministern teilten, wo ein stendhalesker Sekondeleutnant sich mit vierundzwanzig Jahren zum Kaiser krönen ließ und kreolische Damen, diamantenbeladen und kleine Leoparden mit sich führend, zur Messe gingen; wo Nonnen achtzig Jahre lang in geheimen Kämmerchen lebten und starben, wo am helllichten Tage Landjunker ohne ein Wort erstochen wurden und im fliegenverseuchten Vera Cruz Damen im Reifrock an der Festtafel saßen, um den Erzherzog zu empfangen, der ins Land kam, den Liberalismus aufgeklärter Fürsten gegen Gewalten aufzubieten, die er nicht verstand, ja nicht einmal ahnte, indes die Boten des Verrats schon über die unsicheren Straßen jagten; wo sich auf den Haziendas tagtäglich die dreißigköpfige Familie an den Abendtisch setzte, aber die Stühle aus den Schlafzimmern geholt werden mussten, wo der Jahreslohn des Landarbeiters in kleinen Kupfermünzen ausbezahlt wurde und der Besitzer der Hazienda in einer einzigen Woche in Monte Carlo seine ganze Ernte in Goldstücken verspielte; wo die der alles verschlingenden Sonne geweihten Monumente unzerstörbar sind, wo Barockfassaden in Sandstein geritzt und die Märkte voll von Touristen und Rosenkränzen sind.
Alles hat sich hier abgespielt, und wenig hat sich verändert. Das Land hat die Verwirrung, das Gepränge und die Gewalttätigkeit des Machtwechsels erlebt, doch auf die Geburts- und Sterbeziffern hat sich das nicht ausgewirkt. Indios, immer neue Indios wandern und wandern schwer beladen über die endlosen Hügel, sitzen mit starrem Blick auf dem Marktplatz, Stunde um Stunde, scharen sich dann jählings zu einem ihrer Pilgerzüge zusammen und ziehen in einem riesigen Schwarm übers Land, auf der Suche nach einem neuen Gesicht der Gottesmutter.
Jemand ist hereingekommen und hat gesagt, wir würden irgendwann morgen früh in Mexiko-City sein, also mit gar nicht einmal so sehr viel Verspätung. Jeder wird allmählich unruhig. Ich habe auf einem Tisch, den die rechtmäßigen Besitzer freundlicherweise für mich geräumt haben, eine Patience ausgelegt. Rechts und links von meinem Platz stehen zwei zapplige Jungen. Sie sind schrecklich höflich.
»Bitte, M’am, was sind das für Karten?«
Es sind winzige Patiencekarten, wie sie vor dem Krieg in Wien hergestellt wurden und, wie ich annehmen möchte, auch heute dort wieder hergestellt werden.
»Hast du schon mal so herzige Karten gesehen, Jeff? Sind die nicht herzig? Komm und schau dir diese herzigen Karten an, Fleecy-May. Miss Carter, M’am, kommen Sie doch und schaun Sie diese Karten an, haben Sie schon mal so herzige Karten gesehn, Miss Carter, M’am?«
»Hör mal, Braxton, du darfst die Dame nicht stören.«
»Was ist das für eine Patience, M’am?«
»Miss Milligan.« Sie ist fast meine liebste Patience, und sie geht kaum jemals auf Man benötigt viel Konzentration.
»Mein Großpapa legt eine, die ist fast genauso.«
»Oh, der Bube, M’am! Der Karobube auf die schwarze Zehn.«
»Der Bube geht doch nicht auf die Zehn, du Dummkopf, der Bube geht auf die Dame. Nicht wahr, M’am, der Bube geht auf die Dame?«
»Braxton Bragg Jones, willst du wohl die Dame in Ruhe lassen«, sagt Miss Carter.
»Oh, macht gar nichts«, sage ich, »das ist schon in Ordnung. Bitte.«
Es geht nicht auf Ich könnte ja noch immer die Karten umordnen, aber Braxton Bragg und Jefferson finden Miss Milligan allmählich langweilig. Beschämt fange ich etwas an, was schnell und einfach geht und nach mehr aussieht.
Während der Zug durch den Abend fahrt, wird die Landschaft immer lieblicher, zugänglicher und reicher. Auf den Feldern grasen Ochsen, Maulbeerbäume bilden Girlanden an den Hängen, Dörfer und Kirchen treten in der außergewöhnlich klaren Beleuchtung rosa und golden hervor, als wären die Fenster unseres Waggons aus geschliffenem Glas.
Ich beginne ein Gespräch – man übt sein Spanisch – mit dem Offizier aus Monterrey. Unser Austausch der üblichen Höflichkeitsfloskeln nimmt folgende Form an:
»Woher kommen Sie?« werde ich gefragt.
»Aus Amerika.«
»Wir sind in Amerika.«
»Aus Nordamerika.«
»Wir sind in Nordamerika.«
»Aus den Vereinigten Staaten.«
»Wir sind in den Vereinigten Staaten, den Estados Unidos Mexicanos.«
»Verstehe. Oje! Dann ist also«, ich deute auf E., »diese Señora hier was? Keine Amerikanerin? Keine Nordamerikanerin? Was denn dann?«
»Yanqui. ha Señora es Yanqui.«
»Aber man nennt doch nur die Nordamerikaner Yankees … Ich meine, nur Amerikaner aus dem Norden der Vereinigten Staaten … Ich meine, nur Nordamerikaner aus den Staaten … Nordamerikaner aus dem Norden … Ich meine, nur Yankees aus den Nordstaaten heißen Yankees.«
»Por favor?«
In glücklicheren Zeiten pflegte man es so zu halten, dass man über ein Land las, ehe man hinfuhr. Man legte sich eine Bücherliste für die Bibliothek an, befragte gebildete Freunde, dann machte man sich während der Winterabende fleißig an die Arbeit. Diesmal tat ich nichts dergleichen. Aber da ist ein gewisser krümeliger Bodensatz; ich erinnere mich wieder, dass ich dann und wann, hie und da einiges über Mexiko gelesen habe. Bücher eben, wie sie einem im Lauf der Jahre Unterkommen, nichts Systematisches oder, Madame Calderon ausgenommen, kürzlich Gelesenes. Prescotts Conquest, als ich noch sehr jung war, und keineswegs das ganze Buch. Cortés’ Briefe. Dicke Wälzer über Maximilian und Carlota, keiner wirklich gut und alle faszinierend. Allerlei Reiseberichte aus der Zeit der französischen Okkupation, die durchwegs Titel trugen wie LE SIÈGE DE PUEBLIA, Souvenir d’une Campagne ou Cinq Ans au Mexique par un officier de Marine en Retraite, Chevalier de la Legion d’Honneur, Attaché à l’État Major du Marechal Bazaine. Bände, durch die man sich quält und in denen bisweilen eine verrückte, bezaubernde Kleinigkeit, ein paar Worte über eine Bauernküche oder Wegelagerei, durch die gestelzte Eintönigkeit vorimpressionistischer Schilderungen drangen, in denen jaillissaient les cimes majestueuses et enneigées du venerable Popocatepetl
Der Schriftsteller, der Menschen meiner Generation zum ersten Mal Mexiko als Gegenwartsrealität nahebrachte, war H. Lawrence in seinen Briefen, Mornings in Mexico und The Plumed Serpent. Mornings in Mexico hatte einen lyrischen Ton, war spontan, warm, wie ein langer Spaziergang in der Sonne. The Plumed Serpent war erfüllt von Angst und Gewalttat, und Lawrence stieß einen auch noch mit der Nase darauf: Man musste die Menge in der Stierkampfarena hassen, man musste Grauen vor dem Ritual der Landesbewohner empfinden. Vielleicht war die Realität, zu ihrem Vor- oder Nachteil, eher seine eigene als die Realität Mexikos. Tatsächlich gab es darin zwei Realitäten. Die Mornings wurden im Süden niedergeschrieben, in Oaxaca, im Zapotekenland; The Plumed Serpent im Westen, in Chapala, an einem See. Ich habe The Plumed Serpent nie gemocht. Das Buch wirkte unheilvoll, doch ohne rechten Grund. Immerfort wurde warnend auf etwas hingewiesen, und man wusste nie so recht, worauf eigentlich, obwohl man zuweilen dazu gezwungen wurde, den erweckten Anschein für bare Münze zu nehmen. Und Lawrences mysteriöse Indianer, diese Verkörperungen von Macht, Weisheit und Bösartigkeit, blieben nach all den beschwörenden Kapiteln wahrhaft immer noch sehr mysteriös.
Auch war aus diesen Stapeln von littérature engagée nicht viel Erleuchtung zu gewinnen. Man las ein Buch und kam zu der Überzeugung, die mexikanischen Indianer lebten, unbetroffen von ökonomischer Realität, in einem von Weisen geschaffenen Paradies rein handwerklicher Arbeit; man las ein anderes und gewann den Eindruck, sie seien die Vorkämpfer einer erwachenden Arbeiterklasse, ihrer Aufgabe wohl bewusst. Man las von Bösewichtern – die mexikanische Kost, so kraftlos; der Alkohol; die Kirche; die Verfolgung der Kirche; Präsident Cardenas, der so viel mit Stalin und diesem Mann im Weißen Haus gemein habe. Man las von Wunderrezepten – Bodenreform; Bewässerung; Konfiszierung ausländischen Besitzes; die Kirche; die Schließung der Kirchen; Präsident Cardenas, der so viel mit Lenin und D. Roosevelt gemein habe.
Die Dreißigerjahre waren nicht die richtige Zeit, sich über den Streit um Díaz den Kopf zu zerbrechen: der gute Landesvater oder der Despot? Man wusste, dass er sich in einer vulgären Zeit als fähiger Mann erwiesen hatte, als ein Hüter der Ordnung und Förderer des Wirtschaftslebens in einem Land der Trägheit und Anarchie, der seine Gegner hinter Schloss und Riegel setzte, die Wahlergebnisse fälschte und für die Pressefreiheit nichts übrig hatte. Sein Regime kam einem recht milde und entrückt und altmodisch vor; Díaz war schon lange tot, und es war damals ein anderes Land, das inzwischen sehr fern ist. Trotzdem höre ich jetzt im Zug ständig seinen Namen.
In unserem Wagen herrscht eine erwartungsvolle Stimmung, wie in der letzten Nacht an Bord eines Schiffes. Die Jungen und Mädchen singen Lieder. Die Lehrerinnen versuchen sie zu dämpfen, wirken aber selbst ungemein freudig gestimmt. Der Schlafwagenschaffner macht schon die Betten bereit. Alle protestieren, doch es hilft nichts. Kissenschlachten liegen in der Luft. Ich flüchte mich in den Speisewagen, um ein Glas Bier zu trinken. Eine der Lehrerinnen – eine nette Frau, wie man so sagt – hat sich ebenfalls davongemacht.
»Wie ist es wirklich?«
»Mexiko? Sie werden Wunder zu sehen bekommen«, sagte sie mit leuchtenden Augen.
Ein Gefühl der Erregung lässt mich um sieben Uhr wach werden, und ich beschließe aufzustehen, was sonst um diese Zeit nicht meine Gewohnheit ist. Ich ziehe in meinem zugeknöpften Zelt mühsam ein paar Sachen über und gehe in den Speisewagen, wo endlich die Fenster heruntergelassen sind und klar und scharf die frische Morgenluft hereinströmt. Und draußen, unter einem intensiv hellen Himmel, liegt eine schimmernde, üppige Ebene, Zuckerrohr und Getreide stehen zwischen den Kakteen, ein helles, reiches tropisches Land, wunderbar erfrischt, breitet sich aus: grün, grün, grün, das Tal von Mexiko.