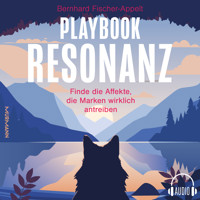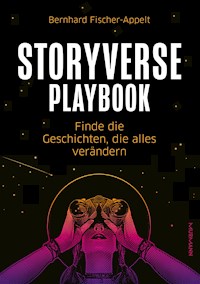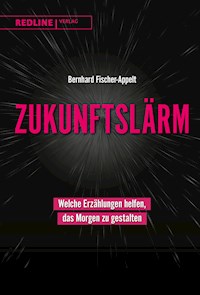
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele behaupten, die Zukunft zu kennen. 2020 hat jedoch gezeigt, wie schnell die Gegenwart die Zukunft überholen kann. Unternehmer, Kommunikationsexperte und Harvard-Forscher Bernhard Fischer-Appelt zeigt, wie man es schafft, im Zukunftslärm Muster zu erkennen, Prioritäten zu setzen und dabei positiv nach vorne zu schauen. Tiefgreifende Umbrüche prägen heute unseren Alltag. Die Digitalisierung revolutioniert die Wirtschaft und infolge von Bevölkerungswachstum, Erderwärmung und Pandemien drohen allerlei Apokalypsen. Eine Zukunftsunsicherheit grassiert und hat die gesellschaftlichen Debatten erfasst. Wie soll man im Zukunftslärm aus Visionen und Albträumen, aus Plänen und Halbwahrheiten optimistisch und mutig nach vorne blicken? Wem glaubt man noch angesichts vieler Populisten und Verschwörungstheoretiker, Experten und Fans neuer Technologien, die alle wissen, was die Zukunft bringt? Indem man lernt, Fakten von Fake News zu unterscheiden und Narrative und Geschichten richtig einzuordnen, davon ist Bernhard Fischer-Appelt überzeugt. Er weiß, wie überzeugende Erzählungen den öffentlichen Diskurs prägen, und zeigt, wie man selbst welche entwickeln kann. Denn nur wer eine realistische Vorstellung des Kommenden hat, kann künftige Herausforderungen besser einschätzen, Prioritäten richtig setzen, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und positiv an seiner Zukunft mitwirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bernhard Fischer-Appelt
ZUKUNFTSLÄRM
Bernhard Fischer-Appelt
ZUKUNFTSLÄRM
Welche Erzählungen helfen, das Morgen zu gestalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2022
© 2022 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Ulrich Wank
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant
Umschlagabbildung: Hatcha/ Shutterstock
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-867-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-375-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-376-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Prolog – das Lied der Zukunft
Erstes Kapitel: Die Zukunft – ein Möglichkeitsraum
Zweites Kapitel: Im Zukunftslärm – warum die Zukunft so ohrenbetäubend kracht
Drittes Kapitel: Unsere Zukünfte – was ist plausibel und was nicht?
Viertes Kapitel: Utopien – über die Zugkraft unerfüllbarer Visionen
Fünftes Kapitel: Dystopie – der Blick in den Abgrund lässt gute Narrative gedeihen
Sechstes Kapitel: Von mir, für euch – für ein starkes Ich- und Wir-Gefühl
Siebtes Kapitel: Technologie – Veränderungsmotor für die Gesellschaft
Achtes Kapitel: Narrative Kräfte – über den Magnetismus von Erzählmustern
Neuntes Kapitel: Verantwortung – Ethik hat auch Zukunft
Zehntes Kapitel: Zukunftsnarrative – wie sie gelingen
Epilog
Danksagungen
Über den Autor
Literatur
Anmerkungen
KENNENLERNEN.
Das sollte unser temporäres neues Zuhause sein? Grauer Himmel. Boston tagelang im Schneematsch. Eine Autonation ohne Winterreifen. Fensterlose Kitas im Keller. Astronomische Innenstadtmieten. Januar 2018. Dann aber auch verzaubernde Momente: Wir besuchten unsere Freunde in Weston, einer Vorstadt jenseits des Bostoner Autobahnrings. Die Fahrt führte unter Tannenzweigen hindurch, von denen Neuschnee rieselte und uns in der gleißenden Sonne blendete. Die öffentliche Schule ist in Weston ein Traum. Im Stadtkern ein Café, eine Reinigung, eine Drogerie, ein Ballettstudio. Drei Straßen weiter schlichen zwei Coyoten über die Fahrbahn. Nach ein paar Mal Abbiegen blickten wir auf ein Holzhaus im typischen Neuengland-Stil: Es sieht aus wie unsere unmittelbare Zukunft.
Eigentlich war ich schon seit Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmer, habe mit meinem Bruder eine Agenturgruppe aufgebaut und arbeitete in der Kommunikationsberatung und Ideenentwicklung. Damit habe ich früh begonnen. Schon als 16-Jähriger hatte ich einen kleinen Verlag gegründet. Daraus ist heute ein fantastisches Team mit 700 Mitarbeiter:innen gewachsen. 2018 schmiedete ich den Plan, in die USA zu gehen. Ich wollte testen, ob es unser Vorstandsteam ohne mich schafft. Ich wollte mich in einer anderen Umgebung umsehen und schauen, ob ich unser Geschäft internationalisieren kann. Und ich wollte mein inhaltliches Interesse wissenschaftlich vertiefen.
Schon längere Zeit hatte ich mich damals wissenschaftlich engagiert, mit einem Mitarbeiter eine Studie begonnen über Autonomie und Digitalisierung. Deshalb bin ich an das Weatherhead Center for International Affairs der Harvard Universität gelangt, in eine wunderbare Gruppe von akademischen Forschern aus sehr unterschiedlichen Wissensgebieten und Ländern. Am ersten Tag fand ich mich in einem Seminar wieder, in dem die Technologietheoretikerin Sheila Jasanoff und der Ökonom Dani Rodrick über Narrative in den Sozialwissenschaften debattierten. Es ist mein Thema geblieben – genauer gesagt, all die Erkenntnisfragen rund um das Thema narrativer Musterwahrnehmung.
In meinem zweiten Jahr bin ich zusammen mit meinem Harvard-Kollegen, dem Historiker Jack Loveridge, in die Materie vorgedrungen. Mit Jack zu arbeiten hat mir viel Freude bereitet. Zusammen haben wir über Zukunftslärm nachgedacht, über die Geschichte von Zukunftsprognosen aus den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts und was daraus geworden ist. Wir haben den ersten und den letzten Satz dieses Buches zusammen entwickelt und noch vieles andere dazwischen erdacht.
Die Harvard-Professorin Sheila Jasanoff hat mich vorbehaltlos in ihre Forschungsgruppe aufgenommen. Sie und die Kolleg:innen dort waren mir eine große Inspiration und Hilfe. Mich hat besonders ihre wissenschaftstheoretische Qualität fasziniert, ihre Präzision und Zuwendung, aber auch ihr Engagement, mit dem sie eine »akademische Fakultät« streng organisiert und dort ein globales Observatorium für gesellschaftswissenschaftliche Fragen der Gentechnik aufgebaut hat.
Doch eines Tages musste ich zurück nach Deutschland, um zu schauen, ob mein Vorstandsexperiment weiter funktionierte. Als ich in Hamburg aus dem Flugzeug stieg, erfuhr ich aus den Nachrichten, dass man dabei war, die US-Grenzen wegen eines neuartigen Corona-Virus zu schließen. Es wären mir nur zwei Tage geblieben, um noch in die USA zurückzukehren, was ich nicht schaffen konnte. Es war eine düstere Lage, da meine Familie noch dort war mit den schulpflichtigen Kindern. Und meine Firma brauchte mich jetzt vor Ort. Ich musste für meine Mitarbeiter:innen da sein in der Krise, deren Größenordnung damals noch nicht absehbar war – das beendete abrupt unsere Zeit in den USA.
Das soziale Gefüge, der akademische Austausch in Harvard war weitgehend um die morgendliche oder mittägliche Nahrungsaufnahme herum organisiert. Fast alle offenen Foren bieten kostenlose Sandwiches oder Frühstück an. Es ist auch für mich neu, dass solche Grundlagen unseres sozialen Gefüges infrage stehen, Restaurants, Kultur und informeller Austausch auf Stopp stehen oder unter sehr erschwerten Bedingungen stattfinden. Die Welt ist es gewöhnt, technologische Risiken und Chancen abzuwägen, hat Szenarien für Systemausfälle und die Schwachstellen kritischer Infrastruktur. Was passiert, wenn das soziale Gefüge zusammenbricht und unsere gemeinschaftliche Vernetzung in der Gegenwart gefangen ist, dafür gab es keinen Krisenplan.
Eine wichtige Möglichkeit, um diesem Stillstand heute entgegenzutreten, ist es, die Zukunft zu gestalten. Es braucht eine Expertise, um zu verstehen, wie heute über Zukünfte gedacht wird. Das erleichtert den Umgang mit ihr. Für Unternehmen kann das bedeuten, systematisch Zukunftsnarrative und Innovationsgeschichten zu formen. Für Politik und Gesellschaft kann es bedeuten, neuen gemeinschaftlichen Stoff zu entwickeln, der gegen die Polarisierung und den Gegenwartsschock hilft, den viele leider falsch verarbeiten. Und für einen selbst kann es bedeuten, auch persönliche und familiäre Fantasien zu entwickeln, die eine plausible Möglichkeit für die Zukunft darstellen.
In meinem Unternehmen habe ich ein Forschungs- und Entwicklungsteam aufgebaut und einen neuen Beratungsansatz entwickelt, dessen erster Teil in diesem Buch geteilt wird. In meinem Team trifft Philosophie und Gesellschaftstheorie auf Strategiepraxis und Kommunikationsexpertise. Die reine Sichtweise, der zunächst analysierende Blick auf die Dinge ist oft entscheidend, um nicht vorschnell, sondern pragmatisch zu handeln.
Meine Tochter hat in Amerika sprechen gelernt. Sie hatte deshalb lange Zeit einen starken amerikanischen Akzent. Auch dieses Buch hat an der einen oder anderen Stelle einen solchen Akzent, weil es auf Englisch entstanden ist und dann übersetzt wurde.
Viel Freude beim Lesen.
Bernhard Fischer-Appelt
PROLOG – DAS LIED DER ZUKUNFT
Texas ist ein Zufluchtsort für Silicon-Valley-Müde. Trotz seines Images als alter Westen und seiner konservativen Politik ist der Lone Star State in vielerlei Hinsicht ein Ort der Zukunft. In der Hauptstadt Austin, dem progressiven, künstlerischen und kreativen Nervenzentrum des größten US-Bundestaates, findet alljährlich das Musik- und Tech-Festival South by Southwest (SXSW) statt, das seit Jahren Audiophile und Digitalfreaks gleichermaßen anzieht. SXSW ist die große Zukunftsfeier unserer Technologiegesellschaft und ein Pilgerort für Evangelisten und Apologeten der Digitalisierung.
Natürlich hat Deutschland auf dem Festival so etwas wie eine eigene Botschaft, ein Deutsches Haus. Hier kommen Vertreter der deutschen Wirtschaft, Politik und Kultur, ungezwungen mit Menschen zusammen, die in Austin leben, und mit Besuchern aus der ganzen Welt. Das Haus, unweit des Hauptcampus der University of Texas, ist nicht groß, aber es bietet einen Einblick quer durch alle Branchen, auch in die Zukunft Deutschlands als Kultur- und Innovationsnation.
Beim Hinausgehen fiel mir auf den Bäumen der gegenüberliegenden Straßenseite ein großer Vogelschwarm auf: ohrenbetäubendes Gezwitscher. Mockingbirds, die offiziellen Staatsvögel von Texas, bei uns bekannt als Spottdrosseln. Sie sind nicht nur standhafte Verteidiger ihres Territoriums, sondern singen in Austin auch das Lied der Zukunft. Besonders gerne ahmen sie die Geräusche anderer Lebewesen nach, darunter Bienen, Mücken und gelegentlich Amphibien, deshalb auch der Name Mockingbird, Imitiervogel.1 Aus diesen Tiergeräuschen kann ein Mockingbird ganze Arien komponieren und mit ihnen anlocken, was er fressen mag, abstoßen, was ihn gefährdet, und finden, was ihn interessiert.2 Als echter Bewohner von Austin kann er sogar die Geräusche von Maschinen imitieren.
Auf gewisse Weise ahmt der Mockingbird damit insgesamt nach, was die SXSW begleitet: Zukunftslärm – so etwas wie die natürliche Version einer technologischen Kakophonie. Das Ringen um die noch größere, lautere, aktuellere und revolutionärere Zukunftsprognose. Aber in den Jahren 2018 und 2019 tauchten auf der SXSW auch zunehmend gesellschaftliche Fragen auf. In die positive und sonst fast euphorische Haltung zum technologischen Wachstum, die an diesem Versammlungsort digitaler Evangelisten zum Ausdruck kommt, mischten sich kritische Stimmen und Themen wie Bias in Algorithmen, gesellschaftliche Verantwortung von Plattformen und die Frage nach einer Technik-Ethik. Plötzlich hörte man nicht nur den hellen Klang der technologischen Zukunft, sondern durchaus auch dunkle besorgte Töne über eine mögliche zukünftige Gesellschaftsveränderung – neben Begeisterung eben auch Bedenken.
In diesem Buch wird die Frage untersucht, die auch einen Großteil des Zukunftslärms, dem wir täglich begegnen, motiviert: Was ist der Stand der Wissenschaft, wenn es darum geht, über die Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft nachzudenken? Ausgehend davon wird untersucht, wie man die echten Signale möglicher Zukünfte effektiv von dem allgemeinen Lärm unterscheiden kann, mit dem die Ideen und Interessen von heute (und gestern) verkauft werden. Die Zukunft unterscheidet sich von der Gegenwart auch dadurch, dass sie noch unmöglich ist. Deshalb ist es wichtig, systematisch daran zu arbeiten, die Grenze des Unmöglichen zu überwinden, wenn es darum geht, über die Zukunft nachzudenken, sie zu beeinflussen und zu gestalten. Eben nicht nur am Realistischen und heute Möglichen festzuhalten. Dafür wird das Instrument eingeführt, mit plausibler Fiktion zu arbeiten und es wirksam zu machen.
Ein gelegentlicher Blick in Zukunftsprojekte der Vergangenheit macht deutlich, dass vieles ganz anders gekommen ist als gedacht, aber auch vieles, was heute als hochaktuelle Zukunft gesehen wird, eine lange Geschichte hat. Besonders soll hier aber betont werden, wie wichtig es ist, transformative Erzählmuster und die Anziehungskraft des Geschichtenerzählens für das Denken über die Zukunft zu verstehen. Daher werden fünf Kräfte erläutert, die eine solche Zukunft als offenen Raum von Möglichkeiten markieren. Vor allem aber geht es in diesem Buch um die Bedeutung und das Potenzial, die eigene Zukunft zu gestalten.
Aber wie und wo soll man damit anfangen? In den folgenden Kapiteln werden wir über die Fähigkeit nachdenken, wegweisende und manchmal geflügelte Worte, überzeugende Sätze, Erzählmuster und Techniken zu entwickeln, um mit plausibler Fiktion die Zukunft zu entwerfen – und zwar noch bevor es darum geht, sie konkret zu bauen.
ERSTES KAPITEL
DIE ZUKUNFT – EIN MÖGLICHKEITSRAUM
Die Zukunft entsteht nur, wenn wir sie anstoßen. Deshalb müssen wir ein klares Bild davon bekommen, welche von mehreren möglichen Zukünften zu wählen ist. Das geht nur, wenn wir verstehen, wie sich unterschiedliche Zukünfte zueinander verhalten – und das geht wiederum nur, wenn wir den Zukunftslärm lichten und verstehen, was in der Gegenwart zu tun ist, um eine Zukunft aufzubauen.
Gelobt für seine Furchtlosigkeit, verflucht für seine Beharrlichkeit beim nächtlichen Gesang oder bei der Verteidigung seines Territoriums, frisst der Mockingbird gerne frisches Obst und Gemüse, was ihn nicht gerade zum Liebling der Gärtner gemacht hat, obwohl er auch viele Insekten vertilgt. Außer den Mockingbirds beherbergen Austins Bäume aber auch noch Grackeln, eine kaum weniger territoriale nordamerikanische Vogelart, die mit den Spottdrosseln gerne spektakuläre und lautstarke Luftkämpfe ausficht. Wer dabei jeweils den Kürzeren zieht, hat sich mir nicht immer erschlossen, als ich in der Hauptstadt des Bundestaates Texas für ein paar Tage an dem erwähnten Kultur- und Zukunftsfestival South by Southwest, kurz SXSW, teilnahm.
Auch das menschliche Gerangel um Zukunftsvorschläge und mediale Aufmerksamkeit ist groß, wie auf Konferenzen, Ausstellungen, Messen und Festivals vom Kaliber der SXSW zu erfahren ist. Die Zukunft wird dort regelmäßig besetzt, indem mitunter absurdeste Technologielösungen propagiert werden. Als einer der skurrilsten Fälle kommt mir zum Beispiel eine Modellserie nuklearbetriebener Autos aus den sechziger Jahren in den Sinn, angefangen mit dem Ford Nukleon. Heute sind solche zukünftigen Objekte mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge, mitfühlende Pflegeroboter und seitwärts fahrende, parkplatzminimierende Autokabinen. Technologische Zukunftsattrappen zu propagieren, kann dabei durchaus auch ein Versuch sein, sich Zukünfte vorzustellen, zu experimentieren und Reaktionen zu testen, darum zu ringen, wer Themen und Möglichkeiten frühzeitig besetzt.
Oft ist es sogar zunächst besser, echte Innovation noch nicht zu zeigen und Sinn dort vorzugeben, wo es gar keinen Sinn gibt – durch bewusste Täuschung oder einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, den Raum zu füllen und einen Entwurf zu zeigen, der es sowieso nie zu seiner Verwirklichung schaffen wird. Hinter solchem Handeln kann vieles stecken: der Wille zur Lufthoheit über die Argumente oder einfach nur der Hunger nach maximaler Aufmerksamkeit, wie eben bei den Spottdrosseln, die auf der Balz und der Suche nach territorialer Hoheit sind. Wie kann es gelingen, Investor:innen zu finden, Erstkund:innen zu gewinnen oder Konsument:innen davon zu überzeugen, dass auch eine lahm gewordene Marke voller Entwicklungspotenzial steckt? Die Zukunft durch Spott und kämpferisch herausposaunte Visionen zu beanspruchen, ist eine ebenso legitime Strategie wie das mühsame Prototyping kleiner Schritte im stillen Kämmerlein, um zu einem gründlich abgerundeten Vorschlag zu gelangen.
Während das Motto des Festivals seine hochkarätigen Redner:innen und Teilnehmer:innen aufforderte, über die Zukunft unserer Gesellschaft nachzudenken, wurde die Spottdrossel zu meiner bevorzugten Metapher für die unscharfe Vorhersagekakophonie, die von der Veranstaltung ausging. Der Spötter und sein Jukebox-Charakter ist ein Meister des Zukunftslärms. Ich wäre nun auch in der Lage, vieles zu intonieren, was man über unsere Zukunft hören möchte. Ich fragte mich aber, wie man diesen ganzen Klangteppich durchdringen kann. Wie können wir das Signal vom Lärm trennen? Wie können wir endlich eine plausible Zukunft hören – eine, nach der ich und alle anderen heute wirklich handeln können? Die Vögel gaben mir darauf sicherlich keine Antwort und die Konferenz in Austin auch nicht.
Die Überforderung von Prognosen durch Zukünfte
Wie man Signal und bloßes Rauschen voneinander unterscheiden kann, ist eines der großen Probleme, mit denen sich Mathematiker und Statistiker beschäftigen. Nach aussagekräftigen Mustern in einem unermesslichen Ozean von Datentreibgut zu suchen, und daraus Aussagen über die Zukunft abzuleiten, liegt in unserer menschlichen Natur. Diese Suche ist ein zutiefst befriedigender Prozess, der Orientierung und Sicherheit verspricht. In der Regel lässt sich die Daten-Spreu vom Weizen durch Verfahren trennen, mit denen wir Signifikanzniveaus für alle möglichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ermitteln können – vor allem, wenn es um einfache Aussagen geht, etwa wie sich Bevölkerungen, das Wetter, ein Verkehrsaufkommen oder eine Viruspandemie entwickeln werden. Solche Methoden versetzen uns in die Lage, in ein paar engen Ausschnitten unserer Lebenswelt ein wenig von unserer Zukunft zu erklären.
Dabei sollte ich allerdings erwähnen, dass die Vorhersage der Zukunft die längste Zeit nicht die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft war. Denn dort ging es lange um das, was gemessen, beobachtet und geprüft werden kann – das heißt um Vergangenes. Erst mit dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisschub und ganz besonders mit dem Anfallen von immer mehr digitalen Daten während der letzten Jahrzehnte ist die Wissenschaft mehr und mehr zu Vorhersagen aufgerufen worden. Der Klimawandel und die Digitalisierung, die beiden schicksalhaften Transformationen unserer Zeit, haben dabei sicherlich eine entscheidende Rolle gespielt. Und so lassen sich mittlerweile dank quantitativer Modellierungen Vorhersagen formulieren, die tatsächlich hilfreich und nicht selten sogar spektakulär genau sind. Die Vorhersage von Alterskohorten ist ein Beispiel dafür. Lineare Gleichungen können mit angemessener Genauigkeit die Alterspyramiden zum Ende des 21. Jahrhunderts bestimmen. Ein weiteres Beispiel ist das berühmte Mooresche Gesetz, die Formel, die das Wachstum der Halbleiterkapazität im Laufe der Zeit mit überraschend hoher Genauigkeit vorhersagt.3 Nicht zuletzt das eigene Alter kann jeder von uns sofort in die Zukunft projizieren – niemand hat Probleme zu sagen, wie alt er oder sie im Jahr 2030 sein wird.
Doch diese Beispiele beschreiben lediglich isolierte Probleme und deren Lösungen. Sie sind nicht viel mehr als Verlängerungen und Projektionen von zukunftsträchtigen, aber leicht fortzuschreibenden Datentrends. Im Gegensatz dazu ergibt sich das künftige Schicksal unserer Gesellschaft in all der damit verbundenen Komplexität aus viel mehr Faktoren als nur ein paar singulären Extrapolationen. Die Gesellschaft der Zukunft und wie sie sich und ihre Welt einmal empfindet, wird zwangsläufig das Ergebnis einer Vielzahl von Trends sein, die sich nur schwer miteinander in den Einklang eines künftigen Gesamtbilds bringen lassen. Schließlich wird so vieles dabei eine Rolle spielen, das sich nicht leicht nachmessen lässt: der Fortschritt in Technik und Wissenschaft, die Entwicklung unseres politischen Denkens und unserer ideellen Weltanschauungen – gar nicht zu reden von den berühmten Wild Cards, jenen seltenen, aber überraschenden Ereignissen mit großen Auswirkungen.
Zukunftsforschung, die redlich bleiben möchte, kann sich damit nicht allein auf konventionelle wissenschaftliche Methoden stützen. Stattdessen muss sie umfassende Narrative erschaffen, die erhebliche Freiheitsgrade zulassen, um die Welt in 20, 30 oder sogar 50 Jahren zu beschreiben. Eine Aufgabe, die aus Datensätzen besteht, die selbst für heutige und künftige Supercomputer zu gewaltig, unstrukturiert oder nicht beschaffbar sein dürften, um sie zu systematisieren und zu einer tauglichen Zukunftsszenario zu verarbeiten.
Drei Hauptwege zur Zukunft, nur einer bricht mit der Gegenwart
Ich verstehe jede Zukunft, die wir uns vorstellen können, als eine Projektion, die ihren Ausgangspunkt notwendigerweise in unserer gemeinsamen Gegenwart hat. Das Hier und Jetzt, also das, was wir heute wahrnehmen, fühlen, beobachten, lieben oder hassen, stellt bereits eine erste Vorwegnahme aller unserer Zukunftsvorstellungen dar – der kurz-, aber auch der langfristigen. Es ist der blinde Fleck, den wir alle teilen, denn wir können nichts extrapolieren, ohne den Hintergrund des heutigen Lebens als Ausgangspunkt zu nehmen. Was jetzt ist, ist immer Quelle und Voraussetzung für jede Vorhersage darüber, was kommt. Ohne diese Grundlage verlieren wir uns in willkürlichen Spekulationen, die uns nichts nützen – und wir verstärken den Zukunftslärm nur weiter, ohne dass er irgendjemandem weiterbringt.
Schauen wir uns kurz an, welche prinzipiellen Mechanismen zum Tragen kommen, wenn man in Richtung Zukunft aufbricht. Dabei gibt es drei verschiedene Wege, denen man folgen kann. Ich stütze mich dabei auf den Ansatz, den die deutsche Kulturwissenschaftlerin Eva Horn entwickelt hat.4
Ein erster Weg in die Zukunft ergibt sich demnach aus der einfachen Annahme, dass alles so bleiben wird, wie es ist. In der Tat sehen viele Menschen ihren Status quo als das Beste an, was die Zukunft für sie bereithalten könnte. Wer dieser Ansicht ist, gehört wahrscheinlich zu den Menschen, die nur schwer mit Veränderungen umgehen können und deshalb hoffen, dass alles noch jahrzehntelang so bleibt wie es ist. Ihr Wunsch ist es wohl, dass sie für den Rest ihres Lebens einfach genauso viel zu essen, zu trinken und das gleiche Dach über dem Kopf haben wie heute. Der feste Glaube an den Status quo wird vermutlich von einer solch ausgeprägten Zuversicht getragen, dass sich solche Menschen eine Abweichung oder ein Ausbrechen von diesem Standpunkt kaum vorstellen können – auch wenn es angesichts der gewaltigen gesellschaftlichen Transformationsaufgaben, die vor uns liegen, dadurch ein böses Erwachen geben könnte. Doch der Wunsch nach Routine, Beständigkeit und Vorhersehbarkeit ist nun einmal ein bestimmender Teil der menschlichen Natur. Und die geheime Sehnsucht nach der damit einhergehenden Untätigkeit und Trägheit mobilisiert immer noch viele Wähler, weshalb Politiker vor dem Wahltag gerne Beständigkeit versprechen.
Der zweite Weg in die Zukunft beginnt ebenfalls im Hier und Jetzt. Auf ihm beschleicht uns jedoch das Gefühl, dass sich viele Dinge im Laufe der Zeit merklich weiterentwickeln werden – dass beispielsweise die Art und Weise, wie wir in Städten wohnen oder uns in ihnen fortbewegen, sich zwangsläufig verändern wird, weil sie der natürlichen Weiterentwicklung der menschlichen Erkenntnis, der Technologien und der Wissenschaft folgen. Dieses Weltbild geht also davon aus, dass zentrale Säulen der heutigen Welt irgendwann eingerissen und neue an ihrer Stelle errichtet werden müssen, die vielleicht ganz anders aussehen. Es mag überraschen, aber in der Tat orientiert sich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen bei der Suche nach ihrer Zukunft an solch evolutionären Erwartungen. Auch deshalb sehen die meisten Politiker dahingehende Versprechen als eher riskant für ihre Wiederwahl an.
Der dritte Weg in die Zukunft ist dagegen geprägt von Unterbrechungen und Überraschungen. Dinge gehen schief, unerwartete Faktoren schleichen sich ein, deren unvorhergesehene Auswirkungen wie Meteoriteneinschläge aus dem Nichts die Welt erschüttern. Dieser Weg in die Zukunft ist turbulent und unberechenbar. Er ist gespickt mit Variablen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht kennen, oder sogar von solchen, von denen wir noch nicht einmal wissen, dass wir sie nicht kennen. Dieser Weg stellt ein disruptives Szenario vor, das gleichermaßen zur Dystopie wie zur Utopie tendiert, zu extremen Ergebnissen eben, welche die Zukunft völlig von der Gegenwart abkoppeln können.
Auf diesem dritten Weg in die Zukunft wird davon ausgegangen, dass sich die Dinge, die wir gewohnt sind, dramatisch verändern und dass wir uns entsprechend darauf einstellen. So könnten sich etwa Menschen in Körper oder Geist durch einen unerwarteten Impuls völlig verändern. Aber auch unsere Umgebung, das Klima etwa, könnte plötzlich und schneller als erwartet von allem abweichen, was wir aus den letzten 10.000 Jahren kennen. Wichtig ist, dass die gewohnte Gegenwart nach solchen Ereignissen aufgegeben wird und wir uns vollständig auf die Zukunft einlassen. So haben wir beispielsweise nach der Jahrhundertfinanzkrise von 2008 die Regulierung der Bankenbranche neugestaltet, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Entschluss gefasst, die Atomkraft in Deutschland auszurangieren oder nach dem Auftreten des Covid-19-Virus zu unserem eigenen Schutz ganze Volkswirtschaften bewusst vorrübergehend stillgelegt.
Unsere weitere Analyse über die kommenden Kapitel wird auf dem dritten hier beschriebenen Weg aufbauen. Nicht weil ich damit rechne, dass wir ausschließlich aus Jahrhundertkatastrophen heraus die Gegenwart wirklich hinter uns lassen und die Zukunft gestalten können, sondern weil für die Erzeugung positiver Zukunftsnarrative die Erörterung einer möglicherweise unerwünschten Entwicklung oder gar einer Katastrophe eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Die beste Zukunft entsteht nun einmal im Abgleich ihrer schlechtesten denkbaren Entwicklung, ein Abgleich, der allein wirklich neu denken und die Zukunft anpacken lässt.
Erst die Pluralisierung der Zukunft gibt uns die nötige Orientierung, um auf sie zu reagieren
Vor etwa zwei Jahrzehnten haben wir begonnen, über die Zukunft im Plural zu sprechen. Ob Klimawandel, Covid-19 oder Mobilität, das Nebeneinander verschiedener möglicher Zukünfte prägt die öffentliche Diskussion. Statt von einer einzigen Zukunft für uns alle zu sprechen, reden wir nun zunehmend von vielen verschiedenen Zukünften. Der Historiker und Zukunftstheoretiker Lucian Hölscher hat diesen interessanten Wandel in einem Zeitungsinterview 2015 so angesprochen: »Man spricht immer öfter von vielen Zukünften statt von der einen Zukunft. Vor zwanzig Jahren hätte man das noch als sprachliche Unmöglichkeit abgetan, heute ist es vielleicht noch etwas ungewöhnlich, aber es setzt sich durch.«5
Ob der Auslöser für diese Entwicklung in der Magie der Jahrtausendwende lag oder einfach nur darin, dass die planetaren Probleme und Herausforderungen der Menschheit uns damals erstmals in ihrer ganzen Tragweite vor Augen traten, sei dahingestellt. Jedenfalls wurden Klimawandel, Mobilität, Urbanität und Digitalisierung plötzlich als Nebeneinander verschiedener Megatrends und möglicher Zukünfte gesehen. Und die neue Pluralität dessen, was wir auf uns zukommen sehen, prägt mittlerweile als Standard die gesamte öffentliche Diskussion. Vermutlich hat erst diese Entwicklung dazu geführt, dass sich, was früher eine geordnete Debatte überschaubarer Zukunftsalternativen war, zu einem so diffusen Zukunftslärm gesteigert hat, dass wir dessen entscheidende Melodiebögen nicht mehr hören können. Genau das möchte dieses Buch jedoch wieder ermöglichen.
Das Nachdenken über prinzipiell viele mögliche Zukünfte verändert nicht nur unsere Vorstellung von dem, was kommen könnte, sondern auch unser Verhältnis dazu. Ein guter Grund also, die Geschichten und Theorien, auf denen das Denken in Zukünften beruht, genauer zu betrachten.
Es fällt etwa auf, dass die Pluralität der Zukünfte vor allem in Diskussionen über große gesellschaftliche Transformationen zur Sprache kommt. Dies gilt insbesondere dort, wo solche Transformationen nur unzureichend auf der Basis vergangener Erfahrungen oder etablierter Konzepte abgeschätzt und bewältigt werden können.
Im Falle des Klimawandels beispielsweise erkennen wir, dass unsere Bewältigungsstrategien nicht ausreichen werden, um uns in diesem massiven Wandlungsgeschehen ausreichend orientieren zu können. Die allmählich spürbaren Veränderungen in der Umwelt, aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse bleiben für uns ungreifbar, wenn wir sie nicht in Form von festgelegten Zukünften denken. Dass wir unterschiedliche Szenarien für eine 2-Grad-, 3-Grad- oder gar 4-Grad-Erwärmung der Atmosphäre entwickeln, zeigt nur, wie abstrakt und komplex die Zusammenhänge zwischen unserer heutigen Art zu leben und zu wirtschaften und den möglichen Folgen sind. Aber sie sind immerhin greifbare Anhaltspunkte für mögliche Zukünfte unseres Erdklimas, der wir angemessene Taten folgen lassen können.
Solange sich unsere Vorstellung auf eine oder nur ein paar von uns minutiös ausgearbeitete Zukunftsvarianten beschränkte, fiel es uns dagegen schwer, unser eigenes Handeln in größeren kausalen und zeitlichen Zusammenhängen zu beurteilen. Aus dieser Begrenzung unserer Vorstellungskraft bezieht das Denken in einem offenen und breiten Spektrum möglicher Zukünfte seine Notwendigkeit. Man könnte also sagen, dass die Rede und das Vorstellen von Zukünften solch große Transformationen wie den Klimawandel zum ersten Mal fassbar, nachvollziehbar, erzählbar und damit letztlich auch gestaltbar machen.
Auf den Trichter kommen, wie mögliche Zukünfte sich zueinander verhalten
Kann uns das Denken in verschiedenen Zukünften helfen, den anstehenden Wandel besser zu verstehen, zu bewältigen und sinnvoll zu gestalten? In der Regel werden beim Denken in Zukünften verschiedene mögliche Zukunftsszenarien zu einem übergreifenden Narrativ von Möglichkeiten kombiniert. Diese übergreifende Erzählung der Zukunft lässt sich am besten mit dem sogenannten »Zukunftskegel« veranschaulichen, einem Konzept, das 1993 von den Sozialwissenschaftlern Clement Bezold und Trevor Hancock zur Konzeptualisierung der Zukunftsdimension entwickelt wurde.6 Es zeigt eine Reihe von Kegeln, die von einem einzigen Kreis ausgehen: der Gegenwart. Entlang einer Zeitachse öffnen sich diese Kegel, um einen immer größer werdenden Raum der Möglichkeiten darzustellen. Jeder der Kegel steht für eine alternative Zukunft und markiert einen bestimmten Bereich in diesem wachsenden Möglichkeitsraum.
Abbildung I: In dem von Bezold und Hancock vorgeschlagenen klassischen Modell läuft dieser Prozess in vier Kategorien ab: mögliche Zukünfte, die als größter Kegel (possible) dargestellt werden, plausible Zukünfte als kleinerer Kegel innerhalb der möglichen Zukünfte (plausible) und schließlich wahrscheinliche (probable) und bevorzugte (preferable) Zukünfte als kleinste Einheiten in der Mitte beider Kegel. Daneben gibt es die bereits angesprochenen Wild Cards, also Zukünfte, die zwar kaum plausibel erscheinen, aber dennoch nicht als unmöglich ausgeschlossen werden können.
Die Illustration mit ihren verschiedenen Kategorien von Kegeln veranschaulicht nicht nur, wie verschiedene Zukünfte gemeinsam ein Narrativ von verschiedenen Möglichkeiten bilden, sondern sie zeigt auch die Konkurrenz, die dieses Modell zwischen den verschiedenen Zukünften vorsieht. Erstens können wir zwischen möglichen und wahrscheinlichen Szenarien unterscheiden. Auf diese Weise lassen sich Pläne für unterschiedlich realistische Situationen entwerfen und unsere Aufmerksamkeit sich entsprechend fokussieren. Zweitens können wir durch dieses Denken in Zukünften eine für uns wünschenswerte Zukunft ausformulieren und sie dann einer realistischeren und plausibleren Zukunft gegenüberstellen. Die Idee des Futures Cone-Modells ist auf genau eine solche Ausarbeitung verschiedener Zukünfte ausgelegt und demonstriert damit bereits selbst einige Aspekte des Denkens in Szenarien.
Ein gutes Beispiel dafür, wie das Durchdenken verschiedener Zukünfte dazu beiträgt, sich in der Gegenwart zu orientieren und reale Probleme zu lösen, findet man im Mantra der ersten Phase der Covid-19-Pandemie: Flatten The Curve (Abflachen der Kurve).7 Das bekannte dazugehörige Diagramm, das verschiedene Infektionsverläufe widerspiegelt, zeigt, wie die Rede von Zukünften als Narrativ für das Mögliche funktioniert: In einem ersten Szenario kommt es zu einer unkontrollierten Ausbreitung der Infektionen, zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und zu vielen Todesfällen. In einem zweiten Szenario wird die Infektionskurve durch die Einführung von Abstandsregeln und die Unterbrechung von Infektionsketten abgeflacht und gestreckt, sodass das Gesundheitssystem nicht bis an seine Grenzen belastet wird.
Damit geht implizit auch einher, dass man, wenn man auf die wünschenswerte Zukunft von Szenario zwei hinarbeiten will, sich die weniger wünschenswerte von Szenario eins vorstellen und ihr entgegenwirken muss. In diesem Fall, indem man die Infektionsgeschwindigkeit verlangsamt. Beide Zukunftsszenarien sind also möglich, aber nur wenn sie einander gegenübergestellt werden, entsteht ein Narrativ von Möglichkeiten. In ähnlicher Weise bündeln die verschiedenen Ziele in der Klimapolitik eine Reihe von an unterschiedlichen Erwärmungsgraden festgemachten Zukünften, die erst dann zu einem Narrativ der Möglichkeiten werden, wenn man sie einander gegenüberstellt.
Wer Zukünfte gut unterscheiden kann, weiß, was in der Gegenwart zu tun ist
Insofern Zukünfte also Narrative des zukünftig Möglichen sind, geht auch das Denken in diesen verschiedenen Zukünften über einfache, auf Szenarios beruhende Prognosen oder Pläne hinaus. Das Denken von Zukünften im Plural ermöglicht es uns, unseren gegenwärtigen Status quo als Ausgangspunkt für viele verschiedene mögliche Entwicklungen zu verstehen. Ein solches breit gelagertes Zukunftsdenken hilft uns auch dabei zu erkennen, wie in der Gegenwart zu handeln ist, denn es macht uns bewusst, dass unsere Einflussnahme in die Gegenwart die unterschiedlichsten Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Die allgemeine Frage »Was wird die Zukunft bringen?« spezifiziert sich damit zur Frage »Welche Zukünfte eröffnen sich aus meinem gegenwärtigen Handeln?«
Zudem lassen sich unter dem Begriff Zukünfte auch verschiedene, gleichzeitig existierende Möglichkeiten und Wünsche zu einem synoptischen Narrativ zusammenfassen. Während das Nachdenken über eine Zukunft auch nur einen neuen Status quo zulässt, kann das Nachdenken über viele Zukünfte die Dynamik und die Konflikte verschiedener Handlungsoptionen und -wünsche für uns nachvollziehbar machen. Wer sich am Ende zum Teilnehmer einer bestimmten Zukunft zählt und wer nicht, ist eine hochpolitische Frage. Auch sie wird durch das Nebeneinander verschiedener Zukünfte erstmals adressierbar. Zukünfte als zusammengesetzte, verschränkte und manchmal widersprüchliche Narrative über das, was vor uns liegt, können also auch komplexe und sich gegenseitig ausschließende Interessen erfassen.
Und schließlich ermöglicht die Rede von Zukünften auch neue Formen der Planung, da sie das individuell und kollektiv Vorstellbare erweitert. Je detaillierter eine Synopse verschiedener Zukünfte ist, desto mehr Kollisionen mit bisher noch ungedachten Pfaden in die Zukunft kann sie hervorrufen und damit sichtbar machen. Ein solches vollständigeres Bild der Möglichkeiten ist jedoch von entscheidender Bedeutung für die Planbarkeit, da es am Ende weniger wichtig ist, ob eine Zukunft tatsächlich eintritt, als vielmehr, welche Alternativen sie noch eröffnet und wie groß der Kegelschnitt der Möglichkeiten ist, in den sie eingebunden ist.
Zukunft kommt nicht einfach auf uns zu, wir müssen sie aktiv gestalten
Nimmt man diese Annahmen und Beobachtungen ernst, dann ist die kommende Zeit nichts, das einfach auf einen zukommt und auf das man sich vorbereiten kann, sondern etwas, das aktiv ins Leben gerufen und aktiviert werden muss. Denn im Gegensatz zu reinen Szenarien ist das Denken in Zukünften auf aktives Eingreifen ausgerichtet – die Zukunft wird bewusst ausgewählt, ermöglicht und gestaltet. Das Jonglieren mit mehreren Zukünften erzeugt also nicht unbedingt einzelne neue Pläne, die auf ein konkretes Ziel hinarbeiten. Vielmehr schafft es eine neue Planbarkeit, indem es aufzeigt, wo man in der Gegenwart ansetzen muss, wenn man sich entschieden hat, was man am weit entfernten Fuß des Kegels erreicht haben möchte.
Zukünfte stellen, zusammengefasst gesagt, also kontrastierende Möglichkeitsnarrative dar, die die Gegenwart als einen Zeitraum mit offenem Ende – eben ihre Zukunft – beschreiben. Zukünfte können vor allem große gesellschaftliche Veränderungen begreifbar machen und zeigen, wo und wie sie gestaltet werden können. Damit eröffnet das Denken in Zukünften auch neue Wege, um Vorsorge zu betreiben und Resilienz aufzubauen, neue Zugänge zur Welt durch Konfrontation mit dem bisher Undenkbaren zu finden sowie neue und gemeinschaftsstiftende Narrative zu formulieren, hinter denen Menschen sich versammeln können.
Um abschließend noch einmal auf die Spottdrosseln in den Bäumen von Austin und das SXSW-Festival zurückzukommen: Der Lärm, den die Vögel genauso wie die Konferenzpodien in der texanischen Hauptstadt verursachen, ist eine Notwendigkeit. Denn er enthält alles, was wir uns von der Zukunft erwarten. Richtig Nutzen daraus beziehen können wir jedoch erst, wenn wir die Differenzen zwischen vielen möglichen Zukünften erkennen können. Dann kann die Entscheidung für die richtige Zukunft fallen und deren Planung und Bau beginnen.
Takeaway Kapitel 1, Die Zukunft – ein Möglichkeitsraum
Die Zukunft…
…entsteht nicht von selbst – sie muss ausgewählt, gestaltet und aktiviert werden.
…und ihre vielen Prognosen und Möglichkeiten, die heute formuliert werden, erzeugen verwirrenden Zukunftslärm.
…erfordert, daraus für sich selbst Szenarien zu bilden, Orientierung zu schaffen.
…zu gestalten, ob als Unternehmer, Politiker oder Aktivist, heißt den Raum der zukünftigen Möglichkeiten abzuschätzen.
…ist vielleicht offener und beeinflussbarer als man denkt.
ZWEITES KAPITEL
IM ZUKUNFTSLÄRM – WARUM DIE ZUKUNFT SO OHRENBETÄUBEND KRACHT
Sich Zukünfte vorzustellen ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Was vorstellbar ist, wird deshalb auf einer gigantischen Leinwand möglicher Zukünfte projiziert. Zukunftslärm ist die dissonante Symphonie aller möglichen Vorstellungen, aus der sich die Zukunft entwickeln wird. Besser, man lernt den Lärm um die Zukünfte zu differenzieren und die Signale vom Lärm zu trennen.
Ob es um Autos, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Möbel, Industrieanlagen, Videospiele oder Lebensmittel geht – Fachmessen informieren uns über den jeweils aktuellen Stand von Produkten, Technologien und Strategien einzelner Branchen. Im Kern ist aus meiner Sicht die wichtigste Funktion solcher Veranstaltungen, uns dabei zu helfen, alte Sichtweisen über Bord zu werfen und dafür neue, in die Zukunft weisende kennenzulernen. Bei meinem Rundgang durch die bunten, blinkenden und lärmenden Welten der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas – es ist die weltweit bedeutendste Messe für Konsumelektronik und ein global wegweisendes Tech-Event – wurde mir das so klar wie kaum jemals zuvor. Besucher können dort beobachten und analysieren, wie Produktpräsentationen sich jeweils bei dem Versuch überbieten, die wahrscheinlichste Zukunft vorwegzunehmen. Messen wie die CES sind unter den Augen der Öffentlichkeit ausgefochtene Gladiatorenkämpfe plausibler technischer Anwendungen. Sie bündeln Erwartungen an bestimmte Zukünfte und regen die Fantasie an, diese sich vorzustellen. Es gibt naturgemäß dabei immer Sieger und Verlierer.
Die Zukunft der Mobilität – als menschliche Maschinen oder als Verkehrsökosystem
Auf der CES konnte ich 2020 einen solchen Ringkampf um die Zukunft beobachten. Es ging um eine zentrale Vorwegnahme unserer künftigen Lebenswelt, nämlich darum, wie sich die Mobilität unserer Gesellschaft verändern wird und wie wir uns in 30 Jahren von A nach B bewegen werden. In diesem Fall traten die global operierenden Autohersteller Daimler mit ihrer Marke Mercedes-Benz aus Deutschland und Hyundai Motor Company aus Südkorea gegeneinander an. Beide stellten ihre jeweils eigene Version der Zukunft vor und inszenierten sie mit großem Aufwand in den Messehallen des Las Vegas Convention Centers.
Die Deutschen hatten beim Blick in ihre Kristallkugel eine Vision entdeckt, derzufolge wir alle auch in Zukunft Besitzer individueller Fahrzeuge bleiben werden, mit denen wir uns in den Städten der Zukunft fortbewegen. Daimler stellte eine futuristische Modellvariante seiner seit 1972 immer wieder überarbeiteten S-Klasse in den Mittelpunkt. Der Limousine wurde ein Elektroantrieb und ein organisches, reptilhaftes Design verpasst, das die Zukunftsprojektion aus Stuttgart zu einem echten Hingucker machte. Unter der Überschrift »Luxus und Nachhaltigkeit – Hand in Hand« wurde den Besuchern das Konzeptfahrzeug als Vision AVTR vorgestellt – das Vorbild für das Vehikel war bereits im Science-Fiction-Film »Avatar« von US-Regisseur James Cameron zu besichtigen.8 Das Innere der bionisch geschwungenen AVTR-Fahrgastzelle war vollgestopft mit futuristischen Spielereien und Schaltflächen – vom Atemfrequenzmesser zur individuellen Fahrererkennung bis zu veganen »Leder«-Sitzen. Dazu sandte das mit Libellenflügeltüren ausgestattete Chassis des Modells geheimnisvoll blaue Lichtimpulse aus Fond und Ballonreifen aus. Das Konzept-Auto stellte aber auch eine Art Nachhaltigkeitsutopie dar, die Hochtechnologie mit Kreislaufwirtschaft verbindet. So besteht die Innenausstattung des AVTR weitgehend aus Lianenfasern und Kunststoffen, die aus PET-Flaschen recycelt werden.
Laut Daimler-Chef Ola Källenius setzte die sehr spezifische Zukunftsprojektion des AVTR auf die Annahme, dass die Beziehungen zwischen dem Menschen, den von ihm erschaffenen Maschinen und der Natur immer enger werden.9 Herauskommen solle dabei ein neues Fahrerlebnis. Ein Lenkrad hat der Vision AVTR keines mehr. Stattdessen steuert sich das Auto mit der Handfläche, die man sanft auf ein ergonomisch gewölbtes Joypad auf der Mittelkonsole legt. Für Mercedes steht der AVTR für den Paradigmenwechsel vom Human-Machine-Interface hin zum Human-Machine-Merge.10 Damit wird das tradierte, oft auch für die automobile Zukunft proklamierte Narrativ von der Beziehung zwischen Mensch und Maschine als getrennt operierenden Entitäten, nicht selten sogar als Opponenten, infrage gestellt.11
Neben seiner ausgefallenen Ausstattung ist das Konzeptauto AVTR aber auch aus einem anderem Blickwinkel interessant: Es zeigt, wie sowohl die Zukunftsprojektion von Mercedes-Benz als auch die Herangehensweise des Filmregisseurs Cameron davon angetrieben wurden, ihre Ideen innerhalb des Spektrums plausibler Fiktion zu positionieren – in dem für den Bau einer Zukunft entscheidenden Bereich also, der einerseits durch die Überschreitung der Grenze des Möglichen gekennzeichnet ist, der aber andererseits das Limit der Plausibilität eben nicht überschreitet. Der Film »Avatar«, der schon 2009 fertiggestellt und in den Kinos gezeigt wurde, bewegte sich zunächst innerhalb der gleichen Grenzen. Seine ursprüngliche Idee ist nämlich bedeutend älter. Mitte der 1990er-Jahre, als Cameron mit ihrer Ausarbeitung anfing, war sie jedoch mit den damaligen technischen Möglichkeiten noch nicht umsetzbar. Das Zukunftsauto Vision AVTR soll in ähnlicher Weise nicht beim heute Denk- und Machbaren stehen bleiben, sondern auf die Zukunft gerichtete Fantasien provozieren. Laut Mercedes geht es nicht darum, »zu zeigen, wie die Mobilität der Zukunft tatsächlich aussehen wird, sondern [...] dass Autos irgendwann einmal mehr sein können als bloße Maschinen […]«12
Ganz anders ging Hyundai an seine Version der Zukunft heran. Die Koreaner machten sich auf der CES nicht einmal mehr die Mühe, ihr Diorama zukünftiger Mobilität um eines ihrer etablierten Automodelle herum aufzubauen. Stattdessen hatten ihre Zukunftsforscher den früheren NASA-Wissenschaftler Jaiwon Shin angeheuert und präsentierten ein optimiertes Verkehrs-Ökosystem des Typs »Brave New World« für den Stadtverkehr in den Megacities des Jahres 2030. Dieser Zukunftsentwurf verzichtet vollkommen auf Individualverkehr. Hyundai fokussiert stattdessen auf eine Nahverkehrssystematik, die zeitlich und räumlich eng auf die Bedürfnisse der Stadtbewohner abgestimmt ist und keine individuell steuernden Verkehrsteilnehmer mehr kennt. Die Vision für die Mobilität der Zukunft wird von Hyundai in eine Kulisse moderner Urbanität eingebettet. Im Straßenbild stehen futuristisch designte Monorails, Stadttrolleys und Quadrocopter zur Verfügung, die in modularen Transporteinheiten Menschen und Güter über Transferhubs schnellstmöglich an ihr Ziel zu bringen. In diesem wie ein Metabolismus wirkenden Szenario kommen Staus natürlich nicht mehr vor.13
Die große Leinwand möglicher Zukünfte – auf der Suche nach Aufmerksamkeit
Von der CES 2020 nahm ich den Eindruck mit, wie unterschiedlich die Annahmen über die Mobilität der Zukunft, ja über Zukunft an sich sein können. Wie können so unterschiedliche Visionen von der Zukunft formuliert werden, wie es Daimler und Hyundai getan haben, wenn sie doch aus derselben Quelle an Ideen schöpfen, sich mit dem identischen Thema Mobilität beschäftigen und mit ebenso identischen Problemen der Gegenwart konfrontiert sind? Und ich fragte mich: Wie kann unsere Zukunft überhaupt gefunden werden, wenn so viele scharfe Dissonanzen auf so vielen Gebieten bestehen?
Zwei Schlussfolgerungen konnte ich noch im Taxi ziehen, das mich vom Las Vegas Convention Center ins Hotel brachte: Erstens muss die Zukunft als eine unendliche Leinwand oder Projektionsfläche betrachtet werden, die für uns alle einsehbar ist und auf der jeder, der eine Zukunft prognostiziert, ein Fleckchen findet, auf dem er oder sie Ideen, Szenarien und Erwartungen ausbreiten kann. Das bedeutet vermutlich, dass wir den singulären Gebrauch des Wortes Zukunft aufgeben und, wie schon beschrieben, stattdessen von Zukünften sprechen sollten.
Und zweitens: Wer auch immer einen Weg in eine mögliche Zukunft auf diese Leinwand kritzelt, malt oder projiziert, wird höchstwahrscheinlich von einer bestimmten Intention angetrieben. Es ist das Ziel, die anderen Vorschläge und Themen zu übertönen, um die Art und Weise, wie wir unseren Weg in die Zukunft sehen, ab einem bestimmten Punkt zu dominieren. In der Wirtschaftswelt nennt man so etwas funktionierenden Wettbewerb. Geht es um Zukünfte, könnte man von einem Rennen um die plausibelsten Fiktionen sprechen. In jedem Fall geht es hier um einen sportlich inspirierten Wettkampf, wie dem zwischen Daimler und Hyundai, und nicht um autoritäre Machtdemonstrationen. Wir als Mitglieder der Gesellschaft, Verbraucher und Wähler, müssen aus den Zukunftsvorschlägen am Ende auswählen und sie zur Umsetzung annehmen.
Es funktioniert wie ein Orchester – vor dem ersten Takt der Symphonie
Bei dem, was auf uns zukommt, haben wir es also zunächst mit einer ungezügelten Kakophonie an Zukunftsvorschlägen zu tun. Datenwissenschaftler würden sie modern als »weißes Rauschen« bezeichnen – als kaum noch interpretierbare Zufallssignale mit gleicher Intensität auf jeder Frequenz. Ähnlich könnte man in meiner Vorstellung die unendliche Vielzahl von Versuchen, sich die Zukunft eines gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder technologischen Schauplatzes oder Aspekts anzueignen, um ihm eine Form von Gewissheit oder gar Unvermeidlichkeit zu geben, als Zukunftsrauschen oder Zukunftslärm bezeichnen. Dieses Phänomen ist von Natur aus mehrstimmig. Und es klingt ein wenig wie die wenigen Minuten vor einem Symphoniekonzert, wenn jeder Musiker noch einmal das Instrument stimmt und Passagen der gemeinsamen Partitur für sich allein und gegen alle anderen spielt – bevor schließlich ein Taktstock das Chaos lichtet und ihm musikalische Bedeutung erzeugt. Doch einen Dirigenten gibt es für den Zukunftslärm nicht – und das ist im Sinne möglichst großer Vielfalt vorstellbarer Zukünfte auch gut so.
Wichtig bleibt es in diesem Zusammenhang festzustellen: Solange das ewige Ringen unterschiedlicher Vorschläge und Interessen nicht endet, wird auch der spekulative, intellektuell dissonante Zukunftslärm, in dem sich alle prognostischen Stimmlagen der jeweiligen Gegenwart bündeln, nicht leiser werden. Und interessanterweise kann deshalb die Großleinwand, auf der das gesamte Panorama unserer Zukunftsvorschläge für alle zu sehen ist, auch nicht leer bleiben. Denn das wäre im Grunde eine Katastrophe, würde es doch bedeuten, dass sich niemand mehr für irgendeine Zukunft interessiert und jeder es aufgegeben hätte, für sich selbst oder für die Gesellschaft als Ganzes nach vorne zu entwerfen, etwas aktiv anzustreben oder antizipierend zu gestalten. Damit ist jedoch kaum zu rechnen, denn eine solche Haltung liefe der menschlichen Natur gänzlich zuwider, die sich sehnlich wünscht, Gewissheit über das Morgen zu erhalten. Schließlich geben uns schon einfache Wetterprognosen kognitive Sicherheit und ein Gefühl des Wohlbefindens – auch wenn solch punktuelle Nahvorhersagen nicht vergleichbar sind mit komplexen Vorwegnahmen von Zukünften wie etwa der des Stadtverkehrs in 30 Jahren.
In der Orientierungslosigkeit – ein Geschenk an die Gesellschaft
Unsere Leinwand möglicher Zukünfte ist also schlicht zu groß und zu verlockend, um ungenutzt zu bleiben. Tag und Nacht wird sie mit neuen Vorschlägen und Ideen bekritzelt, beklebt oder besprüht, darüber, wie die Welt wohl weitergehen wird oder soll. Unser kollektiver Appetit, all diese um Aufmerksamkeit heischenden Projektionen fortlaufend zu präsentieren und zu konsumieren, scheint nicht zu stillen zu sein. Wenn wir einen Schritt zurücktreten, um das Ergebnis zu betrachten, erinnert mich diese Projektionsfläche ein wenig an das Gemälde »Die Alexanderschlacht« des Renaissancemalers Albrecht Altdorfer, das in der Münchner Alten Pinakothek hängt. Weit in die Tiefe gestaffelt, wimmelt es in diesem Panorama von Hunderten von Menschen, Tieren, Waffen, Standarten, Gebäuden, Aktionen, Ursachen und Wirkungen. Dennoch bleibt unklar, wo die Schlacht tobt, wohin sie zieht, geschweige denn, wie sie ausgehen wird. Schlachtengetümmel um die Zukunft.
Genau in dieser Orientierungslosigkeit liegt aber auch das Geschenk des Zukunftslärms für die Gesellschaft. Denn die Leinwand der Zukunft fungiert am Ende eben auch als eine Plattform für das Finden und Sortieren möglicher Zukünfte und für den sich daran anschließenden Wettbewerb, der zur Auslese und Weiterentwicklung der besten Zukunftsideen führt. Und damit übt diese Projektionsfläche eine zentrale Funktion für das Funktionieren und Überleben liberaler Demokratien und Marktwirtschaften aus – selbst wenn dieses wichtige Geschenk an die Gesellschaft auf dem ersten Blick nur scheinbar sinnloses Rauschen hervorbringt.
Die Suche, nach dem, was einmal sein wird – beginnt in der Vergangenheit
Wir müssen noch auf ein weiteres, zentrales Merkmal dessen, was wir auf unserer gewaltigen Leinwand sehen können, eingehen: Alle Zukunftsentwürfe, die dort erscheinen, sind aus heutiger Perspektive Vermutungen. Keine Zukunft kann Gestalt in unseren Köpfen annehmen – weder in denen der Designer von Daimler noch in denen der Zukunftsforscher von Hyundai –, wenn sie nicht im Hier und Jetzt wurzelt. Jede Zukunft, die wir projizieren, hat zwangsläufig ihren Ursprung in unserer Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit, also in dem was bisher geschah. Denn Zukünfte lassen sich nicht aus dem Nichts und jenseits unserer gewohnten, heute für uns aktuellen Bezugspunkte denken. Zu den wichtigsten dieser Orientierungsmarken zählen unsere momentanen emotionalen Erfahrungen, unser heutiges technologisches Wissen, unsere aktuellen ethischen Vorgaben und die Wahrnehmung der Veränderung dieser Bezugspunkte im Laufe der Zeit.