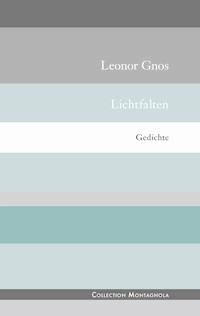Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Mädchen bleibt verwaist zurück, nachdem ein tödlicher Unfall die Eltern aus dem Leben gerissen hat. Doch die frühen Anfänge bleiben später für Judith im Dunkeln. Nur an eine Melodie vermag sie sich zu erinnern. Aber woher stammen diese Töne und Rhythmen? Es beginnt eine jahrelange Suche nach der Herkunft und der eigenen Identität, denn Judith spürt ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Leonor Gnos begleitet Judith in ihrem Roman durch die Stadien der Entwicklung bei ihren Adoptiveltern, im Kinderheim und im Internat, durch die Erfahrungen von Freundschaft und erster Liebe während der siebziger Jahre bis hin zu jener Schwelle, wo sich das Rätsel überraschend auflöst. Ein Zauber wohnt dieser Geschichte inne, die sich in aller Leichtigkeit den grundlegenden Fragen Judiths stellt. Zwischen Kindheit und Erwachsensein ersteht eine Welt mit ihren Hoffnungen und Wünschen, erfüllt von einer atmosphärische Note.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Aber von mir und meinesgleichen fordert das Schicksal, der Welt als Waisen gegenüberzutreten und viele Jahre lang dem Schatten der verschwundenen Eltern nachzujagen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als es zu versuchen und dem Ende unserer Mission entgegenzusehen, so gut wie wir es können, denn ehe wir sie nicht erfüllt haben, wird uns keine Ruhe vergönnt sein.«
Kazuo ISHIGURO, Als wir Waisen waren
Inhaltsverzeichnis
Teil Eins
Teil Zwei
Teil Drei
TEIL EINS
Schnee, Schnee fiel auf die Stadt, als Judith zurückkam. Schnee wirbelte der Straße entlang ins Geäst der Bäume und bildete launische, vom Wind getriebene Formen. Erst legte der Schnee eine Schicht auf die Dächer, eine auf die Straßen und zuletzt eine weiße Decke über die andere. In der Luft hallten die Schläge der Kirchenuhr. Es war Mittag. Das Schild auf der andern Straßenseite neben dem Portal der »Städtischen Kinderkrippe Seemöwe« hinterließ keine Erinnerung in ihr. Sie war kaum drei Jahre alt gewesen, als ihre Eltern sie für einen Tag den Betreuerinnen anvertrauten, bevor sie mit ihr vor dem Eingang der Krippe »Englein flieg« spielten, sie hin und her wiegten, in die Luft schaukelten; flieg und nochmals flieg, hoch und höher bis in den Himmel, soll sie ganz verzückt gerufen haben, unersättlich im Schwingen und Singen, im Flattern und Fliegen. Daran glaubte sie sich zu erinnern. Dass ihr Vater und ihre Mutter sie zuletzt auf den Boden stellten, bevor sie sich umarmten, daran erinnerte sie sich nicht. Schon gar nicht an ihr Versprechen, sie am Abend nach der Tagesreise in den französischen Jura abzuholen. Später vernahm sie, dass ihre Eltern tödlich verunfallt waren. Die Suche nach Familienangehörigen blieb erfolglos. Den Namen Ital fand man bis auf einige wenige Personen in der Schweiz und in Frankreich nirgends. Kein echter Beweis für Judiths Vorhandensein. Sie war davongekommen. Der Eintrag im Register der Kinderkrippe lautete undeutlich auf Jude Ital. Ohne viel zu überlegen, nannten sie die Kinderbetreuerinnen Judith. Innert ein paar Monaten bekam sie Adoptiveltern. Von da an hieß sie Judith Roos.
Sie war nicht zurückgekommen, um die Spuren ihrer Kindheit zu suchen. Ein wehmütiges Gefühl für das Haus, in dem sie ein paar Jahre mit ihren Adoptiveltern verbracht hatte, fehlte ihr. Der rieselnde Schnee brachte ihr das Lied einer Internatsfreundin ins Gedächtnis zurück: Ein flockiger Tag/auf seine Art/ fällt Schnee/ fällt und fällt/ lass dich nicht aufhalten/ stell dich ins Fahrwasser ... Sie ging schneller, sie wollte die Umgebung überfliegen, eher ganz auslassen. Aber die Örtlichkeiten zwangen sich ihrem Blick auf. Der Spielplatz, auf dem Kinder einander Schneebälle zuwarfen, sich stritten, Mütter auf dem Sprung waren, ihre Kleinen von den andern Kindern zu trennen, die Knaben mit Spielgewehren dazwischentraten. Die Väter waren abwesend. Das Haus ihrer Adoptiveltern hatte sie größer in Erinnerung, das Gärtchen davor kleiner, aber der Schneeteppich gab ihm Größe. Sie trat an die Klingelschilder heran. Berta Roos, 2. Stock. Fröstelnd band sie den Schal, den ihr Susan, eine andere Internatsfreundin, geschenkt hatte, enger um den Hals. Weiß passt zu Dir und zum Schnee, hatte sie erklärt. Von Weiß sagt man, dass es alle Farben in sich birgt und ihr Geheimnis bewahrt.
Judith trat zwei Schritte zurück, blickte hoch bis zu den Fenstern des zweiten Stockwerks. Eines war dasjenige ihres Kinderzimmers. Sie erinnerte sich, dass sie nachts oft von einer Gestalt geträumt hatte, die sie wiegte. Sie atmete mit diesem Schaukeln und der Stimme, die eine wiederkehrende Strophe sang: ju ma le um saa/ da um se ju maa. Sie hörte dem Lied zu, ihre Lippen bewegten sich klanglos mit den Silben ju ma le um saa, die Töne trafen nah auf ihr Ohr, da um se ju maa, zwischen Wiegen und Lauschen bis in ihren Hals, wo sich das Lied überschlug. Schwindlig versuchte sie, die Stimme zu halten, doch diese zog sich zurück, flaute ab und verstummte ganz. Mama, schrie sie, obwohl sie kein Recht hatte zu schreien. Sie erwachte schweißgebadet. Rings um sie stand die Finsternis.
Manchmal verscheuchte der Tag die Aufregung der Nacht. Sobald es dämmerte und die Wände blau wurden, schwand die Bestürzung. Aber der Tag war lang, wenn sie nicht Mama und Kind spielte. Mama war eine Schachfigur, die weiße Königin, und sie selbst eine mit Sägemehl gefüllte Stoffpuppe. Sie lag am Boden, krümmte sich. Komm, meine Kleine, was hast du denn?, fragte Mama mit singender Stimme. Sie breitete den Königsmantel aus und hob mit den Armen ihr Kind hoch. Das Licht, das durch das Fenster drang, schien auf ihre Hände. Das war der Moment, der die Zeit aufhob, der Moment, in dem Mama das Kind zu sich emporhob, es ihren Bauch spürte, die Brüste, die Schultern und neben ihrem Gesicht verweilte, direkt unter der Schachkrone. Mama kuschelte das Kind an ihrer Schulter zurecht. Wenn es dich nicht gäbe, flüsterte sie. Ganz nah an ihrem Ohr murmelte das Kind: Es gibt mich ja.
Judith schauderte. Gebannt schaute sie zum Fenster hoch. Nun war sie doch da, die Kindheit. Sie hörte ihre Adoptiveltern sagen, dass ihr Name vielleicht jüdisch sei. Sie wusste nicht, was damit gemeint war. Sie sah es nur in den Gesichtern, in den Augen, die auf ihre Füße starrten, als wäre sie ein Ratespiel, nicht ganz dies, nicht ganz das. Manchmal kamen sie auf sie zu und bestraften sie mit den gleichen Händen, mit denen sie die Kleider am Körper glatt strichen, das Brot brachen, einander zuwinkten. An den Anlass der Übergriffe erinnerte sich Judith nicht. Sie musste etwas nicht richtig gemacht, etwas Falsches gesagt oder nichts gesagt haben, etwas getan oder nicht getan haben. Die Zeit vor den Schuljahren war in ihrem Gedächtnis fast ausgelöscht. Dass sie im Gärtchen vor dem Haus Steine zu Schneckenlinien aufreihte, kam ihr in den Sinn, weil ihre Adoptivmutter gesagt hatte: Es ist Sonntag, geh unten spielen, und ihr Adoptivvater nachrief, am Sonntag haben auch die Vögel frei, sie fliegen leichter. Dass sie in die Luft guckte und den Schwalben nachschaute, die zwitschernd Kreise, Schleifen und Spiralen in den Himmel zeichneten. Dass sie sich heiter wieder ihrem Spiel mit den Steinen hingab.
Deutlich im Gedächtnis haften blieb ihr ein Schultag der zweiten oder dritten Klasse. Sie war nicht sicher, ob sie froh oder traurig sein sollte, dass die Adoptiveltern noch nicht von der Arbeit zurück waren, als sie nach Hause kam. Ganz benommen ging sie gleich in ihr Zimmer, um Mama und Kind zu spielen. Und jetzt, Mama, erzähle ich dir, wie es heute in der Klasse war. Da kommt unsere Judith, rief der Lehrer von weitem. Er machte ein freundliches Gesicht, und sein Blick wechselte nicht von einem Augenblick zum andern die Richtung. Die Kinder liefen mir entgegen. Alle wollten mit mir spielen. Ich spürte ihre Hände, klein wie meine. Wir drehten uns im Kreis, bis große Vögel mit bunten Federn niederschwebten, uns auf ihre Flügel nahmen und in die Luft trugen. Judith, riefen die Kinder, wir folgen dir mit den Vögeln bis zu den Wolken. Judith, klang es aus den Schnäbeln der Vögel, was für ein schöner Name, mit Judith fliegen wir um die Welt.
Dann erzählte sie Mama, dass sie über den Dächern der Stadt segelte, dass die Straßen und Plätze glänzten, die Waldhügel kahl wären und der See einem Teich glich. Dass beim Anblick der in den Krippen und Schulanstalten verbliebenen Kinder die Vögel ungewöhnlich schnell weiterflogen.
Du bist sicher hungrig von der langen Reise, sagte Mama, du musst ein großes Stück Apfelkuchen essen. Das Kind rutschte bis zum Saum des Königsmantels hinunter. Es begann zu dämmern, als Mama den Kuchen auftrug und gleich die Kerzen am Leuchter anzündete. So hell wie die Flammen war auch der Schein über der Stadt, sagte das Kind. Morgen holen uns die Vögel wieder. Ja, sagte Mama, ein Flug gibt den andern, die Vögel haben ein Gedächtnis im Lied, oder sagte sie, die Vögel haben ein Vermächtnis im Sieg? Das Kind wusste es nicht genau, denn mit einem Schlag ging die Türe auf. Der Luftzug löschte die Flammen, vertrieb auf der Stelle die Bilder.
Judith, rief ihre Adoptivmutter, wann hörst du auf, mit dieser schlampigen Stoffpuppe zu spielen, und was sagst du, hier bist du und nicht in der Luft, das wäre noch schöner. Hier dein Abendbrot, dann gehst du zu Bett, da werden dir die Träumereien vergehen. Sie nahm ihr die Stoffpuppe aus der Hand und warf sie zur Tür hinaus in den Abfalleimer.
Von außen drückte die Dämmerung gegen das Fenster. Judith aß schnell das Brot und legte sich ins Bett. Zwischen ihren zusammengepressten Fingern zuckte die weiße Königin. Sie hatte die Schachfigur retten können. Ihr kleiner Finger ersetzte das Kind. Aber das Spiel versiegte. In ihrem Hals steckte ein Kloß. Einen Schrei unterdrückend, steckte sie die Finger in den Mund. Die Königin war ihr aus der Hand in die Kuhle der Brust gefallen.
Judith zitterte. Der Gedanke an den vergangenen Schultag schüttelte sie. Sie sah den Weg, an dem beidseitig die Knaben standen, als machten sie ihr Platz, um sie vorbei zu lassen. Sie sah die lauernden Gesichter, die bis zum Schlitz verengten Augen, die angespannten Oberkörper, das unverschämt wippende Schuhwerk. Sie trugen den Schulranzen auf dem Rücken, ihre Hände waren frei. Sie ging im Taumel hindurch. Sie fühlte sich nackt, als wäre sie doppelt sichtbar. Die Knaben rückten vor, pufften sie, zogen sie an den Händen. Sie stürzte, umgeben von Hosenbeinen, die sich in nichts unterschieden. Die Jungen riefen: Heirassa, Juditha, uns zu schweren Füßen, welchen willst du küssen? Juditha, heirassa, alle unbeschnitten, welchen willst du kitten? Heirassa, Juditha, sag es schnell, sonst töten wir dich auf der Stell.
Sie verstand nicht, was sie meinten. Über ihre Lippen kroch etwas Warmes, sickerte aufs Straßenpflaster. Während sie der roten Spur folgte, kam irgendwoher ein Signal, ein Pfiff. Sie war allein, als sie aufstand. Sie wischte sich das Blut, den Schmutz und die Tränen vom Gesicht.
Da bist du also, sagte der Lehrer im Klassenzimmer. Geh und wasch dir die Hände!
Die Mädchen seufzten auf, die Knaben zischten: Sei bloß still, sonst drücken wir dir den Schädel ein.
Unter den von allen Seiten hervorschießenden Blicken kam sie sich lächerlich vor. Nicht, dass sie lieber ein Knabe gewesen wäre. Das wilde Geschrei, die Marschschritte, die Bewunderung für einen Sportsmann, einen Helden oder ein Monster schreckten sie ab. Aber sie war auch nicht stolz auf ihr Geschlecht. Sie empfand den Gedanken daran zu eingebildet. Erst später nahm er Gestalt an, während andere Einfälle unwirklich blieben.
Über dem Waschbecken spiegelte sich ihr Gesicht mit den Blut- und Dreckspuren. Sie musste sich übergeben. Mit der Hand hielt sie ihre langen Haare im Nacken fest. Als die Übelkeit abflaute, sah sie von Anfang bis Ende den zurückgelegten Weg, den sie in umgekehrter Richtung nochmals gehen musste. Sie schloss die Augen vor Panik. Sie wollte nicht tot sein, nicht hier und nicht dort auf der Strecke.
Im Korridor hörte sie aus dem Klassenzimmer die Stimme des Lehrers und das Räuspern der Kinder. Bei ihrem Eintritt wurde es still. Sie war wieder allen Blicken ausgesetzt und so angespannt, dass sie fast nichts wahrnahm. Die Bankreihen kamen ihr wie Wellen entgegen. Sie musste da hindurchgehen, soviel war ihr klar. Sie ließ sich vom Bild führen, das in der Nähe ihres Sitzplatzes hing. Es stellte ein Alpengebirge mit ewigem Schnee dar. Doch nun rutschte der Schnee von den Bergen herunter. Eine Lawine löste sich polternd von der Wand. Die Angst zog ihre Muskeln zusammen. Sie verfing sich mit den Füßen im Riemen der Schultasche und stürzte. Die Kinder kicherten.
Ja, man nimmt eine Treppe nicht mit dem Kopf zuerst, sagte der Lehrer.
Das ist es nicht, wollte sie entgegnen, drückte sich aber in die Schulbank. Der Schnee war ins Bild zurückgerieselt und blieb ewig auf den Bergen.
Auf dem Weg nach Hause waren die Mädchen bereits verschwunden. Sie blieb hinter den Knaben zurück, dem Schulhaus noch nah genug, um mit einem Satz kehrt zu machen. Der eine oder andere drehte sich nach ihr um. Sie sammelte ihre Gedanken. Auf dem Weg gab es Verzweigungen, Abbiegungen, von denen sie noch nicht wusste, ob sie sich als Hinterhalt oder als Zuflucht eigneten. Laufen - jetzt - schnell - nach rechts, nach links schauen - und dann geradeaus, sagte eine Stimme in ihr. Sie rannte so leichtfüßig, dass die Knaben, die ihr, in einer Hausecke versteckt, Juditha, heirassa zuriefen, das Nachsehen hatten. Sie hörte ihre Schritte hinter sich, als sie schon zu Hause angelangt war und den Asphalt roch und ihren eigenen Schweiß.
Im Dunkel ihres Zimmers nahm sie die Finger aus dem Mund. Sie schloss die Königin in die Hände. Sie war am Ende dieses langen Schultags angekommen, wo es so wenig sichere Wege gab.
Schneeflocken fielen in Judiths offene Augen. Sie glaubte, dass sich hinter dem Fenster des Kinderzimmers etwas bewegte. Sie trat ein paar Schritte zurück. Was sich nicht hinter, sondern vor dem Fenster regte, war der weiße Schleier des Schnees. Sie erschrak. Ein Mann kam aus dem Haus, fragte sie, ob sie jemanden suchte. Sie schüttelte den Kopf, machte kehrt und ging auf die Straße zurück.
Sie dachte an das rätselhafte Gefühl, das ihr die Adoptiveltern vermittelt hatten. Oder betraf es nicht sie? War es nur die Idee, die sie sich von ihr machten, ein Bild, das nichts mit ihr selbst zu tun hatte? Abgewandt waren ihre Augen, abwesend die Herzen der Adoptiveltern. Als ihr Adoptivvater zum letzten Mal in der Küche neben ihr gesessen hatte, blieb es still und stumm zwischen den Gegenständen auf dem Tisch, dem Zucker in der Papiertüte, der Kaffeekanne, dem an allen Seiten angeschnittenen Butterklumpen. Nur der Zeiger der Küchenuhr tickte, und da war noch ein anderes Geräusch ihr gegenüber: die mahlenden Zähne ihrer Adoptivmutter. Sie selbst wagte kaum zu kauen unter ihren Blicken. Ihr Adoptivvater stützte sich mit beiden Armen auf dem Tisch ab, als hielte er auf diese Weise den Blick seiner Frau besser aus. Draußen lachten Kinder, spielten »Fang mich«, Gummibälle rollten, Fahrräder klingelten. Der Lärm auf der Straße breitete sich in der Küche aus als bitterer Scherz. Judith kaute daran wie an hartem Brot, sie würgte am Spaß der anderen Kinder. Sie konnte sich nirgends festhalten, ihre Füße reichten knapp auf den Boden. Im Kopf zählte sie die Zehen, eins, zwei, drei, vier, fünf und von neuem, eins, zwei, drei, bis das Rascheln der Papiertüte den Vorgang unterbrach. Ihr Adoptivvater gab reichlich Zucker ins Glas, rührte den Kaffee um, schepperte immer schneller mit dem Löffel, wellte die Flüssigkeit an den Rand hoch, klatschte sie darüber hinaus. Dann flog der Löffel auf den Tisch. Erschrocken zog sie ihre Hände zurück. Ihr Adoptivvater hob das Glas und warf es gegen ihre Adoptivmutter. Judith bezeichnete jedes Objekt, das sie sah: Hand, Glas, Gesicht, Brühe, Scherben. Über das Gesicht ihrer Adoptivmutter rann Kaffee wie schwarzer Schweiß. Das Glas hinterließ eine Schnittspur. In einer Hosentasche verschwand die Hand. Ihr Adoptivvater stand auf und ging weg, um nicht mehr zurückzukehren. Judith blieb sitzen, die Hände in die Knie gekrallt, als wartete sie bei jedem Vorrücken des Uhrzeigers auf ein einschneidendes Ereignis. Ihre Adoptivmutter stand ebenfalls auf, räumte die Scherben weg, holte einen Putzlappen.
Geh in dein Zimmer, sagte sie. Du hast hier nichts verloren.