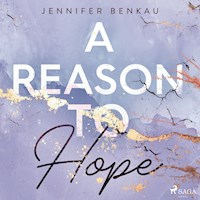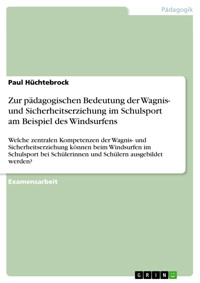
Zur pädagogischen Bedeutung der Wagnis- und Sicherheitserziehung im Schulsport am Beispiel des Windsurfens E-Book
Paul Hüchtebrock
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 2,0, Bergische Universität Wuppertal, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dieser Arbeit soll die Bedeutung von Windsurfen im Schulsport dargestellt werden. Die Sportart soll einen Beitrag zur Wagniserziehung und Sicherheitsförderung in Schule leisten. Ich gehe dem allgemeinen Interesse an Wagniserziehung nach und zeige den Zusammenhang zu der für den Schulsport geforderten Sicherheitserziehung auf. Sicherheits- und Wagniserziehung stellen die Grundlage für die Thematisierung des gewählten Beispiels Windsurfen dar. Mein verstärktes Interesse liegt darin, darzulegen, ob und wie Windsurfen ein Teil des Schulsports sein kann. Dabei sollen praxisrelevante Möglichkeiten herausgestellt werden, die Sportart vorrangig unter Sicherheits- und Wagnisaspekten zu betrachten. Überlegungen wie - Welche Sicherheitsaspekte sind hinsichtlich des Windsurfens relevant? - Welche Wagnisse gibt es im Windsurfen? - Welche Besonderheit kommt Wagnissen beim Surfen zu? - Wie reagieren die Sporttreibenden auf Unsicherheiten? - Welches Verhalten wird von Schülern erwartet? - Welche Erkenntnisse sind für den Schulsport bedeutend? münden somit in die zentrale Fragestellung: Welche zentralen Kompetenzen der Wagnis- und Sicherheitserziehung können beim Windsurfen im Schulsport bei Schülerinnen und Schülern ausgebildet werden? Die Arbeit gibt hierauf die Antwort durch die Benennung konkreter Zielkompetenzen, um damit einen Beitrag zur generellen Sicherheits- und Wagniserziehung leisten zu können. Im Weiteren werden sportartspezifische Kompetenzen benannt, die bei Schülern entwickelt werden sollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 3
1. Einleitung
1.1 Problemaufriss
Im Sport ist in den letzten Jahren eine zunehmende Erlebnisorientierung zu erkennen, bei der spektakuläre Erlebnisse und besondere Herausforderungen und Nervenkitzel gesucht werden. Hierfür werden Begriffe wie Abenteuersport, Risikosport, Thrillsport oder Wagnissport verwendet (vgl. NEUMANN 2002, S.237). Neumann (1999, S.3) sieht Wagnissport besonders in „Natursportarten“ verbreitet, aber ebenso in anderen sportlichen Tätigkeiten. Aus dem städtischen Freizeitbereich lassen sich Skateboarden, Inline-Skating oder BMX-Fahren als Beispiele für wagnisreiche Sportarten nennen. Dabei eröffnen diese Sportarten den Sporttreibenden eine große Bewegungsvielfalt. Sie rufen immer wieder neue, herausfordernde, anspruchsvollere und erstaunlichere Bewegungsanforderungen hervor, die in ihren extremen Formen ansonsten nur von Profisportlern beherrscht werden. Scholz (2005, S.8) merkt an, dass sportliche Wagnisse „nichtnur in den so genannten Extremsportarten“zu finden sind. Auch weniger extreme sportliche Tätigkeiten können wagnisreiche Situationen enthalten und die Sporttreibenden herausfordern.
Erlebnis- oder Abenteuerorientierung im Sport resultieren unter anderem aus Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen. Solche Entwicklungen zeichnen seit den 1990er Jahren eine verstärkte Suche nach Erlebnissen und besonders aufregenden Gefühlszuständen ab, bei denen immer wieder Neues, Spannendes oder etwas Besonderes auftreten soll. Die Suche nach Erlebnissen wird für viele wichtiger Bestandteil des Alltags. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der „Erlebnisgesellschaft“ verwendet (vgl. NEUMANN 1999, S.3). Das Phänomen der Erlebnissuche ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung (vgl. SCHOLZ 2005, S.24) und wird vor allem von kommerziellen Anbietern genutzt, um „Vergnügungswilligen“ (NEUMANN 1999, S.3) durch Achterbahnfahrten, Bungee-Springen Adrenalinschübe oder besonders spannende „Kicks“ zu bieten. Kritisch kann diese Erlebnissuche dann werden, wenn sie übersteigert zur Selbst- und Fremdgefährdung wird (vgl. SCHOLZ 2005, S.25) oder kriminelle Verhaltensweisen ausgeübt werden. Dann kann der Wunsch nach Geschwindigkeitserleben und Spannungsmomenten in illegalen Auto- und Motorradrennen oder S-Bahn-Surfen enden (vgl. SCHWIER 1998, S.18). Bereits bei Kindern kann eine Suche nach „Abenteuern“ beobachtet werden. Sie suchen im Freien Spiel nach herausfordernden Situationen, wollen diese meistern und lernen so ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen (vgl. HECKER 1989, S.329). Bei älteren Kindern und Jugendlichen findet diese Suche häufig in der Freizeit und im Sport statt. Für die Schule stellt
Page 4
sich deswegen die Frage, ob Wagnisse pädagogisch bedeutsam sein können und inwieweit Wagnissport in pädagogische Vorstellungen von Schule integriert werden kann. In den Richtlinien und Lehrplänen des Faches Sport in Nordrhein-Westfalen wird mit der pädagogischen Perspektive „Etwas wagen und verantworten“ der Versuch unternommen, die erzieherischen und bildungsrelevanten Potentiale, die wagnisreiche Situationen enthalten können, im Sportunterricht zu nutzen.
1.2 Intention der Arbeit
Mit dieser Arbeit soll die Bedeutung von Windsurfen im Schulsport dargestellt werden. Die Sportart soll einen Beitrag zur Wagniserziehung und Sicherheitsförderung in Schule leisten. Ich gehe dem allgemeinen Interesse an Wagniserziehung nach und zeige den Zusammenhang zu der für den Schulsport geforderten Sicherheitserziehung auf. Sicherheits- und Wagniserziehung stellen die Grundlage für die Thematisierung des gewählten Beispiels Windsurfen dar. Mein verstärktes Interesse liegt darin, darzulegen, ob und wie Windsurfen ein Teil des Schulsports sein kann. Dabei sollen praxisrelevante Möglichkeiten herausgestellt werden, die Sportart vorrangig unter Sicherheits- und Wagnisaspekten zu betrachten. Überlegungen wie
- Welche Sicherheitsaspekte sind hinsichtlich des Windsurfens relevant? - Welche Wagnisse gibt es im Windsurfen? - Welche Besonderheit kommt Wagnissen beim Surfen zu? - Wie reagieren die Sporttreibenden auf Unsicherheiten? - Welches Verhalten wird von Schülern erwartet? - Welche Erkenntnisse sind für den Schulsport bedeutend? münden somit in die zentrale Fragestellung:
Welche zentralen Kompetenzen der Wagnis- und Sicherheitserziehung können beim Windsurfen im Schulsport bei Schülerinnen und Schülern ausgebildet werden?Die Arbeit gibt hierauf die Antwort durch die Benennung konkreter Zielkompetenzen, um damit einen Beitrag zur generellen Sicherheits- und Wagniserziehung leisten zu können. Im Weiteren werden sportartspezifische Kompetenzen benannt, die bei Schülern entwickelt werden sollen.
Page 5
1.3 Aufbau der Arbeit
Der Aufbau der Arbeit zeigt das methodische Vorgehen. Zunächst wird auf die vier wesentlichen Begriffe der Fragestellung eingegangen: Windsurfen, Schulsport, Sicherheitserziehung, Wagnissport. Die Erarbeitung der Grundlagen soll im Hauptteil auf das Windsurfen übertragen werden, um daran konkrete Kompetenzen der Wagnis- und Sicherheitserziehung aufzuzeigen.
Sodann wird die Sportart Windsurfen begrifflich erläutert und in ihrer Entwicklung dargestellt. Es werden erste Bezüge zum Schulsport und zu Adressatengruppen aufgezeigt. Die pädagogischen Grundlagen beziehen sich auf den Schulsport und curricularen Rahmen, wobei dieses Kapitel verdeutlichen soll, wie Windsurfen im Schulsport einen Platz finden kann.
Im Weiteren wird die Forderung nach Sicherheitserziehung in Schule und Schulsport formuliert und es werden entsprechende Ziele benannt. Daraus werden zu erlernende Fähigkeiten sicherheitsbewussten Sporttreibens abgeleitet. In diesem Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit Sicherheitsvorgaben, die sich allgemein auf den Schulsport und speziell auf Wassersport beziehen.
Ein weiterer Teil der pädagogischen Grundlagen ist die Auseinandersetzung mit Wagnissport. Neben einer praktikablen Arbeitsdefinition wird nach Motiven von Sporttreibenden gefragt, Wagnisse im Sport einzugehen. Für die Thematisierung sportlicher Wagnisse im Schulsport können die Motive wichtig sein. Für den Schulsport geht es um die Frage, welche pädagogische Bedeutung Wagnisse im Sport haben können und wie eine adäquate Vermittlung aussehen soll. Wagnissport wird in dieser Arbeit aber auch kritisch betrachtet, insbesondere im Hinblick auf den Sportunterricht. Im Folgenden werden die Grundlagen zusammengeführt.
Im Hauptteil dieser Arbeit findet ein Transfer der pädagogischen Grundlagen statt, welcher an Hand des Beispiels Windsurfens Sicherheitsförderung und Wagniserziehung konkretisiert. Es werden Kompetenzen der Sicherheitsförderung genannt und erläutert, die im Windsurfen angestrebt werden sollen. Wagnisse im Windsurfen werden thematisiert, beispielhafte Wagnissituationen erläutert, denen sich Surfanfänger stellen können. Dabei bieten die pädagogischen Grundlagen Orientierung hinsichtlich konkreter Lernziele sportlicher Wagnisse. Danach wird der Versuch unternommen, geeignete Wege der Vermittlung von Sicherheits- und Wagniserziehung im Windsurfen zu finden. Praxisempfehlungen werden für die Schule abgeleitet.
Page 6
In der Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse zusammengetragen, um eine Antwort auf die Fragestellung der Arbeit zu geben und die Bedeutung der Wagniserziehung herauszustellen. Die Arbeit endet mit einem Ausblick.
2. Windsurfen
In dem KapitelWindsurfenwerden die im Text verwendeten Begriffe erklärt, die Entstehung des Windsurfens dargestellt und ein erster schulischen Bezug zu der Sportart skizziert.
2.1 Begriffe
Die AusdrückeWindsurfenoderSurfenwerden in dieser Arbeit synonym verwendet, obwohl unter letzterem häufig das hier nicht untersuchte Wellenreiten ohne Segel verstanden wird.Segelsurfenwird im deutschen Sprachgebrauch nur noch selten verwendet, obwohl die Formulierungen der Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalens diesen Begriff der Sportart verwenden.
Das Sportgerät besteht aus einem Surfbrett1und dem Rigg (Einheit aus Mast, Segel und Gabelbaum u.a.). Das Volumen des Surfbrettes richtet sich nach dem Können und Gewicht des Sportlers. Im Anfängerbereich sollte das Surfbrett möglichst viel Volumen (160 bis 220 Liter) und damit Auftrieb haben, da es dann wesentlich kippstabiler ist. Für Surfanfänger sind breite Bretter mit zusätzlichem Schwert (ähnlich dem Kiel eines Bootes) empfehlenswert, da diese für bessere Kippstabilität sorgen und dem Abtreiben auf dem Wasser entgegenwirken. Die Finne am Heck des Surfbrettes dient der Kurshaltung.
Die Segelgröße wird in Quadratmetern angegeben. Für Schulungszwecke sind Segelgrößen zwischen 3 und 4,5 m² geeignet2, in Abhängigkeit von Körpergröße und -gewicht der Schüler. In unseren Breiten werden beim Surfen generell Neoprenanzüge zum Schutz gegen Kälte getragen. Je dicker ein Neoprenanzug ist, desto mehr Wärme gibt er an den Körper ab. Die Dicke des Neoprens wird in Millimetern angegeben. Kurze Anzüge, so genannte „Shorties“ sind zwei bis drei Millimeter dick und sind nur bei wärmeren Wassertemperaturen (ab ca.
1Umgangssprachlich auch: Surfboard oder Board
2Fortgeschrittene wählen die Segelgröße nach den Windverhältnissen (große Segel bis 12 m² bei wenig Wind, kleine Segel
von 3 bis 5 m² bei Sturm).
Page 7
25°C) geeignet. Drei bis vier Millimeter dicke Neoprenanzüge sind für Kinder und Jugendliche geeignet (vgl. CHRISMAR, ERBE 2003, S.43). Alle Fachausdrücke sind im Anhang bebildert dargestellt.
2.2 Geschichtliche Entwicklung des Windsurfens
Das Wellenreiten existierte bereits lange vor dem Windsurfen und gab den Denkanstoß für die Erfindung eines neuen Sportgerätes. Newman Darby hatte 1964 die Idee, ein Surfbrett mit Windkraft fortzubewegen. Dies wird als Vorläufer des Windsurfens gesehen. 1967 testeten die Amerikaner Jim Drake und Hoyle Schweitzer ihr erstes Surfbrett, an dem ein bewegliches Segel über ein Gelenk (Mastfuß) montiert war. Sie gelten als Erfinder des Windsurfens, was früher auch Stehsegeln genannt wurde. Drake und Schweitzer meldeten 1969 das Patent für ihren Windsurfer an und kurz danach wurden weitere Windsurfer in den Vereinigten Staaten produziert.
In der Mitte der 1970er Jahre etablierte sich das Windsurfen in größerer Breite und differenzierte sich weiter aus (vgl. VERCH 2007, S.40). Auch in Europa wurde Windsurfen populärer und im Zuge der Entwicklung wurde die neue Sportart zum Massenphänomen der Freizeitindustrie. Es kam zur Austragung von Regatten und Wettkämpfen. „InDeutschland fanden die ersten Windsurf-Regatten im Jahre 1972 vor Sylt und1973 am Starnberger See statt...“(PFÖRRINGER1989, S.29). 1984 wurde die Sportart erstmals olympische Disziplin in Los Angeles.
Innerhalb der Sportart Windsurfen gibt es mittlerweile verschiedene (Wettkampf-) Disziplinen (z. B.Speed, Slalom, Wave, Freestyle)und zahlreiche Facetten, die jeweils spezifische Anforderungen an den Sportler und das Material stellen. So gibt es für jeden Einsatzbereich entsprechende Brett- und Segeltypen. An der Entwicklung des Sportgeräts wird ständig weitergearbeitet. In den 1970er Jahren wurde das Trapez entwickelt. Mit diesem Hüftgurt konnte man sich in das Rigg einhaken, um insbesondere bei starkem Wind die Haltekräfte reduzieren zu können. Außerdem wurden Fußschlaufen für höhere Standfestigkeit und Sprünge auf die Bretter montiert.
Zahlreiche Innovationen und technischer Fortschritt lassen die Bretter und Riggs leichter und schneller werden, wodurch es sich einfacher surfen lässt. Diese Entwicklung hält bis heute an. Das Material ist nicht mehr nur auf Leistung ausgelegt, der unkomplizierte Freizeitspaß rückt wieder in den Vordergrund.
Page 8
Windsurfen galt in den 1970er und 1980er Jahren als eine Trendsportart und sorgte für ein verändertes, neues Lebensgefühl. Über das Sporttreiben hinaus lebten viele Surfer einen innovativen Lebensstil, der für Unabhängigkeit, Abenteuer und Freiheit stand. Es bildete sich eine Windsurfing-Szene mit eigener Mode und speziellen Fachzeitschriften. Der Sport entwickelte sich in den folgenden Jahren zur Massenbewegung und wird heute unter teilweise extremen Bedingungen zum Leistungssport. In vielen Bereichen ist eine Extremisierung der Sportart zu erkennen. Viele Windsurfer streben nach immer höheren Sprüngen (Waveriding), höheren Geschwindigkeiten (Slalom, Speed), längeren Strecken (Long-Distance-Race), wodurch Windsurfen extremer, risikoreicher und gleichzeitig interessanter für Medien und Zuschauer wird.
In diesem Jahrtausend erlebt der Windsurfsport durch neue, attraktive Disziplinen wie dem Indoor-Surfen, Freestyle, oder Neuauflage des Slaloms einen erneuten Begeisterungsschub (190.000 Besucher beim Windsurf-Worldcup vor Sylt 2007) (Quelle).