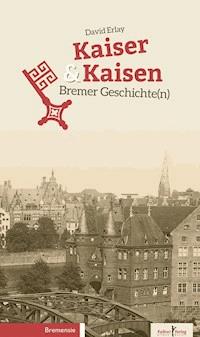6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder hat seine und nur seine Geschichte. Sie gleicht einer Pyramide. Wie diese wächst unser persönliches Haus, dessen Eigenart es ist, dass wir es nur im Groben entwerfen können und hinnehmen müssen, was der eigentliche Architekt vorgibt. Manche nennen ihn Fatum, Schicksal. Was uns indes gehört, ist die unmittelbare Gegenwart. Die kann schlimm sein; doch wie wir ihr begegnen, liegt weitgehend in unserer Hand. »Haltung« heißt hier das Zauberwort. Derarartige Momente zu beschreiben, war die Aufgabe, die David Erlay sich gestellt hat. Wobei er selbst erstaunt war, welche Anzahl von Zuständen »auf ihn zukam«. Für den Leser haben sie den Vorteil, dass er sich überall auf sie einlassen kann: im Bett, an der Haltestelle, im Bus usw. Erlay hat sich in der Regel kurzgefasst, um gleich den Kern herauszuschälen. Lassen Sie sich auf seine Lageberichte ein und phantasieren Sie, wie Sie sie weitererzählen könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Rosys Einsatz
Die Erschaffung der Welt
Initiation
Zum Hals heraus
Die schönste Jahreszeit
Nadine im Netz
Das niemals steinerne Brot
Güterabwägung
Der Pakt von Locarno
Jetzt oder nie
Tempeldienerin
Der Anruf
Lorre muss her
Liebe Not
Sichtweise
Flurbereinigung
Insel der Seligen
Paar excellence
Limbisches System und eigenes Segel
Hausmitteilung
Mutterschmerz, Mutterherz
Ostertisch
Gar nicht mehr dran
Echte Zypressen?
Tragödie
Drei in einem Boot
Eiszeit
Neben Vanessa
Taktlos
Kassel liess grüßen
Letztendlich
Ganz schön heftig
Zu Hause
Zuhause
Heidiland
Zwei Fremde im Zug
Fluch der bösen Tat
Mittagspause
So sieht man sich wieder
Nachtarbeit
Weißglut
Verbotene Liebe
Nach Rottendorf schon mal nicht
Lösungsvorschlag
Gegen elf
Ihr Weihnachten
Gunnar muss gehen
Grüne Augen
Der Name der Rose
Heiliger Ernst
Abschied für länger
Hausfriedensbruch
Therapie
Kleidsamer Abgang
Übergabe
Das Gefieder toter Vögel
Spiegelfechterei
Markusplatz
Nicht wie Hinz und Kunz
Katzenjammer, Sonderklasse
Krämerseele
Eingeladen
Noch mal duschen
Die Frau am Hafen
Alla Milanese
Zu ihr nach Baden-Baden
Plötzlich und unerwartet
Sonntag
Im Märchenland
Babykost
Seegang
Brüderchen und Schwesterchen
Zwischen zwei Frauen
Rheingold
Regina, du Königin
Mann in Sicht
Gewitter
Schlüsselerlebnis
Du
Der du bist im Himmel
ROSYS EINSATZ
Später denkt er oft an jene Minuten. Minuten, die er sich unzählige Male vorgestellt, aber nicht wirklich für möglich gehalten hatte. Er hatte es sich nicht in diesem Rahmen ausgemalt, nur, dass es geschehen könnte, sollte, sie ihn also aufsuchen würde, irgendwie, irgendwo. Eine Wunschvorstellung, eine ohne Aussicht auf tatsächliche Umsetzung, wenngleich er sich nie zu lösen vermochte von dem Gedanken einer Art weihnachtlichen Bescherung. Als es dann wahrhaftig geschah, geschah es ohne ihn, was der Sache aber keineswegs den Rang eines Weltereignisses nahm, dank Rosy nicht, die es sozusagen stellvertretend für ihn erlebte. Dass Tabea in die Redaktion kam, war überhaupt die bestmögliche Form der Verwirklichung, trafen sie sich doch auf dem Boden ihrer gemeinsamen beruflichen Existenz, und auch wenn sie sich nicht von Angesucht zu Angesicht trafen, das Ereignis als solches fand statt. Eine Frau Vaupel sei da gewesen, berichtete ihm Rosy wie nebenher, obwohl sie ihn genauestens beobachtete. Kein elektrischer Schlag hätte ihn heftiger treffen können, er taumelte sogar, musste sich setzen. Rosy fasste seine Schulter, als ob sie ihm auf diese Weise helfen, beistehen könnte, sah ihm intensiv in die Augen. Rosy und er haben ein enges Verhältnis, sie ist mehr als Sekretärin, keine Geliebte zwar, aber eine fürsorgliche Gefährtin für die Zeit im Job. Zusammenhanglos begann er zu erzählen, tat es von hinten nach vorn, ohne Angst, Rosy damit zu verletzen, schilderte also den Druck, unter dem er stand und dessen Auflösung er stets ersehnt hatte, freilich ohne sicher zu sein, ob es eine wirkliche Erleichterung sein würde. Aber dass es nun tatsächlich geschehen war, sie sich nicht mal nur so über den Weg gelaufen sind, sondern sie, Tabea, von sich aus ihn aufgesucht hatte, ihn hatte sehen und sprechen wollen: es war mehr, als er je für möglich gehalten hätte. Für irgendwie möglich allerdings doch schon, eher für logisch, für das einzig sich Anbietende, aber … Rosy strich ihm nur immer wieder über den Kopf, drückte ihn auch einmal an ihre einzigartige Brust, kommentierte jedoch nichts, sagte aber natürlich das Wenige, was zu sagen war, dass nämlich die Besucherin nur kurz einen Blick in sein Zimmer geworfen habe und wieder gegangen sei, obwohl sie, Rosy, sie zum Bleiben aufgefordert habe, dringend sogar, habe sie doch geahnt, dass hier das Leben einen großen Auftritt hatte; sie sagte es nicht ganz so, aber dem Sinne nach, und es wurde ihr ja nun bestätigt, und wenn es nicht zum ganz großen wurde, weil er ja nicht anwesend gewesen war, ausgerechnet jetzt nicht, so mindere das seinen Wert, seine Wucht doch kaum, eigentlich gar nicht, womit sie auf offene Ohren stieß. Dass Tabea es vielleicht oder sogar sicher mit eigener Zielrichtung gestalten wollte, ihr Erscheinen etwa als eine endgültige Befehlsausgabe sah, sie nun ein für alle Mal zu entlassen aus ihrer Beziehung, der gewesenen, derartige Erwägungen brachte Rosy natürlich nicht ins Spiel, konnte sie ja gar nicht, nein, ihr war einzig daran gelegen, ihm das Glück, die Einzigartigkeit dieses Auftauchens vor Augen zu stellen. Und sowieso: Was einmal Wirklichkeit, ist immer Wirklichkeit, kann es jedenfalls bleiben, wer weiß, ob seine Tabea nicht irgendwann sich erneut blicken lässt, mit einer Botschaft, einem Signal, das zu Herzen geht, dem so verwundeten. Er widersprach nicht, hoffte es ja selbst, aber Rosy sah ihm an, dass es nur eine theoretische Hoffnung war, andererseits: Hatte nicht ihre Anwesenheit eben bewiesen, dass der zwar gewünschte, indes nicht für möglich gehaltene Besuch tatsächlich Realität geworden war? Das alles mit der Wärme ihrer Zuneigung vorgetragen, bestimmt nicht die einer Heiligen, einer indes, die von der Liebe nicht weit entfernt. Auf deren Ziel hatte sie ja aber keinen Zugriff, denn selbst eine gescheiterte Liebe blieb, für sie ebenso wahr wie für ihn, eine bestehende. Liebe, das war für beide so etwas wie ein Sakrament, konnte nur äußerlich Schiffbruch erleiden. Selbst wenn ein neues Bündnis wäre, konnte der Mutterboden nicht fortgespült werden. Rosy hoffte denn auch, Tabea bei der Stange gehalten, ihr nicht den Mut zu neuen Annäherungversuchen genommen zu haben. Einmal war sie drauf und dran zu fragen, ob er seiner Frau Mitteilung machen werde, stoppte sich dann aber. Im Übrigen: Höchste Zeit: Der Chef hatte schon, während er in der Kantine war, angerufen, weil wartend auf den bestellten Text, dabei war Eile doch in keiner Weise geboten, für Tiedjen freilich immer. Also los, an den Computer, an dem allerdings Rosy hockte, er saß mit seinem Block daneben und bemühte sich, Diktierfähiges zustande zu bringen. Doch der Name Tabea blitzte immer wieder dazwischen. Aber nicht als Gewitter, höchstens als ein Wetterleuchten. Genau, als ein Leuchten, eines am Himmel.
DIE ERSCHAFFUNG DER WELT
Immerhin: Die erste Entscheidung ist getroffen, die wichtigste. Die Frage ist jetzt nur: zuerst sie oder sie? Ines oder die Frau, die mich schließlich auf die Welt gebracht hat, meine Mutter also? Leider nicht so, wie es hätte sein sollen. Nicht ihre Schuld natürlich, sie musste lediglich vollziehen, was Schicksal oder Zufall ihr auferlegt hatten. Somit aber gehört sie der Vergangenheit an, während Ines ein Mensch der Zukunft ist, meiner Zukunft. Was indes voraussetzt, dass sie sich dieser Zukunft anschließt, sie mit mir teilt. Was es mit ihr auf sich hat, wäre mit fünf Worten gesagt. Und nur, was gesagt wird, wird auch Wirklichkeit. Ich sage, also ist es. Doch dieses Aussprechen fällt mir ungeheuer schwer. Es ist, als müsste ich auf einem Seil den Mississippi überqueren. Dabei ist der Beschluss doch gefasst, muss lediglich in fünf Worte gekleidet werden. Aber eben das versetzt mich in heillose Angst. Ist es deswegen, weil, einmal ausgesprochen, der Schritt auch wirklich vollzogen werden muss, nicht mehr Gegenstand neuer Erwägungen werden darf (zumindest sollte es dazu nicht kommen)? Oder hängt es mit Ines zusammen, mit ihrer ungewissen Reaktion? Aber ist sie denn ungewiss? Wäre doch froh, wenn sie sich so verhielte, denn eben das hieße ja: Zukunft ist drin, gemeinsame. Doch ich fürchte, die Gemeinsamkeit steht auf wackligsten Füßen, eigentlich auf überhaupt keinen. Trotzdem muss es sein, hier und heute. Die Lage ist glasklar gegeben. Und wo keine Wahl, da auch keine Qual. Hannah. Ohnehin aber wird es höchste Zeit. Denn Ines will ein Kind, sofort. Am liebsten ein Mädchen, das immerhin. Jedenfalls sollen wir es unverzüglich angehen, in dieser Nacht schon, stehen die Sterne doch günstig, der Mond sowieso – er will sich aufs Schönste sehen lassen, gewissermaßen seinen Segen geben. Als Ines es mir gestern eröffnete, geschah es mit dem Zusatz: Du möchtest es doch auch, nicht wahr? Ich habe genickt, mit beklommenen Herzen. Mithin, die Stunde der Wahrheit ist fällig. Mach dich, sage, befehle ich mir, auf den Weg. Der Weg ist das Ziel? Diesmal nicht, diesmal ist nur das Ziel das Ziel, ihre Wohnung. Elisabeth-Langgässer-Straße 5 (komme von der Fünf nicht los). Sie wird, wenn es läutet, denken: Wer kann das denn sein? Dass ich es bin, wird sie ausschließen, denn ich habe ja die Schlüssel, einen für unten, einen für oben, könnte also rein. Ich will aber nicht rein, sondern hereingelassen werden, diesmal schon. Große Überraschung denn auch: Du, Johannes? Wo hast du die Schlüssel gelassen, doch nicht verloren, hoffe ich. Schneller Kuss, das wie immer. Nun bin ich drin, Rückzug ausgeschlossen. Ihr fragender Blick indes bleibt, bin zur Erklärung aufgefordert, weshalb ich geläutet und nicht einfach hergekommen bin wie üblich (ganz genau weiß ich es selber nicht, wahrscheinlich sollte sie mich empfangen als etwas Gutes, Willkommenes). Jetzt könnte ich doch noch etwas erfinden, aber nun endlich den Mut zu haben, das bin ich mir schuldig, verdammt noch mal. Nur Gesagtes schafft Wirklichkeit, wie gesagt. Und also sage ich sie, meine fünf Worte. Ines, ich lasse mich umoperieren. Ob sie sofort versteht, was ich meine?
INITIATION
Damit du nicht wieder die Hälfte vergisst, sagte sie und reichte ihm den Zettel mit dem Erwünschten, und zu Andrea gewandt: Männer! Diese ging darauf nicht ein, ging vielmehr ebenfalls nach draußen, hinter ihm her, der mit der großen Einkaufstasche dem Auto entgegenschlenderte. Darf ich, fragte sie ihn, noch etwas dazuschreiben? Was für eine Frage, sagte er lächelnd und gab ihr die Liste. Sie legte sie aufs Knie und setzte darunter, was er ihr mitbringen sollte. Ohne einen Blick darauf zu werfen, nahm er das Blatt wieder an sich. Ich danke dir, sagte sie, was ihn irgendwie seltsam berührte, angenehm berührte, und stieg ein. Beim Anfahren nickte er ihr zu, und sie nickte mit ihren brauen Augen zurück. Aber waren sie überhaupt braun? Doch, er war so gut wie sicher, es freute ihn, endlich wahrgenommen zu haben, in welcher Farbe ihre Augen schimmerten, denn natürlich schimmerten sie. Dass sie sich duzten, war das Ergebnis ihres Zusammenseins hier in Collioure. Sie war mitgekommen, weil seine Frau ihre Cellolehrerin gefragt hatte, ob sie nicht Lust habe, mitzufahren. Lust nicht, hatte diese geantwortet, aber sie würde sehr gern mitfahren, zumal sie diesen Teil von Frankreich noch nicht kenne. Frieda hatte es ihm als Tatsache mitgeteilt, hatte nicht etwa vorher um Einwilligung nachgesucht. Dass ihre Lehrerin reagiert hatte, wie sie reagiert hatte, teilte sie ihm aber hinterher mit, verschwieg ihre leichte Unsicherheit nicht: Wie sie das wohl gemeint habe, dass sie ohne Lust mitreise. Immerhin aber doch sehr gern, hatte er geantwortet. Nun, sie hatten das nicht weiter vertieft, aber ihm entging nicht, dass es Frieda weiter beschäftigte. Immer beschäftigten sie irgendwelche Dinge, meist in negativer Richtung. Auch für sie beide war es übrigens das erste Mal, dass sie hier unten Ferien machten, sozusagen am Rockzipfel, herrlich schon die Anfahrt, das Zueilen auf die Pyrenäen, in denen der Mount Canigou wie ein Berglöwe mit weißer Mähne thronte. Wie leicht war es ihnen doch gemacht worden, Honfleur zu vergessen, der ewige Gegenpol im Norden, ihnen beiden interessant geworden durch Namen wie Marguerite Duras und Françoise Sagan (Trouville war natürlich eingeschmolzen in ihre umtriebige Vereinnahmung der Gegend). Während er dem blendend weißen Kubus des Supermarchés entgegenfuhr, wurde ihm bewusst, wie anders auf einmal alles war, die Landschaft war nicht gemeint, sondern die Situation, dass sie nicht für sich, sondern zu Dritt waren, was es jedoch auch nicht traf, denn sie waren nicht einfach ein Trio, das gemeinsam Ferien am Mittelmeer genoss, sondern das Ungewohnte ging von Andrea aus, sie bildete das Pendel, das in die gewohnte Zweisamkeit hineinschwang und eine neue Lage schuf, eines, das sich eben geäußert hatte, als sie ihm ihren Wunsch mit auf den Weg gab, an Frieda vorbei. Sicher, es war schon klar gewesen, dass die Situation eine neue sein würde, eine neue, aber keine umstürzlerische. Vor allem Frieda, trotz allen Grübelns glücklich über die Anwesenheit der geliebten Lehrerin, hatte dann auf Familie gemacht, während ihm Andrea doch so etwas wie ein fremder, ein eingeflogener Vogel war. Nun auf einmal, indem sie ihm ihren Wunsch anvertraute, hatte sie gleichermaßen aus seiner Hand gepickt, und nun, als er an einer der hier seltenen Ampeln auf Grün wartete, erschien es ihm, als habe er längst darauf gewartet. Leicht klopfenden Herzens betrat er den Supermarkt, in dem er sich ja schon auskannte, arbeitete die Liste ab, gab etwa dem letzten Artikel nicht den Vortritt, warf nicht etwa einen Blick darauf, wollte dadurch die Sache steigern, den Augenblick, da eine wundersame, eine wunderbare Vertrautheit sich entfaltete. Dieser Augenblick war schließlich gekommen, er stand vor dem Regal mit dem Schild Hygiene, stand aber zunächst neben einer Frau, die ebenfalls zulangen wollte und der er selbstverständlich den ersten Griff überließ, wobei er meinte, eine Haltung bei ihr registrieren zu können so in der Richtung: Was haben Sie denn hier zu suchen? Die Kassiererin dagegen hatte für das kleine Paket keinerlei Erstaunen übrig, dafür, dass ein Er es aufs Band legte; er jedoch, als er zurückfuhr, hatte die Hand auf der rosafarbenen Schachtel, weiterhin klopfenden Herzens, jetzt nur etwas verstärkt. Wie würde es gleich ablaufen, würde Frieda dabei sein, wenn –? Auf andere Weise als vorher ließ er sich Zeit und steuerte den Citröen mit der Behutsamkeit eines Fahrschülers ihrem Haus entgegen. Dabei konnte er gar nicht schnell genug ankommen.
ZUM HALS HERAUS
Er hatte ihr zu Weihnachten eine silberne Kette geschenkt. Als sie sie anlegte, fand er, sie sah hinreißend damit aus. Das war Heiligabend gewesen. Am nächsten Morgen, als sie die Treppe hinunterkam, hinunterschritt, fehlte die Kette an ihrem Hals. Der Versuchung, dies erstaunt zu bemerken, widerstand er. Überhaupt veredelte die Kette ihren Modigliani-Hals nie mehr, und nie machte er dies zwischen ihnen zum Thema. Anderer Schmuck dagegen leuchtete ihm jeden Morgen entgegen. Wo keine Kette, ist man auch nicht in Ketten, dachte er einmal leicht amüsiert. Ketten indes trug sie ja andauernd, nur diese silberne nicht, die aus seiner Hand. Was konnte, was sollte er daraus schließen?
DIE SCHÖNSTE JAHRESZEIT
Jetzt müssen wir frieren, klagt der kleine Ludwig und liest vom Kalenderblatt ab: Win-ter-an-fang. Nein, herrlich! ruft Donata, die großer Schwester: Endlich wird die Welt wieder heller.
NADINE IM NETZ
Sie verließ das Zimmer, gar nicht mal besonders leise, drehte sich auch nicht um. Auf Wiedersehen hatte ihre Großmutter gesagt und dabei sogar gelächelt. Draußen stand Dagmar, und an ihr vorbei ging ihre Mutter, zu ihrer Mutter zurück. Nadine fand das komisch, dass auch ihre Mutter noch eine Mutter hatte. Dass es ihre Großmutter war, klar, das war klar, aber dass es auch gleichzeitig die Mutter ihrer Mutter war, war ihr immer irgendwie befremdlich gewesen, befremdlich, aber auch gerecht, denn auf diese Weise hatte auch ihre Mutter nicht das letzte Wort, musste auf ihre Mutter hören. Jetzt wird es wohl gleich vorbei sein, meinte Dagmar. Wobei womit? Na, mit dem Leben, sagte ihre Schwester, sie habe sich schließlich eben von ihr verabschiedet. Ja, gewiss, aber verabschieden tue man sich dauernd, und außerdem hatte sie »Auf Wiedersehen« gesagt, ihre Großmutter. Weshalb also schüttelte Dagmar den Kopf? Immer tat sie so klug und weise. Es gibt kein Wiedersehen, sagte Dagmar. Es ist aus und vorbei. Aber wenn sie es doch gesagt hat, setzte Nadine dagegen, warum sollte sie lügen? Manche Leute glauben, dass so etwas wie eine Fortsetzung existiert, man auch danach noch – noch irgendwie wandelt und sich mit anderen aus der Familie trifft, die ebenfalls wie Großmutter davongegangen sind. Sie ist doch noch da, beharrte Nadine. Oder findest du, dass inzwischen etwas passiert ist, jetzt, obwohl Mama wieder bei ihr sitzt? Weshalb, meinst du, hast du dich überhaupt verabschiedet, sagte Dagmar. Weil Mama es so wollte. Und weshalb habe sie es gewollt? Sie werde doch wohl den Grund genannt haben. Wie kompliziert auf einmal alles war. Du wirst in die gleiche Lage kommen wie Großmutter, sagte Dagmar, ich auch, Mama ebenfalls, jeder, alle. Wie ich eben schon sagte. Einmal ist es aus mit dem Leben. Dann ist man nicht mehr da, ausgelöscht. Wie eine Kerze. Das höre ich heute zum ersten Mal, stammelte Nadine und lehnte sich gegen die Wand hinter ihr. Du meinst, mich soll es nicht mehr geben, irgendwann? Soll, das hast du schon richtig erkannt, sagte Dagmar. Es ist dir auferlegt. Auferlegt, was meine sie damit? Dass man es nicht ändern könne. Und sie lüge nicht, falls sie ihr das mal wieder unterstellen wolle. Aber sie möge sich beruhigen, noch dürfe sie aus dem Vollen schöpfen. Aus welchem Vollen? Aus dem Vollen der Zeit. Die von Großmutter habe sich abgenutzt, sie sei alt, im Gegensatz zu ihr, der Stachelbeere der Familie. Das mit der Stachelbeere war irgendwann mal aufgekommen, jetzt war es eine Bezeichnung wie mit Uhu angeklebt. Dein Leben, dozierte Dagmar weiter, das geht gerade erst auf, auf wie eine Blüte. Nein, du hast es mir eben genommen, sagte die sogenannte Kleine, beinah tonlos, beinah starr. Ich habe dich bloß aufgeklärt, versuchte Dagmar richtigzustellen. Dafür hat man schließlich eine ältere Schwester. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! schrie Nadine. Ach, sie wolle lieber kleines Kind bleiben? Ich will am Leben bleiben, immer! Also tatsächlich kleines Kind, sagte Dagmar mitleidig-schnippisch. Los, hol’ mir ’ne Cola. Als Nadine sich an der Wand nicht rührte, drehte Dagmar sich um zu ihr, und schon im Umdrehen überfiel sie ein jähes Gefühl. Gleichzeitig fuhr sie zusammen, ihre Mutter trat plötzlich hinaus. Von diesem Augenblick erzählte sie dann später immer wieder.
DAS NIEMALS STEINERNE BROT
Die eiserne Ration Glück aufgebraucht heißt eine Zeile bei Ingeborg Bachmann, und sie steht im Band »Unveröffentlichte Gedichte«. Finde sie wahnsinnig gut, diese Zeile, weshalb hat sie sie bloß nicht übernommen in ihre lyrische Silberladung? Aufgefallen ist mir jedoch der Umgang mit dem Wort »eisern«. Da klein geschrieben, hätte die Dichterin es als verheißungsvolles Versprechen auffassen können: was eisern ist, muss Äonen nicht fürchten, die Ration Glück, sie besäße Ewigkeitsbestand, quasi jedenfalls. Hielt sie also – trotz der im Gedicht beschworenen Erstickungsgefahr – daran fest, dass Gefahr letztlich nicht drohe, totaler Glücksverlust nicht zu befürchten sei? Eiserne groß geschrieben hätte bedeutet: Das letzte Gut im Tornister des Lebens ist tatsächlich geschmolzen, unnötig, es mit einem Tropfen Branntwein zu betäuben. Die Kenner, die angeblichen, werden es so sehen. Ich nicht, ich setze auf die unsterbliche Hoffnung der Dichterin, auch wenn der Ablauf ihrer Verse die Erstickung konstatiert. Sie hat die Zuversicht in die schreckliche Bilanz eingeschmuggelt, sie sogar als Trompetenstoß an den Anfang postiert. Als Aufbegehren gegen das Zermalmtwerden. Welche Welt könnte da besser sein?!
GÜTERABWÄGUNG
Aber du heiratest ihn doch nicht deswegen, sagt und fragt er. Eigentlich schon, nickt sie. Weil du Angst hast und mir nicht mehr vertraust –? Es war zu einschneidend damals, sagt sie, so etwas vergisst man nicht. Es hätte aus sein können mit mir. Na, aus, sagt, murmelt er. Selbst jetzt noch versuchst du, es runterzuspielen. Dabei stand es auf der Kippe. Was ich nicht wissen konnte, kein Mensch hätte es wissen können. Ich ahnte es, sagt sie. Den ganzen Tag hatte sie über diese Schmerzen geklagt und dass es irgendetwas Schlimmes sein müsse. Die Schmerzen hatte er ihr abgenommen, halbwegs, nicht jedoch die Befürchtung, Fast-Gewissheit, dass sie eine außerordentliche Gefahr signalisierten. Geschehen aber musste schließlich etwas, er war ja kein Unmensch, und so war er mit ihr, die gekrümmt auf dem Rücksitz hockte, damit sie sich mit ihrem Schmerz strecken konnte, abends nach 10 in die Klinik gefahren, absolut überzeugt, man werde dort zwar den körperlichen Aufruhr bestätigen, ihm jedoch den lebensbedrohlichen Charakter nehmen. Gelika neigte zu dramatischen Aufritten, immer schon. Anfangs war das sogar einer der Züge gewesen, die er an ihr mochte, es gab ihr in seinen Augen etwas typisch Weibliches, jungmädelhaft Ungestümes, hatte Reste von Wildheit und Kindlichkeit, alles Eigenschaften, die ihn weitaus mehr erheiterten als nervten. Ein Geschöpf der puren Natürlichkeit, schien es ihm. Doch wie das in der Liebe so ist: Was ihm zunächst schwärmen ließ, wurde mit der Zeit für ihn zu einem Ärgernis, das unverdorben Kindliche zunehmend kindisch. In der Klinik erfolgte die Erlösung dann leider nicht sofort, er war erstaunt, dass mindestens die Hälfte der Stühle in der Notaufnahme belegt waren; so viele, dachte er verwirrt, die es spätabends hierher trieb? Endlich waren sie, war Gelika dann doch dran, und nun ging alles schnell, gewissermaßen blitzschnell. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sagte Gelika ihm am nächsten Tag, als er sie nach dem Eingriff besuchte, durchaus mit Schuldgefühlen, denn der Arzt hatte, fast schon vorwurfsvoll, wie ihm dünkte, also vorwurfsvoll gefragt, weshalb sie nicht längst erschienen seien, hatte ganz knapp, doch ganz eindringlich den Ernst der Lage geschildert, da war sie im Grunde schon von ihm getrennt, bereits in der Obhut der Klinik, er war nicht geblieben, fühlte sich überflüssig-hilflos, war so etwas wie in resultathafter Panik. Hinterher aber, als sie entlassen und wieder zu Hause, war die gemeinsame Erleichterung größer als das Bedürfnis, den schlimmen Tag wie einen Teig zu wenden, war man einfach nur froh, dass alles überstanden war. Besonders er badete in guter Stimmung. Doch dann (dann hieß vierzehn Jahre später) auf einmal, als wäre ein böses Tier erwacht, hatte ihre Gemeinsamkeit, beinah hörbar wie aufbrechendes Eis, Risse gezeigt. Rinnen mit schmutzigem Wasser bildeten sich, stets breiter und breiter werdend, und am Ende und heute nun wirklich hatte er sich eingestehen müssen, dass die Dinge jetzt anders lagen, aus Tag Nacht geworden war, Gelika im Begriff stand, aus ihrer Ehe auszusteigen, eine neue einzugehen. Er musste zur Kenntnis nehmen, dass seine Frau seit damals mit einem Trauma lebte, dem des beinah zu Späten, und in diese Gefahr wolle sie sich endgültig nicht mehr begeben. Als wenn er durch Schaden nicht klug geworden wäre! Mein Gott, Gelika, Liebes! Sein Verhalten seinerzeit, es hätte sich doch niemals wiederholt, würde sich niemals wiederholen, war doch kein Grund, sich zu trennen, von ihm, und einen Arzt zu heiraten. Er hängte an, stammelnd: zu heiraten, um gewappnet zu sein. Nein, aber einen Mann, der auch Arzt ist, entgegnete sie, nicht mal unfreundlich, Krankenhausarzt dazu, Leitender. Also keine Liebe mehr, hustete er, keine von ihr zu ihm, nicht mal wenigstes ein Fünkchen, aus dem sich vielleicht doch noch einmal – Güterabwägung, unterbrach sie kühl. Ganz einfach.
DER PAKT VON LOCARNO
Sie war noch nie in der Schweiz gewesen, also auch noch nie im Tessin, wohin sie jetzt mit dem Zug von Lübeck aus fuhr. Dass es die Schweiz und das Tessin waren, erfüllte sie nicht mit besonderer Erwartung, es hätte auch Belgien oder Dänemark sein können. Wichtig war allein, dass die Reise zu ihm, ihrem Geliebten, führte. Sie mochte es, einen Geliebten zu haben, nicht etwa einen engen Freund, weshalb sie denn auch bei anderen nur diese Bezeichnung in den stets sehr roten Mund nahm: Mein Geliebter sagt, mein Geliebter hat. Unter anderem hatte er sie kürzlich fotografiert – so, wie eine Geliebte nur von einem Geliebten ins Bild gesetzt werden kann. Zeigen wollte er die Fotos erst, wenn sie, nach seinem Ärzte-Kongress, gemeinsame Tage im Sonnenkanton verbringen würden. Verstanden hatte sie diese Verzögerung zwar nicht, aber wenn das seine Vorstellung war, sollte es ihr recht sein. Dann, nach inzwischen doch endloser Fahrt, war sie angelangt, beinahe jedenfalls, denn in Bellinzona musste sie noch in einen Regionaltreno nach Locarno umsteigen. Doch schließlich lag alles hinter und das gemeinsame Glück vor ihr, unter Palmen, wie sie zu ihrem Entzücken feststellen konnte, und auch die raschen Ausblicke auf den Lago, sie leuchteten vor Verheißung, was für eine Wahl, dieses Tessin. Und dann fuhr der Zug auch schon in den Bahnhof von Locarno ein und hielt mit fröhlichem Knirschen. Bereits auf den letzten Metern hatte sie Ausschau nach ihm gehalten, ohne ihn freilich zu erspähen, nichts wie hinaus also auf den Bahnsteig, endlich weg von der Smartphone- zur richtigen Geliebten-Liebe, in die Wärme auch, die sie bereits in Bellinzona jäh empfangen hatte. Doch so sehr ihre Blicke auch flogen – sie flogen ins Leere oder prallten an den anderen Ausgestiegenen oder den sie Erwartenden ab. Zu Letzteren zählte er dann aber doch nicht, weder wartete noch erwartete er sie, war einfach nicht da. Dafür die Wärme, die jetzt unter dem Bahnhofsdach wie aufgeladen war. Noch konnte er sich verspätet haben, schuldlos dazu, nichts war verloren, obwohl sie schon anfing, sicher zu sein, dass … Sie setzte sich auf ihren roten Koffer (sie hatte gedacht: Rot zu Rot, das passt), wartete nun ihrerseits, ohne indes noch zu erwarten, wurde wenigstens darin nicht enttäuscht, denn er kam in der Tat nicht mehr, würde nie mehr kommen, das stand für sie bald fest. Es war noch gar nicht arg spät, als sie aufstand und sich mit ihrem Koffer ins dämmrige Freie begab. Draußen herrschte noch Betrieb, nicht gerade lärmender, aber lebhafter. Stimmen und Lachen kugelten durch den Abend, sie erblickte Arkaden. Geschäfte blitzten aus ihnen hervor, nur ihn, den Geliebten, erblickte sie weiterhin und endgültig nicht, wie sie mit für sie noch fremdem Grimm konstatierte. Vor einer Bar entdeckte sie ein freies Tischchen, bestellte sich erst ein Wasser, dann, wie zwei Männer neben ihr, ein Glas Wein, roten, dazu noch mal ein Aqua minerale, danach, man soll bei einem bleiben, weiteren vino rosso, in größerer Menge nun, so wie bei dem Paar vor ihr, daneben einen Cappuccino und zum Schluss einen Grappa plus, was denn sonst, einen Espresso doppio. Es perlte ihr nur so von den Lippen, kein Wunder, geübt war geübt, obwohl: In dem Bistro, das sie spätnachmittags nach der Arbeit aufsuchte, musste sie es gar nicht mehr aussprechen, man stellte den Espresso, den doppelten, ganz selbstverständlich vor ihr ab. Dazwischen, welch köstliche Einlage, ein Teller mit Salami, den gleichen, den sich auch das Paar hatte kommen lassen. Dazwischen fernerhin ein Pakt, den ersten, den sie mit sich selber abschloss: Nie mehr einen Geliebten, nur noch einen, der liebte. Und ganz bestimmt niemanden, der sie lediglich auf Fotos besaß. Ihr fiel auf, dass sie immer eine Frau im Blick hatte. Lag viel