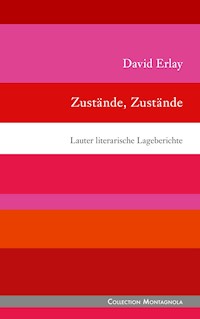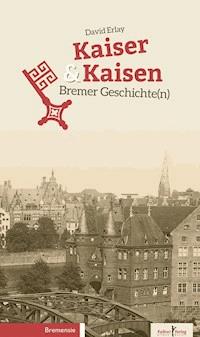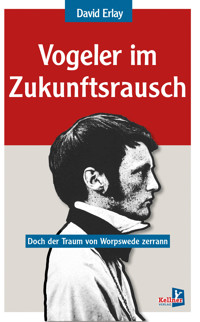
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kellner, Klaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch erscheint endlich ein Reprint des viel beachteten Originals aus dem Jahr 1972. Durch die dichte Zusammenstellung von Originalquellen wie Briefen, Flugblättern und Zeitungsartikeln bietet dieses Buch ein einmaliges Bild des berühmten Malers Heinrich Vogeler. Sein Schaffen, seine Person und die Lebenswirklichkeit in Worpswede werden so greifbar und anschaulich dargestellt. Die Zusammenstellung von historisch wertvollen Dokumenten erzeugt ein beeindruckendes Zeitdokument und wirft ein neues Licht auf den Maler Heinrich Vogeler. Ein Standardwerk für alle Worpswede-Liebhaber und Kunstfreunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reprint einer Erstbiografie
Vogeler im Zukunftsrausch
David Erlay
Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek
registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden:
http://dnb.d-nb.de
Bild Umschlagrückseite:
Das zauberhafte Muster, mit dem die Rückseite grundiert ist, entstammt einer Heizungsverkleidung, die Vogeler 1901 für die Münchener Wohnung des Verlegers und Lyrikers Alfred Walter Heymel geschaffen hat. Als dieser 1904 nach Bremen in die Riensberger Straße umzog, nahm er das kunstvolle Gitter mit, natürlich. Heute befindet es sich im Focke-Museum.
Foto: Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
Wie es begann
1972: das Jahr, in dem, was Heinrich Vogeler betraf, die runde Zahl 100 anstand. Denn 1872 war der Maler in Bremen geboren worden. Festliche Würdigung schien also angebracht – festliche, gesellschaftlich respektable, wohlgemerkt. Seine Radikalität wollte keiner feiern, nur eine Minderheit wusste auch von ihr. Allenfalls als Nebenbemerkung zulässig. Okay, er hatte sich in die Sowjetunion abgesetzt, ärgerlicherweise, dennoch wölbte sich über ihm im allgemeinen Bewusstsein der Anschein einer eher samtenen Figur. Dass er viele Jahre ein menschlich Zerrissener, in der politischen Haltung ein glühend Vorwärtsstürmender gewesen war, es blieb im Halbdunkel. Dabei schrie alles aus ihm heraus, die neue Liebe, besonders jene, welche von der persönlichen Enge erlöste und dafür die Menschheit umarmte. Der einzelne Teil der Gemeinschaft, der rot, sprich sozialistisch angestrichenen war, jedenfalls was man damals unter Sozialismus und Kommunismus verstand. Schwierig und schmerzlich blieb, wenn die Ehefrau sich einen Geliebten leistete, man selbst mit einem flammenden Geschöpf das Bett teilte, aber nur auf Zeit, weil dieses dann aufs Lager eines anderen wechselte. Hehre Ziele, sehr menschliches Verhalten, sowohl im Umkreis von Vogeler, als auch bei ihm selbst. Er war jemand, der eine Schaukelexistenz zwischen Verlangen und Versagen führte. Sein Anwesen, das schaffte er, öffnete er für eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, sah sich aber rasch zermürbt, angefeindet, musste Diffamierungen und Hausdurchsuchungen hinnehmen. Kollegen erwiesen sich als hämische Kandidaten – es nahm alles kein Ende mit den Stolpersteinen auf der Reise ins kosmische Paradies, teils persönlich, teils durch die Umstände bedingt. Ein Netz, das jeden Tag hundertmal riss. Schon diese wilde Ära meldete sich gelegentlich im Gespräch, nichts Genaues indes wusste man (mehr), das Ganze eine im Dunst dahindämmernde Epoche, besser, nicht daran rühren, viel besser. Vogeler, der Maler frühlingsheller Stimmungen, so mochte und liebte man ihn. Und doch gab es sie, die andere Seite, die des hellsichtigen Gegenwartsmenschen (»Die Leiden der Frau im Kriege«), die des revolutionär-sozialen Zeitgenossen (Barkenhoff-Fresken). Doch ließ man in nicht los vom kreativen Brot der frühen Jahre. Die blumenumkränzten »Träume«, das Selbstbildnis »Die Lerche«, Titelblatt der Mappe »An den Frühling«. Das war es, dem die gepflegte Erinnerung galt. Da alle Welt zu ihm und seinem schönen Besitz kam,veredelte er das Dorf zu einem Weltdorf, sich selbst zu einem Weltbürger. Dessen Werk: viel Gebrauchskunst, vielleicht das Beste in seinem Regenbogen, der voll ist von Geschaffenem. Auf zu vielen Hochzeiten getanzt? Was hat er eigentlich nicht gemacht? Immer sollte Geld hereinkommen. Gut, dass es sie gab, die Kapitalisten, wenn man sie auch bekämpfen musste. Allzu oft verkümmerte der gute Wille, reichte nicht zur Tat, aber besser sich an ihn zu halten als sich herauszuhalten, das hätte den Maler krank gemacht. David Erlay, Journalist in Bremen, stieß dann endlich vor zum ganzen Menschen Heinrich Vogeler. Zugegebenermaßen mit zunehmender Betonung der Wende, die jener vermeintliche Worpswede-Prinz nach und nach – nicht zuletzt in der benachbarten Hansestadt – vollzog. Bremen sang ja, neben München, einige Wochen das Lied der Räterepublik, und Vogeler, obwohl nicht an vorderster Stelle, sang das Lied der Revolutionäre mit. Das fiel in den Kontoren des betuchten Bürgertums (sein Kundenstamm) auf keinen frohen Boden, man sah den Publikumsliebling aus der nahen Künstlerkolonie in verderbliche Zonen gezerrt. Doch es half nichts, Vogeler verließ die schöne Welt des Scheins, eine Schneise in die Biografie des Malers war geschlagen, und ein Journalist, eben David Erlay, machte sich Jahrzehnte später daran, den Spuren dieser Schneise nachzugehen. Aber das liegt nun auch schon wieder eine lange Zeit zurück. Kein Grund indes, diese früheren und ersten Recherchen verstauben zu lassen, sie sich nicht als Reprint vor Augen und ins Gemüt zu führen. Ein tolles Panorama lodert da auf, auch wenn die Vorgänge inzwischen eine dichtere, wahrhaftigere Färbung angenommen haben. Geschichte entblättert sich ja fortwährend. Doch weshalb nicht nachlesen, was die biografische, die journalistische Fahndung seinerzeit (schon) ergeben hat? Der quasi keuchende Versuch, ein Dasein mit all seinem Hellen, aber auch Dunklem darzustellen, eines, das lyrisch und politisch geprägt war, sich verausgabte in expressionistischem Aufruhr, immer wieder sich verschattete in schwermütigen Wellen. Auch aufgeben konnte, musste er. Künstler und Lebenskünstlers ist er gewesen, dieser Heinrich Vogeler. Ja, vor allem Lebenskünstler, einer auf Probe, dem der große Wurf verwehrt blieb. Nach dem Auftakt einer biografischen Aufarbeitung sind nicht wenige in den Zug eingestiegen, haben sich ihrerseits auf das Pferd Vogeler geschwungen und versucht, auf der Rennbahn der Wissenszufuhr und Vermarktung immer weiter nach vorn zu galoppieren. Und ein Ende der Ermittlungen ist nicht abzusehen. Das ist der Lauf der Dinge. Unverrückbar aber der Anfang, das pionierhafte Unterfangen jenes Journalisten, einen Menschen und Künstler namens Heinrich Vogeler ins (einigermaßen) rechte Licht zu rücken, solches, das keine seiner Höhen und Tiefen, Ziele und Sehnsüchte auslässt. Und weshalb tat dieser junge Mann das? Nun, er hatte etliche Wochen im »Haus im Schluh« gewohnt, dessen archivarische Seele seit 1946 der Kunsthistoriker Hans-Herman Rief war. Dieser ertrank geradezu im von ihm gesammelten Material über und von Heinrich Vogeler, der einst seiner Ex-Frau zu dieser Pension in schönster Worpsweder Muldenlage verholfen hatte. Und der Gast? Er folgte Rief, verfiel der Faszination, welche die Person des ihm bis dahin nur vage bekannten Malers ausstrahlte, doch je mehr der Archivar ihm vorlegte, desto mehr wucherte das Verlangen nach einer umfassenden Darstellung. Den Autor kannte er schon: er selbst. Und so ging er ans Werk, grub an noch hundert anderen Stellen, bis dann so etwas wie ein Gesamtbild entstand, rissig immer noch, aber doch mit aufschlussreichen Umrissen. 1972 lag das Buch vor, lang, lang ist’s her, kann man inzwischen sagen, so dass ein Reprint der Erstveröffentlichung sich empfahl. Dankenswerterweise war der KellnerVerlag ebenfalls dieser Meinung, so dass die Collage (denn um eine solche handelt es sich: Eigenes mit Zeitgenössischem kombiniert) wieder zur Verfügung steht. Obwohl, während er recherchiert hatte, in einem wahren Fakten-Rausch, war der Journalist, wie er später in einem Interview bekannte, stets von einem Gefühl des Ungenügens begleitet gewesen: was sind schon die (vermeintlichen) Bausteine eines Lebens, Daten, Ereignisse – das Wahre bleibt trotzdem unsichtbar. Er belegte das gegenüber dem Reporter mit dem Spruch: 2 x 2 ist noch lange nicht 4. Um überhaupt wieder ins Gleichgewicht zu kommen, hatte er sich schließlich gesagt: sammle deine Früchte und behänge damit den Vogeler-Baum. Einen erhellenden Anblick wird der am Schluss allemal bieten. Zur Kenntnis hatte man das Buch nach Erscheinen ziemlich schnell genommen, etwa in der FAZ . Und eine so renommierte Stimme wie die Süddeutschen Zeitung bescheinigte: »David Erlay hat das Mosaik von Vogelers wirrem und doch konsequentem Leben in mühevoller Arbeit zusammengefügt. Dafür ist ihm zu danken, er hat damit ein Zeitdokument geschaffen.« Eine Rezension, die den Verfasser mit außerordentlicher Freude erfüllte. Sehr willkommen auch eine Besprechung der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeine, bezogen auf einen nach besagtem »Zeitdokument« entstandenen ergänzenden Text mit dem Titel »Künstler, Kinder, Kommunarden/Heinrich Vogeler und sein Barkenhoff«. »Geschickt verbindet der Autor eigenen Text mit zeitgenössischen Dokumenten, Briefen, Zeitungsartikeln und Tagebuchauszügen. Seine glänzenden, fließenden Übergänge und nicht zuletzt Erlays herrlich ironische Distanz machen diese Biografie für den Leser spannend wie einen Roman.« Bereits zuvor war in der Welt am Sonntag zu lesen gewesen: »Erlay ... hat die künstlerischen Schwierigkeiten und privaten Querelen ... aufgezeigt, hat Briefe und Tagebücher ... durchforstet und ist damit den Künstlern so nah auf den Pelz gerückt wie niemand zuvor.« Das Boot hatte jedenfalls Fahrt aufgenommen. Wir beschränken uns auf die Ausfahrt, die Erstveröffentlichung, der Mutter all der Arbeiten, die Erlay zum Thema Vogeler und Worpswede vorgelegt hat. Ihr Titel: »Worpswede-Bremen-Moskau. Der Weg des Heinrich Vogeler«, erschienen seinerzeit im Schünemann Universitätsverlag. Wichtig war Erlay dort, wie in allen Folgeveröffentlichungen, den ganzen Vogeler im Auge zu behalten. Wie aber sagt Hermann Hesse? »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.« Dem KellnerVerlag war es ein Bedürfnis, den Anfang in Sachen Vogeler in die Gegenwart zu holen, sprich: Erlays erstes Buch zum Maler aus Worpswede als Reprint wieder vorzulegen – als nachdrücklichen Nachdruck, wie es einer Mitarbeiterin nicht unzutreffend einfiel.
Das Buch von 1972
Vorbemerkung in der
Erstveröffentlichung von 1972
Dieses Buch ist eine Biografie, keine Wertung des künstlerischen Werks von Heinrich Vogeler. Seine Kunst spielt insoweit eine Rolle, als sie zur Entwicklung der Person gehört. Es wurde versucht, durch Vorlegen von teilweise noch unbekanntem oder längst wieder vergessenem Material – dazu gehören sowohl eigene Bekenntnisse Vogelers als auch Äußerungen unmittelbar Beteiligter, zeitgenössische Quellen wie Zeitungen und geheime Berichte der Überwachungsbehörden – den künstlerischen, politischen und privaten Weg des Malers darzustellen, um so zur Urteilsfindung über eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche und gerade in der Gegenwart wieder diskutierte Gestalt beizutragen. Um jedoch ein bloßes Aneinanderreihen von Dokumenten zu vermeiden, Authentizität mit Lesbarkeit zu koppeln und den Interessierten direkter in das Geschehen mit einzubeziehen, wurde als stilistisches Verfahren weitgehend die Montage von Zitat und verbindendem Text gewählt. Dem gleichen Zweck dient die gleichsam szenische Form der Auseinandersetzung Roselius-Vogeler: eine Zusammenstellung aus einem Briefwechsel, den beide 1918 geführt haben. Auch ist, um die kontrastreichen Stationen im Leben Vogelers zu beleuchten, hin und wieder mit dem filmischen Mittel des zeitlichen Schnitts gearbeitet worden. Die Herkunft des verwendeten Materials, zum Teil bereits aus dem Text ersichtlich, ist im Quellenverzeichnis am Schluß des Buches genannt.
All denen, die mir in so freundschaftlicher Weise zu diesem Material verholfen und dafür mitunter viel Zeit und Mühe aufgewandt haben, sage ich meinen herzlichen Dank. D. E.
»Das Leben hat keinen Sinn mehr«
Es ist stille, dunkle Nacht. Vogeler fühlt sich »losgelöst von allem, grenzenlos, aber ohne ein Gefühl der Vereinsamung«. Er weiß: Etwas muss geschehen.
Und er beginnt zu schreiben:
»Schon lange, als das Jahr 1917 dem Ende zuging, sah man in Deutschland überall die seltsamsten Erscheinungen am Himmel und unter den Menschen. Das Merkwürdige aber war, dass am Spätnachmittag des 24. Dezember auf dem Potsdamer Platz von vielen Menschen der liebe Gott gesehen worden ist. Ein alter trauriger Mann verteilte Flugblätter. Oben stand: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, und darunter in lapidarer Schrift die zehn Gebote. Der Mann wurde von Schutzleuten aufgegriffen, vorn Oberkommando der Marken wegen Landesverrat standrechtlich erschossen. Einige Aufnehmer des Flugblattes, die die Worte des alten Mannes verteidigten, kamen ins Irrenhaus.
Gott war tot.
Ein paar Tage darauf waren unsere großen Feldherrn nach Berlin gekommen, mit der festen Absicht, durch Wort und Tat die Welt von Elend und Blut zu erlösen. So kamen sie mit den Vertretern der Friedenskonferenz zusammen. Sie kamen überein, die Welt mit dem Schwerte in der Hand vor sich in die Knie zu zwingen, erhoben sich selber zum bluttriefenden Götzen, aus dessen selbstherrlicher Hand die Menschheit ihre Gesetze empfangen sollte. Da sahen sie plötzlich, wie der tot geglaubte Mann vom Potsdamer Platz mitten unter ihnen stand und stumm auf seine zehn Gebote wies. Aber niemand wollte die ärmliche Erscheinung kennen. Da gab er sich zu erkennen und war fast seines Triumphes froh, denn er glaubte ja an die Menschheit. Der Kaiser und die Feldherrn führten seinen Namen in ihren Telegrammen, die Krieger trugen ihn auf dem Bauche, die Feldprediger hatten die schwersten Verbrechen der Menschheit durch seinen Namen geheiligt. Da aber sah Gott, dass man ihn gar nicht kennen wollte, dass man von ihm sich nur eine prunkende Form, eine Uniform behalten hatte, und aus der glotzte das goldene Kalb und beherrschte die Welt.
Da verließ Gott die Friedensversammlung und machte den ordenbesternten Götzen Platz, denn Gott will nicht siegen,
Gott ist.
Die Götzen aber fühlten das Volk immer tiefer ins Elend und erweckten weiter Hass, Bitternis, Zerstörung und Tod, und wie sie nichts mehr hatten außer blechernen Schmucksternen und Kreuzen, verschenkten sie das gestohlene Gut ihren Völkern. Da ging Gott zu denen, die zusammengebrochen waren unter der Bürde der Leiden, unter Hass und Lüge: Es gibt über euren Götzen einen Gott, es gibt über eurem Fahneneid meine ewigen Gesetze. Es gibt über eurem Hass die Liebe.
Da gaben die Krüppel ihre blutstinkenden grauen Kleider, ihre Orden und Ehrenzeichen zurück an den Gott des Mammons, gingen unter das Volk und entheiligten die Mordwaffen und vernichteten sie. Gott aber ging zum Kaiser: Du bist Sklave des Scheins. Werde Herr des Lichtes, indem du der Wahrheit dienst und die Lüge erkennst. Vernichte die Grenzen, sei der Menschheit Führer. Erkenne die Eitelkeit des Wirkens. Sei Friedensfürst, setze an die Stelle des Wortes die Tat, Demut an die Stelle der Siegereitelkeit, Wahrheit anstatt Lüge, Aufbau anstatt Zerstörung. In die Knie vor der Liebe Gottes, sei Erlöser, habe die Kraft des Dienens, Kaiser!«
»Das Märchen vom lieben Gott« fließt ihm »ohne Unterbrechung oder Änderung eines Wortes aus der Feder«. »Nun schrieb ich noch eine Anrede über die Geschichte: An den Kaiser. Protest des Unteroffiziers Vogeler gegen den Brest Litowsker Gewaltfrieden. Auf den Umschlag kam die Adresse des Kaisers in Charleville. Dann ging ich noch nachts ins Dorf und warf den Brief in den Postkasten.«
Auf dem Rückweg zum Barkenhoff jedoch bestürmen ihn »tausend Gedanken«. Vor allem bewegt ihn die Frage, ob »der Mann« da in Charleville sein Protest-Märchen überhaupt erhalten wird. »Mensch, Unteroffizier, du hast ja den Instanzenweg nicht eingehalten.« Also »Zurück in die Bibliothek«. Er schreibt das Gleichnis noch einmal ab und verfasst einen Begleittext, gerichtet an das AOK (Armeeoberkommando), an Ludendorff. Dieser Brief beschäftigt sich aber außerdem noch »mit jener Anfrage des Feldherrn über die Stimmung der Truppen in Bezug auf die Rede von Kühlmanns in Brest-Litowsk«, Nachrichtenmann Vogeler weiß da nämlich bestens Bescheid, er kann sagen, was die Mannschaft »wirklich« denkt, »was der Feldwebel davon dem Oberst mitteilte, was für Veränderungen des Textes in der Brigade vor sich gingen, wie die Redaktion der Division ausfällt und was die Armeegruppe für nötig hielt, in der Abendmeldung dem General Ludendorff auf den Tisch zu legen«. Ratschlag des Unteroffiziers an seinen obersten Chef: »Exzellenz, ziehen Sie Ihre roten Hosen aus und setzen Sie sich in den Dreck, nur dann werden Sie erfahren, was der Frontsoldat denkt.« Zusammen mit der Abschrift seiner Geschichte vom lieben Gott schickt er diese Zeilen an seinen Vorgesetzten »Zur Weiterbeförderung an das AOK«.
Das ist im Januar 1918, in Worpswede.
»Vogeler wird es noch einmal weit bringen«, prophezeit Fritz Overbeck am 26. September 1893 aus Düsseldorf seinem Freund Otto Modersohn. Davon ist er jetzt »mehr wie je« überzeugt, nachdem er Gelegenheit hatte, Vogelers Arbeiten – »ich male auf seinem Atelier« – zu sehen: »Sie sind wirklich famos.« Und am 24. März 1894: »Im Mai wird wahrscheinlich Vogeler nach Worpswede kommen. Ich glaube, der wird noch einmal sehr Bedeutendes leisten.« Overbeck verspricht sich für Modersohn mit dem Zuzug eine »sehr gute« Gesellschaft: »Es sind verwandte Züge da.«
»Außer einigen gelegentlichen Zeitungsnotizen, dass in Worpswede Maler wären, war fast nichts davon bekannt, ja sogar die tatsächliche Existenz einer ganzen Kolonie, die Jahr für Jahr wiederkehre, war in Bremen fast nur einzelnen Kunstfreunden bekannt«, berichten die »Bremer Nachrichten« im Dezember 1894.
Nachdem der Autor zunächst eine Schilderung des nordöstlich der Hansestadt gelegenen Dorfes gegeben hat – »Breite behagliche Strohdächer mit dicker grüner Moosdecke bergen unter sich ein malerisches Innere, wo das offene Feuer auf der Diele schwelt und der blaue Rauch das rußgeschwärzte Balkenwerk verschleiert« –, stellt er die Mitglieder der Kolonie vor: »Vor nunmehr zehn Jahren kam als erster der Maler Fritz Mackensen nach dort, eine Ferienreise brachte den angehenden jungen Künstler, der damals die Düsseldorfer Akademie besuchte, nach dem entlegenen Moordorf. Schon damals machte der Ort mit seinen eigenen Reizen einen tiefen Eindruck auf ihn. So zeichnete er vier Wochen lang dort, in der Folge verbrachte er stets seine Akademieferien hier. Im Sommer 1889 gesellten sich seine beiden Freunde, die Landschafter Otto Modersohn aus Soest in Westfalen und der Radierer Hans am Ende aus Trier zu ihm. Alle drei gewannen die Gegend von Tag zu Tag lieber, und als der Herbst kam, beschlossen sie aus künstlerischer Begeisterung heraus, nicht die Akademie wieder aufzusuchen, sondern den ganzen Winter über in Worpswede zu bleiben. Fern von den geistigen Genüssen, die eine Großstadt und gar erst eine Künstlerstadt bietet, haben sie unter der Landbevölkerung lebend (und ›in Holzschuhen gehend‹) den Winter zugebracht. Die Pariser Weltausstellung sah sie gemeinsam 14 Tage dort. Da studierten sie die Werke eines Corot, Rousseau und vor allem Millet. Dann ging’s aus der Geistesmetropole der Welt direkt zurück ins einsame Moordorf. Es ward für sie selbstverständlich, dass sie sich mit den Frühlingsvögeln am Weyerberg einstellten und mit dem ersten Winterschnee den Rückzug in die Stadt antraten.
Im Sommer 1892 gesellten sich aus Düsseldorf Fritz Overbeck und Eduard Euler zu ihnen, ersterer ein Sohn unserer Stadt. Auch der bekannte Bremer Maler Carl Vinnen malte damals längere Zeit in Worpswede; Hendrich, der phantastische Berliner Maler und ein junger Landschafter Klein aus Odessa waren vorübergehend dort. Das kleine Häuflein wuchs beständig. Im Sommer 1893 kam als Gast Prof. Ludwig Bockelmann zu ihnen und malte in dem benachbarten Kirchdorfe Seisingen. In diesem Sommer erhielt die Kolonie neuen Zuwachs. Zunächst kam Heinrich Vogeler von der Düsseldorfer Akademie, auch ein Sohn unserer Stadt. Bisher hatten seine Studienreisen ihn nach Italien geführt. Nach einem jungen Königsberger Maler Erich Eichler kamen drei Künstler der Münchener Schule: Otto Ubbelohde aus Marburg, Hermann Gröber und Otto Thaimeier aus München. Als letzter kam der durch seine originellen Bilder in Künstlerkreisen wohlbekannt gewordene Prof. C. Seiler, der Nachfolger im Amte Bockelmanns an der Berliner Akademie nach dort.
Im Vordergrund des Interesses an den Worpsweder Malern steht natürlich das große Kolossalbild von Fritz Mackensen: ›Missionspredigt im Freien‹. Es ist im Formate so groß, dass es in keinem Raume im Dorf unterzubringen war. Der Künstler hat es darum ganz im Freien gemalt. In gar mancher stürmischer Nacht ist der Künstler zu seinem Bilde geeilt und hat darüber gewacht. Von Heinrich Vogeler sah ich eine ganze Reihe reizvoller Märchenkompositionen, zu denen er dort Naturstudien malte, die bewiesen, dass der Künstler koloristisch sehr veranlagt ist. Unter diesen seinen Studien fielen mir besonders zwei mehr oder weniger ausgeführte Bilder auf: ein Studienkopf, junges Mädchen mit blauem Glockenblumenkranz im Haar, und ein junges Mädchen, ganze Figur, in ein reiches märchenhaftes Gewand gehüllt, unter einem blühenden Apfelbaume stehend. Augenblicklich ist er damit beschäftigt, einen ganzen Zyklus seiner Märchenkompositionen auf Kupfer zu radieren.«
»Fritz Overbeck schmunzelte froh«, als der 21-jährige Vogeler in Worpswede eintrifft. Dem Kaufmannssohn, am 12. Dezember 1872 in Bremen geboren, hatte das »akademische Getriebe« in Düsseldorf wenig behagt, so dass er sich »immer mehr frei arbeitete in Holland, Italien, Paris«. Die Kollegen erweisen sich bei dem »jungen Ankömmling« als »sehr behilflich«. Ein Giebelzimmer im kleinen Haus einer Gendarmenwitwe ist es, wo er sich einrichtet und abends ins »reinliche Bett« steigt.
Mit Fritz Mackensen, dem Radierer Hans am Ende und Fritz Overbeck zieht er – »nach dem Essen im Gasthaus« – los, um den »rotbärtigen Westfalen« aufzusuchen. Modersohn malt in einem ehemaligen Schulraum. Alles sieht bei ihm »nach intensiver Arbeit aus«. Vogeler ist »erregt«, und zwar nicht allein »von der Fülle der Arbeit, sondern auch davon, wie Otto Modersohn die Landschaft hier erfasste. Sowohl die braunrote Herbststimmung des Moores als auch den smaragdgrünen blumigen Frühling der Wiesen und die weißen Birkenstämme«. Dann und vor allem »die Lüfte, das sommerliche Ziehen der weißen Wolken über das Land, der graue Sturm, der die Bäume peitscht, und die eigentümliche Kraft der Farbe, die der Moorlandschaft eigen ist, wenn sich die Luft in dem dunklen Schwarz der Torfgräben und Moorsümpfe spiegelt«.
Anschließend pilgert die Truppe zur Dorfkirche, nicht um zu beten, sondern weil dort Mackensens Fleißarbeit hängt. Dem Anfänger Vogeler verraten die »fertigen Einzelheiten« des Bildes ein »großes Können«, aber die »Zusammenstellung der Figuren« lässt ihn »so kalt«, ihm ist, als sei dieser malerische Kraftakt eine »Illustration, die man vorübergehend ansieht und schnell vergisst«.
Eine Ansicht, die von den damaligen Kritikern nicht geteilt wird: Für sie ragt Mackensen unter den Worpswedern »um Haupteslänge« hervor. Sein Kolossalbild »Gottesdienst« habe man denn auch für sich aufgestellt. Kein Besucher werde seine Ergriffenheit und seine Bewunderung verleugnen können. »Unter den übrigen vier Worpswedern befinden sich zwei Landschafter, Modersohn und Overbeck, der letztere liebt vorwiegend die düsteren, der erstere die heiteren Stimmungen.« Bei beiden gilt es, »von vornherein« über »technische Unbehülflichkeiten« sowie »Mängel der Zeichnung und Perspektive« und »Unvollkommene Staffage« hinwegzusehen, »wohingegen eine starke Naturempfindung keinem von ihnen abzusprechen ist«. Fazit: »Diese Talente müssen erst ausreifen.«
Vogeler wird als »flotter Zeichner« eingestuft, »der sich mit Leichtigkeit an jede Stilart anpasst«. Sein imitierter Gobelin ist »sehr feinfühlig«, die alte Frau mit den Gänsen und dem heranschleichenden Frosch »humorvoll«, das stilisierte Dornröschen und der Abschied gar »allerliebst«. Er könne auch porträtieren, wie seine »Martha von Hamburg« und »ein gelbblondes Mädchen im gelben Gewand, mitten in eine grüne Wiese gesetzt«, bezeugten, nur bevorzuge er das »Bizarre und Altertümliche« zu sehr auf Kosten des »Schönen«. Gesamturteil über diese Ausstellung in der Bremer Kunsthalle im Jahre 1895: Die Worpsweder brachten »Zwar Neues«, aber abgesehen von Mackensen »wenig Gutes« (»Bremer Nachrichten«).
Ähnlich negativ und, was Vogeler betrifft, sogar noch wesentlich krasser, äußert sich eine andere Zeitung. Nach einem Lob für Mackensen und Hans am Ende heißt es da: »Abgesehen von einem genial sein sollenden wirren Durcheinander der Linien, das tatsächlich aber auf einem Mangel an klarer Vorstellung des Erreichbaren und des zu Erreichenden zu beruhen scheint, und abgesehen von den geradezu schmutzigen Flecken, die die Natur wie durch ein rauchgefärbtes Glas betrachtet und dem so gewonnenen Eindrucke nachgebildet erscheinen lassen, fehlt den Radierungen der anderen Worpsweder eine verständige Besonnenheit und eine gesunde Kraft. Wer die Gelegenheit benutzt hat, im Dresdener Kupferstichkabinett dies gesamte Schaffen ihres offenbaren Vorbildes, Max Klinger, eingehend zu studieren und dann desselben Meisters Glaubensbekenntnis in seiner Broschüre über ›Malerei und Zeichnung‹ gelesen hat, der wird leicht finden, worauf es ankommt. Heinrich Vogeler vor allem, der sich auf Klinger am meisten berufen zu wollen scheint, würde aus der Lektüre jener Schrift lernen, weshalb gerade Klinger meiner Meinung nach ihn am ehesten desavouieren würde, und hier spreche ich nicht mehr von den Radierungen allein. Ich weiß wohl, es gehört heutzutage eine nicht kleine Portion Mut dazu, vor phantastischen ›Kunstwerken‹ zu gestehen, dass man sie nicht goutiert, dass man sie strikt ablehnt. Vor seinen phantastischen Sachen aber glaube ich nicht erst der Berufung auf das ipse dixit des Abgottes der Phantasiekünstler zu bedürfen, um meine ehrliche Überzeugung zu begründen. Wo, wie hier, die Phantastik sich nicht die adäquate Form selbsttätig geschaffen, da versagt die Illusion; wo, wie hier, wenigstens meinem Gefühle nach, der gärende Most in abgenutzte Schläuche (das heißt also unbildlich gesprochen: wo die Phantasie in offenbar vorher erdachte Formen) gefasst wird, da ist kein guter Jahrgang zu erhoffen. ›Umkehr‹ scheint hier das allein richtige Wort wohlmeinender Freunde; denn lebensfähig muss sogar die Karikatur sein, wenn sie künstlerisch berechtigt sein will.« (Ernst Neuling in der »Weser-Zeitung«)
Aber es gibt auch Kritik an der Kritik, und eine Stimme wie die folgende (»Kölnische Zeitung«) wird die jungen Freunde in dem Gefühl bestärkt haben, trotz aller Verrisse richtig zu liegen: »In der Bremer Kunsthalle erregt jetzt etwas so Neues, Originelles, Ursprüngliches allgemeinste Aufmerksamkeit, wie es auf diesem Gebiete hier kaum dagewesen: es ist die besondere Ausstellung der Künstler-Vereinigung ›Worpswede‹. Wie vieles Neue, namentlich auch in der Kunst, bei der großen Menge und auch oft bei den ›Fachleuten‹ auf Widerspruch, Unbehagen oder auch Spottlust stößt, so geht es auch diesem Unternehmen, wissen doch sogar viele Bremer nicht einmal, wo eigentlich dieses weltabgeschiedene Nest Worpswede liegt; man erinnert sich höchstens, dass es irgendwo herum in dem verrufenen Teufelsmoor in der Nähe des Weyerberges, einige Stunden nördlich von Bremen in einer der traurigsten Gegenden der Erde zu suchen ist. Und dort soll sich eine Malerschule gebildet haben, die ihre Sachen in der Bremer Kunsthalle auszustellen sich erdreistet? In der Tat haben dann auch würdige Leute, die von dem geplanten Unternehmen der Ausstellung der ›Worpsweder‹ hörten, das Ganze für einen ›schlechten Scherz‹ erklärt, und der Volkswitz, hier wohl richtiger gesagt, der ›Börsenwitz‹ hat die betreffenden Räume der Ausstellung als ›Lachkabinett‹ bezeichnet. Die Spötter ahnen nicht, dass sie nur das uralte Lied anstimmen, dass der Unverstand und die Schwerfälligkeit der Spießbürger immer anheben, wenn in der Kunst völlig Neues sich zu regen beginnt. Einen großen äußeren Erfolg haben sie denn in den letzten Tagen auch schon zu verzeichnen: von dem Vorstande der ›Münchner Kunstgenossenschaft‹, den Präsidenten Professor v. Stieler und v. Bauer, die auf der Durchreise nach Paris Gelegenheit nahmen, die in der Kunsthalle ausgestellten Arbeiten der ›Worpsweder‹ zu sehen, erhielten sie in äußerst liebenswürdiger Weise die Aufforderung, an der ›Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im Glaspalast zu München‹ teilzunehmen, und zwar in der Weise, dass ihnen ein eigener Saal zur Verfügung gestellt wird.«
Und München wird das, was man einen Durchbruch nennt. »Da ist nirgends der Verdacht der Effekthascherei oder der Schönfärberei möglich. Man muss ihnen auf den ersten Blick glauben« (»Kreutz-Zeitung«, Berlin). Mackensen erhält für den »Gottesdienst« die große goldene Medaille, von Modersohn (»das stärkste Talent unter den Worpswedern«, »Münchener Neueste Nachrichten«) kauft der Bayerische Staat dessen größtes Gemälde für die Pinakothek.
Indes, so etwas schafft auch persönliche Probleme. »Ich war mir«, schreibt Overbeck an Modersohn, »ganz genau bewusst, dass, wenn einer, Du verdient habest, was Du erreicht hast, und eben dieses Bewusstsein hat mir in der letzten Zeit viele scheußliche Augenblicke gemacht. Ich fühle mich zurückgesetzt neben Dir, das konnte ich nicht ertragen, während es sich doch aus der Lage der Dinge genügsam erklärte. Ich bitte Dich, verzeih mir das ...«
1894 kommt Vogeler nach Worpswede, 1895 ist er dort schon Hausbesitzer. Das heißt, eher ist es ein Häuschen, das er da am Weyerberg einer Witwe, der versoffenen Meta, für 3.000 Mark abkauft; sein väterliches Erbteil gestattet ihm diesen Erwerb. Immerhin gehören auch vier Morgen Land dazu. Das ärmliche, aber romantische Anwesen liegt auf halber Höhe des Hanges im Schatten zweier Kastanienbäume, unter denen zu wohnen Vogeler sich bei seinen Streifzügen gewünscht hat. Nun ist der Traum in Erfüllung gegangen.
Umbauarbeiten machen den Aufenthalt dort jedoch zunächst zu keiner reinen Freude, die Romantik ist eher düsterer Art: Herbststürme fegen um und durch das halboffene Haus, in dem Vogeler die Nächte auf kümmerlicher Bettstatt unter einem aufgespannten Regenschirm verbringt. Aber »endlich wurde mein Haus gemütlich. Die Mutter schickte mit dem Fuhrmann allerhand alte Möbel heraus. Sie hatte auch mit Geldmitteln beim Umbau geholfen. Die Malerkolonie brachte Geld zusammen und kaufte eine große alte Kupferpresse von Felsing in Berlin, die nun bei mir im Hause untergebracht wurde. Das machte mich recht produktiv. Wir druckten alles selber, so dass ich eine ganze Kollektion meiner radierten Märchenphantasien zur graphischen Ausstellung nach Wien hatte senden können. Eines Tages kam der Bäcker, Meister Jan Keller, der auch zugleich Postverwalter war, ohne Mütze in seinem mehlbestaubten Arbeitskittel zu mir über den Berg gelaufen und winkte schon von weitem mit einem Telegramm. ›Die kleine goldene Medaille von der Wiener Graphischen Ausstellung‹, rief er mir schon von weitem zu.«
Und dann?
»Wo ist Heinrich Vogeler? Er ist nicht mehr. Er fährt im Lande herum und hält Vorträge über seine Arbeitsschule. Er ist es, der als erster den Kommunismus in die Tat umsetzte, der sein Haus, sein weites Land, seine Tulpen, seine Märchen ... verschenkte – sogar sein Herz. Ein Dutzend Menschen wohnen im Barkenhoff. Sie graben, roden, tischlern und drucken und unterrichten und erträumen sich ein Menschheitsparadies, gebaut aus lauter warmer Liebe. Barkenhoff: Alles verschwindet langsam, was einst Glück und Genießen und Falterruhe und Schnörkelfreudigkeit war. Die seidenen Zimmertapeten sind heruntergerissen. Kahle, getünchte Wände sind geblieben. Große, eiserne Öfen mit langen Rohren sind ins Zimmer gesetzt und zerreißen mit aufdringlicher Plumpheit die Heimeligkeit und Zartheit der Räume. Die Kuschelecken wollen nicht mehr traulich sein. Die Eleganz hochbeiniger Stühle wirkt wie Verlegenheit. Zierliche Tischchen zerschrammt, mit Tinte begossen, kommen sich so überflüssig vor. Alles, was einst Glück war: Bilder, Plastik, Vasen, alles steht nun wie geduldet da. Die Scheiben im Bibliothekszimmer, einst vom Mittelalter angehaucht, sind eingedrückt. Der Musiksaal ist kalt, der Flügel verhängt. Die weite Diele, von einem neuen Vogeler mit Fresken bemalt, fröstelt. Im Schreibzimmer steht der seltsam große Schreibtisch noch, darüber hängt die Totenmaske eines Bremer Revolutionärs. In der Küche, an einem langen Tisch, sitzen sie und essen aus irdenen Tellern; teils essen sie mit Holzlöffeln, teils mit wunderschönen Löffeln aus Silber. Das Atelier ist Trockenboden geworden. Der Pferdestall, in dem einst die Gäule des vergangenen Vogeler stampften, ist eine Tischlerwerkstatt. Die Tulpen aus dem Vorgarten sind herausgerissen, Kartoffeln sind dafür gepflanzt worden. Die Rosen sind dahin. Sonnenblumen sollen kommen, Am Teich unten, wo der Kahn liegt, ist eine Hütte gebaut, daran steht: Spartakusbude. Hier wohnte einst, wie ein neuer Franziskus, der Millionenerbe eines westfälischen Industriellen und bereitete sich für den Kommunismus vor [Eberhard Osthaus].
Ja, Vogeler hat getan, was kaum einer tat von denen, die an fetten Tischen Weltbeglückung machen. Vogeler hat Ernst gemacht. Seine Briefe, die er erhält, sind auch die Briefe seiner Genossen. Er kennt kein Geheimnis mehr. Sein Herz liegt in den Herzen aller derer, die im Barkenhoff wohnen und bauen.
Manchmal, im Sommer, geht er ins Bienenhaus, wo eine kahle Kammer ist. Nur ein Feldbett ist drin, ein Tisch und ein Stuhl. Man stößt fast mit dem Kopf an die Wand. In einer winzigen Nische sah ich einige Mohnköpfe liegen, Ähren, Erika, Zwiebeln und ein Stück Bienenwabe. Dort liegt er, wenn der Wald in die Kammer blüht, wenn die Heide summt ... Dort liegt er und lauscht auf den Gott, der ihn zerbrach, den Beseligten, und einen Härteren, Stählernen aus ihm machte. Auf dem Tische, hingeworfen, sah ich noch ein Bild seiner Frau, die ihn lange schon verlassen hat ...« (Max Jungnickel in der »Frankfurter Zeitung«).
Zunächst ist es nicht mehr als eine Kate, was Vogeler da gekauft hat, aber ein Haus immerhin, und das, so argwöhnt Martha, ist verdächtig. Wer ein Haus kauft, der holt sich auch bald eine Frau aus der Stadt, und überhaupt: wie kann ein junger Mensch nur so viel Geld in der Hand haben? Martha, das ist die Tochter einer Lehrerswitwe. Gleich bei der ersten Begegnung empfindet er sie als »etwas tief in mein Leben Eingreifendes. Ein ganz junges Menschenkind ohne das Bedürfnis, irgendwie wirken zu wollen, interessiert an allem, was geschah, ohne jede konventionelle Hemmung«, Nur er ist gehemmt, sieht keinen Anlass, ihr näherzutreten. Das jedoch ändert sich: Vogeler wandert mit ihr, malt sie auch, doch »sehr zutraulich war das blonde Mädchen noch nicht«. Und nach dem Hauskauf geht sie erst recht auf Distanz.
Eine Frau aus der Stadt aber holt Vogeler sich nicht.
Jedoch wird bald eine von dort zu den Worpswedern hinauskommen: Paula, Tochter des Bremer Baurats Becker. Bleibt sie zunächst nur einige Sommerwochen, so siedelt sie 1898 ganz zur Kolonie über. Diese, mag sie auch nach außen eine Einheit bilden, ist in Wirklichkeit von Krisen nicht frei. Es gibt unter den »Fünfen« sehr verschiedene Auffassungen darüber, was in der Kunst zu tun sei. Für Otto Modersohn scheint bereits 1897 der Augenblick des Abschieds gekommen: »Die Worpsweder Zeit geht zu Ende. Unendlich viel verdanke ich ihr, dem stillen abgeschlossenen Leben in der Natur. Im Folgenden will ich kurz die Summe ziehen, die Quintessenz meiner Gedanken und Bestrebungen und Ziele erläutern.
Stets will ich von der Natur ausgehen, in ihr meine Lehrmeisterin erkennen, aber nicht in bloßer Nachahmung befangen, sondern sie überwinden, verklären durch die Kunst. Was nicht durch die Phantasie umgestaltet wird, bleibt Abklatsch. Jene herrscht und siegt über die Materie, erhebt sich in freiem Fluge wie der Vogel in der Luft, jener sucht mühsam auf dem Boden seine Nahrung. Die Natur ist gewissermaßen die Grammatik, sie enthält die Teile, der Künstler schafft mit ihnen im Bilde ein Ganzes. Es muss der Geist hinzukommen und das Beste hinzutun ... Die Stille und Abgeschiedenheit meines Lebens haben meine Erkenntnis darin gefördert, was meine Art, meinen Stil ausmacht, was meiner Individualität entspricht. Nicht wenig hat die Nähe von Mackensen und der übrigen dazu beigetragen (Modersohn 1893 über Mackensen und Hans am Ende: ›Lebensanschauungen, die meinen zuwider laufen‹), mich im Gegensatz zu ihnen auf meine Wege zu weisen ... Seit vorigen Sommer ist eine vollständige Wandlung mit mir vorgegangen. Ich will mein Leben für mich leben. Ich liebe eine gewisse Derbheit, Ungezwungenheit, Ungeniertheit des Ausdrucks. Eine natürliche Sinnlichkeit. In alle Zukunft will ich mir das bewahren. Um meine Art in Kunst zu leben, muss ich von Worpswede fort. Das bin ich mir menschlich und künstlerisch schuldig.«
Das ist im April. Einige Wochen darauf kommt Paula. In ihrem Tagebuch vermerkt sie: »Ich möchte ihn kennenlernen, diesen Modersohn.«
»Dieser Modersohn« entschließt sich, zu bleiben.
Doch Spannungen in den Beziehungen der Freunde bestehen weiter. Und wieder ist es Modersohn, den es zu Konsequenzen treibt, assistiert von Vogeler und Overbeck. In einem Schreiben an die anderen begründet Modersohn (Paula: »Etwas Langes in braunem Anzug mit rötlichem Bart«) seinen Austritt aus der künstlerischen Vereinigung der Worpsweder:
»Von Anfang an fühlte ich mich mit so manchem in Carl Vinnens Denkschrift im Widerspruch, so dass ich nicht umhin kann, Eure Aufmerksamkeit nochmals auf dieselbe zu lenken. Ich trete nur ungern aus meiner Zurückhaltung heraus, ich kann nicht anders, mein Inneres zwingt mich dazu.
C. Vinnen sagt: ›Wo sich Künstler zu idealem, gemeinschaftlichem Streben zusammenschließen, sehen wir sie ihre Kräfte vergeuden in dem Wust parlamentarischen Unsinns, den ihre eifrigen Debatten über Gründung und Führung ihrer Vereinigung zeigen, jede noch so kleine Kunststadt hat ihre Stürme im Glase Wasser, die lächerlich wären, wenn sie nicht die künstlerische Produktion dadurch so sehr schädigten, dass sie den Blick von der Hauptsache auf jämmerliche Nebendinge ablenkten.‹
Du lieber Gott, hat C. Vinnen sich da nicht mit eigenen Worten geschlagen! – Ich verkenne durchaus nicht, dass unsere Vereinigung uns zu unserer Einführung die größten Dienste geleistet hat, aber sie fängt ernstlich an, durch alle mit ihr verbundenen Pflichten gegen Welt und Ausstellungen und besonders auch gegeneinander uns über den Kopf zu wachsen. Sie bedroht unsere Ruhe, die man zu künstlerischem Schaffen in erster Linie braucht. Hiergegen gibt es nur ein Radikalmittel: die Auflösung der Vereinigung.
Merkwürdig berühren mich die Worte in der Denkschrift: ›Eine äußerliche Identifizierung jedes einzelnen mit der Gesamtheit, ein energisches Eintreten Aller für jeden einzelnen ist notwendig.‹ Geschieht das vielleicht durch diese Denkschrift, wo mir und auch anderen Freunden völlig fremde Anschauungen zugemutet werden? Ich betone, dass alles auf persönliche, individuelle Freiheit ankommt. Durch einen Verein wird die persönliche Gefühls- und Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Darum ist es besser, er existiert nicht weiter.
Je straffer organisiert z. B. ein Staat ist, desto weniger ist der einzelne Bürger. Noch ein Vergleich aus der Natur scheint mir passend: die Rinde eines Baumes kann zu fest werden, so dass der Baum abstirbt. Unsere Beziehungen müssen möglichst locker sein, wir dürfen keinerlei Druck und Zwang empfinden. Das zehrt künstlerische Kräfte auf. Solch eine Denkschrift würde ich mit Freuden begrüßt haben, die gewissermaßen möglichste Freiheit der Persönlichkeit statuarisch festgelegt hätte. ›Ein jeder muss nach seiner Façon selig werden.‹
Das ist der Gedanke, der in Worpswede immer der maßgebende sein muss, lasst ihn uns hochhalten, lasst ihn uns anerkennen.
Um das für meinen Teil zu erreichen, zeige ich Ihnen meinen Austritt aus dem Verein hierdurch an und hoffe, dass Vorstehendes meinen Schritt Euch erklärt und dass mein Schritt Sympathien bei Euch erweckt hat.«
Bei Vogeler ist dies der Fall: »Ich glaube, dass dies das beste Wort ist, was für die freie Entwicklung der Kunst in Worpswede gesagt ist. Auflösung der Vereinigung, völlige Freiheit jedes einzelnen. Nur so kann jeder an seiner eigenen Welt bauen, wenn er auf eigenen Füßen steht und nur das zu verwirklichen sucht, was er verantworten kann. Eine Vereinigung wird Zwangsjacke und muss über kurz oder lang unbedingt den Frieden stören, schon stört sie die Ruhe. Ich habe volle Sympathien mit den Gefühlen Otto Modersohns und schließe mich seinem Austritte an.«
Auch Overbeck sind »Modersohns Ausführungen ... ganz aus der Seele gesprochen«. Nach seiner Überzeugung »sind dadurch die Bahnen vorgezeichnet, welche die Worpsweder Kunst in Zukunft einzuschlagen hat. Auch ich weiß nichts Besseres zu tun, als mich dem Austritt anzuschließen«.
Mackensen hofft, dass seine Kunstbestrebungen »dieselben bleiben werden«. Im Übrigen enthalte er sich »jeder weiteren Bemerkung«.
»Dass die Auflösung des Vereins früher oder später einmal erfolgen könne, dieser Möglichkeit sah jeder von uns entgegen. Dass der Verein, weil Otto Modersohn austreten wollte, gesprengt werden müsste«, dazu liegt nach Auffassung von Hans am Ende »gar keine Veranlassung vor«. Die plötzliche »Sprengung« mit solchen Mitteln »beweist, dass nicht nur künstlerische, sondern auch persönliche Motive mitsprachen«, Der Radierer kann es nur eine »lächerliche Arroganz« nennen, »dass Ihr der Worpsweder Kunst ihre Wege vorschreiben wollt«, Nachdem sie den Brief bis jetzt nicht den Weg »freier Zirkulation« hätten gehen lassen, »mögt Ihr ihn selbst an Carl Vinnen senden«. Warnung des Reserveoffiziers an die angeblichen Sprengmeister: »Ich verbitte mir jedoch ausdrücklich, dass dies von Vereinswegen, also auch in meinem Namen geschieht.«
»Als einzige Gerechtigkeit« bittet der von Modersohn attackierte Vinnen, »entweder keines unserer beiden Schriftstücke oder beide zusammen aufzubewahren«. Von einer Rechtfertigung gegenüber der Modersohnschen Auffassung, so teilt er aus Baden-Baden mit, könne er sich keinen praktischen Nutzen versprechen.
Der die »Freiheit der Persönlichkeit« fordernde Vereinsgegner ist »auf das unangenehmste überrascht, von H. Vogeler zu hören, dass Ihr unsere Schrift ganz falsch aufgefasst habt«. Er erklärt deshalb, »dass ich absolut nichts Persönliches, nichts Verletzendes im Sinn hatte, als ich allmählich zu der Anschauung kam, dass eine Auflösung des Vereins das Beste sei«, gibt allerdings zu, die Form habe »etwas schroff und unvermittelt« wirken können. Dass sie verletzt hat, bedauert er »sehr«, und er nimmt sie daher »gern zurück«. Modersohn bittet, sie zu vergessen und nur den »Kern, den Inhalt« zu sehen. »Der Inhalt kann Euch doch nicht verletzen.«
Ein mündliches Besprechen habe er wegen der damit verbundenen »Erregung« sowie wegen der »Nutzlosigkeit« vermieden. Er hat »durchaus« die Hoffnung, dass es durch Auflösung des Vereins möglich sein wird, »leichter und angenehmer« miteinander zu verkehren. »Gerade wenn jeder größere Anlass, wodurch unsere verschiedenen Auffassungen und Ansichten zusammenplatzen können, beseitigt ist, wird doch weit eher Friede und Eintracht unter uns herrschen«, wonach er sich »so unendlich« sehnt. »So sollte es ... ein Friedenswerk sein, und Ihr nehmt es zum Anlass des Gegenteils« – das bedauert er »schmerzlich«. »Kann man denn nicht«, klagt und zürnt Individualist Modersohn, »ruhig in Worpswede leben und malen?« Das ist sein »Lebensziel«. In allem, was sein Leben angeht, will er »ganz frei, ganz selbständig, ganz mündig« sein, will »keinem zu danken und keinem zu folgen haben«. »Das ist die berechtigte Forderung jedes freien Mannes, keiner kann ihm das schmälern.«
Vogeler selbst, eher Prinz noch denn König (tatsächlich wird man ihn so nennen: König Heinrich), fühlt sich gleichwohl erhaben wie ein solcher. »Liebes Fräulein Becker«, schreibt er an einem Apriltag des Jahres 1900 der Malerin nach Paris, »glauben Sie mir, hier ist alles einfach demoralisierend. Wie hier die Menschen im allgemeinen denken, das ist nicht menschlich, jeder für sich wird ein Sonderling, sein Horizont schrumpft ein, er sitzt auf seinem Sofa und hütet ängstlich wie einen kostbaren Schatz seine kleinlichsten Gefühle.«
Der sich da so vor Worpswede schüttelt, hat eine Zeitlang den Torf nicht gerochen. Seit acht Tagen ist er nun wieder daheim. Jetzt hockt er im Wohnzimmer und schreibt sich seine Übellaunigkeit von der Seele. »Mit hohen Hoffnungen und freien stolzen Gefühlen« ist er auf seinen Barkenhoff heimgekehrt – von Leuten kommend, »die groß und frei waren und voller freier Menschlichkeit«. Und nun ist ihm, als wolle die Luft um den Weyerberg seine besten Stimmungen töten. Alles sei so trostlos geworden hier: »Worpswede wird Villenkolonie.«
Bei der Notenverteilung für seine Kollegen schneidet als einziger Modersohn gut ab: Er ist »sehr nett«, doch »vollkommen blind gegen den entsetzlichen Zustand seiner armen Frau«. »Overbecks sind dieselben wie immer und geben nichts ab von ihren geheimen geistigen Habseligkeiten. Am Ende schleicht grollend und finster grüßend und – ist mein Nachbar.« Zu Mackensen, seinem Förderer und Lehrmeister (der später sein gehässiger Gegner wird: in der Nachkriegszeit schnüffelt der Major der Reserve – freilich nicht nur er – als Spitzel für die Bremer Polizei, der er Berichte über den Kommunisten Vogeler liefert) »kommt das Himmelreich persönlich. Er ward ein frommer Dulder. Die Schlechtigkeit der Menschen im Allgemeinen, der Worpsweder im Besonderen hat diesen Menschen geknickt. Eine Memme, feig vor der Wahrheit gegen sich selbst, der dem Schicksal alles aufbürdet und sich selbst nur als unschuldig duldenden Heiland sieht, und der Freundschaftspakt mit am Ende – das gesetzte Zeichen für diese seine Religion«.
»Vielleicht«, sinniert Vogeler, »tut es nun bald not, dass ich mein Bündel schnüre und wandere in ein fernes Tal, wo keine Menschen sind, denn schon werden Sie bei den obigen Zeilen vielleicht gedacht haben: Da schauen’s den an, den hoat’s a schon, nämlich von wegen die Demoralisierung.« Und dann: »Manchmal fliegt mich hier ein schlechter Gedanke an, und ich kann ihn nicht wehren; nie war mir das unter den anderen Menschen, draußen im Leben.« An seiner Vitalität zweifelt Paulas »ganzer Liebling« (Becker über Vogeler) dennoch nicht. Er ist, bekennt er, »wohl der Geschwollenste hier. Ich möchte die Welt etwas aus den Angeln nehmen, solch ein Kraftprotz bin ich geworden. Fühle mich erhaben wie ein König«.
Mit einem Blick zurück auf seinen Aufenthalt in der IsarMetropole gesteht er: »Habe in München viele schlimme Sachen gehabt, manche früher liebe Freunde verloren ... Vielleicht verliere ich auch hier mal alles, vielleicht gerade durch meine einzige Geliebte, aber was schert mich dies alles, der ich meine ganze Kraft habe durch sie. Solange mir dieser Glaube nicht genommen ist, lebe ich als Künstler. Wenn auch dieser fiele, dann ist meine Uhr abgelaufen ...«
Dass gerade sie diesen Brief erhalte, sei eigentlich Zufall, bemerkt der 27-jährige »Kraftprotz« gegenüber der jüngeren Kollegin (Jahrgang 1876), aber er habe mal vieles loswerden müssen, »was hoffentlich bei Ihnen als absolut heilig betrachtet wird; nicht als ob Sie mit keinem Menschen darüber sprechen dürften, was mir hoch und teuer ist, nur eines für alle, die mir nahe kommen: absoluten Respekt vor mir, vor meinem Besten«. Ihn, so fordert er, »soll man ganz nehmen oder ganz verdammen, das ist, was ich von jedem Vollmenschen ganz verlangen muss«.
Doch nun ist’s ihm genug »der Protzerei«, er wendet sich Frl. Becker zu – nicht ohne vorher ein hohes Lied auf Martha gesungen zu haben: »Wenige Worte von ihr eröffneten mir die weitesten Horizonte.« Woran er sonst sein ganzes Arbeitsjahr gesetzt habe, male er jetzt in wenigen Wochen. »In ihr verehre ich den Menschen, der seine Sinne vorurteilsfrei und kulturlos dem Eindrucke gefangen gibt.«
In Paula Beckers Brief vorn 8. März sei fortwährend von Frühling und sonstigen schönen Dingen die Rede gewesen: »Ist ja Blödsinn, gibt’s ja gar nicht.« Vom 20. bis 25. März sei er noch bei Hauptmann in Schlesien mit dem Schlitten die Berge hinuntergejagt. »Dann hier ein blöder Ostwind und nun Regen, Regen, Regen.« Dass ihr dies Paris gefalle, habe er sich beinah gedacht, »denn wohl nie hörte ich von einem Künstler ohne Begeisterung davon reden«, Aber erst Florenz, wohin sie im nächsten Winter müsse: da würden ihr die Augen aufgehen. Und wenn sie nach Norden in die Normandie »oder so« gehe, werde sie Freiheit und Größe finden. Er sagt’s nicht ohne Neid.
Im Übrigen, so lässt der übermütig-verdrossene Twen sie wissen, habe sie sich kolossal zu ihrem Vorteil verändert. Vogeler zu der fernen Paula Becker: »Sie sind so frei von althergebrachten Poesierequisiten geworden« – und überhaupt, früher hätte er ihr »son« verrückten Brief nicht schreiben können. »Leben Sie wohl.« Der mit ihr in Paris weilenden Bildhauerin Clara Westhoff, weiteres weibliches Ferment der Worpsweder Kolonie, soll sie sagen, dass er sie verehre, aber trotzdem fürs erste keine Zeit habe, ihr zu schreiben.
Es regnet also nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Worpswede geht ihm auf die Nerven. Gefühlshüter, die auf ihrem Sofa hocken, ängstliche Käuze. »Freie und große Menschen«, so scheint’s dem Publikumsbeschimpfer, gibt’s nur anderswo. In seinem Brief ist von München die Rede. Rudolf Alexander Schröder hatte ihn nach dort geholt: als Mitarbeiter der »Insel«, einer von Otto Julius Bierbaum, Alfred Walter Heymel und Schröder herausgegebenen Monatsschrift mit Illustrationen.
Vogeler später über »Die Insel«: »Ein Sammelpunkt der Begabtesten der neuromantisehen Dekadenz.« Er hat ein freundschaftliches Verhältnis zu den »führenden Insulanern, ... wenngleich mich vieles, was ich hier erlebte, einfach erschreckte. Da war vor allem die Art und Weise der Behandlung der Dienerschaft, die jederzeit fühlen musste, dass man uneingeschränkte Gewalt über sie hatte«. In der Rückschau nimmt sich diese Zeit für Vogeler so aus: »Ich hatte in München immer das Gefühl, als ging ich am Leben her und wusste nicht den Weg, wie sich mir das Tor zum Leben öffnen würde. Meine graphischen Arbeiten ... drückten wohl diese Horizontlosigkeit aus. Unbewusst entstand eine rein formale wirklichkeitsfremde Phantasiekunst ohne Inhalt. Sie war eine romantische Flucht aus der Wirklichkeit, und daher war sie auch wohl den bürgerlichen Menschen eine erwünschte Ablenkung von den drohenden sozialen Fragen der Gegenwart. Im Rahmen eines Spiegels des Inselformates erhoben sich märchenhafte Vögel, wie Blätter und Blumen gebogen, mit phantastischem Gefieder, das wieder in wogende Zweige, in Früchte und Blumen überging. Blütenkelche, die wieder Blütenkelche aus sich herausstießen, ein Formenzeichen, das geradezu nach Farben schrie, nach giftigen, süßen, einschmeichelnden und aufreizenden Farben. Nirgends war ein Horizont, nirgends ein Durchblick, nirgends eine Perspektive; das Ganze war ein schöner Vorhang, der die Wirklichkeit verhüllte. So traf wohl meine Inselgraphik den Charakter einer besonderen Zeitepoche, die auch meinen Charakter irgendwie formte, eine uferlose Romantik, hinter aller Wirklichkeit und im Widerspruch zu ihr. Dass sie wie eine Flucht vor der hässlichen Wirklichkeit war, gerade dadurch hatte meine Kunst wohl damals solchen Erfolg ...«
Als Vogeler dies schreibt, sind 40 Jahre vergangen. Längst lebt er auf einem anderen Stern, einem roten. Erich Weinert hat diese in Moskau und Kasachstan zu Papier gebrachten »Erinnerungen« aus einem »Haufen von Blättern und Zettelchen« zusammengestellt; »manche Erlebnisse und Betrachtungen waren in mehreren Varianten vorhanden. Viele Aufzeichnungen waren im Entwurf stecken- oder unfertig geblieben«. Partei-Barde Weinert, »führender kommunistischer Zeitdichter« in der DDR (Der Große Brockhaus), steht von 1943 bis 1945 als Präsident dem Nationalkomitee Freies Deutschland vor, einer aus deutschen Emigranten, Überläufern und Kriegsgefangenen gegründeten Organisation, die in der Sowjetunion gegen die Nazis und für raschen Frieden kämpft. In den zwanziger Jahren politisiert er in Versform u. a. in der Bremer »Arbeiter-Zeitung«, so mit dem Reimprodukt »Ein Zar gefällig?«:
Viktoria von Schaumburg-Lippe
Die alte aufgebackne Schrippe,
Nahm gleich die Sache in die Hand.
Die setzt ein russisches Barönchen
Als Prinzgemahlchen auf ihr Thrönchen
Weil der’s verstand.
Die alte Dame hat Gelüste
Der kleine schlanke Weißgardiste
Der fasst sie feste ums Korsett.
Lasst nur die andern neidisch äugen!
Hier gilt es, einen Zaren zu zeugen.
Marsch, marsch ins Bett.
So triste das Jahr 1900 in Worpswede für Vogeler beginnt: Sommer und Herbst bringen eine Entschädigung. Wie so oft, geschieht dies durch einen Gast. »Die roten Rosen waren nie so rot«, notiert der »große Feierlichkeit« (Martha) verbreitende Barkenhoff-Besucher. Das erste Mal sind Vogeler und Rilke sich in Florenz begegnet, ohne jedoch in Kontakt getreten zu sein. Vogeler glaubt damals, »einen Mönch vor sich zu haben, der seine Hände meist hoch vor den Körper erhob, als wolle er immer ein Gebet beginnen«.