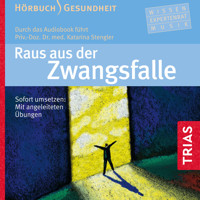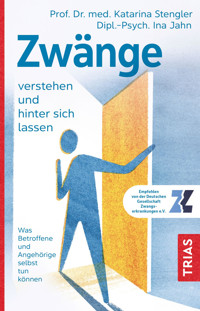
24,99 €
Mehr erfahren.
So bieten Sie Zwangsstörungen die Stirn
Zwangshandlungen und Zwangsgedanken können zu hartnäckigen Begleitern werden, die das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigen. Doch es gibt Wege, sie wieder loszuwerden. Prof. Dr. Katarina Stengler und Ina Jahn sind erfahrene Expertinnen für Zwangserkrankungen am Helios Park-Klinikum Leipzig und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Zwangsstörungen in den Griff bekommen.
- Selbsttest: Erfahren Sie mehr darüber, ob Sie unter behandlungsbedürftigen Zwängen leiden.
- Hilfe zur Selbsthilfe: So verstehen Sie, wie Zwänge entstehen, und lernen durch Übungen und praktische Tipps, sie schrittweise zu bewältigen.
- Neue Therapie-Ansätze: Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen in der Diagnostik und Therapie, z. B. über die aufsuchende Behandlung schwer zwangserkrankter Menschen.
- Tipps für Angehörige: Als Partner und Angehörige sind Sie bedeutende Wegbegleiter. Umso wichtiger ist es für Sie zu wissen, was im Kampf gegen den Zwang zu beachten ist und wie Sie sich abgrenzen können.
Für ein Leben ohne Zwänge.
Empfohlen von der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e. V.
"Ein wichtiges Buch für Betroffene und ihre Angehörigen. Es macht Mut, zeigt Strategien auf und gibt wertvolle Tipps, wie Betroffene und Angehörige sich gegen den Zwang stellen und ihren persönlichen gesunden Freiraum wieder zurückerobern können." Antonia Peters, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zwänge verstehen und hinter sich lassen
Was Betroffene und Angehörige selbst tun können
Prof. Dr. med. Katarina Stengler, Dipl.-Psych. Ina Jahn
2. Auflage 2024
4 Abbildungen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Autorinnen möchten mit diesem Ratgeber Menschen ansprechen, die sich erstmals oder weiterführend zum Thema Zwangserkrankungen informieren möchten, vielleicht als Betroffene, vielleicht als Angehörige eines Menschen mit Zwangserkrankung.
Wenn Sie als Betroffener bislang noch keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben, hoffen wir, dass Sie viele Ihrer Fragen in diesem Buch beantwortet bekommen. Vor allem sollten Sie am Ende der Lektüre Mut gefasst haben, die mögliche Scham oder Peinlichkeit im Umgang mit Zwangssymptomen zu überwinden und gegebenenfalls professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Die Zwangserkrankung zählt zu den heimlichen Erkrankungen, sodass sehr viel mehr Menschen als bislang angenommen an dieser Erkrankung leiden. Wir wissen heute, dass 1–3% aller Menschen im Laufe ihres Lebens von einer Zwangserkrankung betroffen sind – in einer Stadt wie Leipzig mit über 600 000 Einwohnern sind das immerhin mindestens 6000 Menschen.
Während Zwangserkrankungen noch vor einigen Jahren als kaum oder schlecht behandelbar und so gut wie immer als chronisch verlaufend galten, sieht es heute ganz anders aus. Wir wissen, dass es mittlerweile sehr gute Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Zwangserkrankungen gibt, und wir Therapeuten haben gelernt, dass auch die Angehörigen eine wichtige Rolle im Behandlungsprozess spielen.
Deshalb richtet sich dieses Buch auch an Sie als Angehörige, liebe Mütter und Väter, Partner und Partnerinnen, Kinder und Geschwister von Menschen mit Zwangserkrankungen. Sie sind Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung und haben nicht selten schon einen langen, schwierigen Weg hinter sich. Sie können sich hier – auch gemeinsam mit den Betroffenen – informieren.
Dieses Buch bietet:
umfangreiches Wissen über die Erkrankung und ihre unterschiedlichen Ausprägungen
Informationen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von krankhaften Zwängen, zum Krankheitsverlauf und zu wirksamen Therapieformen
einen Selbsttest zur Früherkennung für Betroffene
Betroffene und Angehörige selbst kommen zu Wort und schildern ihre persönliche Geschichte – vermutlich werden Sie sich in einigen Aspekten wiederfinden und denken: »Ja, genauso oder so ähnlich erlebe und empfinde ich das auch.«
Einen weiteren Schwerpunkt dieses Buchs bilden Anleitungen, Übungen und praktische Tipps, die Sie dabei unterstützen, sich mit der Erkrankung und den möglichen persönlichen Entstehungsmechanismen auseinanderzusetzen und sich den Zwängen schrittweise entgegenzustellen.
Obwohl wir Ihnen sehr ans Herz legen, sich therapeutische Unterstützung zu holen, sind alle praktischen Anleitungen so angelegt und beschrieben, dass Sie auch in Eigenregie erfolgreich damit arbeiten können.
So verstehen wir den Inhalt des Buchs als eine Art Schlüssel zu zwangsspezifischem Wissen, der dazu genutzt werden kann, um Ihnen, liebe Betroffene und Angehörige, Empfehlungen zur Selbsthilfe zu geben bzw. neue Erkenntnisse aufzuschließen. In diesem Sinne wünschen wir uns, dass Sie viel Anregendes und Hilfreiches – ein ganzes Set Schlüssel zur Selbsthilfe – bekommen, um den Zwängen im Alltag zu begegnen, um ein genussvolles und zwangsarmes Leben zu führen.
Leipzig, im September 2023
Katarina Stengler & Ina Jahn
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Basiswissen
Wie Sie Zwänge besser verstehen können
Wenn Zwänge das Leben bestimmen
Leiden Sie darunter, ständig kontrollieren zu müssen?
Bestimmen Waschrituale Ihr Leben?
Haben Sie Angst vor »schlimmen Gedanken«?
Wann sind Zwänge krankhaft?
Was sind Zwangserkrankungen?
Formen der Zwangserkrankung
Zwangsgedanken
Zwangshandlungen
Wie ist der Verlauf von Zwangserkrankungen?
Die Zwänge schleichen sich ein
Was sind häufige Begleiterkrankungen?
Angsterkrankungen
Depressionen
Was ist eine zwanghafte Persönlichkeit?
Welche Gefühle spielen eine Rolle?
Angst gehört meist dazu
Gefühle wie Ekel, Anspannung, Unvollständigkeit
Mit Stigmatisierungserleben verbundene Gefühle
Zwangserkrankungen und ihre verwandten Störungen
Zwanghaftes Sammeln und Horten von Dingen
Körperbezogene Verhaltensweisen wie Haareausreißen und Hautknibbeln
Zwanghafte Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit
Wenn sich alles um das eigene Körperbild dreht
Den eigenen Körpergeruch nicht riechen können
Ursachen
Wie Zwangserkrankungen entstehen können
Psychologische Faktoren
Welche Persönlichkeitsmerkmale sind typisch?
Wie eine »Zwangsspirale« entsteht
Was erhält den Zwang aufrecht?
Warum ist es so schwer, den Zwang aufzugeben?
Vermeidungsstrategien
Familiäre und soziale Bedingungen
Einflüsse von Erziehung
Weitere soziale Einflüsse
Belastende Lebensumstände
Biologische Faktoren
Veränderungen im Gehirn
Welche Rolle spielen die Gene?
Das Zusammenspiel der Faktoren
Checkliste: Meine persönlichen Faktoren
Erkennen und behandeln
Wie Sie Zwängen entgegentreten können
Wann brauchen Betroffene professionelle Unterstützung?
Selbsttest
Diagnosestellung
Welche unterschiedlichen Therapieformen gibt es?
Psychotherapie
Information und Wissensvermittlung: Psychoedukation
Was ist Verhaltenstherapie?
Wie läuft eine Verhaltenstherapie ab?
Metakognitive Ansätze
Achtsamkeitsbasierte Ansätze
Biologische Behandlungsverfahren
Welche Medikamente sind hilfreich?
Wann Psychotherapie, wann Medikamente, wann beides?
Psychosoziale und ergänzende Methoden
Trainings von Alltags- und sozialen Fertigkeiten
Ergotherapie
Bewegungs- und Sporttherapie
Musiktherapie
Komplexere psychosoziale Interventionen
Wo und wie soll die Therapie stattfinden?
Ambulante Behandlung
Stationäre oder teilstationäre Therapie
Zuhause-Behandlung für schwer zwangserkrankte Menschen
Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (StäB)
Aufsuchende Behandlung über »PIA mobil«
Integrative Versorgungsformen am Beispiel des Leipziger Modells
Weitere Behandlungssettings wie internetbasierte Therapie
Selbsthilfe für Betroffene
Wie Sie Zwänge hinter sich lassen
Machen Sie eine Bestandsaufnahme
1. Welche Beschwerden habe ich?
2. Checkliste: Welche Zwangssymptome habe ich?
3. Welche Lebensbereiche sind zwangsfrei?
4. Was sind meine persönlichen kurzfristigen Ziele?
5. Welche langfristigen Ziele habe ich?
6. Was denke, fühle und tue ich in der zwangsspezifischen Situation?
Die Zwänge schrittweise bewältigen
Die (übertriebene) Bewertung verändern
Anspannungsverlauf bei der Exposition
Übungsleitfaden bei Zwangshandlungen
Übungsleitfaden bei Zwangsgedanken
Wie oft muss ich üben?
Wenn plötzlich neue Zwänge auftreten
Wann bin ich geheilt?
Ressourcen erkennen und stärken
Die »Zwangslücken« füllen
Genusstraining
Wie Sie Krisen bewältigen
3-Punkte-Krisenmanagement
Erstellen Sie sich einen Krisenpass
Selbsthilfegruppen für Betroffene
Persönliches Engagement als Peer
Angehörige
Unterstützung und Hilfe für Zwangserkrankte
Welche Belastungen erleben Angehörige?
Für die Familie können Zwänge sehr belastend sein
Erkennen, dass es nicht nur seltsame Eigenarten sind
Die Angst, der Partner könnte seine Zwangsgedanken in die Tat umsetzen
Wie fühlen sich Kinder zwangserkrankter Eltern?
Eltern erkrankter Kinder als »Zwangskomplizen«
Wie Angehörige die Zwangserkrankung verkraften
Spagat der Angehörigen
Hat die Therapie Auswirkungen auf Angehörige?
Gesunde Anteile stärken
Veränderungen mitgestalten
Angehörige als Co-Therapeuten
Angehörige als Kooperationspartner
Eltern von zwangserkrankten Kindern
(Erwachsene) Kinder von zwangserkrankten Eltern
Partner von Menschen mit Zwangserkrankungen
Überforderung erkennen
Wie können Angehörige im Krisenfall unterstützen?
Hilfe annehmen
Wo finde ich Unterstützung?
Selbsthilfegruppen für Angehörige
Danksagung
Service
Selbsttests für Betroffene (angelehnt an J. Abramowitz)
Arbeitsmaterialien
Übungsblatt: Beschwerdeliste
Übungsblatt: Symptom-Checkliste (angelehnt an Goodmann et al.)
Übungsblatt: Zwangsfreie Lebensbereiche
Übungsblatt: Symptomliste
Übungsblatt: Verhaltensbeobachtung
Übungsblatt: Kurzfristige Ziele
Übungsblatt: Langfristige Ziele
Übungsblatt: Meine übergeordneten Ziele
Übungsblatt: Bedeutung relativieren
Arbeitsblatt: Konfrontationsprotokoll
Krisenpass
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
© René Rogge |
Basiswissen
Erfahren Sie in diesem Buchteil, wie sich Zwänge in unser Leben einschleichen und immer weiter ausbreiten können, wenn wir nichts dagegen tun.
Wie Sie Zwänge besser verstehen können
Zwänge können in allen Lebensbereichen auftreten und sowohl unsere Gedanken als auch unsere Handlungen »diktieren«.
Wenn Zwänge das Leben bestimmen
Die Zwänge tauchen meist nicht von heute auf morgen auf, sondern entwickeln sich langsam aus persönlichen Macken, Auffälligkeiten, Angewohnheiten und Eigenheiten, die zunächst ganz unauffällig Tag für Tag ausgeführt werden. Die Abläufe erscheinen zunächst selbstverständlich und werden in der Folge automatisch in den Alltag integriert. Erst allmählich merken Sie, dass es nicht mehr anders geht. Dass die ehemals kleinen Macken Ihren gesamten Alltagsablauf bestimmen.
Leiden Sie darunter, ständig kontrollieren zu müssen?
Kontrollrituale vor dem Verlassen der Wohnung
Eine Lehrerin, die zu uns kam, konnte ihre Wohnung nur nach ausgiebigen Kontrollgängen, die in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden mussten, verlassen. Mehrere Kontrollrituale reihten sich in einer komplexen Handlungskette aneinander: Im Flur gehen mehrere Türen zu den einzelnen Zimmern ab: Das Zimmer, dessen Tür am nächsten an der Wohnungstür liegt, wird zuletzt kontrolliert – das war eine wichtige Grundregel dieses Rituals. Im Schlafzimmer wurde begonnen: Da gab es nur wenige Steckdosen, einen Lichtschalter, zwei Fensterknäufe. Das ist schnell überprüft, angefasst, gerüttelt – in Ordnung. Im Bad gestaltete sich das Ganze schwieriger: Die Wasserhähne wurden fast bis zu deren Zerstörung gedrückt – Fenster, Steckdose, weiter. Die Küche wurde zwangsläufig zur Herausforderung: viele Elektrogeräte, Wasser, Licht, Fenster. Dann die Wohnungstür selbst: schließen, rütteln, ziehen, drücken. Am Ende war das alltägliche Ritual geschafft, aber die betroffene Lehrerin war es auch, obgleich zunächst einmal Erleichterung und Entlastung nach dem Abschluss dieser aufwendigen Handlungen eintrat.
Geht es Ihnen auch so, dass Sie morgens nicht mehr pünktlich aus dem Haus kommen, weil das Nachschauen nach elektrischen Geräten, nach Wasserhähnen, Türen und Fenstern unendlich viel Zeit in Anspruch nimmt? Oder haben Sie Ihren Partner dazu gebracht, als Letzter die Wohnung zu verlassen und alles ordnungsgemäß zu kontrollieren? Haben Sie wegen der ausführlichen Kontrolltätigkeit, für Freizeit und Freunde nur noch wenig Zeit? Verbrauchen auch Sie alle Zeit und Energie für die Kontrollen im Haushalt oder für Verpflichtungen bei der Arbeit?
Bestimmen Waschrituale Ihr Leben?
Wenn die Angst vor Infektionen überhandnimmt
Eine Studentin fühlte sich nach ihrem Auslandssemester plötzlich unwohl bei dem Gedanken, fremde, gar öffentliche Toiletten zu benutzen. Immer wieder stellte sie sich vor, wer wohl die Toilette alles vor ihr benutzt haben könnte und welche potenziellen Gefährdungen hinsichtlich »Kontamination« mit menschlichen Exkrementen (Blut, Sekret, Speichel etc.) ihr damit drohten. Sie verband damit die Sorge, sie könne sich selbst, dann aber vor allem andere, ihren Freund, ihre Eltern und Geschwister mit einer Geschlechtskrankheit infizieren.
Das war so unerträglich für sie geworden, dass sie sich einerseits von allen fremden Toiletten fernhielt. Andererseits hatte sie auch beim Benutzen der eigenen Toilette ausgiebige Waschrituale im Vor- und Nachgang eingeschaltet.
Letztlich kamen auch außerhalb und unabhängig von der konkreten Toilettensituation, allein in der Vorstellung, Ängste und Befürchtungen auf: Es reichte bereits, daran zu denken, dass jemand, der von ihr gedanklich in Zusammenhang mit einer potenziellen Geschlechtskrankheit gebracht wurde, in ihrer unmittelbaren Nähe war. Bereits dann, bei dieser »gedanklichen Kontamination«, musste sich die Studentin einem umfangreichen Waschritual unterziehen.
Stehen auch Sie vielleicht früher auf, um vor der Arbeit noch die täglich notwendigen Reinigungs- und Waschrituale an und um sich herum zu bewältigen? Vielleicht tragen auch Sie Ihre Kontaminationsbefürchtungen, die Sorgen, sich mit Bakterien oder Ähnlichem in öffentlichen Einrichtungen, Bussen, Bahn etc. anzustecken, schon lange mit sich herum? Versuchen Sie möglicherweise auch schon längere Zeit, Ihre Befürchtungen vor Angehörigen geheim zu halten? Haben Sie sich vielleicht auch erst, als Ihrem Partner oder Ihren Eltern auffiel, wie oft Sie beispielsweise die Kleidung wechselten, wie intensiv Sie sich gewaschen haben oder wie auffällig Ihre Rituale im Umgang mit Nahrungsmitteln wurden, eingestanden, wie sehr Ihre täglichen Handlungsabläufe durch aufwändige Reinigungsrituale unterbrochen werden?
Haben Sie Angst vor »schlimmen Gedanken«?
Belastungen und Beeinträchtigungen ergeben sich aber auch im Zusammenhang mit Zwangsgedanken. Dann nämlich, wenn die Inhalte so bedrohlich erlebt werden, dass ein normaler Alltag schlicht unmöglich ist.
Dabei können die Belastungen und Beeinträchtigungen durch die Zwangssymptomatik sehr vielfältig sein. Betroffene fühlen sich im Laufe der Erkrankung »den Regeln des Zwangs« verpflichtet. Jeder Versuch, eigene Wünsche, Bedürfnisse zwanglos umzusetzen, kann scheitern. Ein gewisser Widerstand kann nur am Beginn der Erkrankung aufrechterhalten werden, aber irgendwann ordnet sich der Alltag dem Zwang unter. Dann findet häufig kein normales berufliches oder privates Leben mehr statt. Der Widerstand gegen die Zwangssymptome kann immer geringer werden, bis der Zwang die Normalität aus dem Schul-, Berufs- und Privatleben verdrängt hat.
Tipp für Angehörige – Was Sie tun können, wenn Sie erste Zwänge bemerken
Haben Sie als Angehörige den Mut, Zwänge beim Betroffenen anzusprechen. Gehen Sie in vertrauensvoller Atmosphäre auf den Betroffenen zu und versuchen Sie in verständnisvoller Art und Weise zu sagen, dass Sie sich Sorgen machen. Sagen Sie, dass Sie sich über Zwänge informiert haben und dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das ist für den Betroffenen zwar unangenehm, zwingt aber zur Auseinandersetzung und bricht für alle Beteiligten das qualvolle Schweigen!
Die Angst, dem eigenen Kind etwas anzutun
Gar nicht so selten werden wir um Hilfe gebeten, wenn eine junge Mutter kurz nach der Geburt ihres Kindes völlig zurückgezogen lebt, das gewünschte und geliebte Kind nicht mehr versorgen kann.
Zunächst vermuten Partner und Eltern, manchmal auch der Hausarzt, eine Depression. Wochenbettdepression – so etwas ist gar nicht so selten. Die junge Frau spricht nicht mit den Angehörigen über ihre Gedanken und Gefühle. Immer wieder sagt sie, sie könne nicht allein sein mit dem Kind, sie habe Angst. Das Baby baden, wickeln, stillen, ins Bett bringen, spazieren fahren – alles geht nur mit Begleitung. Schließlich hat sich die Familie darauf eingestellt, dass immer jemand dabei ist, denn dann geht alles scheinbar sehr gut. Nichts muss die junge Frau allein tun, alle haben sich arrangiert. Alle haben ihre eigenen Ansprüche zugunsten der jungen Mutter und ihres Kindes zurückgestellt. Und die junge Mutter selbst ist unablässig damit beschäftigt, dieses Helfersystem zu organisieren, zu überprüfen, am Laufen zu halten. Erst als der Partner drängt, auch wieder Dinge allein tun zu wollen, und als die Eltern einmal für kurze Zeit nicht verfügbar sind, eskaliert die Situation.
Irgendwann berichtet die junge Frau ihrem Partner von ihren Ängsten, dem Baby etwas anzutun, den Sorgen, als Mutter zu versagen. Sie leidet unter Zwangsgedanken.
Wann sind Zwänge krankhaft?
Fast jeder hatte wahrscheinlich schon mal Befürchtungen wie »Habe ich versehentlich etwas Schlimmes getan?«. Auch haben die meisten Menschen schon mal etwas bewusst kontrolliert.
Wichtig
Auch Menschen ohne Zwangserkrankung kennen Gedanken wie »Was wäre, wenn ich jetzt hier runterspringen würde?« oder »Ich könnte mich auf der Autobahn-Toilette mit Krankheitskeimen infizieren«.
Krankhaft werden Wiederholungen, Rituale, sich aufdrängende unangenehme Gedanken erst dann, wenn sie Ihren Alltag beeinträchtigen. Wenn Sie selbst nicht mehr das Gefühl haben, Herr im eigenen Hause zu sein, sondern gefühlt die Zwänge das Zepter übernommen haben. Wenn alltägliche Pflichten und Anforderungen nicht mehr den eigenen Regeln und Vorstellungen entsprechen, sondern Sie diese eher als fremd-, eben »zwangsbestimmt«, erleben.
Der eigene Tagesablauf, das Familienleben, der berufliche Alltag, die Freizeit – alles kann dann beeinträchtigt sein, nichts erscheint mehr sicher vor den »zwangsdiktierten«, unveränderbaren Regeln: »Schau noch mal nach, wasch lieber zweimal, kontrolliere die Tür, benutze keine spitzen Gegenstände, Autofahren ist gefährlich.«
Tipp für Betroffene – Zwänge erkennen
Der Übergang von normalen Ritualen zu krankhaften Zwängen ist fließend. Entscheidend für die Krankhaftigkeit und schließlich die Behandlungsbedürftigkeit ist, dass Sie unter Ihrem Tun leiden, die Sinnlosigkeit erkennen, es aber trotzdem nicht unterlassen können.
Zudem ist es wichtig, auf Ihr unmittelbares soziales Umfeld zu schauen und einzuschätzen, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß die Zwänge Ihr Leben einschränken.
Hier kann insbesondere auch die Rückmeldung Ihrer Angehörigen sehr wichtig sein. Wenn beispielsweise Ihre Angehörigen wiederholt darauf hinweisen, dass mit Ihnen »irgendetwas nicht stimmt« oder Sie »anders als sonst« sind, dann sollten Sie innehalten und versuchen, sich etwas Zeit zu nehmen und dem Gesagten nachspüren.
Sie sollten sich dann fragen: »Bin ich anders geworden?«, »Stimmt irgendetwas nicht mit mir?«, »Fühle ich mich von den Dingen, die ich tue und die ich denken muss, beeinträchtigt und belastet?«
Was sind Zwangserkrankungen?
Eine Zwangserkrankung liegt vor, wenn typischerweise immer wieder Gedanken und Handlungen auftreten, die den normalen sozialen Alltag der Betroffenen beeinträchtigen. So berichten Betroffene zum einen über Gedanken, die sich wiederholt aufdrängen (sog. Zwangsgedanken), und zum anderen über wiederholt durchgeführte Gedanken- wie auch Handlungsabläufe (sog. Zwangshandlungen).
Ein weiteres Merkmal ist, dass die Zwänge von Betroffenen überwiegend als lästig, unangenehm, meist quälend empfunden werden. Zudem sollten Betroffene die Zwänge für sich mindestens zeitweise als übertrieben oder unsinnig einordnen können.
Zwangserkrankungen gehen nicht selten mit ausgeprägten psychosozialen Beeinträchtigungen einher. Dabei kann prinzipiell jeder Bereich des alltäglichen Lebens der Betroffenen wie Arbeit, Familie, Freizeit etc. durch die Zwangserkrankung beeinträchtigt sein.
Bekannt ist, dass zwischen 1 und 3% aller Menschen im Laufe ihres Lebens von einer Zwangserkrankung betroffen sind.
Weil Menschen mit Zwangserkrankungen in der Regel sehr stark unter ihrer Erkrankung und den damit verbundenen Beeinträchtigungen leiden, sollten sie sich selbst ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber auch Angehörige können versuchen, Betroffene zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen.
(Susi Schaaf, Bellheim)
Formen der Zwangserkrankung
Bevor wir Zwangsgedanken als auch Zwangshandlungen ausführlicher beschreiben, sollten Sie erfahren, dass diese beiden Formen typischerweise gemeinsam auftreten. Strenggenommen können sie auch nicht voneinander abgrenzt werden, da Zwangsgedanken zum einen Auslöser, zum anderen gleichzeitig Begleiter von Zwangshandlungen sein können.
Aus therapeutischer Sicht ist es aber wichtig, beide Formen zu unterscheiden zu lernen! Dies kann auch gut gelingen, wenn Sie folgendes Unterscheidungsmerkmal kennen: Zwangsgedanken lösen beim Betroffenen zum Beispiel innere Anspannung, Angst aus und Zwangshandlungen dienen dazu, diese unangenehmen Gefühle zu reduzieren.
Wissen – Wie Sie Zwangsgedanken und Zwangshandlungen unterscheiden können
Es gibt ein Merkmal, an dem Sie zuverlässig Zwangsgedanken und Zwangshandlungen voneinander unterscheiden können. Allerdings kann es sein, dass – wenn Zwänge bereits längere Zeit bestehen – Betroffene die Zwangsgedanken kaum für sich wahrnehmen.
(Susi Schaaf, Belleheim)
Zwangsgedanken
Bekannt ist, dass uns täglich mehrere tausend Gedanken verschiedenen Inhalts durch den Kopf gehen. Darunter können ebenso alltagsrelevante Ideen wie auch unsinnige oder abwegig erscheinende oder unangenehme Vorstellungen sein. Manchen Gedanken schenken wir dabei vielleicht mehr Aufmerksamkeit, um andere bemühen wir uns hingegen gar nicht. Das ist normal.
Gedanken, die sich nun immer und immer wieder gegen den eigenen Willen aufdrängen, nennt man Zwangsgedanken. Dabei können Zwangsgedanken in Form von Gedanken, Vorstellungen, Ideen, aber auch als Impulse zu einer bestimmten Handlung auftauchen.
Das Leidvolle: Es gibt keine angenehmen Zwangsgedanken – es handelt sich immer um unangenehme, meist aggressiv gefärbte oder moralisch verwerflich wirkende Inhalte. Diese Inhalte haben nichts mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen zu tun. Deshalb erscheinen sie den Betroffenen fremd und als nicht zu ihnen gehörig. Zumeist fällt es den Betroffenen äußerst schwer, über die Inhalte der Zwangsgedanken zu sprechen.
Wissen – Definition: Zwangsgedanken
Zwangsgedanken drängen sich immer gegen den eigenen Willen auf. Sind gegen eigene Wünsche und Bedürfnisse gerichtet und haben immer unangenehme Inhalte. Deshalb sind Zwangsgedanken so quälend und können zu Angst und Depression führen.
Doch Betroffene können lernen, dass Zwangsgedanken gar nicht so bedrohlich oder gefährlich sind, wie sie zunächst scheinen. Dieser Eindruck entsteht jedoch, weil sich Zwangsgedanken nicht einfach abstellen lassen. Zwangsgedanken drängen sich ständig auf, erschweren das normale Denken und Handeln, begleiten die Betroffenen manchmal den ganzen Tag über.
Die Angst, ungewollt unanständige Worte zu schreiben
Zwangsgedanken können etwa dazu führen, dass der fleißige Journalist, der für eine überregionale Zeitung tätig ist, plötzlich nicht mehr schreiben kann, weil sich ihm immer wieder der Gedanke aufdrängt, er könnte unanständige Wörter in die Texte einfügen. Er könnte Sätze schreiben, die andere verletzen oder beschämen. Bislang hat er deshalb immer und immer wieder das Verfasste kontrolliert, gelesen, kontrolliert, gelesen. Oft sitzt er Stunden und liest nur zwei Seiten. Manchmal kann er die Inhalte nicht mehr erfassen, weil die Wörter verschwimmen und nur noch die einzelnen Buchstaben vor den Augen erscheinen. Mittlerweile schafft er seine Arbeit nicht mehr, er ist arbeitsunfähig geworden und hat große Angst, wenn er an seine berufliche Zukunft denkt.
Welche Inhalte haben Zwangsgedanken?
Zwangsgedanken haben aggressive, sexuelle oder blasphemische, das heißt gotteslästerische Inhalte. Im Zusammenhang mit ▶ Zwangshandlungen können auch Zwangsgedanken auftreten – dann meist mit den Themen Verschmutzung und Symmetrie.
Zwangsgedanken mit aggressiven Inhalten. Diese richten sich meist gegen Menschen in der unmittelbaren Umgebung, Nachbarn, Freunde, Angehörige oder auch einfach gegen Menschen, denen man im Alltag begegnet. Betroffene leiden dabei unter Gedanken wie »Ich könnte meinen Partner absichtlich das Kopfkissen auf das Gesicht drücken«. Aber ebenso können die Gedanken inhaltlich gegen die Betroffenen selbst gerichtet sein: »Ich könnte absichtlich aus dem offenen Fenster springen.«
Solche aggressiven Zwangsgedanken belasten Betroffene, wie zum Beispiel auch die junge Mutter mit ihrem Baby, die wir schon kennengelernt ▶ haben, extrem und führen nicht selten zu Vermeidungsverhalten. Werden diese Gedanken erkannt und richtig eingeordnet, können sie mittlerweile gut behandelt werden.
Zwangsgedanken mit sexuellen Inhalten. Zwangsgedanken mit sexuellen Inhalten werden als besonders belastend empfunden, weil sie den Betroffenen selbst äußerst peinlich sind und als sehr schamvoll erlebt werden.
Sexuelle Zwangsgedanken am Arbeitsplatz
Einem jungen Mann, der in einer großen Computerfirma arbeitete, drängten sich ständig Gedanken auf, seine freundliche junge Kollegin »unsittlich berühren zu können oder gar weitere sexuelle Aktivitäten unmittelbar am Arbeitsplatz auszuführen«. Er ist glücklich verheiratet, auch die Mitarbeiterin ist in festen Händen – im Übrigen kennen sich die beiden seit langem, haben eine freundschaftliche Beziehung zueinander. Der junge Mann schämt sich wegen seiner Gedanken und traut sich nicht, jemandem etwas davon zu erzählen. Vielmehr zweifelt er an sich, fühlt sich für seine Gedanken schuldig – vor allem seiner Frau gegenüber, die natürlich nichts ahnt. Er meidet den kollegialen Kontakt, was die berufliche Situation zusätzlich kompliziert werden lässt.
Zwangsgedanken mit religiösen, blasphemischen Inhalten. Diese sind für Betroffene, die nicht immer nur sehr gläubige Menschen sind, eine große Belastung. Beispielsweise wenn sich während des Gottesdiensts die Gedanken aufdrängen, in die vollbesetzte Kirche gotteslästerliche Worte und Sätze wie »Jesus ist ein Hurensohn« hineinzurufen.
Das erschreckt nicht nur, sondern ruft erhebliche Selbstzweifel hervor und kann Betroffene regelrecht verzweifeln lassen, insbesondere wenn es sich um einen regelmäßigen Kirchgänger handelt und diese Gedanken beharrlich immer wieder auftreten und sich nicht abstellen lassen. In der Folge können ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle und Angst auftreten.
Zwangshandlungen
Zwangshandlungen sind sich ständig wiederholende Handlungsabläufe, Verhaltensweisen und Rituale. Betroffene können sich nicht dagegen wehren, immer und immer wieder Handlungen auszuführen, obgleich sie um die Sinnlosigkeit oder Übertriebenheit wissen.
Erst wenn Betroffene die entsprechende Handlung ausgeführt haben, fühlen sie sich erleichtert, sind beruhigt, haben ein besseres Gefühl – und können den alltäglichen Abläufen wieder nachgehen. Inhaltlich soll ein Unglück, etwas Schlimmes, gar eine Katastrophe verhindert werden. So soll beispielsweise der Herd nicht Quelle eines Wohnungsbrands werden, die unverschlossene Tür nicht zum Diebstahl einladen. Für den Betroffenen entstehen im Zusammenhang mit Zwangshandlungen oft Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen.
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen treten häufig gemeinsam auf. Manche Zwangshandlungen haben überhaupt nur den Zweck, Zwangsgedanken zu verdrängen bzw. diese besser auszuhalten (siehe Kapitel ▶ »Wie eine Zwangsspirale entsteht«).
Zwangshandlungen können sehr umfangreich, komplex und energieraubend sein. In unserer langjährigen klinischen Praxis haben uns Betroffene immer wieder von neuen, komplizierten und unwahrscheinlich anstrengend klingenden Zwangshandlungen berichtet.
Wissen – Definition: Zwangshandlungen
Zwangshandlungen sind sich wiederholende Handlungsabläufe. Sie werden als sinnlos, mindestens als übertrieben empfunden. Durch die Zwangshandlungen soll Unheil, Schlimmes oder Katastrophales verhindert werden. Nach dem Ausführen der Handlungen stellen sich kurzzeitig Gefühle wie Entlastung oder Erleichterung ein. Auf Dauer gelingt es kaum, erfolgreich gegen Zwangshandlungen Widerstand zu leisten.
Tipp für Betroffene – Zwangssymptome herausfinden
Im Serviceteil finden Sie eine ▶ Checkliste mit Symptomen, welche bei einer Zwangserkrankung häufiger auftreten können. Gehen Sie diese durch und finden Sie heraus, welche Zwangssymptome Sie für sich persönlich kennen.
Welche Inhalte haben Zwangshandlungen?
Grundsätzlich sollten Sie wissen, dass es keine Handlung gibt, die nicht »vom Zwang erfasst« werden könnte.
Kontrollzwänge sind vor den Wasch- und Reinigungszwängen die häufigste Form von Zwangshandlungen. Erst danach kommen die Sammel-, Zähl- und andere seltenere Formen wie zum Beispiel die zwanghafte Langsamkeit.
Kontrollzwänge. Zum Kontrollzwang gehört das Beispiel der ▶ Lehrerin, die vor dem Verlassen der Wohnung strenge Regeln zur Kontrolle von elektrischen Geräten, Wasserhähnen, Türen und Fenstern aufstellte. Dabei ist die Sorge, etwas Schlimmes oder Katastrophales könnte passieren, vorherrschend. Genauso ist es, wenn sich wie im Beispiel mit den ▶ Obstkisten Zwangsgedanken und Kontrollhandlungen mischen.
»Den eigenen Sinnen nicht vertrauen können« – das berichten viele von Kontrollzwängen Betroffene. Dies kann sich unter anderem auch darin äußern, dass Betroffene längere Zeit auf Dinge schauen und beispielsweise eine Zeit lang den Blick auf die Schalter des Küchenherds richten.
Menschen mit Zwangserkrankungen haben häufig ein sehr großes Verantwortungsgefühl und verbinden mit den Kontrollhandlungen so gut wie immer das Thema Schuld. Betroffene befürchten, durch eigenes (fehlerhaftes) Tun, Schuld auf sich zu laden, andere zu schädigen und dafür die Verantwortung tragen zu müssen. Um dies zu vermeiden, unternehmen Betroffene unvorstellbare Anstrengungen, oft so lange, bis der Alltag zusammenzubrechen droht.
Glassplitter in Obstkisten verstecken