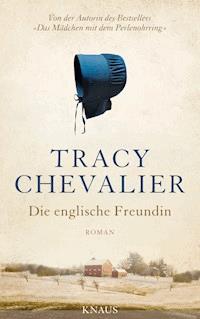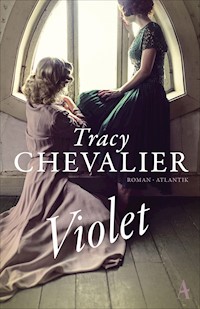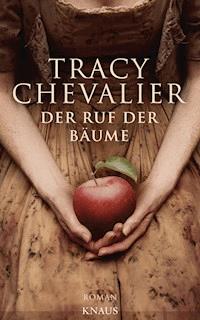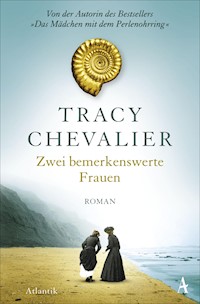
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein beeindruckender Roman über zwei abenteuerlustige Frauen, eine wunderbare Freundschaft und die faszinierende Welt der Fossilien." The Telegraph Seit Mary als Baby vom Blitz getroffen wurde, steht fest, dass sie für Höheres bestimmt ist. Und tatsächlich: Niemand findet so spektakuläre Fossilien am Strand des kleinen Städtchens Lyme wie Mary. Eines Tages macht sie eine erstaunliche Entdeckung, doch in der männerdominierten Welt des 19. Jahrhunderts schenkt ihr niemand Gehör. Zum Glück findet sie in Elizabeth, einer jungen Frau aus besseren Kreisen, die aus London in die Provinz ziehen musste, eine Verbündete. Die Freundschaft wird bald ihr wichtigster Halt – bis sich Mary und Elizabeth in denselben Mann verlieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tracy Chevalier
Zwei bemerkenswerte Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Anne Rademacher
Atlantik
Für meinen Sohn Jacob
IAnders als alle Steine am Strand
Den Blitzschlag habe ich in meinem Leben immer wieder gespürt, in Wirklichkeit getroffen hat er mich aber nur einmal. Eigentlich sollte ich mich nicht daran erinnern können, ich war schließlich fast noch ein Baby, aber ich erinnere mich. Ich saß auf einem Feld. Pferde waren da und Reiter, die Kunststücke vorführten. Plötzlich zog ein Gewitter auf. Eine Frau, es war nicht Mam, nahm mich hoch und trug mich unter einen Baum. Als sie mich fest an sich drückte, schaute ich auf und sah ein Muster aus schwarzen Blättern vor weißem Himmel.
Und dann war da plötzlich Krach, als würden alle Bäume umstürzen, und ein sehr helles Licht, wie wenn man in die Sonne blickt. Etwas durchzuckte mich, sirrend und heiß, als hätte ich ein glühendes Kohlenstück angelangt. Ich roch verbranntes Fleisch und spürte, dass da Schmerz sein musste, aber mir tat nichts weh. Mir war nur, als hätte man mein Inneres nach außen gestülpt.
Dann begannen sie an mir herumzuzerren. Ich hörte Geschrei, konnte aber selbst keinen Ton von mir geben. Man trug mich irgendwohin, und Wärme umhüllte mich, nicht von einer Decke, sondern feuchte Wärme. Es war Wasser, und Wasser kannte ich, denn unser Haus stand nah am Meer, ich konnte es vom Fenster aus sehen. Ich schlug die Augen wieder auf, und mir ist, als hätte ich sie seither nie mehr geschlossen.
Der Blitz tötete die Frau, die mich hielt, und die beiden Mädchen daneben; doch ich hab ihn überlebt. Es heißt, vor dem Gewitter wär ich ein stilles, ständig kränkelndes Kind gewesen, aber danach hätte ich mich zu einem gesunden und quicklebendigen Mädchen entwickelt. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, doch ich spüre die Erinnerung an diesen Blitzschlag immer noch. Wenn mich etwas besonders bewegt oder erregt, durchfährt er mich wie ein Schauder. Ich hab ihn gespürt, als Joe den ersten Krokodilkopf fand und ihn mir zeigte; und als ich dann selbst den Körper dazu entdeckte, hab ich ihn wieder gespürt. Der Blitz kam auch, als ich andere Riesenbestien auf dem Strand fand und als mir zum ersten Mal Colonel Birch begegnete. Oft spüre ich den Blitz und weiß nicht, warum er da ist. Manchmal verstehe ich ihn nicht, doch ich höre auf das, was er mir sagt, denn der Blitz ist in mir, und ich bin der Blitz. Er ist in mich gefahren, als ich ein Baby war, und hat mich seither nie mehr verlassen.
Jedes Mal, wenn ich ein Fossil finde, fühle ich das Echo des Blitzschlags in mir, dieses leise Sirren, das mir sagt: »Ja, Mary Anning, du bist anders als alle Steine am Strand.« Darum bin ich Fossilienjägerin geworden: Ich will den Blitzschlag spüren und dieses Anderssein. Jeden Tag will ich es spüren.
IISchmutzig, mysteriös und nicht sehr damenhaft
Mary Anning führt mit den Augen. Gleich bei unserer ersten Begegnung fiel mir das auf, obwohl sie damals noch ein Mädchen war. Ihre knopfbraunen, hellwachen Augen scheinen, typisch für eine Fossilienjägerin, ständig nach etwas zu suchen, selbst dort, wo es wirklich nichts Interessantes zu finden gibt, auf der Straße etwa oder im Haus. Wegen dieser Angewohnheit wirkt sie sogar dann lebendig und voller Energie, wenn sie sich völlig ruhig verhält. Meine Schwestern behaupten, ich sei genauso, mein Blick schweife ständig suchend umher, statt stetig und fest zu sein. Nur, dass sie das nicht als Kompliment meinen, wie ich bei Mary.
Ich beobachte seit Langem, dass Menschen meist mit einer besonderen Eigenheit des Gesichts oder des Körpers führen. Bei meinem Bruder John zum Beispiel sind es die Augenbrauen. Zum einen natürlich, weil sie ihm in markanten Büscheln über den Augen stehen, aber auch, weil sie der Teil seines Gesichts sind, der am häufigsten in Bewegung ist. Bei John scheinen die Augenbrauen den Gedanken zu folgen, unter denen sich die Stirn in Falten legt und wieder glättet. Nach Louise ist er das zweitälteste der Philpotkinder, und da er der einzige Sohn blieb, musste er nach dem Tod unserer Eltern die Verantwortung für vier Schwestern übernehmen, eine Pflicht, die einem leicht in die Augenbrauen steigen kann.
Meine jüngste Schwester Margaret führt mit den Händen. Sie sind zwar klein, haben aber überproportional lange und elegante Finger, sodass sie besser Klavier spielt als wir anderen. Beim Tanzen fällt sie durch betont graziöse Handbewegungen auf, und im Schlaf wirft sie die Arme hoch über den Kopf, selbst wenn es im Zimmer kalt ist.
Frances, die einzige Philpot-Schwester, die geheiratet hat, führt mit dem Busen – was vermutlich alles erklärt. Wir Philpots sind keine Schönheiten, unsere Figuren sind hager und unsere Gesichtszüge herb. Auch reichte das Familienvermögen nur, um eine Tochter problemlos zu verheiraten. Frances machte das Rennen und verließ das Haus am Red Lion Square, um die Frau eines Kaufmanns in Essex zu werden.
Schon immer habe ich Menschen bewundert, die wie Mary Anning mit den Augen führen, denn sie scheinen die Welt und deren Treiben bewusster wahrzunehmen. Aus diesem Grund vertrage ich mich auch mit meiner ältesten Schwester Louise am besten. Louise hat wie alle Philpots graue Augen und ist eher schweigsam, aber wenn sie einen fest anblickt, nimmt man sie ohne Worte ernst.
Auch ich wollte immer mit den Augen führen, doch es war mir nicht vergönnt. Ich habe ein markantes Kinn, und wenn ich die Zähne zusammenbeiße – was aus Kummer über diese Welt leider öfter geschieht, als es sollte –, verspannt es sich und wirkt scharf wie eine Klinge. Auf einem Ball hörte ich einmal einen potenziellen Bewerber um meine Hand sagen, er traue sich nicht, mich zum Tanzen aufzufordern, weil er Angst habe, sich an meinem Gesicht zu schneiden. Von dieser Bemerkung habe ich mich nie wieder richtig erholt, und sie erklärt wohl, warum ich unverheiratet geblieben bin und selten tanze.
Nur zu gern hätte ich das Kinn gegen die Augen eingetauscht, doch ist mir aufgefallen, dass sich das Merkmal, mit dem ein Mensch führt, genauso wenig ändern lässt wie sein Charakter. Mein ausgeprägtes Kinn ist so versteinert wie die Fossilien, die ich sammele; es wird mir wohl ewig bleiben und, wie ich befürchte, die Menschen abschrecken.
Mary Anning lernte ich in Lyme Regis kennen, der Kleinstadt, in der sie ihr ganzes Leben verbrachte. Niemals hätte ich gedacht, dass ich in so einem Ort landen könnte. Wir Philpots sind natürlich in London aufgewachsen, genauer gesagt am Red Lion Square. Von Lyme hatte ich zwar gehört, weil die modernen Seebäder, die damals überall aus dem Boden schossen, ein beliebtes Gesprächsthema waren, selbst besucht hatte ich es nie. Im Sommer bereisten wir Philpots meist Städte in Sussex wie Brighton oder Hastings. Als unsere Mutter noch lebte, bestand sie darauf, dass wir frische Luft atmeten und im Meer badeten. Sie hing den Lehren des Doktor Richard Russell an, der eine Dissertation über die wohltuenden Auswirkungen des Meerwassers geschrieben hatte, in dem man seiner Meinung nicht nur baden, sondern das man auch trinken sollte. Auch wenn ich mich weigerte, es zu trinken, ging ich gelegentlich zum Schwimmen. Am Meer fühlte ich mich heimisch, nur dass ich einmal wirklich am Meer wohnen würde, hätte ich nicht vermutet.
Doch zwei Jahre nach dem Tod unserer Eltern verkündete mein Bruder eines Abends beim Dinner, dass er sich mit der Tochter eines befreundeten Anwaltskollegen unseres Vaters verlobt habe. Wir küssten John und gratulierten ihm, Margaret spielte einen Festwalzer auf dem Klavier. Nachts im Bett aber weinte ich, wie meine Schwestern vermutlich auch, denn wir wussten, dass dies das Ende unseres trauten Lebens in London sein würde. Hatte unser Bruder erst geheiratet, würden weder Platz noch Geld reichen, um uns alle am Red Lion Square wohnen zu lassen. Die neue Mrs Philpot würde natürlich die Herrin in ihrem Haus sein wollen und es mit Kindern füllen. Drei Schwestern waren einfach zu viel des Guten, insbesondere, wenn abzusehen war, dass sie unverheiratet blieben. Louise und mir war bereits klar, dass wir keinen Mann mehr finden würden. Wir hatten kaum Geld und hätten mögliche Ehemänner allein durch unser Aussehen oder ein gewinnendes Wesen überzeugen müssen, wozu aber weder das eine noch das andere taugte. Louise hatte zwar schöne Augen, die ihrem Gesicht Leben und Anmut gaben, war aber hoch gewachsen – so hoch, dass die meisten Männer zu ihr aufschauen mussten –, und hatte zu allem Überfluss auch noch große Hände und Füße. Erschwerend hinzu kam ihre ausgeprägte Schweigsamkeit, mit der sie mögliche Bewerber verunsicherte, weil sie sich von ihr kritisch beäugt fühlten – was vermutlich sogar stimmte. Ich selbst war klein, hager und unscheinbar, konnte nicht flirten und versuchte stattdessen, über ernste Dinge zu reden, was die Männer erst recht abschreckte.
Wir waren wie Schafe, die von einer abgeweideten Wiese auf die nächste getrieben werden mussten, und John fiel die Rolle des Schäfers zu.
Am Morgen nach seiner Ankündigung legte er ein Buch auf den Frühstückstisch, das er von einem Freund ausgeliehen hatte.
»Ich dachte, ihr wollt in den Sommerferien vielleicht einmal etwas Neues sehen und nicht schon wieder Onkel und Tante in Brighton besuchen«, schlug er vor. »Wie wäre es mit einer kleinen Reise entlang der Südküste? Weil der Krieg mit Frankreich Reisen zum Kontinent unmöglich macht, sprießen in letzter Zeit überall Seebäder aus dem Boden. Eastbourne oder Worthing zum Beispiel. Oder ihr fahrt noch etwas weiter bis Lymington, vielleicht auch bis an die Küste Dorsets, nach Weymouth oder Lyme Regis.« John ließ diese Namen fallen, als hakte er auf einer Liste in seinem Kopf einen nach dem anderen ab. So funktionierte sein ordentlich strukturiertes Anwaltsgehirn eben. Offenbar hatte er bereits eine genaue Vorstellung davon, wo er uns hinschicken könnte, wollte uns aber nicht zu sehr drängen. »Schaut einmal rein, was euch gefallen könnte.« John klopfte auf das Buch. Obwohl er es mit keinem Wort erwähnte, wussten wir alle, dass es um mehr ging als nur um ein Reiseziel. Wir sollten uns nach einem neuen Zuhause umschauen, in dem wir zwar einen etwas bescheideneren Haushalt führen würden, aber wenigstens nicht, wie es in London der Fall wäre, in Armut leben mussten.
Sobald John sich in seine Kanzlei verabschiedet hatte, nahm ich das Buch zur Hand. »Führer zu Trink- und Badekuren für das Jahr 1804«, las ich Louise und Margaret vor. Beim Durchblättern entdeckte ich, dass die englischen Städte alphabetisch aufgelistet waren. Das vornehme Bath hatte mit neunundvierzig Seiten natürlich den längsten Eintrag bekommen, ergänzt durch eine große Landkarte und eine ausklappbare Panoramaansicht der Stadt, deren elegante Fassaden sich harmonisch in die Hügel der Umgebung fügten. Über unser geliebtes Brighton gab es einen begeistert klingenden Bericht von dreiundzwanzig Seiten. Ich schlug die Städte nach, die unser Bruder erwähnt hatte. Einige waren gerade einmal bessere Fischerdörfer und gaben nicht mehr als zwei Seiten voller halbherziger Plattitüden her. John hatte die Orte seiner Wahl mit einem Punkt am Seitenrand markiert. Vermutlich hatte er alle Einträge des Buchs gelesen und sich für diejenigen entschieden, die seinen Vorstellungen am nächsten kamen. Er hatte ganze Arbeit geleistet.
»Und warum nicht Brighton«, fragte Margaret.
Ich las gerade den Eintrag über Lyme Regis und lächelte ironisch: »Hier ist die Antwort.« Ich reichte ihr den Führer. »Schau, was John angestrichen hat.«
»›Lyme wird vor allem von Angehörigen der mittleren Gesellschaftsschicht aufgesucht‹«, las Margaret laut vor. »›Feriengäste entscheiden sich für diesen Ort, weil sie dort nicht nur Linderung für viele Krankheiten finden, sondern in Zeiten versiegender Einkünfte auch ihr angeschlagenes Vermögen schonen können.‹« Sie ließ das Buch in den Schoß sinken. »Das heißt also, Brighton ist zu teuer für die Philpot-Schwestern.«
»Du könntest hier bei John und seiner Frau bleiben«, schlug ich in einem plötzlichen Anflug von Großzügigkeit vor. »Mit einer von uns kommen sie sicher zurecht. Wir müssen uns nicht gleich alle an die Küste verbannen lassen.«
»So ein Unsinn, Elizabeth, wir lassen uns nicht auseinanderreißen«, erklärte Margaret mit einer Loyalität, für die ich sie umarmen musste.
In jenem Sommer reisten wir, wie von John vorgeschlagen, die Küste entlang. Mit von der Partie waren unsere Tante, unser Onkel, unsere zukünftige Schwägerin, deren Mutter und, wann immer er sich freimachen konnte, John. Unsere Begleiter ließen ständig Kommentare fallen: »Was für herrliche Gärten! Wie ich die Menschen beneide, die das ganze Jahr hier leben und sich in ihnen ergehen können!«, hieß es da, oder »Diese Leihbibliothek ist so hervorragend bestückt, man könnte meinen, man wäre in London« oder »Ist die Luft hier nicht wunderbar mild und frisch? Ich wünschte, ich könnte sie das ganze Jahr atmen«.Die Anmaßung, mit der die anderen sich so selbstverständlich in unsere Zukunft einmischten, war verletzend, zumal sich dabei besonders unsere Schwägerin hervortat, die das Haus der Philpots übernehmen würde und sich nicht ernsthaft vorstellen musste, in Worthing oder Hastings zu leben. Ihre Kommentare wurden schließlich so ärgerlich, dass Louise sich immer öfter von gemeinschaftlichen Ausflügen entschuldigte und ich zunehmend gereizter reagierte. Allein Margaret machte es Spaß, diese neuen Städte zu erkunden, und sei es nur, um sich über die matschigen Straßen von Lymington oder das bescheidene Provinztheater in Eastbourne lustig zu machen. Am besten gefiel es ihr in Weymouth. Da König George diese Stadt sehr mochte, war sie populärer als die anderen, und es trafen täglich mehrere Kutschen aus London und Bath ein, die einen niemals versiegenden Zustrom vornehmer Gäste ausspuckten.
Ich selbst war während unserer Reise meistens schlecht gelaunt. Die Vorstellung, gegen den eigenen Willen in einen bestimmten Ort übersiedeln zu müssen, kann einem diesen als Urlaubsziel verleiden. Im Vergleich zu London musste natürlich jede andere Stadt den Kürzeren ziehen. Selbst Brighton und Hastings, Seebäder, die ich früher gern besucht hatte, schien es plötzlich an Esprit und Eleganz zu mangeln.
Bis wir Lyme Regis erreichten, waren von unserer Gesellschaft nur noch Louise, Margaret und ich übrig geblieben: John musste zurück in die Kanzlei und hatte seine Verlobte samt deren Mutter mitgenommen; unser Onkel hatte einen Gichtanfall bekommen, sodass er humpelnd mit unserer Tante die Rückreise nach Brighton antrat. Begleitet wurden wir jetzt von den Durhams, einer Familie, die wir in Weymouth kennengelernt hatten. Wir nahmen zusammen eine Kutsche, und sie halfen uns, eine Unterkunft in der Broad Street zu finden, der Hauptstraße von Lyme Regis.
Von allen Orten, die wir in jenem Sommer besucht hatten, war Lyme in meinen Augen der ansprechendste. Mittlerweile war es September geworden, ein Monat, in dem es überall schön ist, weil die milde Luft und das goldene Licht selbst den trostlosesten Ferienort aufhellen. Wir genossen das gute Wetter – und dass wir von unserer Familie und deren Erwartungen befreit waren. Endlich konnte ich mir eine eigene Meinung darüber bilden, wo ich gerne leben würde.
Lyme Regis ist eine Stadt, die sich ihrer geographischen Umgebung eher angepasst hat, als sich die Landschaft zu unterwerfen. Die steilen Pässe, über die man den Ort erreicht, sind für Kutschen unpassierbar, weshalb die meisten Reisenden beim Wirtshaus Queen’s Arms in Charmouth oder an der Straßenkreuzung von Uplyme aussteigen und sich von kleineren Wägen weiter befördern lassen. Eine schmale Straße führt bis an den Meeresstrand hinab, macht dort eine scharfe Biegung von der Küste weg und steigt gleich wieder hügelauf, als hätte sie nur einen kurzen Blick auf die Wellen werfen wollen, um dann schnell zu fliehen. Unten an der Küste, wo der kleine Fluss Lym ins Meer mündet, hat sich das quadratische Stadtzentrum gebildet. Dort befindet sich das größte Wirtshaus des Ortes, das Three Cups, dem das Zollamt und der Ballsaal gegenüberliegen, der bei aller Bescheidenheit immerhin mit drei Kristallkronleuchtern und einem schönen Erkerfenster zum Strand hin aufwarten kann. Von diesem Zentrum aus erstrecken sich entlang der Küste und des Flusses die Wohnhäuser, während sich alle Geschäfte und die Stände des Shambles-Marktes an der Broad Street befinden. Im Unterschied zu Bath, Cheltenham oder Brighton wurde Lyme nicht geplant, sondern wucherte mal in diese, mal in jene Richtung, als hätte es vergeblich versucht, den Hügeln und der See zu entkommen.
Aber Lyme hat noch eine zweite Seite, denn es sieht so aus, als grenzten unten am Meer zwei verschiedene Gemeinden aneinander, verbunden durch einen schmalen Strand, an dem sich in Erwartung der Besucherströme die Badekarren drängen. Dieses andere Lyme am westlichen Ende des Strandes scheint die See nicht zu fliehen, sondern sie zu suchen und zu umarmen. Dominiert wird dieser Stadtteil vom »Cobb«, einer langen grauen Steinmauer, die wie ein gekrümmter Finger ins Meer hineinragt. Hinter dieser Mauer finden die Fischerboote und Handelsschiffe, die von überall her kommen, einen geschützten und ruhigen Ankerplatz. Der Cobb ist mehrere Meter hoch und so breit, dass man zu dritt Arm in Arm über ihn schlendern kann, wie es viele Feriengäste tun, um von dort den schönen Ausblick auf die Stadt und die dramatische Küstenlinie mit ihren sanften Hügeln und den grünen, grauen und braunen Klippen zu genießen.
Bath und Brighton sind trotz ihres Umlands schön, da sie das Auge mit ihren glatten Steinfassaden und dem gleichmäßigen Stadtbild erfreuen. Lyme jedoch ist wegen seines Umlands schön und trotz seiner langweiligen Architektur. Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick.
Auch meinen Schwestern gefiel es in Lyme, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Bei Margaret war die Sache einfach: Sie wurde die Ballkönigin von Lyme. Mit ihren achtzehn Jahren war sie kess und lebendig und so attraktiv, wie eine Philpot es nur sein konnte. Sie hatte hübsche braune Locken und lange, elegant geschwungene Arme, die sie gern zur Geltung brachte, indem sie sie hoch über den Kopf riss. Ihr Gesicht war zwar etwas länglich und ihr Mund zu klein, auch traten die Halssehnen zu stark hervor, doch mit achtzehn Jahren spielte das noch keine Rolle. Erst später würde man darauf schauen. Wenigstens hatte sie nicht mein messerscharfes Kinn geerbt oder war unvorteilhaft hoch gewachsen wie Louise. In Lyme jedenfalls konnte ihr in jenem Sommer kaum jemand das Wasser reichen, und sie erfreute sich weit mehr männlicher Aufmerksamkeit als in Weymouth oder Brighton, wo die Konkurrenz größer gewesen war. Margaret lebte glücklich von einem Ball zum nächsten und vertrieb sich die Zwischenzeit mit Kartenspielen und beim Nachmittagstee im Ballsaal. Sie badete im Meer oder flanierte mit ihren neuen Bekannten den Cobb auf und ab.
Louise machte sich nichts aus Bällen und konnte auch dem Kartenspiel wenig abgewinnen, dafür hatte sie gleich in den ersten Tagen auf den Klippen westlich der Stadt ein Gebiet mit überraschend wilder Vegetation und stillen, von Efeu und Moos überwucherten Pfaden entdeckt, die sich an abgestürzten Felsbrocken vorbeischlängelten.
Bei einem Morgenspaziergang über den Monmouth-Strand, der westlich des Cobbs beginnt, fand auch ich meine Lyme-Beschäftigung. Wir begleiteten die Durhams, unsere Freunde aus Weymouth, die nach dem sogenannten »Schlangenfriedhof« suchten, einem langen Felsband, das sich weit über den Strand erstreckt, aber nur bei Ebbe freigelegt wird. Der Weg war weiter, als wir gedacht hatten, und über den steinigen Strand ging es nur mühsam voran. Ich hielt den Blick ständig auf den Boden gerichtet, um nicht zu stolpern, und als ich meinen Fuß zwischen zwei Steine setzte, fiel mir ein außergewöhnlicher, mit einem Streifenmuster geschmückter Kiesel auf. Ich bückte mich und hob ihn auf – es war das erste von vielen tausend Malen, die ich das in Zukunft noch tun sollte. Der Stein hatte die Form einer Spirale, auf der sich in gleichmäßigen Abständen Rippen wölbten. Er erinnerte mich an eine Schlange, die sich um ihre Schwanzspitze herum eingerollt hat, und ich fand das regelmäßige Muster so hübsch, dass ich den Stein behalten wollte. Zwar hatte ich keine Ahnung, was ich da in der Hand hielt, doch ich wusste, dass es sich nicht um einen einfachen Kiesel handeln konnte. Ich zeigte meinen Fund erst Louise und Margaret und dann den Durhams.
»Ah, das ist ein Schlangenstein«, erklärte Mr Durham.
Fast hätte ich meinen Fund fallen lassen, obwohl mir mein Verstand sagte, dass diese Schlange nicht mehr lebte. Aber ein ganz normaler Stein war es eben auch nicht. Dann ging mir ein Licht auf: »Das ist ein … ein Fossil, nicht wahr?« Ich sprach das Wort zögernd aus, denn ich war mir nicht sicher, ob die Durhams den Begriff kannten. Natürlich hatte ich schon über Fossilien gelesen und auch einige in einer Vitrine im Britischen Museum gesehen, aber dass sie einfach so am Strand herumlagen, hatte ich nicht gewusst.
»Ich denke schon«, erwiderte Mr Durham. »Solche Steine werden hier oft gefunden. Einige Einheimische verkaufen sie als Kuriositäten und nennen sie deshalb ›Kuris‹.«
»Wo ist der Kopf?«, fragte Margaret. »Es sieht aus, als wäre er abgehackt worden.«
»Vielleicht ist er auch abgebrochen«, gab Miss Durham zu bedenken. »Wo haben Sie den Schlangenstein gefunden, Miss Philpot?«
Ich deutete auf die Stelle. Wir suchten gemeinsam, sahen aber nirgendwo einen Schlangenkopf herumliegen. Die anderen verloren bald das Interesse und gingen weiter, ich aber suchte noch eine Weile allein, bevor ich mich wieder der Gruppe anschloss. Im Gehen öffnete ich gelegentlich die Hand, um meinen Fund anzuschauen, von dem ich bald erfahren sollte, dass es sich um meinen ersten Ammoniten handelte. Ich fand es seltsam, den Körper einer mir unbekannten Kreatur in der Hand zu halten, aber es war auch schön. Die feste Form zu umfassen hatte etwas Beruhigendes, als würde ich mich auf einen Wanderstab oder ein Geländer stützen.
Am Ende des Monmouth-Strandes, kurz vorm Seven Rocks Point, hinter dem sich der weitere Verlauf der Küste dem Blick entzieht, fanden wir den Schlangenfriedhof. Es war eine glatte Kalksteinfläche, die von spiralförmigen Abdrücken übersät war. Die weißen Linien im grauen Stein stammten von Hunderten solcher Kreaturen, wie ich eine in der Hand hielt, nur dass diese riesig waren. Jede einzelne von ihnen hatte die Größe eines Speisetellers. Es war ein so ungewöhnlicher, auch bedrückender Anblick, dass wir schweigend dastanden und schauten.
»Sind das Boa constrictor, oder was?«, fragte Margaret schließlich. »Die sind ja riesig!«
»Aber in England gibt es keine Boa constrictor«, meinte Miss Durham. »Wie sollten sie hierhergekommen sein?«
»Vielleicht haben sie vor ein paar hundert Jahren hier gelebt«, überlegte Mrs Durham.
»Oder sogar vor tausend oder fünftausend Jahren«, warf Mr Durham ein. »Gut möglich, dass es schon so lange her ist. Vielleicht sind sie später in andere Teile der Welt abgewandert.«
Für mich sahen die Abdrücke nicht wie Schlangen aus, allerdings auch nicht wie irgendein anderes Tier, das ich kannte. Ich balancierte über die Felsplatte, wobei ich meine Schritte vorsichtig setzte, um auf keine der Kreaturen zu treten. Natürlich war mir klar, dass sie schon lange tot waren und es sich auch nicht um Körper, sondern eher um deren Abdrücke im Stein handelte. Man konnte sich kaum vorstellen, dass sie einmal gelebt hatten. Ich fand, dass sie unvergänglich aussahen, als wären sie schon immer im Stein eingeschlossen.
Wenn wir in Lyme leben würden, überlegte ich, könnte ich jederzeit hierherkommen und mir diese Versteinerungen anschauen. Und ich könnte kleinere Schlangensteine und andere Fossilien am Strand suchen. Das war doch etwas. Für mich war es genug.
Unser Bruder war sehr erfreut über unsere Wahl. Lyme war kostengünstig, außerdem hatte sich William Pitt der Jüngere als junger Mann in der Stadt aufgehalten, um sich von einer Krankheit zu erholen. Für John war es beruhigend, dass ein britischer Premierminister hohe Stücke auf den Ort hielt, an den er seine Schwestern verbannte.
Im nächsten Frühjahr zogen wir um. John hatte uns ein Cottage am oberen Ende der Silver Street gekauft, das hoch über den Stränden und den Läden der Broad Street lag, deren Verlängerung die Silver Street war. Bald darauf verkauften John und seine neue Frau unser altes Haus am Red Lion Square und schafften sich mit Hilfe der Mitgift unserer Schwägerin ein neues in der Montague Street an, die direkt am Britischen Museum lag. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass unsere Entscheidung uns gleich vollständig von unserer Vergangenheit abschnitt, doch so war es. Jetzt hatten wir nur noch die Gegenwart und eine Zukunft in Lyme.
Auf den ersten Blick war das Morley Cottage ein Schock für uns. Die Zimmer waren klein, die Decken niedrig und die Fußböden uneben. Alles war ganz anders als in unserem Londoner Zuhause. Das kleine, aus Feldstein gebaute Haus hatte ein Schieferdach. Im Erdgeschoss gab es einen Salon, ein Esszimmer und eine Küche, darüber befanden sich zwei Schlafzimmer und noch eine Kammer unterm Dachvorsprung für unser Dienstmädchen Bessy. Louise und ich teilten uns ein Zimmer und überließen das andere Margaret, denn sie beklagte sich immer, wenn wir abends noch lange lasen; Louise in ihren Botanikbüchern und ich in meinen Werken zur Naturgeschichte. Für das Klavier unserer Mutter, ihr Sofa oder den Mahagonieesstisch reichte der Platz im Cottage nicht, wir mussten sie in London zurücklassen. Stattdessen kauften wir im nahe gelegenen Axminster kleinere und schlichtere Möbelstücke und in Exeter ein winziges Klavier. Diese rein äußerlichen Einschränkungen spiegelten unseren Niedergang von einer wohlhabenden Familie mit mehreren Dienstboten und vielen Besuchern zu einem stark verkleinerten Haushalt mit nur einem Dienstmädchen, das kochen und putzen musste. Und das in einer Stadt, deren Familien fast alle unter unserem gesellschaftlichen Niveau waren.
Allerdings gewöhnten wir uns an unser neues Zuhause. Es dauerte gar nicht lange, da erschien uns unser altes Haus in London als viel zu groß. Mit seinen hohen Decken und den riesigen Fenstern war es schwer zu heizen gewesen, und seine Ausmaße überstiegen bei Weitem, was ein Mensch zum Wohnen brauchte. Was half all die Pracht, wenn man ihr als Bewohner keine eigene Größe entgegensetzen konnte? Das Morley Cottage hingegen war ein Damenhaus, hatte Damengröße und entsprach weiblichen Ansprüchen. Da nie ein Mann mit uns dort wohnte, ist dies natürlich eine rein theoretische Behauptung, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein männliches Wesen aus unserer Gesellschaftsschicht dort niemals wohlgefühlt hätte. John jedenfalls kämpfte bei seinen Besuchen mit allen möglichen Problemen. Ständig schlug er sich den Kopf an den Deckenbalken an, er stolperte über unebene Türschwellen, musste sich bücken, wenn er durch die niedrigen Fenster schauen wollte, und schwankte unsicher auf der steilen Treppe. Im Morley Cottage war alles eine Nummer kleiner geworden, nur der Herd in unserer Küche war größer als sein Gegenstück in Bloomsbury.
Wir gewöhnten uns auch daran, in einem kleineren gesellschaftlichen Kreis zu verkehren. Lyme liegt recht abgelegen, die nächste größere Stadt ist das fünfundzwanzig Meilen entfernte Exeter. Vermutlich erklärt das auch, warum die Einwohner von Lyme sich zwar an die gängigen gesellschaftlichen Konventionen halten, aber trotzdem ihren eigenen Kopf haben und unberechenbar sind. Sie können engstirnig, gleichzeitig aber auch tolerant sein. Kein Wunder also, dass es in dieser kleinen Stadt gleich mehrere von der anglikanischen Kirche abweichende Glaubensgemeinschaften gibt. Die Hauptkirche des Orts, Sankt Michael, gehört natürlich nach wie vor zur Church of England, aber es kommen noch diverse andere Gotteshäuser hinzu, in denen sich die Gläubigen versammeln, die Zweifel an der traditionellen Lehrmeinung der Kirche haben: Methodisten, Baptisten, Quäker und Kongregationalisten.
Ich knüpfte in Lyme zwar neue Kontakte, doch insgesamt gefiel mir der widerborstige Geist der Stadt als Ganzes besser, als es einzelne ihrer Bewohner taten – zumindest bis zu dem Tag, an dem ich Mary Anning kennenlernte. Wir Philpots galten in der Stadt noch jahrelang als Londoner Gewächse, die man misstrauisch, wenn auch mit einer gewissen Nachsicht beäugte. Reich waren wir zwar nicht, denn mit einhundertfünfzig Pfund im Jahr können drei unverheiratete Frauen keine großen Sprünge machen, aber immer noch wohlhabender als die meisten Menschen in Lyme. Zudem sicherte uns unsere Herkunft aus einer gebildeten Londoner Anwaltsfamilie ein gewisses Maß an Respekt. Darüber, dass keine von uns dreien einen Mann hatte, schienen sich die Leute allerdings gerne lustig zu machen; wenigstens taten sie es hinter unserem Rücken und lachten uns nicht direkt ins Gesicht.
Auch wenn das Morley Cottage nichts Besonderes war, bot er eine atemberaubende Aussicht auf die Bucht von Lyme und die östliche Hügelkette entlang der Küste, aus der als höchster Punkt das Golden Cap herausragte. An klaren Tagen reichte der Blick bis zur Isle of Portland, die wie ein Krokodil, von dem man nur den langen flachen Kopf über Wasser sieht, vor der Küste lag. Oft stand ich schon frühmorgens auf und setzte mich mit meinem Tee ans Fenster, um die Sonne aufgehen und dem Golden Cap seinen Namen geben zu sehen. Der Anblick linderte den Schmerz, mit dem ich immer noch dem lebendig pulsierenden London nachtrauerte, das ich gegen dieses abgelegene, schäbige Seebad an der Südwestküste Englands hatte eintauschen müssen. Wenn die Sonne die Hügel mit ihrem Glanz überzog, hatte ich das Gefühl, unsere Isolation hier nicht nur akzeptieren, sondern ihr auch etwas abgewinnen zu können. War der Himmel jedoch von tief hängenden Sturmwolken bedeckt oder einfach nur gleichförmig grau, nahm die Verzweiflung wieder zu.
Schon bald nach unserer Ankunft im Morley Cottage erkor ich Fossilien zu meiner neuen Leidenschaft. Irgendeinen Zeitvertreib brauchte ich schließlich: Ich war fünfundzwanzig, würde wahrscheinlich niemals heiraten und suchte nach einer Liebhaberei, die meine Tage ausfüllen konnte. Das Leben einer Dame kann unendlich öde und langweilig sein.
Meine Schwestern hatten ihre Territorien bereits abgesteckt. Louise sah man den ganzen Tag auf Händen und Knien in unserem Garten in der Silver Street, wo sie die Hortensien rodete, die ihr als Blumen zu vulgär erschienen. Margaret ging im Ballsaal ihrer Liebe zum Kartenspiel und zum Tanz nach. So oft sie konnte, überredete sie Louise und mich, sie zu begleiten, allerdings fand sie bald jüngere Freundinnen. Nichts schreckt potenzielle Bewerber mehr ab als altjüngferliche Schwestern, die am Rand der Tanzfläche stehen und hinter vorgehaltenen Handschuhen dumme Bemerkungen machen. Margaret war gerade neunzehn geworden, und so sehr sie auch über die provinziellen Bälle und Kleider in Lyme lästern mochte, setzte sie doch schönste Hoffnungen darein, im Ballsaal eine gute Partie zu machen.
Ich selbst war nach dem frühen Fund eines Goldammoniten, der am Strand zwischen Lyme und Charmouth in der Sonne geglitzert hatte, hoffnungslos dem verführerischen Kitzel der Schatzsuche verfallen und immer häufiger am Strand anzutreffen. Damals interessierten sich nur wenige Frauen ernsthaft für Fossilien, denn diese Liebhaberei galt als nicht besonders damenhaft, sondern als schmutzig und mysteriös. Doch das machte mir nichts. Schließlich gab es niemanden, den ich mit meiner Weiblichkeit beeindrucken wollte.
Es stimmt schon, dass Fossilien ein ungewöhnliches Steckenpferd sind. Als Überreste einstiger Lebewesen finden sie nicht bei jedem Anklang. Denkt man zu lange darüber nach, was man da in Händen hält, nämlich einen Körper, der schon lange tot ist, mag einem das seltsam vorkommen. Noch dazu stammen Fossilien nicht aus unserer Welt, sondern aus einer Vergangenheit, die wir uns heute nur noch schwer vorstellen können. Einerseits macht genau das sie für mich so anziehend, gleichzeitig ist es aber auch der Grund, warum ich lieber Fischfossilien sammele, die mit ihren beeindruckenden Mustern aus Flossen und Schuppen noch eher den Fischen ähneln, die wir jeden Freitag essen, und die damit mehr mit unserer Gegenwart zu tun haben.
Den Fossilien verdanke ich auch meine erste Begegnung mit Mary Anning und ihrer Familie. Kaum hatte ich eine Handvoll Versteinerungen gesammelt, glaubte ich einen Ausstellungskasten zu brauchen, in dem ich sie ordentlich sortiert präsentieren konnte. Von uns Philpot-Schwestern war ich schon immer diejenige gewesen, die gern organisierte und ordnete. Ich arrangierte Louises Blumen in Vasen und stellte das Porzellan, das Margaret aus London mitgebracht hatte, in Vitrinen aus. Dieses Bedürfnis nach Ordnung führte mich in Richard Annings Kellerwerkstatt in der Unterstadt. Sie lag am Cockmoile Square, wobei Square – Platz – ein recht großspuriges Wort für die kleine, gerade einmal wohnzimmergroße freie Stelle zwischen den Häusern war. Obwohl er sich gleich hinter dem Hauptplatz der Stadt befand, über den die feinen Leute flanierten, waren die Häuser am Cockmoile Square recht schäbig. Dort lebten und arbeiteten die Handwerker, außerdem befand sich an einer Ecke des Platzes noch das winzige Gefängnis der Stadt, das man an den Schlagknüppeln vor der Tür erkannte.
Selbst wenn man mir Richard Anning nicht als bewährten Möbeltischler empfohlen hätte, wäre ich früher oder später vor seiner Werkstatt gelandet, und sei es nur, um meine Fossilien mit denen zu vergleichen, die dort von der kleinen Mary Anning auf einem Tisch zum Verkauf angeboten wurden. Mary war ein hochgewachsenes, schlankes Mädchen mit den rauen Händen eines Kindes, das nie mit Puppen gespielt, sondern schon immer gearbeitet hatte. Zwei forsche braune Augen machten ihr eher gewöhnliches, flaches Gesicht interessant. Als ich mich näherte, wühlte sie gerade in einem Korb mit Fossilien, fischte Ammoniten heraus und warf sie in verschiedene Schüsseln, als handelte es sich um ein Spiel. Selbst in ihrem jungen Alter konnte sie die verschiedenen Ammonitenarten an den Lobenlinien, die sich um den spiralförmigen Körper zogen, unterscheiden. Jetzt blickte sie vom Sortieren auf und sah mich voller Neugierde und Begeisterung an. »Wollen Sie Kuris kaufen, Ma’am? Wir haben hier ein paar schöne Exemplare. Schauen Sie mal, diese hübsche Seelilie kostet nur eine Krone.« Sie hielt einen wundervollen Krinoiden hoch, dessen lange Wedel sich tatsächlich wie eine Lilie entfalteten. Ich mag keine Lilien, denn ihr Geruch ist mir zu aufdringlich süß; generell ziehe ich herbere Düfte vor. Meine Bettwäsche lasse ich von Bessy auf den Rosmarinsträuchern im Garten des Morley Cottage trocknen, während sie die meiner Schwestern über den Lavendel legt. »Gefällt sie Ihnen, Ma’am – Miss?« Mary war hartnäckig.
Ich zuckte zusammen. War es so offensichtlich, dass ich nicht verheiratet war? Natürlich war es das. Erstens fehlte in meiner Begleitung der Ehemann, der auf mich aufpasste und mir meine Wünsche erfüllte. Doch es gab noch etwas anderes, das mir an verheirateten Frauen aufgefallen war: eine in sich ruhende Selbstgefälligkeit, die daher rührte, dass sie sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen mussten. Verheiratete Frauen glichen einem Pudding, der in seiner Form fest geworden war, während ledige Frauen ungeformt und unberechenbar waren.
Ich klopfte auf meinen Korb. »Vielen Dank, aber ich habe meine eigenen Fossilien. Ich will zu deinem Vater, ist er da?« Mary nickte in Richtung der Stufen, die zu einer offenen Tür hinabführten. Mit eingezogenem Kopf ging ich in einen dunklen, schmutzigen Raum, der von Holz und Steinen überquoll. Sägespäne und sandiger Steinstaub bedeckten den Boden. Es roch so stark nach Lack, dass ich am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht hätte. Doch dazu war es zu spät, denn Richard Anning hatte mich bereits erblickt und nagelte mich mit seiner spitzen, wohlgeformten Nase auf der Stelle fest, als hätte er einen Pfeil durch mich geschossen. Ich habe noch nie Menschen gemocht, die mit der Nase führen: Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf das Zentrum ihres Gesichts, und diese Konzentrierung ruft bei mir eine Art Lähmung hervor.
Er war ein schlanker Mann, mittelgroß, mit dunklem, dichtem Haar und einem markanten Kinn. Seine Augen waren von der Art Dunkelblau, hinter dem sich etwas zu verbergen scheint. Angesichts seiner groben, herablassenden Art und der manchmal ungehobelten Manieren sollte mir seine Attraktivität ein ständiges Ärgernis bleiben. Leider hatte er sein gutes Aussehen nicht der Tochter vererbt, die mehr damit hätte anfangen können.
Er arbeitete gerade an einem kleinen Schrank mit Glastüren und hielt einen Lackierpinsel in der Hand. Vom ersten Moment an hegte ich eine heftige Abneigung gegen ihn, denn während ich ihm beschrieb, was ich wollte, hielt er es noch nicht einmal für nötig, den Pinsel wegzulegen, auch meine Sammlung würdigte er keines Blickes. »Eine Guinee«, war alles, was Richard Anning zu sagen hatte.
Es war eine unverschämte Summe für einen Ausstellungskasten. Glaubte er etwa, er könne die Jungfer aus London über den Tisch ziehen? Oder hielt er mich vielleicht für reich? Einen Moment lang starrte ich in sein attraktives Gesicht und überlegte, ob ich auf meinen Bruder warten sollte, damit er bei seinem nächsten Besuch mit Richard Anning verhandelte. Aber das konnte noch Monate dauern, außerdem wollte ich nicht wegen jeder Kleinigkeit meinen Bruder belästigen. Ich würde mich in Lyme durchsetzen müssen, damit sich die Handwerker nicht länger über mich lustig machten.
Ein Blick in die Werkstatt genügte, um zu wissen, dass Richard Anning den Auftrag brauchen konnte. Ich beschloss, dies zu meinem Vorteil zu nutzen. »Es ist wirklich bedauerlich, dass Sie mir einen dermaßen überhöhten Preis nennen«, sagte ich, wickelte meine Fossilien in ein Musselintuch und legte sie zurück in den Korb. »Natürlich hätte ich Ihren Namen deutlich sichtbar an dem Kasten angebracht. Jeder, der sich meine Sammlung anschaut, hätte ihn gesehen. In diesem Fall aber muss ich mich an jemanden wenden, dessen Preise realistischer sind.«
»Die wollen Sie ausstellen?« Richard Anning machte eine Kopfbewegung zu meinem Korb hin. Seine Ungläubigkeit entschied die Sache endgültig: Eher würde ich mir jemanden in Axminster, wenn nötig sogar in Exeter suchen, als diesem Mann einen Auftrag zu erteilen. Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nie wieder.
»Guten Tag, Sir«, sagte ich schnippisch und machte auf dem Absatz kehrt. Ich wollte die Treppe hinaufrauschen, doch Mary verdarb mir meinen dramatischen Abgang. Sie stand mitten in der Tür und versperrte mir den Weg. »Was für Kuris haben Sie denn?«, fragte sie. Ihre Augen ruhten auf meinem Korb.
»Wohl kaum etwas, das dich interessieren dürfte«, zischte ich, drückte mich an ihr vorbei und lief auf den Platz hinaus. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil mich der Tonfall von Richard Anning so verletzt hatte. Was kümmerte mich die Meinung eines Möbeltischlers? Für einen Neuling auf dem Gebiet der Fossilien fand ich meine kleine Sammlung wirklich recht ansehnlich. Ich hatte bereits einen intakten Ammoniten gefunden und mehrere in Einzelteilen, außerdem einen pfeilförmigen Belemniten, dessen dünne Spitze nicht wie bei den meisten Exemplaren abgebrochen, sondern völlig unversehrt war. Doch noch während ich wütend am Tisch der Annings vorbeistürmte, erkannte ich, dass ihre Fossilien schöner und vielfältiger als meine eigenen waren. Alle Fundstücke waren intakt, gereinigt und sortiert. Und es waren wirklich viele. Auf Marys Tisch lagen Exemplare ausgestellt, von denen ich noch nicht einmal gewusst hatte, dass sie Fossilien waren: eine zweischalige Muschelart, ein herzförmiger Stein mit einem Muster auf der Oberfläche und eine Kreatur mit fünf langen winkenden Armen.
Mary hatte meine unhöfliche Bemerkung ignoriert und war mir nach draußen gefolgt. »Ha’m Sie auch Vertebis?«
Ich hörte ein Rascheln am Tisch und das klackende Geräusch von aneinanderschlagenden Steinen. »Die kommen aus dem Krokodilrücken«, sagte Mary. »Manche behaupten, dass es Zähne sind, aber Pa und ich wissen es besser. Sehen Sie?«
Ich drehte mich um und sah den Stein an, den sie mir hinhielt. Er war etwa so groß wie ein Zweipennystück, nur dicker, zwar rund, aber an den Seiten leicht eckig abgeflacht. Die Oberfläche war konkav und in der Mitte eingezogen, als hätte ihn jemand in weichem Zustand mit zwei Fingern zusammen gedrückt. Mir fiel das Skelett einer Eidechse ein, das ich im Britischen Museum gesehen hatte.
»Du meinst wahrscheinlich Vertebra«, korrigierte ich sie und nahm den Stein in die Hand. »Das sind Wirbel. Aber Krokodile gibt es in England nicht.«
Mary zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ha’m wir nur noch nie welche gesehen, weil sie jetzt woanders hin sind. Nach Schottland zum Beispiel.«
Ich musste lächeln.
Als ich ihr den Stein zurückreichte, blickte sich Mary suchend nach ihrem Vater um. »Behalten Sie ihn«, flüsterte sie.
»Danke. Wie heißt du denn?«
»Mary.«
»Das ist sehr nett von dir, Mary Anning. Ich werde ihn in Ehren halten.«
Und ich hielt ihn in Ehren. Marys Wirbel war das erste Fossil, das in meinen Schaukasten kam.
Wenn ich heute an unsere erste Begegnung denke, muss ich schmunzeln. Damals hätte ich mir niemals vorstellen können, dass mir Mary eines Tages der wichtigste Mensch auf Erden sein würde, mit Ausnahme meiner Schwestern natürlich. Es war undenkbar, dass eine fünfundzwanzigjährige Dame aus der gehobenen Mittelschicht freundschaftlichen Umgang mit einem jungen Mädchen aus der Arbeiterklasse pflegte. Doch schon damals hatte Mary etwas, das mich auf der Stelle für sie einnahm. Natürlich teilten wir das Interesse für Fossilien, aber das allein war es nicht. Obwohl sie noch ein kleines Mädchen war, führte Mary Anning bereits mit den Augen, und das hätte ich gern selbst gekonnt.
Wenige Tage später hatte Mary herausgefunden, wo wir wohnten, was in Lyme Regis mit seinen wenigen Straßen kein großes Kunststück war, und kam uns besuchen. Louise und ich saßen gerade in der Küche und entstielten die frisch gepflückten Holunderblüten, aus denen wir Sirup herstellen wollten, als sie plötzlich in der Hintertür stand. Margaret übte einen Tanzschritt und wirbelte um den Tisch herum, gleichzeitig versuchte sie uns zu überreden, aus den Blüten doch lieber Champagner anzusetzen. Ihre Hilfe bot sie uns jedoch nicht an, was mich für ihren Vorschlag vielleicht etwas empfänglicher gemacht hätte. Wegen ihres Geklappers und Geplappers bemerkten wir anfangs gar nicht, dass Mary im Türrahmen lehnte. Bessy, die wir Zucker kaufen geschickt hatten und die jetzt schlecht gelaunt in die Küche zurückgepoltert kam, erblickte sie zuerst.
»Wer ist das denn? Weg mit dir, Mädchen!«, rief sie und blies ihre dicken Backen auf.
Bessy war mit uns aus London gekommen und jammerte ständig darüber, wie sehr sie sich verschlechtert hatte: der steile Weg von der Stadt zum Morley Cottage hinauf, die schneidende Seebrise, die sich ihr auf die Brust legte, der unverständliche Dialekt der Einheimischen, denen sie auf dem Markt begegnete, und die Krabben aus der Bucht von Lyme, auf die sie mit einem Hautausschlag reagierte. Hatte sie in Bloomsbury wie ein stilles und williges Mädchen gewirkt, brachte Lyme eine Sturheit in ihr zum Vorschein, die man ihr jetzt an den Backen ablesen konnte. Hinter ihrem Rücken machten wir Schwestern uns gern über ihr Gejammer lustig, manchmal brachte sie uns allerdings fast so weit, dass wir ihr kündigen wollten – vorausgesetzt, sie drohte nicht gerade selbst damit.
Doch auf Mary machte Bessys Ruppigkeit keinen Eindruck, denn sie wich nicht von der Türschwelle. »Was machen Sie da?«
»Holunderblütensirup«, erwiderte ich.
»Holunderblütenchampagner«, korrigierte mich Margaret und unterstrich ihre Aussage mit einer affektierten Handbewegung.
»Hab ich noch nie getrunken«, sagte Mary. Sie beäugte die duftigen Holunderblüten und sog deren Muskatduft ein, der die ganze Küche erfüllte.
»Im Juni gibt es hier solche Mengen von Holunder, man muss ihn einfach verwerten«, sagte Margaret. »Tut ihr Landbewohner das etwa nicht?«
Die herablassenden Worte meiner Schwester ließen mich zusammenzucken, doch Mary wirkte nicht beleidigt. Stattdessen folgten ihre Augen Margaret, die sich nun im Walzerschritt durchs Zimmer drehte, kokett mal über die eine, dann über die andere Schulter blickte und die Hände im Takt ihrer gesummten Melodie bewegte.
Um Himmels willen, dachte ich, das Mädchen wird doch nicht die Albernste von uns bewundern? »Was gibt’s, Mary?«, fragte ich. Es klang recht kurz angebunden, was ich nicht beabsichtigt hatte.
Mary Anning drehte sich zu mir um, aber ihr Blick wanderte trotzdem immer wieder zu Margaret zurück. »Pa hat mich geschickt. Ich soll sagen, dass er Ihnen den Ausstellungskasten für ein Pfund macht.«
»Ach, plötzlich doch?« Einen von Richard Anning angefertigten Ausstellungskasten wollte ich eigentlich nicht mehr. »Sag ihm, ich denke darüber nach.«
»Wer ist denn deine Besucherin, Elizabeth?«, fragte Louise, die Hände immer noch in den Holunderblüten.
»Das ist Mary Anning, die Tochter des Möbeltischlers.«
Als sie den Namen hörte, hielt Bessy, die gerade Mehl und Butter für Scones auf den Tisch stellen wollte, in der Bewegung inne und starrte Mary mit offenem Mund an. »Du bist das Blitzmädchen?«
Mary senkte den Blick und nickte.
Jetzt schauten wir sie alle an. Selbst Margaret hatte ihren Walzer unterbrochen. Wir hatten von einem Mädchen gehört, das vom Blitz getroffen worden war, denn die Leute sprachen auch Jahre später noch davon. Es war eines dieser Wunder, von denen Kleinstädte lange zehrten. Ertrunkene Kinder, die plötzlich Wasser spuckten wie ein Walfisch und wieder zum Leben erwachten; Männer, die von den Klippen stürzten und völlig unversehrt zurückkamen; Jungen, die von Kutschen überfahren wurden und nur mit einem Kratzer auf der Backe wieder aufstanden – das waren die ehrfürchtig bestaunten Wunder des Alltags, die sich mit der Zeit zu Legenden entwickelten und eine Gemeinschaft zusammenhielten. Bei meiner ersten Begegnung mit Mary war ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, es könne sich bei ihr um das Blitzmädchen handeln.
»Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du getroffen wurdest?«, fragte Margaret.
Mary zuckte mit den Schultern. Unser plötzliches Interesse war ihr offensichtlich unangenehm.
Louise, die es wie Mary nicht leiden konnte, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, versuchte das Thema zu wechseln. »Ich heiße übrigens auch Mary. Man hat mich auf die Namen meiner beiden Großmütter getauft. Nur dass ich Großmutter Mary nicht so gerne mochte wie Großmutter Louise.« Sie hielt kurz inne. »Möchtest du uns helfen?«
»Was soll ich machen?« Mary trat an den Tisch.
»Zuerst wäschst du dir die Hände«, befahl ich. »Louise, schau nur ihre Nägel an!« Marys Fingernägel hatten einen grauen Lehmrand, und ihre Fingerkuppen waren runzlig vom Kalkstein, ein Zustand, der mir bald von meinen eigenen Fingern vertraut sein sollte.
Bessy starrte Mary immer noch an. »Bessy, solange wir hier in der Küche sitzen, kannst du im Wohnzimmer sauber machen«, wies ich sie an.
Sie brummte unwillig und nahm ihren Wischmopp. »Ich würde kein Mädchen in meine Küche lassen, das der Blitz getroffen hat.«
»Allmählich wirst du so abergläubisch wie die Einheimischen hier, auf die du so gerne herabschaust«, tadelte ich sie.
Bessy blies wieder die Backen auf und schlug mit dem Mopp gegen den Türpfosten. Louise und ich zwinkerten uns lächelnd zu, und Margaret begann erneut summend um den Tisch zu tanzen.
»Margaret, bitte tu uns den Gefallen und tanze woanders!«, rief ich. »Geh und tanze mit Bessys Mopp.«
Margaret lachte und wirbelte zur Enttäuschung unserer kleinen Besucherin in Pirouetten zur Tür hinaus und durch den Flur davon. Louise zeigte Mary nun, wie man die Stiele von den Blütendolden abknipste und darauf achtete, den Blütenstaub nicht in der ganzen Küche zu verteilen, sondern in den Topf zu schütteln. Sobald sie verstanden hatte, wie es ging, arbeitete Mary zügig und hielt erst inne, als Margaret mit einem hellgrünen Turban auf dem Kopf wieder hereinkam. »Eine Feder oder zwei?«, fragte sie und hielt sich erst eine, dann eine zweite Straußenfeder an das Band über ihrer Stirn.
Mary sah Margaret mit großen Augen an, zu jener Zeit kannte man solche Kopfbedeckungen in Lyme noch nicht. Rückblickend kann ich behaupten, dass Margaret den Frauen von Lyme die Mode gebracht hat, denn binnen weniger Jahre wurden Turbane auf der Broad Street zu einem gängigen Anblick. Ich finde, es gibt Hüte, die besser zu Empire-Kleidern passen als Turbane, und sicher wird manch einer hinter vorgehaltener Hand über Margaret gelacht haben. Aber ist Mode nicht dazu da, zu unterhalten?
»Vielen Dank für deine Hilfe«, sagte Louise, als die Holunderblüten in einer Mischung aus heißem Wasser, Zucker und Zitronen zogen. »Wenn der Sirup fertig ist, bekommst du eine Flasche davon.«
Mary Anning nickte und drehte sich zu mir um. »Darf ich mir Ihre Kuris anschauen, Miss? Neulich haben Sie die mir nicht gezeigt.«
Ich zögerte, schämte ich mich doch plötzlich ein wenig, ihr meine Fundstücke zu zeigen. Für ein junges Mädchen war Mary erstaunlich selbstbeherrscht. Vermutlich lag es daran, dass sie schon von klein auf arbeiten musste, obwohl man natürlich versucht war, es dem Blitzschlag zuzuschreiben. Ich unterdrückte meinen Widerwillen und führte Mary ins Esszimmer. Die meisten Menschen kommentieren beim Betreten dieses Zimmers als Erstes den wunderbaren Blick aufs Golden Cap, den man vom Fenster aus hat, aber Mary schaute nicht einmal hin, sondern steuerte zielstrebig auf die Anrichte zu, auf der ich, sehr zu Bessys Missfallen, meine Fundstücke aufgereiht hatte. »Was ist das denn?« Sie deutete auf die Papieretiketten neben den einzelnen Fossilien.
»Etiketten. Auf ihnen steht, wann und wo und in welcher Gesteinsschicht ich das Fossil gefunden habe, außerdem eine Vermutung, um was es sich handeln könnte. So machen sie es im Britischen Museum auch.«
»Waren Sie da schon?« Mit gerunzelter Stirn studierte Mary jedes einzelne Etikett.
»Ja, wir sind ganz in der Nähe aufgewachsen. Notierst du nicht, wo du deine Sachen findest?«
Mary zuckte die Schultern. »Ich kann nicht lesen und schreiben.«
»Wirst du später die Schule besuchen?«
Wieder zuckte sie die Schultern. »Vielleicht die Sonntagsschule. Da kann man auch Lesen und Schreiben lernen.«
»In der Michaelskirche?«
»Nein, wir gehören nicht zur Kirche von England, wir sind Kongregationalisten. Unsere Kirche steht in der Coombe Street.« Mary hob den Ammoniten hoch, auf den ich besonders stolz war. Er war völlig intakt, hatte weder Risse noch Absplitterungen und eine feine, gleichmäßige Rippenzeichnung auf der Spirale. »Für den Ammo können sie einen Schilling kriegen, wenn sie ihn ordentlich reinigen«, meinte sie.
»Oh, ich werde ihn nicht verkaufen. Er ist für meine Sammlung.«
Mary schaute mich verblüfft an. Da ging mir auf, dass die Annings nicht sammelten, um ihre Fundstücke zu behalten. Für sie bedeuteten gute Fundstücke gutes Geld.
Mary legte den Ammoniten wieder hin und nahm sich einen braunen Stein mit spiralförmigen Markierungen, der ungefähr so lang war wie ihr Finger, aber dicker. »Das ist ein seltsames Exemplar«, sagte ich. »Ich bin mir nicht sicher, worum es sich handelt. Vielleicht ist es einfach nur ein Stein, aber irgendwie … irgendwie sieht er anders aus. Ich musste ihn einfach mitnehmen.«
»Das ist ein Bezoar.«
»Ein Bezoar?« Ich runzelte die Stirn. »Was ist das?«
»Eine Haarkugel, wie man sie in den Mägen von Ziegen findet, Miss. Hat Pa gesagt.« Sie legte den Stein wieder weg und nahm als Nächstes eine zweischalige Muschel in die Hand, eine Gryphaea. Die Einheimischen verglichen sie mit den Zehennägeln des Teufels. »Diese Gryphie haben Sie aber noch nicht gereinigt, was Miss?«
»Den Dreck habe ich abgebürstet.«
»Haben Sie das mit einer Klinge gemacht?« Ich blickte ratlos. »Mit was für einer Klinge?«
»Ach, ein Briefmesser tut es schon, obwohl ein Rasiermesser natürlich besser ist. Man kratzt von innen, um den Schlick und all das Zeug rauszubekommen, dann sieht man auch ihre Form besser. Ich kann es Ihnen zeigen.«
Ich holte kurz Luft. Die Vorstellung, von einem Kind etwas gezeigt zu bekommen, fand ich blamabel. Aber andererseits …
»Na gut, Mary Anning. Komm morgen mit deinen Messern vorbei und zeig mir, wie es geht. Ich zahle dir einen Penny für jedes Fossil, das du reinigst.«
Die Aussicht auf Bezahlung ließ Mary strahlen. »Vielen Dank, Miss Philpot.«
»Jetzt aber fort mit dir. Sag Bessy auf dem Weg nach draußen, sie soll dir eine Scheibe von ihrem Früchtekuchen mitgeben.«
»Sie erinnert sich an den Blitz«, sagte Louise, als Mary weg war. »Ich habe es in ihren Augen gesehen.«
»Wie ist das möglich? Sie war fast noch ein Baby!«
»Wenn man vom Blitz getroffen wird, vergisst man das wahrscheinlich sein Leben lang nicht.«
Am nächsten Tag willigte Richard Anning ein, mir für fünfzehn Schilling einen Ausstellungskasten zu zimmern. Es war die erste einer ganzen Reihe von Vitrinen, die ich mir mit der Zeit zulegen sollte, aus der Hand von Richard Anning kamen jedoch nur noch vier, dann verstarb er. Es gab Kästen von besserer Qualität und Machart, in denen die Schubladen einfach herausglitten, ohne zu klemmen, und die Fugen nicht nach einer Trockenperiode neu geklebt werden mussten. Doch da ich wusste, dass er die Sorgfalt, die seinen Schränken fehlte, in den Fossilienunterricht seiner Tochter steckte, akzeptierte ich die Mängel seiner Handwerksarbeit.
Schon bald war Mary nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Sie reinigte meine Fossilien, und als sie entdeckte, dass ich Fischfossilien am liebsten mochte, verkaufte sie mir die Exemplare, die sie mit ihrem Vater gefunden hatte. Manchmal begleitete sie mich an den Strand, wenn ich selbst suchen ging. Ich gab es zwar nicht zu, doch ich fühlte mich in ihrer Begleitung sicherer, da ich immer Angst hatte, von der Flut abgeschnitten zu werden. Mary fürchtete die Gezeiten nicht; sie hatte ein sicheres Gespür für ihr Kommen und Gehen, das sich bei mir niemals einstellte. Wahrscheinlich muss man dazu so nah am Meer aufwachsen, dass man vom Fenster aus hineinspringen könnte. Während ich vor jedem Strandspaziergang die Gezeitentabelle in unserem Jahresalmanach konsultierte, war Mary immer genau über den Meeresstand informiert und konnte mir sagen, ob die Flut kam oder ging, ob Nipp- oder Springflut herrschte und wie viel Strand zu welchem Zeitpunkt zugänglich war. Allein ging ich nur bei Ebbe an den Strand; dann wusste ich, dass ein paar sichere Stunden vor mir lagen. Allerdings vergaß ich trotzdem oft die Zeit, was bei der Fossilienjagd leicht geschehen kann, und wenn ich schließlich kehrtmachte, um heimzugehen, sah ich, wie das Meer mir schon wieder entgegenkroch. Mary hingegen hatte die Meeresbewegungen immer im Kopf.
Auch aus anderen Gründen schätzte ich Marys Gesellschaft. Ich lernte viel von ihr, zum Beispiel, dass die See gleichgroße Steine in einzelne Streifen am Strand sortiert, in denen man wiederum unterschiedliche Fossilien findet. Sie zeigte mir die vertikalen Risse in den Klippen, die Warnzeichen für Erdrutsche waren, und wo Pfade auf die Klippen hinaufführten, über die wir uns in Sicherheit bringen konnten, wenn die Flut uns den Rückweg abschnitt.
Außerdem war es praktisch, eine Begleitung zu haben. In mancherlei Hinsicht war Lyme liberaler als London. Ich konnte zum Beispiel allein in die Stadt gehen, ohne mich, wie es in London der Fall gewesen wäre, von meinen Schwestern oder Bessy begleiten lassen zu müssen. Der Strand war jedoch oft menschenleer. Nur gelegentlich begegneten mir ein paar Fischer, die nach ihren Krabbenfallen schauten, Schrott- und Treibholzsammler, hinter denen ich aber Schmuggler vermutete, oder Reisende, die bei Ebbe von Charmouth nach Lyme oder umgekehrt unterwegs waren. Für eine Dame schickte es sich nicht, allein an den Strand zu gehen, noch nicht einmal nach den recht freizügigen Maßstäben Lymes. Später, als ich älter und in der Stadt bekannter war, mich außerdem nicht mehr kümmerte, was andere über mich dachten, ging ich oft und gern allein zum Strand, doch in jenen ersten Tagen zog ich Gesellschaft vor. Manchmal konnte ich Margaret oder Louise zum Mitkommen überreden, sie fanden sogar ab und zu Fossilien. Auch wenn Margaret sich nicht gerne die Hände schmutzig machte, freute sie sich, wenn sie Brocken von Eisenpyrit entdeckte, weil dieses Katzengold so schön glitzerte. Louise fand Steine im Vergleich zu den von ihr bevorzugten Pflanzen leblos, allerdings kletterte sie manchmal in die Klippen, um bestimmte Seegrashalme mit ihrer Lupe zu untersuchen.
Besonders oft gingen wir zum Suchen an den etwa eine Meile langen Strand zwischen Lyme und Charmouth. Läuft man am Haus der Annings vorbei in Richtung Osten zum Ende des Gun Cliffs, gelangt man an eine Stelle, an der die Küstenlinie eine scharfe Linkskurve macht, sodass der Strand dahinter von der Stadt aus nicht mehr zu sehen ist. Dort ziehen sich über mehrere Hundert Meter die Church Cliffs die Küste entlang. Sie bestehen aus sogenanntem Blauen Lias, von Schieferschichten durchsetzte Kalksteinbänke, die durch ihr bläulich graues Streifenmuster auffallen. Hinter den Church Cliffs macht der Strand eine sanfte Rechtsbiegung und läuft dann in gerader Linie weiter auf Charmouth zu. Hinter dieser Rechtsbiegung hängt der Black Ven über dem Strand, ein riesiger Erdrutsch aus Mergel, der von den Klippen zum Meer hin abfällt. Sowohl die Church Cliffs als auch der Black Ven bergen viele Fossilien, die sich mit der Zeit aus den Klippen lösen und auf den darunterliegenden Strand fallen. An diesem Ort fand Mary viele ihrer besten Stücke. Und es war der Ort, an dem sich unsere größten Tragödien abspielten.
Als unser zweiter Sommer in Lyme begann, hatte Margaret sich bereits bestens eingelebt. Sie war jung, hatte von der Seeluft einen frischen Teint, und sie war immer noch neu, was sie zu einem Liebling der Amüsiergesellschaft machte. Bald hatte sie feste Spielpartner fürs Whist gefunden, mit anderen Bekannten ging sie regelmäßig zum Baden, und dann gab es noch Familien, mit denen sie über den Cobb flanierte. Während der Saison fand jeden Dienstagabend ein Tanzvergnügen im Ballsaal statt, und Margaret, die keines von ihnen ausließ, wurde wegen ihrer Leichtfüßigkeit zu einer begehrten Tanzpartnerin. Manchmal begleiteten Louise und ich sie, doch sie fand bald interessantere Freunde, denen sie sich anschließen konnte: Familien aus London, Bristol oder Exeter, die einen Teil des Sommers in Lyme verbrachten, außerdem noch ein paar handverlesene Einheimische. Louise und ich waren froh, nicht jedes Mal mitkommen zu müssen. Seit jener »schneidenden« Bemerkung über mein Kinn vor ein paar Jahren tanzte ich nicht mehr gerne, saß lieber am Tisch und schaute zu oder blieb gleich zu Hause und las. Wenn drei Schwestern zusammen mit hundertfünfzig Pfund im Jahr auskommen müssen, bleibt nicht viel Geld für Bücher übrig. In Lymes Leihbibliothek gab es vor allem Romane, doch zu den gängigen Gelegenheiten wie Weihnachten oder meinen Geburtstagen wünschte ich mir ausschließlich Bücher über Naturkunde. Für ein Buch verzichtete ich gerne jederzeit auf einen neuen Schal; außerdem hatte ich Freunde in London, die mir Bücher liehen.
Meine Schwestern vermissten London nicht mehr. Margaret war lieber umschwärmter Mittelpunkt in einer Kleinstadt, als sich in der Londoner Gesellschaft unter Tausenden behaupten zu müssen. Auch Louise wirkte zufrieden, denn die Ruhe sagte ihr zu. Sie liebte den Garten des Morley Cottage mit seiner Aussicht über die Bucht von Lyme und dem hundertjährigen Tulpenbaum in einer der Ecken. Unser Garten in Lyme war viel größer als der am Red Lion Square, wo wir natürlich Gärtner gehabt hatten. Hier jedoch machte Louise fast alles allein, und es gefiel ihr so. Das Klima war eine Herausforderung für sie, denn der salzige Wind verlangte robustere Pflanzen als der milde Londoner Regen. Hier gediehen Veronika, Fetthenne und Wacholder, Salbei, Grasnelken und Stranddisteln. Louise legte Rosenbeete an, die schöner waren als alle, die ich in Bloomsbury gesehen hatte.
Von uns dreien war ich diejenige, die London am meisten nachtrauerte. Mir fehlten die neuen Ideen, die dort ständig im Umlauf waren. In London hatten wir zu einem großen Zirkel von Anwaltsfamilien gehört. Die gesellschaftlichen Anlässe waren nicht nur unterhaltsam, sondern auch intellektuell stimulierend. Oft hatte ich mit meinem Bruder und seinen Freunden beim Dinner gesessen und ihren Diskussionen gelauscht: Wie stand es mit Napoleons Aussichten? Hätte Pitt wirklich noch einmal Premierminister werden müssen? Was sollte man gegen den Sklavenhandel unternehmen? Gelegentlich steuerte ich sogar selbst eine Anmerkung zum Gespräch bei.
In Lyme gab es solche Gespräche nicht. Ich hatte zwar meine Fossilien, um mir die Zeit zu vertreiben, über sie reden konnte ich jedoch mit kaum jemandem. Wenn ich ein Buch von Hutton, Cuvier, Werner, Lamarck oder anderen Naturwissenschaftlern gelesen hatte, fehlten mir Freunde in der Nähe, die ich hätte fragen können, was sie von den radikalen Ideen dieser Männer hielten. Lyme war zwar von bemerkenswerten Naturphänomenen umgeben, nur interessierte sich fast niemand aus der Mittelklasse der Stadt dafür. Man zog es vor, sich über das Wetter und die Gezeiten zu unterhalten, über den Fischfang und den Feldbau, die Sommergäste und die Saison. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Leute sich Gedanken über Napoleon und den Krieg mit Frankreich machten, und sei es nur wegen der Auswirkungen auf die kleine Schiffsbauindustrie in Lyme. Aber die einheimischen Familien diskutierten lieber über notwendige Reparaturen an der ramponierten Strandmauer, über das kürzlich eröffnete Badehaus, das aufgrund seines Erfolges sicher bald von anderen Städten kopiert würde, oder erörterten allen Ernstes, ob die städtische Mühle das Mehl fein genug mahle. Manchmal ließen sich die Sommergäste, die wir im Ballsaal, in der Kirche oder bei Tee-Einladungen trafen, in ein Gespräch über wichtigere Dinge verwickeln, aber viele von ihnen verreisten ja gerade, um eine Weile den ernsteren Themen zu entfliehen, weshalb sie den Tratsch und Klatsch der Einheimischen durchaus genossen.
Besonders enttäuschend war, dass ich die vielen Fragen, die mir durch meine mysteriösen Fossilienfunde im Kopf herumgingen, nicht aussprechen konnte. Die Ammoniten zum Beispiel, die auffälligsten und eindrucksvollsten Fossilien, die man in Lyme fand: Was genau waren sie? Dass es sich um Schlangen handelte, wie die meisten felsenfest glaubten, bezweifelte ich. Warum sollten sie sich so rund zusammenrollen? Ich hatte noch nie von Schlangen gehört, die so etwas taten. Und wo waren ihre Köpfe? Jeden Ammoniten, den ich fand, studierte ich sorgfältig, entdeckte aber nie die Spur eines Kopfes. War es nicht ausgesprochen seltsam, dass ich so viele Versteinerungen von ihnen am Strand fand, aber nie ein lebendes Exemplar zu Gesicht bekam?
Andere Menschen schienen sich solche Fragen nicht zu stellen. Ständig hoffte ich, dass mich eines Tages jemand bei einer Tee-Einladung in unserem Salon ansprechen würde: »Wissen Sie, Miss Philpot, Ammoniten erinnern mich irgendwie an Schlangen. Glauben Sie, dass es sich um eine Schlangenart handelt, die wir nicht kennen?« Stattdessen unterhielt man sich über die matschige Straße, die von Charmouth herführte, über die geeignete Garderobe für den nächsten Ball oder den Wanderzirkus, den man in Bridport zu besuchen gedachte. Kam das Gespräch überhaupt jemals auf Fossilien, dann nur, um sich über mein Interesse zu wundern: »Was finden Sie nur an diesen toten Steinen?«, fragte mich einmal eine neue Freundin Margarets aus dem Ballsaal.