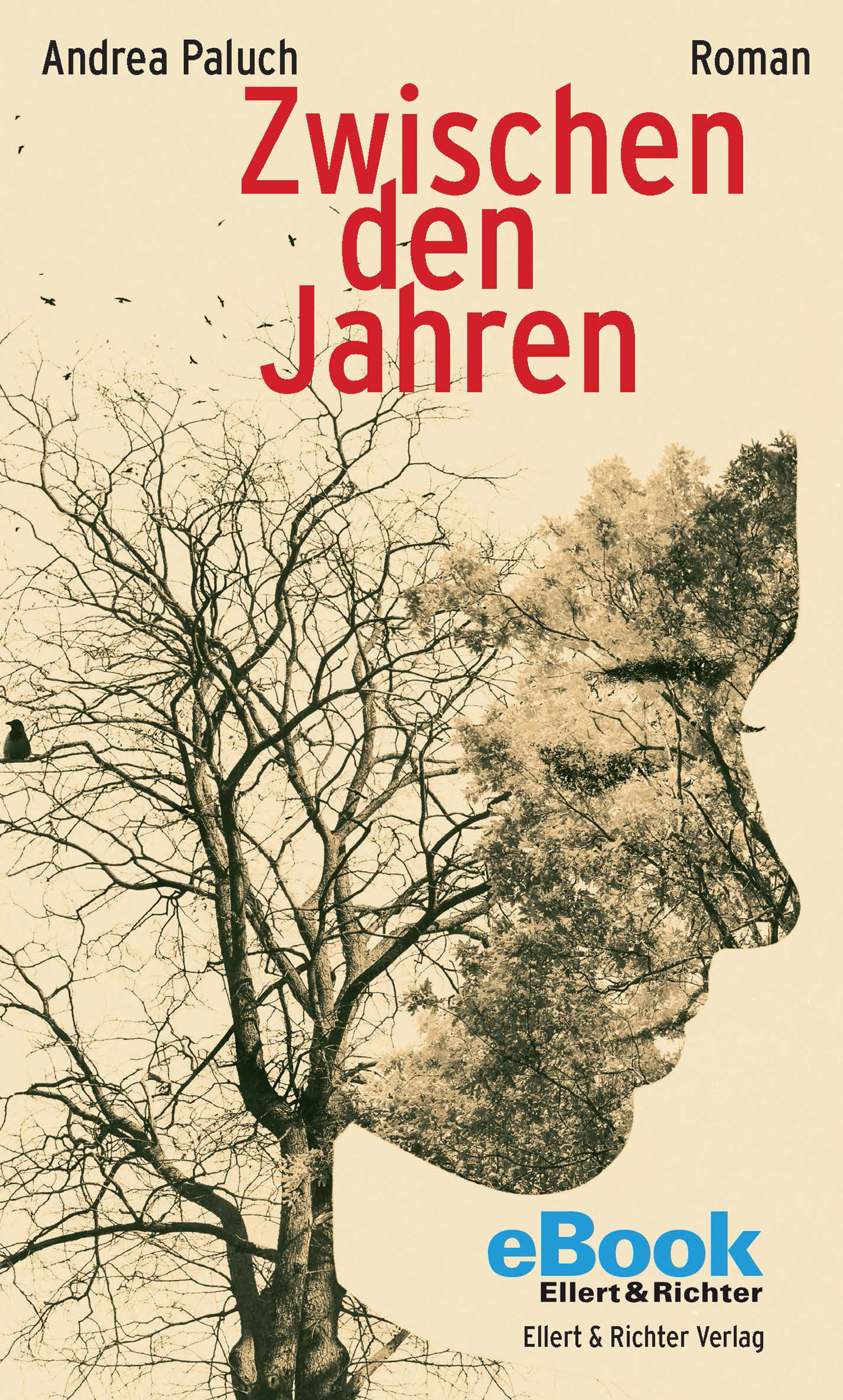
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ellert & Richter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Zwischen den Jahren" sind große Themen wie Liebesverrat, Verführung zum Seitensprung, Krieg in Afghanistan, Befehle zum Töten zentral, doch zu lesen sind sie in einem leichten, fließenden Ton. Das macht die Wucht des Textes aus. Er ist schnörkellos erzählt, scheinbar einfach, hat es aber in sich – Lebensweisheiten, die aber an keiner Stelle altklug daherkommen. Im Gegenteil: Sie wirken frisch. Ein Roman mit einer ungeheuren Tiefe. Der Leser ist dank der intensiven Ich-Perspektive der Erzählerin hautnah an den Gefühlen und dem Geschehen dran. Die literarischen Elemente werden in ihrer Wirkung von den klugen, radikalen Einsichten der Erzählerin über ihr Leben und ihr Eheleben, aber ebenso andere gesellschaftliche Entwicklungen wie das Internet oder die Medien ergänzt. Diese klugen Beobachtungen geben dem Roman die Dimension der Abrechnung einer ganzen Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Andrea Paluch
Zwischen den Jahren
Roman
Gut gehängt ist besser als schlecht verheiratet.William Shakespeare, Was ihr wollt
Yesterday I got so old
It made me want to cry …
The Cure, In Between Days
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Vita
I
Dies ist eine Geschichte über mich. Und sie endet gut. Jedenfalls für mich. Wenn man seine eigene Hauptperson ist, kann man selbst entscheiden, wie man am Ende seiner Geschichte dastehen will. Man kann der Wirklichkeit ein Schnippchen schlagen. Deshalb erzählen Menschen Geschichten, denke ich. Nicht, um die Wirklichkeit abzubilden, sondern um sie zu entwerfen. Da ich weiß, wie meine Geschichte endet, kann ich auch gleich sagen, was passieren wird. Es ist nämlich nicht die Geschichte eines Ehebruchs, in dem zwei Frauen und zwei Männer die Hauptrollen spielen. Es ist die Geschichte von mir und meinem Leben. Und das ist merkwürdig. Denn „mein Leben“, das bin ja ich. Und dennoch ist es mir manchmal fremd. Dies ist die Geschichte, wie mein Leben zu einem Ding wurde, einem mir äußerlichen Ding wie ein Auto oder ein Computer, und wie ich mich spaltete und wieder zusammensetzte. Und so beginne ich sie.
Zu meinem 40. Geburtstag bekam ich eine Perücke. Sie war blond, das Haar war glatt und voll und wie ein Pagenkopf frisiert. Tanya hatte sie mir geschenkt.
Tanya ist meine Freundin. Nicht irgendeine Freundin. Sie ist das, was ich eine beste Freundin nennen würde. Nicht so eine Kindheitsfreundin, mit der ich Kaugummiblasen geübt habe oder die Erste, die in mein Poesiealbum geschrieben hat, niemand, den ich schon ewig kenne und der deshalb einen Vertrauensvorschuss genießt, geschuldet den gemeinsamen Erfahrungen, die man macht, wenn man erwachsen wird und über die erste Achselhaarrasur redet oder was man mit seiner Zunge anfängt, wenn man einen Jungen küsst. Nein, Tanya ist eine fremde Frau, die ich mir als Freundin ausgesucht habe. Sie ist so, wie ich mich eigentlich gerne sehe – unkonventionell, spontan, frech und direkt.
Tanya habe ich im Tierheim getroffen, als wir unsere Katze dort holten. Sie stand vor einem Hundekäfig und sah dem Boxer und der Promenadenmischung darin beim Bellen zu. Als wir die Papiere unterschrieben und unseren kleinen Kater in einen Katzenkorb verpackten, ging sie an uns vorbei. Sie nickte. Als ich sie ansprach, tat ich es aus Mitgefühl.
Tanya ist trinkfester als ein Mann, jedenfalls als mein Mann. Der wird von Sekt immer müde, trinkt dann zwar mir zuliebe, abends, wenn er nach Hause kommt, mit rot unterlaufenen Augen noch ein drittes Glas, wird aber, was sonst so gar nicht seine Art ist, schweigsamer und schweigsamer, hört am Ende nur noch zu, wenn er nicht in Gedanken schon dem Schlaf nachhängt, nur um dann zu sagen: „Das letzte Glas wird immer voller, je länger du trinkst. Ich kann nicht mehr.“ Wer meinen Mann kennt, könnte an diesem Satz gleich mehrere Merkwürdigkeiten feststellen. Erstens ist es höchst ungewöhnlich, dass mein Mann zuhört. Ich meine, nur zuhört. Nicht dass er ein schlechter Zuhörer wäre, aber meistens redet er. Sagen wir so: Er hört zu, um danach besser reden zu können. So sind Männer? Nein, eben nicht. So ist mein Mann. Männer, wie ich sie kenne, wollen eigentlich nicht reden. Und ich liebe ihn, weil er es tut.
Als ich meinen Mann kennenlernte, hieß jener amerikanische Musiker, der mit „1999“ den Soundtrack meiner Jugend schrieb, noch Prince und nicht wieder Prince, nachdem er sich zwischendurch „the Artist formerly known as Prince“ genannt hatte. Und in einem seiner Songs, den ich immer auf dem Walkman hörte und dessen Titel ich nicht mehr erinnere, heißt es: „Tonight we make love with only words“. Der Walkman ist längst durch einen iPod ersetzt, aber die Textzeile ist unersetzbar.
Es ist auch keineswegs selbstverständlich, dass mein Mann rot unterlaufene Augen hat. Er ist nämlich ein attraktiver Mann. Sagen alle. Sage ich. Und die Falten um seine Augen, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind wie die grauen Haare, die jetzt seine dunkelblonden zu melieren beginnen, heben das eher noch hervor. Falten sind Lebenslinien im Gesicht. Und die meisten davon spiegeln sich in meinem, denn unser Leben ist geteiltes Glück.
Und dann ist hervorzuheben, dass mein Mann mit mir abends Sekt trinkt, sogar wenn er müde ist. Wenn Sie wüssten, wer mein Mann ist, würden Sie es vermutlich nicht für möglich halten. Denn seitdem er den neuen Job hat, ist er andauernd im Fernsehen, und wenn Sie auch Zuschauer eines öffentlich-rechtlichen Programms sind, glauben Sie wahrscheinlich, dass er Tag und Nacht arbeitet und in Ihrem Flachbildschirm wohnt. Gesehen haben Sie meinen Mann auf jeden Fall schon. Er ist Moderator beim Fernsehen und macht die Polit-Talkshow. Seitdem er sich mit Frau Merkel treffen kann, wann immer er will (das behauptet er jedenfalls nach dem zweiten Glas Sekt), hat sich unser Leben verändert. Er ist plötzlich für viele wichtig, nicht nur für mich, und wird wichtig genommen, von mir allerdings etwas weniger, weil ich seine neuen Gesprächspartner in der Regel nicht so schätze, und ja, er arbeitet viel. Was man so Arbeit nennt. Er liest Zeitungen, nimmt Einladungen zu Empfängen an, wie es ihm gefällt – und redet mit Leuten. Wer ihn so lange kennt wie ich, der würde zögern, dies Arbeit zu nennen. Für ihn jedenfalls. Für mich wäre es ein Albtraum und nicht mit Geld und guten Worten zu bezahlen. Aber für ihn verhält es sich so, dass all das, was ihm in seinen früheren Jobs Probleme gemacht hat, jetzt plötzlich Schlüsselqualifikationen sind. Sieben Dinge gleichzeitig tun, verschiedene Themen zusammenbinden und einen ganz neuen Zusammenhang entstehen lassen; Ungeduld, wenn ein Argument nicht kommt; die Leidenschaft für Neues und Desinteresse gegenüber dem, was bereits vergangen ist. Na ja, was ich sagen will: Er ist vielleicht wichtig und wird wichtig genommen. Aber er nimmt sich selbst nicht wichtig. Und schon gar nicht Merkel und die anderen. Für ihn ist das alles leicht. Und obwohl sich unser Leben verändert hat und wir beide gute Jobs haben – das klingt fast wie „Karriere“, die wir immer vermeiden wollten –, ist es so, als lebten wir rückwärts, als würden wir mit jedem Tag jünger. Die Kinder sind mittlerweile selbstständig, lesen sich selbst in den Schlaf, beherrschen den Busfahrplan und suchen sich zur Not auf Google Maps den Weg durch die Stadt, sodass ich mehr arbeiten kann, und das, obwohl mein Mann so selten da ist.
Oder mich mit Tanya treffen.
Mein Mann und ich, wir werden nicht nur täglich jünger, sondern auch mit jedem Jahr. So fühlt es sich an. So fühlte sich dieser vierzigste Geburtstag an. Auch wenn wir es uns nicht mehr jeden Abend sagten, auch wenn wir weniger Zeit miteinander verbrachten, war ich mit meinem Leben nie zufriedener. Vielleicht war ich gerade deshalb zufrieden, weil unsere gemeinsame Zeit knapp wurde. Das zeigte doch, dass das Leben intensiver wurde, dass sich der Erfolg, den wir nie wollten, ausweitete; dass es immer mehr Dinge gab, auf die ich stolz sein konnte, was nie der Plan war. Die Kinder, die ein eigenes Leben gegen meines durchsetzten, das Haus oder der Garten, der nun schon so bewachsen war, dass man Unkraut jäten und Laub harken musste, Beschäftigungen, die die gemeinsame Zeit noch mehr beschnitten. Trotzdem machte mir auch das Laubharken Spaß, wenn ich schwitzte und der Westwind so eisig war, dass er den Schweiß nicht von der Stirn sog, sondern nur kalt werden ließ. Und wenn die ersten Krokusse und Schneeglöckchen die schwarze Erde mit Farbtupfern infizierten, wenn ich die ersten Tannenreisige von den Rosen nahm, obwohl der Nachtfrost noch immer wiederkommen konnte, dann freute ich mich darauf, den Geruch des Winterbodens tief einzuatmen und mir die Gartenhandschuhe auszuziehen, um die Rauheit und die Feuchtigkeit der Erde auf der Haut zu spüren.
Es war okay, unser Erfolgsleben, weil es eine innere Distanz gab, eine Coolness, die mich anders machte, mich und uns.
Es hatte heftig geschneit. So heftig, dass Züge ausgefallen und Autobahnen gesperrt worden waren. Der Ostwind hatte die Felder abgeräumt und hohe Verwehungen aufgetürmt. Der Verkehr blieb stehen, die Welt drehte sich langsamer. Und die Sonne schien. Ein gebleichter Tag, mein vierzehntausendsechshundertster auf Erden, der Himmel wie Neonlicht, die Welt wie weiße Wäsche. Die Fenster waren seit dem Sommer nicht geputzt worden. Das Licht schälte den Dreck vom Glas. Regen mit Staub und Abgasen hatte es stumpf gemacht. So dreckig wie die Scheiben waren, so glücklich war unser Leben.
Wir verabschiedeten die Kinder in den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, und mein Mann kochte Kaffee in der Espressokanne, die er bei unserem ersten Urlaub in Italien auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Und ich, ich packte Tanyas Geschenk aus.
Ich setzte die Perücke auf. Die Haare fielen tief in den Nacken und vors Gesicht. Es fühlte sich an wie früher im Schwimmbad mit Badekappenpflicht. Dieser enge Zug um den Kopf, wenn man sich eine Gummihaube aufstülpt. Ich spürte das Gewicht einer zweiten Kopfhaut über meiner eigenen. Mein Mann pfiff laut über das Zischen des Espressokochers „Every Breath You Take“. Ich ging zu ihm und schlang meine Arme von hinten um seine Hüften. Er hatte mich nicht kommen hören, und ich spürte ein leichtes Zucken, als ich ihn berührte. Übermütig drehte er sich um – und wich zurück. Falls er sich bei meiner unerwarteten Berührung erschrocken hatte, der Schreck vor meinem Anblick war größer.
„Was“, fragte ich.
Ich glaube, und im Nachhinein erscheint es mir wie ein Zeichen, er hat mich im ersten Moment tatsächlich nicht erkannt. Ich meine, es waren nur er und ich im Haus und es waren nur andere Haare. Ich war noch so groß wie vorher, hatte den gleichen graublauen Pullover an und die gleiche Jogginghose, trug das gleiche Parfüm, wenn auch durch die Nacht aufgerieben, und hatte das gleiche Gesicht. Aber er erkannte mich nicht. Nicht sofort.
„Dein goldenes Haar Margarete“, sagte er dann.
Was sich wie eine Liedzeile der „Neuen Deutschen Welle“ anhört, ist ein Zitat von Paul Celan. Es kam aus einer Zeit, als wir begriffen, dass Sprache eine eigene Form der Wirklichkeit schaffen kann. Mein Mann nutzte diese Erkenntnis praktisch, indem er redete und redete und Welt auf Welt erschuf, ich nutzte sie theoretisch. Ich bin Dozentin für vergleichende Literaturwissenschaft. Dozentin, das klingt toll, nach Karriere eben, es ist aber keine. Ich bin keine Lehrstuhlinhaberin, keine Professorin, ich bin Dozentin, im akademischen Mittelbau steckengeblieben. Typische Frauenkarriere: zwei Kinder, ein aufgeschlossener Mann, der sicher Vatermonate genommen hätte, wenn es die damals schon gegeben hätte, und trotzdem hat der Tag nur vierundzwanzig Stunden und schlafen muss man auch und ab und zu durchatmen. In meinem Laptop steckt eine halbfertige Habilitation über „Die Suche nach der vollkommenen Sprache“, steckt da seit zehn Jahren. Welche Sprache sprach Gott, als er zu Adam redete? Gab es eine Ursprache, bevor sich die Völker trennten? Und ist die Hoffnung, in einen Zustand vor der babylonischen Sprachverwirrung zurückzufinden, eine Utopie, die zu leben sich lohnt?
Inzwischen müsste ich von vorn anfangen, so viele theoretische Verwerfungen hat es gegeben. Der Poststrukturalismus ist Vergangenheit, mit Lacan kann ich keinem mehr kommen. Anfangs wollte ich es nicht wahrhaben, dass ich die Kraft nicht aufbringen kann, die Habilitation fertig zu schreiben. Dann habe ich gekämpft, habe Interpretationen über die Genesis gelesen, über die Kabbala und das Esperanto. Und dann habe ich schließlich verstanden. Ich weiß es noch wie heute, den Moment, als mein Grübeln über Hieroglyphica und Grammatik endlich eine Antwort erhielt.
Seitdem ist es okay, dass ich nicht weltberühmt werde. Es ist okay, dass nach mir keine Straßen benannt werden und mich nicht noch in zweihundert Jahren Studentinnen in Fußnoten erwähnen. Mir reicht das kleine Glück, zu lesen und mit interessierten jungen Menschen, die Bücher nicht für gedruckte E-Books halten, über Literatur zu reden. Ich habe mich mit meinem Job arrangiert.
Eine Zeit lang hatten mein Mann und ich Seite an Seite für die gleiche Sache gearbeitet: Erkenntnis durch Sprache. Dann hatte er die Pferde gewechselt. Er hatte aufgehört, daran zu glauben, dass Sprache ein Sinn mit eigenem Recht sei, für ihn war sie lediglich Mittel zum Zweck. Er wurde Journalist. Da konnte er reden, so viel er wollte, und keine Bedeutung war ernst über den Tag hinaus.
„Was ist das?“, fragte er.
„Das bin ich.“
„Nein, das da –?“ Er zeigte auf meinen Kopf.
„Das bin ich auch“, sagte ich. Aber da täuschte ich mich.
Ich ging ins Badezimmer. Im Radio lief ein Bericht über zwei italienische Journalistinnen, die in der afghanischen Provinz Herat vermisst wurden. Ich suchte einen Sender ohne Nachrichten und Weihnachtsmusik.
Ich betrachtete mich im Spiegel. Ich sah mich nicht. Natürlich wusste ich, dass ich es war. Aber wenn man sich anschaut und sich selbst nicht erkennt, dann spaltet sich etwas. Dann trennt sich das Denken vom Körper, und der Körper wird einem fremd.
„Tanya hat sie mir geschenkt“, rief die blonde Frau in die Küche.
II
Tanya ist meine beste Freundin. Das habe ich schon gesagt. Sie ist seit einiger Zeit Sängerin in einer Rockband, die auf den Namen d.jam getauft wurde, was irgendwie nach Drogenmissbrauch klingt und vermutlich auch so gemeint ist.
Sängerin – das klingt nicht nur abgefahren, das ist es auch. Manchmal besuche ich sie in ihrem Proberaum, schlage die Beine übereinander und höre zu. Und wenn ich vollgedröhnt vom Bass nach Hause komme, dann hat mein Herzschlag den Rhythmus ihrer Musik.
„Schreibt sie sich deshalb mit Ypsilon?“, hatte mein Mann gefragt, als er ihren Namen zum ersten Mal las. Ich hatte ihm einen Zeitungsbericht über die Band gezeigt. Der Spott in seiner Stimme war voll gegen mich gerichtet. Es gibt diese seltsame Eifersucht von Männern auf die Freundinnen ihrer Frauen. Ich kenne das auch anders herum, als Freundin, die zum Störenfried abgestempelt wird.
„Du magst sie nicht, bevor du sie überhaupt gesehen hast“, sagte ich. Das war vor vier Jahren gewesen. Wir saßen unter einem Himmel wie Kirschsorbet.
„So ist es nicht. Nur –“
„Nur was?“
„Ich meine, sie ist Mitte dreißig oder so. Muss sie so tun, als wäre sie ein Rockstar?“
„Was willst du mir sagen? Dass man mit Mitte dreißig nichts Neues mehr anfangen soll?“
Er zog die Zeitung zu sich rüber.
„Hat sie gefärbte Haare?“
„Gefällt sie dir doch?“
„Wie alt, sagtest du noch, ist sie?“
„Du sagtest, sie ist Mitte dreißig …“
Tanya war einen Kopf kleiner als ich und hatte dunkles Haar, das ins Kastanienbraune überging. Selbst auf dem matten Papier des Zeitungsfotos schimmerte es. Man sah ihr an, dass sie Sport trieb. Sie machte Step Aerobic und Power Yoga. Sie stand immer in der ersten Reihe. Niemand macht das normalerweise freiwillig, aus Angst, peinlich zu sein oder dumm aufzufallen. Sie sagte: „Hinten sehe ich nur die Fehler der anderen.“
Sie war keine zierliche Frau. Im Gegenteil, sie hätte genauso gut rundlich sein können, aber so gern wie sie lebte, trank und tanzte, so hart war sie gegen sich selbst, wenn es um körperliche Fitness ging. Und diese Härte hatte sie mitunter auch gegenüber Menschen. Auch denen gegenüber, die sie mochte. Auch mir gegenüber.
Unser erstes Nachtgespräch im Garten. Wir hatten die Füße auf die Blumenkübel gelegt und schauten den Fledermäusen zu, die über unseren Köpfen Mücken und Motten vertilgten. Ich überlegte, wie viel Leben wohl eine Fledermaus in einer Nacht auslöscht. Die tönernen Kübel gaben den heißen Tag langsam wieder ab.
„Ich muss dich warnen“, sagte Tanya. „Meine Freundschaften scheitern.“
Mein Mann telefonierte im Haus.
Was wollte sie von mir? Wir tranken zusammen Sekt, und ich zog ab und zu an ihrer Zigarette, nach zwanzig Jahren Nichtrauchen. Irgendwie klang es, als wollte sie mir eine Beziehung vorschlagen.
„Es liegt an mir, klar. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, was ich falsch mache.“
Ich wusste es. Ich hätte es ihr sagen können. Ich war bei der Probe dabei, als sie Marlene, der Gitarristin, sagte: „Du musst dich entscheiden. Entweder oder.“ Die beiden spielten als Duo zusammen. Es hatte was, die Rocksongs der Band unplugged zu hören. Mir gefiel das fast besser. Aber als es die ersten Konzerte geben sollte, stellte sich heraus, dass Marlene nicht auftreten wollte. Ich weiß nicht, ob es Lampenfieber war oder weibliche Bescheidenheit oder Zweifel an der Qualität von Tanya oder ihr oder beiden. Aber Tanya fragte nicht nach, sondern sagte ihr, was Sache war. Und damit hatte sich die Freundschaft erledigt.
„Hast du mal überlegt, wie es wäre, nicht du zu sein?“, fragte sie.
„Ich wollte früher immer Aschenbrödel sein“, gab ich zurück. „Nur die wahre Liebe erkennt die Prinzessin in ihr.“
„Nein, nicht als Kind. Heute. Ich meine, ich bin zwar ich, aber führe ein anderes Leben. Ich bin ja gerne ich. Aber ich würde gern wissen, wie es ist, wenn man Kinder hat. Oder einen Mann. Einfach wie es ist, wenn man sein Leben neu zusammenwürfelt.“
„Kinder zu haben fühlt sich an, als hättest du zu wenig Schlaf gehabt“, sagte ich.
„Und einen Mann?“
„Meinst du meinen?“
„Ich meine einen, den man für immer hat. Mit dem man sein Leben teilt. Ich würde gern wissen, wie es ist, wenn man treu ist.“
III
Und jetzt hielt ich Tanyas Perücke in den Händen, setzte sie auf und ab und drehte mich unter den Augen des Mannes, von dem Tanya gerne wissen wollte, wie es war, seine Frau zu sein. Später erzählte sie mir von ihren Männern, und wie sehr es sie erschöpfte, immer wieder von vorne anzufangen.
„Beziehungswechsel, das ist der Fluch unserer Generation“, sagte sie. „Wir dachten, es wäre cool, möglichst häufig andere Partner zu haben, tatsächlich wurden wir nur immer beziehungsunfähiger. Ich kann noch nicht mal Frauen eine gute Freundin sein.“
Dann fragte sie mich, ob ich meinem Mann eine gute Frau sei.
„Definiere ‚gute Frau‘“, sagte ich.
Gebügelte Moderatorenhemden? Jeden Abend ein gedeckter Tisch? Ein Schlips zu Weihnachten? Nichts dergleichen.
Sie: „Spielt ihr euch im Bett etwas vor?“
Ich: „Immer.“





























