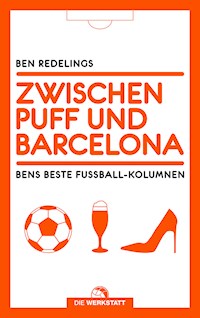
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Die Werkstatt
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Über 600 Kolumnen hat Ben Redelings seit 2015 auf ntv.de, der Internetplattform des gleichnamigen Nachrichtensenders, veröffentlicht – und erreicht damit ein Lesepublikum in Millionenhöhe. Mit "Zwischen Puff und Barcelona" legt er nun erstmals eine Auswahl seiner besten Texte vor – amüsant, fachlich-prägnant und immer unterhaltsam reflektiert der Bestseller-Autor die unendlichen Geschichten des Fußballs mit einer stets menschlichen Note. Ein besonderer Lesegenuss für alle Fußballfreunde!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2021 Verlag Die Werkstatt GmbH
Siekerwall 21, D-33602 Bielefeld
www.werkstatt-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlag: High Heel von Husein Aziz / Noun Project
Satz und Gestaltung: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen
ISBN 978-3-7307-0571-1
In Zusammenarbeit mit ntv Nachrichtenfernsehen GmbH 2021, vermarktet durch Ad Alliance GmbH
Ben Redelings
Zwischen Puff und Barcelona
Bens beste Fußball-Kolumnen
VERLAG DIE WERKSTATT
Inhalt
„Bitte einen achtfachen Cognac!“
Ein Hoch auf Trainer-Legende Uwe Klimaschefski
Wie Maier die Luft aus dem Schwachsinn ließ
„Deadline Day“? Ein aufgeblasener Schwachsinn
Papa, ich möchte bitte einen anderen Verein!
Wie fixe ich mein Kind für meinen Verein an?
Wenn es Größeres gibt als den WM-Titel
Timm Klose und Uli Borowka sprechen offen über Alkoholsucht
Schön wie Lothar, elegant wie Maradona
2006 sorgte der Nacktlöwe Goleo für Aufregung
Wenn der Designer im LSD-Rausch ist
Kölner Karnevalstrikot? Da fehlt jetzt nur noch der Tusch!
Ein Leben zwischen Puff und Barcelona
Rolf Töpperwien zum 70. Geburtstag
Als es bei Paul Breitner ganz flüssig lief
Die kuriose Geschichte des Elfmeters in der Bundesliga
Die irre Geschichte des verschollenen WM-Pokals
Das Rätsel um sein Verschwinden ist bis heute nicht gelöst
Anekdoten hier, ganz viel Erotik dort
Wenn (Fußball-)Profis Bücher schreiben
Bayern vernichtete schon einmal einen Weltstar
Das 8:2 gegen Barça und die Messi-Folgen
Blind, arrogant und immer musikalisch
Was wäre der Fußball ohne Schiedsrichter?
Als die Hosen Uli Hoeneß reizten
Düsseldorfs bekannteste Punkband und ihr „Bayern“-Song
München ist wie ein Zahnarztbesuch
Katrin Müller-Hohenstein und Gala-Gäste sorgen für Lacher
Heinz Höher, Kind der Bundesliga
Heinz Höher ist tot
Vom Torhagel zum Meistertrainer
Er war der erste Feuerwehrmann der Liga
„Wir rülpsen nicht, wir kotzen schon!“
Kondome, Aftershave, Rasierapparate – und Paul Gascoigne
Dem BVB ist ein Wunderkind geboren
Was Erling Braut Haaland auf den Platz zaubert, übertrifft alles
„Das waren Mörder!“
Ist der Fußball zu ruppig geworden?
La Ling zerstört den Traum der DDR
2:0 gegen Holland vorn – und dann das …
Als Bayern Bayer zu „Vizekusen“ degradiert
Wie Leverkusen im Mai 2000 die Meisterschaft verliert
Der „Tiger“ mit dem Trainer-Stäbchen
Erinnerung an einen legendären Abend mit Hermann Gerland
Als Eintracht Frankfurt in Rostock eskalierte
Mai 1992, Ostseestadion. Das Trauma lebt bis heute weiter
Thomas Müller und die Leichtigkeit des Seins
Zum 100. Länderspiel von Bayerns Thomas Müller
Mach’s wie Peter Neururer!
Manchmal ist die alte Liebe eben nicht die schlechteste
Ewald Lienen wurde gehalten, um zu bleiben
Als nichts mehr ging, hielt St. Pauli am Trainer fest
Als die Gegenspieler „wuff-wuff“ machten
Das Revierderby hat irre Geschichten geschrieben
Zlatan Ibrahimović hält sich für Gott
Die sagenhaften Sprüche des schwedischen Enfant terribles
2016 war ein Arschloch, bis auf
… Gewinner wie Ronaldo, Will Grigg und Island bei der EM
„Für den BVB haben wir uns nicht mal umgezogen“
Erwin und Helmut Kremers – Legenden auf Schalke
Die Erotik-Puppen liegen im Kofferraum
Sandro Wagner findet die Spielergeneration „aalglatt“ peinlich
„Finito, basta, Kasper, geh nach Hause“
Monogamie? Nicht auf der Trainerposition beim FC Schalke
Der feine Herr, der so streitbar war
Zum Tod von Torhüter-Legende Hans Tilkowski
Bambi im Land der geilen Böcke
Heute führen auch Fußballfans Vielehen
Ancelotti kaut und langweilt sich
Die 53. Bundesliga-Spielzeit bot höchst amüsanten Stoff
Nations League? Dafür bin ich schon zu alt
Das ist so wie mit unserem ersten VHS-Rekorder
Ohne Holland macht es keinen Spaß
Ein weiteres Fußball-Großereignis ohne den Erzrivalen?
Als Kapellmann den FC Bayern belehrte
Er war der Leroy Sané des Jahres 1973
Der Schließmuskel des Verbalhexers
Thorsten Legat ist der heimliche Favorit des RTL-Dschungels
„Heri, mach keinen Scheiß!“
Mit Heribert Bruchhagen wird es nie langweilig
Als sich fünf Schalker mal im Wald verliefen
Ja, Spieler hassen Trainingslager
Beiersdorfer holte den Zeitlupen-Uruguayer
Trainerfuchs Huub Stevens gewährt spektakuläre Einblicke
Claudio Pizarro lebt unseren Traum
Mit über 40 Jahren entscheidet er noch wichtige Spiele
Torsten Mattuschka – der Ribéry des Ostens
Union Berlins Kultkicker mit Herz und Plauze
Der pöbelnde Egozentriker hat überreizt
Coach Gertjan Verbeek beleidigt „Bild“-Reporter und noch mehr
„Hans, trinken Sie nicht so viel!“
1954er-Weltmeister Hans Schäfer zum 90. Geburtstag
Wenn Liebe so wunderbar blind macht
Erinnerungen überblenden die menschlichen Schattenseiten
„Immer mehrere auf einmal“
Einst redeten die Fußballhelden frei Schnauze – lustig war’s
Der „Mister HSV“ der glorreichen Zeiten
Manfred Kaltz hat kein Abschiedsspiel bekommen
Rooneys Gehirn ist in der Hose
Wayne Rooney hat seine Frau betrogen. Wieder einmal
Das zynische Schicksal des Werner Hansch
Das Geständnis, spielsüchtig zu sein
„Alter, wollen die uns verarschen???“
Trainerverpflichtungen sind selten Liebeshochzeiten
Der HSV geht niemals so ganz
Der Hamburger SV war immer da! 55 Jahre Bundesliga
„Für mich war Fußball alles“
Ein Hoch auf den großen Bernard „Ennatz“ Dietz
Rendezvous mit einer WM-Legende
Eine persönliche Begegnung mit David Odonkor
Löw umschifft elegant einen Eklat
Die Nicht-Nominierungen von Sandro Wagner und Leroy Sané
Warum Ahlenfelder es besser hatte als Kruse
Löw streicht Max Kruse aus dem DFB-Kader
Der Sonnenkönig der Bundesliga ist tot
Zum Tod von Günter Eichberg
Mario Basler nimmt Kippen mit ins Grab
Rauchen und Fußball, das passt eigentlich nicht zusammen
Als Giovanni Trapattoni zum Vulkan wurde
„Ich habe fertig“, „Flasche leer“ und „Was erlaube Strunz?“
Irgendwann mit der Schale in der Hand?
Zwei Geburten und die deutsche Meisterschaft
Der Fußball steht kurz vor dem Infarkt
Höchste Zeit, nach Hilfe aus der „Schwarzwaldklinik“ zu rufen
Einen wie Hrubesch kriegt der DFB nie wieder
Ab heute ist Horst Hrubesch Fußball-Rentner
Warum Kimmichs Weg ein besonderer wird
Wie selbstbewusst der Jungstar in große Fußstapfen tritt
Sein Herz kann man nicht betrügen
Am Wochenende habe ich mit der TSG Hoffenheim gefiebert
Fußball ist heute unwichtig
Wenn das Ergebnis dich nicht interessiert
Als Thomas Tuchel die Spieler des BVB beleidigte
Sportjournalist Pit Gottschalk offenbart ein pikantes Detail
Schalkes „charakterlose Gesellen“
Lieber Teile der Mannschaft als den Trainer rausschmeißen?
Als Stefan Effenberg beim Rodeln verunglückte
… und wie man sich beim Paket-Öffnen übel verletzen kann
Familienfeier mit schwarzem Schaf
Einweihung der „Hall of Fame“ – und DFB-Präsident Grindel
Ulis zweites Gesicht
Eiskalt & egoistisch – Uli Hoeneß kann auch ganz anders
Der Terrorgnom und der Flugkapitän gehen
Ein Blick zurück auf „Robbery“
Wenn Papa und Sohn den BVB besiegen
Der VfL Bochum schlägt Borussia Dortmund mit 10:4
Der gefeierte BVB-Retter mit dem Masterplan
„Aki“ Watzke zum 60. Geburtstag
Warum Stefan Kuntz bei Kai Pflaume heulte
U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist nah am Wasser gebaut
Ansgar Brinkmann ist ein Phänomen
Zum 50. – Erinnerung an wahnwitzige Begegnungen
„Ihr könnt Eimer zum Kotzen mitnehmen“
Die Sommerpause ist die Zeit für herrlichste Anekdoten
Der Fips Asmussen unter den Spielerberatern
In Erinnerung an Norbert Pflippen
Dieses Mal ist der FC Bayern fällig!
Der VfL Bochum freut sich schon auf das DFB-Pokal-Duell
Mit RB Leipzig ist es wie mit Trump
Die Widerstände gegen das Brausekonstrukt werden leiser
Die lahmste Ente der Bundesliga
Eine Verneigung vor Michael „Ata“ Lameck
Er hätte sogar den Bundeskanzler gestürzt
Rückblick auf die irre Karriere des Trainers Rudi Gutendorf
BVB-Monster brauchen kein Viagra-Omelett
Ist Mentalität am Ende etwa doch nicht alles?
Wenn der Arsch tüchtig Kirmes hat
Fans wissen: Bald kommen wieder Tage des Sonnenscheins
Ehrlichkeit? Das ist eine Seifenblase im Fußball
Im Fußballgeschäft lernt man ganz anständig zu lügen
Die tiefe Sehnsucht nach Jürgen Klopp
Lucien Favre offenbart das eigentliche Problem des BVB
Der bodenständige Weltmeister sagt Adieu
Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere
Ihr werdet den Fußball nie verstehen
Der 1. FC Kaiserslautern steigt in die 3. Liga ab
Der Tag, als der Tod kam
Ein Tag, an den ich mich immer mit großem Schmerz erinnere
Wozu gibt es eigentlich ’ne Winterpause?
Schneestürme, keine Rasenheizungen – eisige Erinnerungen
Das große Wundern über Winnie Schäfer
Mann mit wallender Mähne und „tausend Gesichtern“
Schalke müsste es wie die Bayern machen
Nübel oder Schubert? Im Idealfall so wie Olli Kahn beim FCB
Als Calmund den FC Bayern reinlegen wollte
Oder: Wie erfinderisch Bundesliga-Offizielle werden können
Auch der beste Schiri der Welt macht Fehler
Pierluigi Collina – die berühmteste Fußball-Glatze der Welt
Das Spiel ist eh schon lange verloren
Champions-League-Sperre für ManCity? Daran glaubst du?
Witz und Weltfrieden statt Fadenkreuze
Fans am Pranger? Es geht auch ganz anders
Als Calli acht Crème brûlée inhalierte
Auf „11Freunde“-Partys wird gut gegessen
„Bitte nennt mich Berti McVogts …“
Der Trainer Berti Vogts hätte Besseres verdient gehabt
Wie Schumacher den deutschen Fußball provozierte
Mit seinem Buch „Anpfiff“ trat er einen Riesenskandal los
Der Götze hinter der Fassade
Im Kino läuft der Film „Being Mario Götze“ an
Neururers spektakulärer Unfall
Verletzungen – nur weil er helfen wollte
Bleibt das Jahrhunderttalent auf Schalke?
Noch hat Nationalspieler Leon Goretzka S04 nicht verlassen
Lasst die Schnellfeuer-Gewehre ruhen!
Schiri Ahlenfelder und sein berühmtester Halbzeitpfiff
Der Transfer, der Christoph Daum (fast) das Leben gekostet hätte
Es geht ums nackte Überleben!
Der FC Bayern ruiniert sich das eigene Geschäft
Wenn Dauer-Siegen zum Problem wird
„Der Emma hat mir in die Eier gezwickt“
Über die BVB-Ikone Aki Schmidt
Papa, ich habe jetzt einen anderen Verein!
Hilfe, der Sohn eines Kollegen ist jetzt Fan von RB Leipzig
Zum Autor
Editorische Anmerkung
„Bitte einen achtfachen Cognac!“
„Unsere Spieler können 50-Meter-Pässe spielen: fünf Meter weit und 45 Meter hoch.“ Wer hat’s gesagt? Der legendäre Trainer Uwe Klimaschefski – gleichermaßen gefürchtet wie geliebt. Warum? Weil er die Spieler gefördert hat – mal so, mal so.
Man kann mit Fug und Recht behaupten: Uwe Klimaschefski ist der Sprüchekönig unter den Bundesliga-Trainern. Dass ihn heute dennoch viele Fußballfans nicht mehr kennen, hat damit zu tun, dass er nie die ganz großen Erfolge feiern durfte. Auch wenn er manchen Scherz und Schabernack mit seinen Profis trieb („Meine Spieler sind Intellektuelle. Die haben Maos Tod letzte Woche noch nicht verkraftet“), haben sie ihn trotz allem geliebt und verehrt. Franco Foda sagte einmal: „Wer unter Klimaschefski ein Jahr durchhält, der ist einen großen Schritt weiter im Leben gekommen und braucht sich vor nichts mehr zu fürchten.“
Vor 25 Jahren saß der gebürtige Bremerhavener übrigens sogar einmal für ein einziges Spiel auf der Bank des heutigen Bundesligisten SV Darmstadt 98. Doch nach einer 0:2-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth war schon wieder Schluss bei den Lilien. Es hat einfach nicht gepasst für den Mann, der einmal so schön sagte: „Als Bundesliga-trainer siehst du doch schon am Gang, ob einer Fußball spielen kann oder bei der Müllabfuhr ist.“
Schon als Spieler verstand es Klimaschefski, sein Schicksal tatkräftig selbst in die Hand zu nehmen. Als er 1963 zum Start der neu geschaffenen Bundesliga einen Verein suchte, zeigten sich gleich mehrere Klubs interessiert. Klimaschefski hatte die Qual der Wahl. Innerlich hatte er sich nach einem Angebot aus Berlin bereits für die Hertha entschieden, doch da er schon einen Termin mit dem Präsidenten von Saarbrücken gemacht hatte, wollte er diesen auch wahrnehmen. Das einzige Problem: Die Vertreter von der Hertha (Präsident Holst) und aus Saarbrücken waren für denselben Tag angemeldet. Klimaschefski erinnert sich: „Es kam, wie es kommen musste. Plötzlich klingelte es, und der andere Verhandlungspartner stand vor der Tür. Herr Holst musste sich dann so lange im Bad versteckt halten, bis ich den Saarbrückern abgesagt hatte. Danach war ich Herthaner!“
Während seiner Karriere hatte Klimaschefski immer mit einer Fehlstellung seiner Beine zu kämpfen gehabt. Als er später als Trainer einmal arbeitslos war, nutzte er diese Zeit sinnvoll. Bei einer Operation ließ er sich die O-Beine („Derjenige, der mich tunnelt, kriegt zwei Beinschüsse zurück“) richten. Noch als Spieler hatten ihn seine Kameraden so sehr gehänselt, dass er sich nachts die Knie mit Bettlaken zusammenband. Nun war er wieder zu Späßen aufgelegt: „Wenn du jetzt einen mit geraden Beinen triffst, bin ich es.“
Der Trainer Klimaschefski war bei seinen Spielern gleichermaßen gefürchtet wie beliebt. Seine stets gerade, offene Art gefiel aber verständlicherweise nicht allen Profis. Jemand, den er direkt anging, musste schon einmal kräftig schlucken: „Was will der? Geld? Der soll froh sein, wenn er auf unserem Platz den Sauerstoff kostenlos einatmen darf.“
Ein unbändiger Ehrgeiz stachelte Klimaschefski an, wie Homburgs damaliger Spieler Harald Diener einmal der Presse verriet: „Wenn unser Trainer mit seiner Mannschaft im Rückstand liegt, dauert ein Spiel oft drei Stunden. Wenn man dann heimkommt, sind die Filets so hart, dass man sie nicht mehr essen kann.“ Niederlagen nahm der Bremerhavener persönlich. Nach einer verlorenen Partie bei einem Hallenturnier raunzte er seine Spieler an: „Jetzt zieht euch warm an. Ich reiße euch den Arsch auf. Bis zur Naht!“
So manches Mal saß er nach einer Niederlage im Presseraum, schaute kurz die Journalisten an und eilte dann hinfort: „Weitere Fragen kann ich nicht beantworten. Ich muss jetzt zu meinen Spielern. Die sind so blind, dass sie den Weg von der Kabine zum Bus nicht finden.“
Als ein Pressevertreter einmal wissen wollte, wann der Trainer denn die nächsten Spieler verkaufen würde, antwortete Klimaschefski: „Wenn die Schrottpreise wieder steigen!“ Mit seinen Profis ging er gerne verbal hart ins Gericht: „Unsere Spieler können 50-Meter-Pässe spielen: fünf Meter weit und 45 Meter hoch.“
Berühmt-berüchtigt waren auch des Trainers Scherze mit neuen Spielern. Bei einer Übungseinheit besorgte Klimaschefski eine Platzwalze und gab das Kommando aus: „So, Jungs, wir machen heute einen Härtetest. Jeder zieht die Walze 400 Meter. Dabei fahren wir die Löcher zu, die die Leichtathleten mit ihren Schuhen aufgerissen haben. Der Neue da fängt an.“ Auf den ersten 100 Metern rollte die Walze gut an. Der Ehrgeiz, sich nicht zu blamieren, zog kräftig mit. Nach 200 Metern wurde der Neuling so klein, dass er die grinsenden Spieler auf der anderen Seite nicht mehr sehen konnte. Ins Ziel kam er beinahe auf allen vieren. „Gut gemacht“, lobte ihn der Trainer, „aber ich habe gesehen, dass die Übung doch wohl etwas zu schwer ist und außerdem zu gefährlich. Die Walze hätte dich ja beinahe überrollt. Wir brechen ab!“
Einen spanischen Testspieler ließ Uwe Klimaschefski einmal in voller Fußballkluft unter der Dusche mit dem Ball jonglieren: „Lass mal sehen, wie du bei Regen spielst!“ Und als Dieter Müller aus der Schweiz in die Bundesliga zum 1. FC Saarbrücken zurückkehrte, sah Klimaschefski noch viel Arbeit auf seinen Stürmer zukommen: „Von seinem Grasshopper-Trip hat er eine Menge Schweizer Speck mitgebracht.“
Spieler lehnten sich gegen den Trainer eher selten auf. Doch in seiner Zeit beim FC Homburg gab es dafür einen anderen harten Brocken. Ein Unerschrockener mit dem Spitznamen „Underberg“ leistete dem Trainer von Zeit zu Zeit Widerstand. Es war der Platzwart des FC. An einem Rosenmontag befahl Klimaschefski seinen Spielern, den Mann am Pfosten mit Springseilen festzubinden. Anschließend machte die Mannschaft Torschusstraining. Der ganze schaurige Spuk endete nach knapp fünfzehn Minuten. Die Frau des Platzwarts kam mit einem Brotmesser aus der Vereinsgaststätte gestürmt und schnitt ihren Mann vom Pfosten los.
Doch schon bald sollte „Underberg“ wieder für Ärger sorgen. In einem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den HSV lagen die Hamburger 2:1 in Homburg in Führung – doch dann gab es einen Elfmeter für den FC. Den Ball parierte HSV-Torwart Rudi Kargus nur knapp. Homburg schied aus, und Klimaschefski war sauer. Am nächsten Morgen wandelte er schon früh durch das leere Waldstadion. Auf dem Rasen blieb er am Elfmeterpunkt stehen. Klimaschefski schaute sich die Entfernung vom Punkt zum Tor mehrmals aus allen möglichen Perspektiven an. Dann stand für ihn fest: Hier stimmt etwas nicht! Er holte sich einen Zollstock und maß nach: 2, 4, 6, 8, 10, 12 …! Etwas mehr als zwölf Meter war der Elfmeterpunkt von der Torlinie entfernt. Sofort zitierte er den Platzwart herbei. Doch „Underberg“ war sich keiner Schuld bewusst. Schulterzuckend meinte er nur: „Wenn der den Ball von zwölf Metern nicht reinkriegt, dann hätte er den von elf auch nicht reinbekommen.“ Über ein Vierteljahr hat Klimaschefski anschließend kein Wort mit dem guten Mann geredet.
Dabei hätten sich die beiden eigentlich ganz gut verstehen müssen – schließlich trank Klimaschefski selbst gerne einen mit. Denn wie sagte er einmal nach einer unglücklichen 1:2-Niederlage seiner Saarbrücker bei Bayer Uerdingen auf der anschließenden Pressekonferenz so schön: „Bitte einen achtfachen Cognac!“
Wie Maier die Luft aus dem Schwachsinn ließ
Bald wird er wieder zelebriert, der „Deadline Day“. Zeit, diesem aufgeblasenen Massenbelustigungs-Schwachsinn am Ende der Transferfrist etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel Sepp Maier und einen echt wahnsinnigen Anti-Transferrekord.
Der „Deadline Day“. Am 31.08. ist es so weit. Unglaubliche Spannung, riesige Summen – aufgeblasener Schwachsinn. Es wird Zeit, diesem grotesken Massenbelustigungs-Spektakel etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel einen echten, wahnsinnigen Rekord.
Vor 49 Jahren, am 20. August 1966, startete ein gewisser Josef Dieter, besser bekannt unter seinem Rufnamen „Sepp“, Maier eine unglaubliche Serie. 442 Bundesliga-Partien stand der Torwart des FC Bayern München ununterbrochen im Kasten des Rekordmeisters. Das sind 13 komplette Spielzeiten am Stück für ein und denselben Verein. Kein „Deadline Day“ dieser Welt kann eine spektakulärere Geschichte schreiben als diese.
Und es hätte ewig so weitergehen können, denn Sepp Maier hatte einen festen Plan: „Erst wenn ich Moos auf den Knien habe und die Kameraden mich beim Einlaufen stützen müssen, dann höre ich auf.“ Doch der 14. Juli 1979 veränderte alles. An diesem Tage geriet das Auto des Bayern-Torhüters ins Schleudern und krachte auf regennasser Straße in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es waren die Sekunden, in denen eine große Karriere zu Ende ging. Knapp 24 Stunden nach seinem verheerenden Autounfall fragte die Presse bereits, ob die „Bayern nun einen neuen Torwart holen“ müssten. So ist das Geschäft. Ohne Sentimentalität und ohne ein Gedächtnis. Das musste auch der Weltmeister Maier in diesen Tagen schmerzhaft erfahren. 13 lange Jahre hatte er kein einziges Spiel verpasst und nun das. Katsche Schwarzenbeck gab die einzig richtige Antwort in diesem Moment: „Mich interessiert jetzt wirklich nicht, wer nun bei uns im Tor steht oder ob wir einen anderen Keeper kaufen müssen. Am wichtigsten ist, dass der Sepp schnell wieder gesund wird!“
Und diese Gesundheit hing tatsächlich am seidenen Faden. Am Ende war es Uli Hoeneß, der Sepp Maier das Leben rettete. Als er den Torwart im Krankenhaus besuchte, war Maier nicht der Maier, den der Bayern-Manager kannte. Hoeneß war betroffen. „Sepp, da stimmt doch was nicht. Du brauchst sofort einen Spezialisten“, rief der Ex-Mannschaftskamerad und rannte augenblicklich aus dem Zimmer. Auf Hoeneß’ Drängen wurde Maier in ein anderes Krankenhaus verlegt. Das beherzte Einschreiten seines Freundes rettete dem Torhüter damals das Leben.
Die heute undenkbare Folge von 442 Partien am Stück konnte Maier nur erreichen, weil er auch mit kleineren Blessuren weiterspielte. Nach einem Tritt mit der Stiefelspitze eines gegnerischen Stürmers in die Rippen erzählte der Bayern-Tormann statt zu klagen lieber etwas Humorvolles: „Kennt ihr den Witz vom Neger [dieses Wort galt damals noch nicht als anstößig, Anm. d. Autors], der beim Krieg zweier Stämme einen Speer in die Brust bekommt? Ein anderer fragt den Verletzten: ,Tut’s weh?‘ Er antwortet: ,Nur beim Lachen.‘ Und so ähnlich geht’s mir auch.“
Maier sagte einmal: „Verletzen kann man mich schon, aber ich habe ein gutes Ersatzteillager.“ Er begründete seine Robustheit damit, dass er einer vom Lande sei, der von klein auf mit „Körnern gefüttert“ wurde. Die körperliche Unempfindlichkeit habe jedenfalls nicht an einem speziellen Fitnesstraining gelegen – denn das gab es erst gar nicht: „Bei uns früher sind die Eisen im Keller verrostet.“ Und verletzte er sich doch einmal, so konnte er auch auf seine Fans zählen. Der Rentner Kurt Preisenberger, der damals die Fanpost des FC Bayern betreute, erinnert sich: „Als einmal bei einem Spiel dem Sepp Maier drei Zähne eingeschlagen wurden, kam am nächsten Tag ein Eilpäckchen mit drei Ersatzzähnen.“ Maiers ultimativer Trick: Er stand auch im Winter barfuß in seinen Schuhen. „So habe ich mehr Gefühl für den Boden“, schmunzelte der Bayern-Keeper.
Am Ende fiel Maier der Abschied schwer. Denn als er wieder fit war, durfte er nicht spielen. Er war sauer und rief stark angetrunken mitten in der Nacht bei seinem Trainer an, um sich Luft zu machen. Er fühlte sich schlecht behandelt von seinem Coach: „Als Csernai noch Lorants Assistent war, kroch er mir in den Hintern. Ich habe ihm zum Cheftrainerposten mitverholfen, dafür lässt er mich jetzt hängen.“ Csernai reagierte besonnen: „Ich habe doch nicht diesen Unfall gebaut, sondern Sepp! Die lange Zeit, die er wegen seines Unfalls von der Mannschaft getrennt war, hat ihn verändert. Er lebte nur noch in seiner eigenen Welt. Als er zurückkam, machte er nur noch Stunk, das hat ihm die Mannschaft nicht verziehen. Sepp hatte nicht bemerkt, dass mit den anderen in seiner Abwesenheit etwas vor sich gegangen war. Es war plötzlich eine fremde Mannschaft, die er noch dazu durch seinen Unfall in eine schlimme Lage gebracht hatte. Jeder von uns wusste doch, wie der Sepp immer mit dem Auto rast. Der Sepp soll zufrieden sein, dass er noch lebt. Dafür sollte er dankbar sein.“
Diese Erkenntnis setzte sich langsam, aber stetig bei Maier durch. Zum Saisonende war endgültig Schluss: „Fußball, das war meine Welt, meine große Welt! Zuletzt, als ich nur noch auf der Tribüne gesessen bin, als das Flutlicht angegangen ist, habe ich erst gespürt, was mir der Fußball wirklich bedeutet. Jedes Mal lief mir eine Gänsehaut den Rücken runter. Früher, als ich voll dabei war im Spiel, hab ich doch nie mitbekommen, was das für eine Atmosphäre ist!“ Nach 473 Spielen sagte Sepp Maier der Bundesliga vorerst Adieu. Sein Rekord wird als sein Vermächtnis ewig bestehen bleiben. Die diesjährige Rekordablösesumme dürfte hingegen beim nächsten „Deadline Day“ bereits wieder Geschichte sein.
Papa, ich möchte bitte einen anderen Verein!
Wie fixe ich mein Kind für meinen Verein an? Darf ich,als Fan eines „Natural Born Loser“-Klubs, überhaupt so egoistisch sein? Ach was, scheiß doch auf den FC Bayern! Das Leben ist doch auch keine Butterfahrt.
Es sind mit die schwersten Momente im Leben eines Vaters. Ein Freund berichtete mir am Mittwoch letzter Woche mit zittriger Stimme, dass sein Sohn ihn gefragt habe, ob es okay wäre, wenn er sich einen neuen Verein suchen würde. Am Abend zuvor war unser gemeinsamer Lieblingsklub, der VfL Bochum, nach einer schlimmen (Nicht-)Leistung in Paderborn aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nun sehnte sich die unschuldige kindliche Seele ganz offensichtlich nach ein wenig Frieden.
Natürlich schrieb ich dem Kollegen postwendend zurück, dass er seinem Sechsjährigen sagen solle, dass das NICHT okay wäre. Die Liebe zu einem Fußballverein sei schließlich viel tiefer verankert als jedes Eheversprechen – und selbst da heißt es schon: Bis dass der Tod uns scheidet!
Unter Fußballfans gibt es ein unausgesprochenes Gesetz: Hast du jemals dein Herz an einen Klub verloren, so ist es um dich geschehen. Ab diesem Augenblick hast du keine Wahl mehr. Mitgefangen, mitgehangen. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf Gedeih und Verderb. Es gibt kein Entrinnen, oder wie es ein Königsblauer mal so treffend formuliert hat: „Schalke ist wie eine schöne Krankheit. Wenn du sie einmal hast, wirst du sie Gott sei Dank nicht mehr los.“ In dieser Aussage steckt so viel tiefere Wahrheit drin, dass man die Sätze ruhig einmal etwas länger auf sich wirken lassen sollte.
Doch wie gelingt es einem Vater, seinen Nachwuchs auf die rechte Bahn zu bringen? Oder anders ausgedrückt: Wie fixt ein Vater seine Kinder an, ausgerechnet ihr Herz an „Natural Born Losers“ wie den VfL Bochum, die Offenbacher Kickers oder den Karlsruher SC zu verlieren? Wenn du selbst in jungen Jahren nicht zufällig mit einem Gewinner-Verein von deinem Papa (oder deiner Mama oder anderen Familienmitgliedern) infiziert worden bist, dann hast du nun das schwere Los erwischt, das scheinbar Unmögliche wahr werden zu lassen.
Ich hatte schon immer großen Respekt vor dieser Herausforderung – lange Jahre bevor ich überhaupt Kinder bekommen habe. Denn ich werde nie die Worte des Vorsitzenden unseres ältesten Fanklubs, der „Bochumer Jungen“, vergessen, der damals für meinen Film „Wer braucht schon ein Sektfrühstück bei Real Madrid?“ stotternd und mit belegter Stimme erklärte: „Ich weiß noch, als mein Junge, der jetzt auch im Fanklub ist und ’ne Dauerkarte hat, tatsächlich mal eine Zeit lang – allerdings auch bedingt durch seine Fußballmannschaft, wo er gespielt hat – in der großen Ära von Borussia Dortmund – als sie die Champions League gewonnen haben und alles nur noch in Schwarz-Gelb herumlief –, als er da plötzlich auch so, ja, in Schwarz-Gelb herumgelaufen ist. Da habe ich nur gedacht, ich werde bekloppt – das war ja unglaublich!“
Natürlich gibt es da draußen immer noch Unwissende, die fragen, was denn so schlimm daran wäre, wenn die eigenen Kinder einen anderen Verein mögen würden als man selbst. Das sind in der Regel aber auch Leute, die sich für ihre 0,33-Liter-Flasche Bier einen Silikon-Kronkorken kaufen, weil sie das Getränk nicht auf einmal austrinken und es sich anschließend gut verschlossen und „vor Insekten geschützt“ (so die Werbung) in den Kühlschrank stellen. Mit rationalem Fußball-Irrsinn braucht man denen also gar nicht erst zu kommen.
Kein Vater sollte sich schlecht dabei fühlen, wenn er das eigene Kind sehenden Auges ins vermeintliche Unglück führt, weil er es für einen Klub begeistert, der viel häufiger verliert, als dass er siegt. Oder wie es einmal ein Anhänger so drastisch korrekt formulierte: „VfL-Fan zu sein, ist, wie wenn dich jedes Wochenende deine Frau verlässt.“
Denn umgekehrt wird auch ein Schuh draus: Aus pädagogischer Sicht kann es durchaus sinnvoll sein, sein Kind nicht einem Gewinner-Verein in den Rachen zu werfen. Das Leben ist schließlich keine Butterfahrt. Die nächste Niederlage wartet zumeist direkt hinter der nächsten Ecke. Wer das früh genug lernt, den schmeißt nichts mehr so leicht aus der Bahn.
Also, liebe Väter da draußen, die nicht die Daumen für einen der Big Player drücken: Lasst euch nicht unterkriegen. Die „Natural Born Loser“-Klubs brauchen uns – und wir sie! Und wenn ihr einmal an euch selbst zweifeln solltet, denkt an die großen Worte des Radiokommentators und VfL-Fans Günther Pohl. Der hat uns allen einmal so wundervoll pointiert ins Stammbuch geschrieben: „Das Besondere ist, einen Verein zu haben, der manchmal gewinnt. Weil man die Erfolge viel intensiver genießt und auskostet als bei einem Verein, der jede Woche gewinnt. Wenn man 3:0 gegen Dortmund siegt, muss man den Abend rausgehen und bis morgens die Nacht durchfeiern, weil man nie weiß, ob es das letzte Mal ist. Auch ’nen Abstieg muss man den Tag feiern, weil an dem Tag ist man ja noch Bundesligist, an dem Tag ist man ja noch dabei gewesen. Man weiß ja auch nicht, ob das noch einmal wiederkommt. Deshalb ist jedes Erfolgserlebnis des VfL ein Grund zum Feiern!“ Und am schönsten ist es, wenn man an diesen ganz besonderen Tagen seine Liebsten um sich weiß.
Wenn es Größeres gibt als den WM-Titel
Die offenen Worte von Fußballprofi Timm Klose über seine Alkoholsucht sorgten für Schlagzeilen. Das Thema bleibt ein Tabu, obwohl jeder fünfte Profi mit Süchten kämpft. Auch Ex-Nationalspieler Uli Borowka trank. Heute hilft er anderen.
Uli Borowka liegt auf einer dreckigen Matratze. Er hat einen Entschluss gefasst. Heute wird er sich das Leben nehmen. Doch der Mix aus Alkohol und Tabletten verfehlt seine Wirkung. Borowka wacht wieder auf. Vier Jahre später geht der ehemalige Fußballstar von Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen in eine Entzugsklinik. Seit diesen Monaten im Jahr 2000 lebt Uli Borowka abstinent. Er selbst sagt über sein jetziges Leben: „Jeder Tag, an dem ich keinen Alkohol trinke, ist für mich mehr wert als jeder Titel, den ich gewonnen habe.“
Als der Ex-Bundesligaspieler Timm Klose am Wochenende in einem Interview von seiner Alkoholsucht erzählte, zeigten sich wieder einmal viele Fußballfans erstaunt darüber, wie Hochleistungssport und extensiver Alkoholkonsum zusammenpassen. Für Uli Borowka war das Alltag, damals. Genau wie Klose begann auch der Mann aus dem sauerländischen Menden bereits als junger Mensch mit dem Trinken – und hörte erst mit 38 Jahren wieder auf. Borowka sagt rückblickend: „Ich war 16 Jahre lang Fußballprofi und 16 Jahre lang starker Trinker.“ Dazu kam sein intensiver Medikamentenkonsum. Schmerzmittel, die ihn nicht nur seine kaputten Knie vergessen ließen, sondern auch die Nebenwirkungen des Alkohols abmilderten. Wenn Uli Borowka auf dem Platz stand, gab er sein Bestes. Doch es gab Tage, da schaffte es der Werder-Profi erst gar nicht bis auf den Rasen. Sein Trainer Otto Rehhagel deckte ihn in diesen Momenten. Er brauchte seinen Verteidiger. Unbeschädigt, als tadellosen Sportsmann. Deshalb erfand Rehhagel Ausreden für ihn. Und Borowka nahm diese dankend an. Nachdem der ehemalige Werder-Profi in seinem Buch „Volle Pulle“ geschrieben hatte, dass Otto Rehhagel wegen dieser Täuschungen und des Deckens von Borowkas Alkoholsucht in dieser Zeit „co-abhängig“ gewesen sei, redete der Europameister-Trainer von 2004 lange Jahre nicht mehr mit seinem Ex-Spieler. Dabei gab Borowka seinem früheren Trainer gar keine direkte Schuld. Vor allem, weil er selbst wusste, dass dieses Verhalten alles andere als selten ist.
Knapp zehn Jahre zuvor hatten die Spieler beim Hamburger SV ihren Coach Branko Zebec gedeckt, obwohl sie genau wussten, dass der in erhöhtem Maße dem Alkohol zusprach. Auch für sie zählte, dass sie mit ihm und durch ihn gewannen. Doch am 29. Spieltag der Saison 1979/80 bei der Partie des HSV in Dortmund konnte die gesamte Fernsehnation erstmals sehen, was längst so viele wussten: Branko Zebec hatte ein Alkoholproblem. Völlig abwesend verfolgte der volltrunkene Trainer die erste Halbzeit auf der Bank des Westfalenstadions. In der zweiten Hälfte blieb sein Platz leer. HSV-Präsident und Anwalt Dr. Wolfgang Klein wählte seine Worte mit Bedacht, und dennoch benutzte er erstmals bewusst und öffentlich das Wort „Alkohol“ in seiner Stellungnahme: „Es ist bekannt, dass Herr Zebec seit Langem unter einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse leidet. Deshalb ist jeder Tropfen Alkohol für ihn besonders schädlich.“ Da er am Freitag die Hinfahrt im Bus verpasst hatte, war Zebec im Leihwagen dem Team gefolgt. In der Nacht stoppte ihn die Polizei in der Nähe der Autobahnausfahrt Ascheberg bei Münster und behielt seinen Führerschein sofort an Ort und Stelle ein. Die Blutprobe ergab einen Promillewert von 3,25. Der „Spiegel“ schrieb damals: „Der Jugoslawe Branko Zebec (Spitzname: Fernet-Branko) trainierte zwar Bayern München zur Deutschen Meisterschaft. Doch der Diabetiker benötigt Blutzucker senkende Insulinpräparate und ist bei Alkoholgenuss bis zum komaartigen Rausch doppelt gefährdet.“ Zebec bekam seine Krankheit zeitlebens nicht in den Griff. Er starb bereits mit 59 Jahren an den Folgen seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs.
Die Sucht-Beichte von Timm Klose, der aktuell bei Norwich City spielt, ist im englischen Fußball spätestens seit dem 1998 erschienenen und mehrfach prämierten Buch „Addicted“ des ehemaligen Nationalspielers Tony Adams keine Seltenheit mehr. Adams beschrieb damals detailliert seine Parallelwelt zwischen Fußballprofi und Alkoholiker. Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Deutschland im Elfmeterschießen bei der Europameisterschaft 1996 und einer siebenwöchigen Phase des Trinkens fand Adams über den Gang an die Öffentlichkeit einen Weg aus der Sucht. Seit Jahren engagiert sich der frühere Arsenal-Spieler mit verschiedenen Projekten in der Suchthilfe.
Das Geständnis von Timm Klose wird für Adams und Borowka deshalb nicht überraschend gekommen sein. Beide wissen um die vielfältigen Suchtproblematiken im Profi-Fußball und weisen öffentlich darauf hin, dass nach aktuellen Studien mindestens jeder fünfte Spieler mit einer Sucht – neben dem Alkohol auch Drogen/Medikamente und Glücksspiel – zu kämpfen hat. Öffentliche Bekenntnisse wie die von Klose helfen dabei, die Menschen im unbarmherzigen Millionengeschäft Fußball weiter zu sensibilisieren. Denn eine schlichte Wahrheit mussten alle Betroffenen machen: Es kann jeden treffen. Selbst die Allergrößten wie den Torjäger aller Torjäger, Gerd Müller. Und auch dieser sagte, genau wie Borowka, einmal: „Dass ich die Sucht bezwungen habe, war mein größter Sieg – wichtiger noch als der WM-Titel.“
Schön wie Lothar, elegant wie Maradona
Heraushängende Zunge, keine Hose: „So ist nicht mal Matthäus in schlimmsten Zeiten rumgelaufen“, fluchte TV-Moderator Oliver Welke. 2006 sorgte Goleo für Aufregung. Wer der Nacktlöwe ist und warum er auch als „Crazy Frog“ gut aussieht: Hier kommt die Antwort!
Es war das bestgehütete Geheimnis eines Sommers. Vor der WM 2006 setzten die Medien alles daran, den Mann unter dem Goleo-Kostüm zu enttarnen. Die Neugierde war riesig. Man fragte sich, wer da dem flauschigen Löwen seine Stimme lieh. Und wer so fließend-fröhlich auf Englisch, Deutsch und Spanisch mit der versammelten Weltpresse parlieren und seinen Körper so betont schwungvoll in Szene setzen konnte. Doch egal wie tief man auch bohrte, die Presse bekam keine Antworten.
Aus Sicherheitsgründen sagte man damals die Teilnahme Goleos an Shows wie „TV total“ ab. Zu groß wäre das Risiko einer gezielten Attacke gewesen. Einmal das „wahre“ Gesicht des Maskottchens in der Öffentlichkeit – und der schöne Schein wäre dahin gewesen. Und so durfte Goleo selbst seinen Kopf nur in gut abgeschirmten Kabinen abnehmen. Und tatsächlich: Das Geheimnis, welcher vielseitig begabte Mann ein ganzes Sommermärchen lang unter dem Kostüm schwitzte, blieb bis zum heutigen Tage gewahrt. Nun ist der Zeitpunkt zur Enttarnung gekommen.
Im Sommerurlaub an der Nordseeküste hatte ich einen jungen Mann kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch, weil ich ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Ohne Fußball ist alles nichts!“ trug. Bereits wieder zu Hause, schrieb er mir über Facebook: „Wusstest du eigentlich, dass ich bei der WM 2006 Goleo war?“ Ich war von einem Moment auf den nächsten wie elektrisiert. Hatte ich tatsächlich den Mann kennengelernt, der sich in seiner Rolle als Löwe der Nation selbst so vorstellte: „In meiner Person vereinen sich die Schönheit von Lothar Matthäus, die Eleganz von Maradona und das weltmännische Auftreten von Oliver Bierhoff“?
Marcel Batangtaris ist Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher – und wird seit vielen Jahren für Spezial-Einsätze in Kostümen gebucht. Er stand damals gerade am Flughafen von Kopenhagen, als man ihm mitteilte: Du bist Goleo! In Dänemark hatte er soeben einen Festival-Auftritt als „Crazy Frog“ hinter sich gebracht. Bis zu 120.000 Zuschauer beglückte er auf der Bühne mit der Figur des Klingelton-Anbieters „Jamba“. Am 30. Mai 2005 schob sich ein Song des „Crazy Frog“ auf Platz 1 der britischen Charts. Viele sahen damals das Ende jeglichen guten Geschmacks gekommen, doch für den Wahl-Kölner Batangtaris lief es gut. Dass Goleo noch einmal eine ganz andere Hausnummer sein sollte, ahnte er damals bereits, als das Angebot kam – aber wie krass es tatsächlich werden würde, konnte er nicht annähernd wissen.
Seinen ersten Auftritt als sprechender Löwe hatte er direkt vor der WM. Zwei Millionen Fußballanhänger aus aller Welt empfingen ihn auf dem Fanfest in Berlin – live im deutschen Fernsehen. 200 Meter hinter ihm stand ein Kollege, der „Pille“, Goleos sprechenden Begleiter in Form eines Fußballs, steuerte und ihm seine Stimme über ein eingebautes Mikrofon verlieh. Batangtaris selbst konnte über Elektroden an den Händen den Mund des Löwen öffnen und schließen.
Der ausgebildete Schauspieler hatte sich Goleo als gemütlichen Gute-Laune-Kerl zurechtgelegt und zeigte in seiner Rolle vollen Einsatz. „Da muss der ganze Körper mitgehen, wenn man so eine Figur spielt“, erzählt Batangtaris und lässt die brummig-gutmütige Stimme des Löwen noch einmal erklingen. Er habe Goleos Stimme immer zwischen Samson und Snoop Dogg gesehen – zwischen klassisch und modern. Und das sei offensichtlich gut angekommen. Nicht nur die Kinder, auch ganz viele Erwachsene hätten sich damals an ihn gekuschelt und unbedingt ein Foto mit ihm machen wollen. Trotz der lautstarken Kritik im Vorhinein sei Goleo während der vier Wochen eine Art „Super-Hero“ gewesen. Das habe jede Menge Spaß gemacht. Auch wenn er bei jedem Auftritt „geschwitzt habe wie Bolle“ und drei Kilo abnahm.
Stets habe er sich bemüht, einen politisch korrekten Goleo zu geben. Fragen nach dem kommenden Weltmeister beantwortete er diplomatisch ausweichend mit einem Verweis auf das fabelhafte Wetter in Deutschland. Und stellte mal ein Reporter eine provozierende Frage, so rief Goleo mit seinem berühmten Löwen-Charme in die Runde: „Freut ihr euch auch so, hier zu sein?“ – und ging danach entspannt-locker zum nächsten Kind, das ein Foto mit ihm haben wollte.
Das alles klappte wunderbar bis zum Tage des WM-Viertelfinal-Spiels gegen Argentinien in Berlin. Eigentlich war nach dem Abspielen der Hymnen der Job für Goleo bereits erledigt. Doch an diesem legendären 30. Juni war alles anders. Deutschland lag gegen den mehrmaligen Weltmeister mit 0:1 hinten, und in der deutschen Kurve ging gar nichts mehr. Es herrschte Mucksmäuschenstille. Da kam jemand auf die Idee, Goleo hinauszuschicken. Er sollte ein „bisschen Gas geben“ und für Stimmung im deutschen Lager sorgen. Batangtaris schmiss sich augenblicklich in sein Kostüm, eilte hinaus und kam gerade rechtzeitig zum 1:1-Ausgleich. Und nun packte es ihn. Wer sich noch einmal genau die Szenen von damals anschaut, kann bei den Aufnahmen vom Elfmeterschießen links hinter Lehmann einen ausgelassen jubelnden Löwen sehen. Das sei nicht in Ordnung gewesen, sagt der Schauspieler neun Jahre später, aber „da sind die Gäule einfach mit mir durchgegangen“. Es sei ihm verziehen.
Die vier Wochen seien unvergesslich und wunderschön gewesen. Nur eine Frage habe er irgendwann nicht mehr hören können: „Warum hat Goleo eigentlich keine Hose an?“ Batangtaris ist sich sicher, dass er heute in einer Vermögensliga mit Bill Gates spielen würde, hätte er damals nur einen Euro pro Hosen-Frage bekommen. Er habe sich schließlich angewöhnt, einfach eine Gegenfrage zu stellen: „Hast du je Donald Duck mit einer Hose gesehen? Nein? Dann denk mal drüber nach!“
Wenn der Designer im LSD-Rausch ist
Sind die jeck beim Effzeh? Was war das bitte schön? Kölner Stunksitzung im Karnevalstrikot? Spöttern fehlte nur ein Tusch. Doch das hässlichste Trikot der Fußball-Bundesliga ist es trotzdem nicht. Das ist immer noch regenbogenfarben.
Das Karnevals-Jersey der Kölner hat am letzten Wochenende für zahlreiche Lacher gesorgt. Und auch wenn dieses Hemd ganz weit vorne im Reich der Geschmacksverirrungen landet, der gezielte Angriff vonseiten des 1. FC Köln auf den Titel-Thron des „hässlichsten Trikots aller Zeiten“ ist dennoch knapp gescheitert: Diesen ruhmbehafteten Platz am Designer-Himmel lässt sich der VfL Bochum nicht streitig machen.
Denn wer kennt es nicht, das kunterbunte Papageien-Jersey aus der Saison 1997/98? Damals pfiffen sich Hunderte Anhänger des Revierklubs live im WDR-Fernsehen die Seele aus dem Leib. Und das, obwohl man noch wenige Augenblicke zuvor im Bochumer Schauspielhaus siegestrunken und ausgelassen den erstmaligen Einzug des Vereins in einen europäischen Wettbewerb gefeiert hatte. Als der eigentliche Höhepunkt des Abends erfolgen sollte, begann das Dilemma. Die Präsentation der neuen Trikots für die folgende UEFA-Cup-Saison ging in die Geschichte der Bundesliga ein.
Gespannt warteten die Fans an diesem legendären Abend, bis sich der rote Vorhang zur Seite schob und man endlich sehen konnte, in welchem Outfit sich der Klub auf den Weg nach Europa machen sollte. Was dann zu hören war, erinnerte an Schreie aus übelsten Splatterfilmen. Als diese langsam verstummten und einer ungläubigen Ohnmacht wichen, ertönte die laute Stimme eines entsetzten VfL-Fans. Auf den Aufnahmen des WDR ist gut zu hören, wie er im schnörkellosen Idiom der Region rief: „Boah, wie scheiße sieht dat denn aus!“
Als die Mannschaft einen Tag später auf dem Bochumer Rathausbalkon empfangen wurde, sangen die Anhänger unten auf dem Vorplatz immer wieder: „Wir wollen blau-weiße Trikots, blau-weiße Trikots!“ Der Wunsch wurde bekanntermaßen nicht erhört.
Damals hatte der Bochumer Sponsor, die Lottofirma Faber, erstmals auch den Job des Ausrüsters übernommen und diese Chance beim Schopf gepackt. Das kunterbunte Logo des Unternehmens erstreckte sich in seiner umfangreichen Farbpalette über die gesamte linke Seite des Jerseys. Nicht wenige stellten sich die Frage, ob hinter Faber tatsächlich eine Lottofirma oder nicht doch vielleicht eher ein Hersteller für Buntstifte steckte. Ein kostenloser LSD-Rausch der Sinne war die Folge. Als VfL-Bochum-Anhänger hatte man schwere Stunden des Selbstzweifels und der inneren Einkehr vor sich.
Doch anders als erwartet, hatten die zuerst schmerzlichen Auswirkungen der fortschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs auch ihre positiven Seiten. Trotz sechs wirklich ansehnlicher und teils spektakulärer Partien im internationalen Wettbewerb gegen Trabzonspor, Brügge und Ajax Amsterdam kannte den VfL Bochum schon ein Jahr später in Europa niemand mehr. Sportlich. Mit diesen Trikots hatte sich der Verein jedoch in das kollektive Gedächtnis der Fans eingebrannt. Als ich 2004 auf einer Irland-Rundreise einen Engländer aus Reading kennenlernte, wusste er zuerst mit dem Klub tief aus dem Westen der Republik nichts anzufangen. Bis es ihm langsam dämmerte und er zu grinsen begann: „Are you kidding me? That’s your club? Fantastic jerseys. Really ugly!“
Und damit war klar: Sportlich kennt den VfL Bochum außerhalb Deutschlands fast niemand, aber den Verein mit den hässlichsten Trikots aller Zeiten in einem europäischen Wettbewerb, den haben viele nicht vergessen. Faber sei Dank!
Und auch in Deutschland waren die Regenbogenhemden des VfL der letzte Schrei in der Liga. Die Kaiserslauterer Fans skandierten bei ihrem Auswärtsspiel in Bochum 90 Minuten lang nur eine einzige Zeile: „Ihr habt hässliche Trikots!“ Was soll man sagen? Es wirkte. Die Partie ging 1:3 verloren.
Einige Jahre später spielte der VfL Bochum übrigens in rosafarbenen Trikots. Als der Zeugwart die Jerseys kurz vor der Saison zur Anprobe rauslegte, weigerten sich die Spieler, die Hemden anzuziehen. Man versteifte sich teamintern sogar zu der Aussage: „Müssen wir die Dinger in einem Meisterschaftsspiel tragen, dann werden wir verlieren.“ Man kann der damaligen Mannschaft viele Vorwürfe machen, aber nicht, dass sie sich nicht daran hielt, was sie einmal versprach. Man verlor folgerichtig die Begegnung in Rosa auf Schalke sang- und klanglos mit 0:3.
Übrigens: Wer sich einen alten Klassiker aus dem „Aktuellen Sportstudio“ ansieht, in dem sich ein Designer damals für mehrere Bundesligavereine neue Trikots ausgedacht hatte (besonders schön der Satz von Moderator Hanns Joachim Friedrichs: „Für unsere Schwarz-Weiß-Zuschauer muss man die Farben erst einmal erklären“), die anschließend tanzend (!) präsentiert wurden, der wird sich verwundert zeigen. Da hatte doch tatsächlich im Jahre 1974 der Modedesigner dem MSV Duisburg das spätere Papageientrikot des VfL untergejubelt. Getragen haben es die Meidericher nie. Gut für den VfL Bochum. Dieser Titel des „hässlichsten Trikots aller Zeiten“ scheint uns bis in alle Ewigkeit nicht mehr zu nehmen.
Ein Leben zwischen Puff und Barcelona
Vielen Fußballfans ist der Mann mit der markanten Stimme unvergessen. Sein Reporter-Stil war einzigartig: stets etwas zu laut und schrill. Rolf Töpperwien zum 70. Geburtstag – ein Blick zurück auf Storys und Skandale.
Sie erinnern sich doch sicherlich an das Blödelduo „Klaus und Klaus“ und ihren Riesenhit „An der Nordseeküste“? Am 31. August 1985 traten die beiden ungleichen Sangesbrüder beim Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV auf – und zwar direkt vor der Partie beim Einlaufen der Mannschaften. Der eine Klaus im Werder-Trikot, der andere im HSV-Dress. Ausgedacht hatte sich diese wilde Idee ein Mann, der eigentlich an diesem Nachmittag einen ganz anderen Job zu erledigen hatte. Aber ZDF-Reporter Rolf Töpperwien war schon immer ein Freund der blumigen Spielberichte, und so verschaffte sich der heutige Jubilar für die abendliche Ausstrahlung des Samstagabendklassikers „Das aktuelle Sportstudio“ die etwas anderen Bilder eines Derbys.
Und da auch die Fans der beiden Vereine Töpperwiens Idee klasse fanden und sofort gesanglich mit einstiegen, verhalfen dieser kurze Auftritt auf dem grünen Rasen und das Millionenpublikum vor den Bildschirmen am Abend dem Gesangsduo zum endgültigen Durchbruch. Übrigens: Einer der beiden von „Klaus und Klaus“, der korpulentere Klaus Baumgart, war von 1990 bis 1993 Vize-Präsident seines Heimatklubs VfB Oldenburg. So klein ist die Fußballwelt.
Doch zurück zum ZDF-Reporter Rolf Töpperwien und seiner ganz besonderen, unverkennbaren Art und seinen kuriosen Einfällen. Sein spezielles Markenzeichen war stets: er selbst! Bis heute legendär und so herrlich exemplarisch für das Arbeiten Töpperwiens sind die Szenen nach dem 6:6 des FC Schalke 04 1984 im DFB-Pokal zu Hause gegen den FC Bayern München. Auf dem Platz tanzten und sangen ausgelassene Zuschauer um den dreifachen Torschützen des Abends, Olaf Thon, herum. Direkt neben dem kleinen Schalker versuchte Rolf Töpperwien mitten im dicksten Getümmel sich energisch Platz und Gehör zu verschaffen – ein Auge dabei stets zurück in Richtung seines Kameramanns, der auf noch aussichtsloserem Posten verharrte. Doch Töpperwien gab nicht auf. Er rangelte und drängte und sprach dabei die Fans immer wieder direkt an, doch dem Olaf endlich sein verdientes Interview zu ermöglichen.
Und dann klappte es tatsächlich – als aus dem Hintergrund behelmte Polizisten für einen Moment die Lage etwas beruhigen konnten. Und Töpperwien? Der entlockte in dieser unglaublichen Situation, nach diesem unfassbaren Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München dem erstaunten, gerade 18 Jahre alt gewordenen Olaf Thon eine scheinbare Banalität, die sich aber aufgrund der gesamten Rahmenbedingungen bei vielen Zuschauern bis heute im Gedächtnis festgebrannt hat: Der dreifache königsblaue Torschütze des Abends schlief doch tatsächlich auch in dieser Nacht zu Hause noch immer in Bayern-Bettwäsche.
Töpperwien, der Mann aus Osterode am Harz, ist in seiner Reporterkarriere viel herumgekommen. Er hat alle Stadien von Barcelona bis Johannesburg gesehen – doch am liebsten war er wohl in Bremen. Das wusste auch der spätere Bundestrainer Erich Ribbeck: „Der schläft doch in Bremer Bettwäsche, den haben sie grün-weiß eingewickelt.“ Aus seiner Vorliebe für die Hansestädter und ganz besonders für ihren langjährigen Übungsleiter Otto Rehhagel hat Rolf Töpperwien in der Tat nie einen Hehl gemacht. Und so sagte der ZDF-Reporter sogar einmal ganz freimütig: „Udo Lattek mag Otto Rehhagel nicht, also mag ich Lattek nicht.“ Der Angesprochene ließ allerdings mit einer Retourkutsche nicht lange auf sich warten. Lattek: „Wer ist Rolf Töpperwien, hat der schon mal eine Mannschaft trainiert? Als ich noch Trainer war, ist der bei mir doch früher überall reingekrochen, wo eine Öffnung war.“
Bei Werder war Töpperwien so etwas wie der Haus- und Hofberichterstatter, der ganz besonders von seinem fast schon innigen Verhältnis zu Otto Rehhagel profitierte. Unvergessen die Szene, als Werder nach dem Europapokalsieg 1992 gerade wieder in Bremen gelandet war und „Töppi“, wie er gerne genannt werden möchte, wieder aus dem dicksten Getümmel legendär-ausgelassen kommentierte: „Jetzt! Jetzt betritt Otto Rehhagel deutschen Boden!“
Aber auch Rehhagel wusste, was er an seinem Reporter beim ZDF hatte. Als eines Tages Töpperwiens Schwester und Rundfunkmoderatorin Sabine vor dem Werder-Trainer mit dem Mikrofon auftauchte, meinte Rehhagel wenig charmant: „Gute Frau, schicken Sie mir Ihren Bruder, mit dem rede ich.“
Nicht alle Zuschauer haben Töpperwien, der 2010 mit 60 Jahren beim ZDF ausschied, und seine ganz spezielle Art geliebt, wie dieser Reim des „SportBild“-Lesers Dietmar Z. aus 4980 Bünde 21 Ende der 1980er Jahre zeigt: „Ist Rolf Töpperwien am Ball, hoffen wir auf Tonausfall.“ Und den hätte es für den Reporter – wegen einer skurrilen Geschichte abseits des grünen Rasens – einmal beinahe von seinem Arbeitgeber zwangsverordnet gegeben. Doch was war geschehen?
Über Töpperwien, der sich selbst immer als sehr volksnah sah („Ich gehe zu den Jungs in deren Stammkneipen, und da spüren die dann beim Bier: Der Töppi hat ja die gleichen Interessen wie ich, der kennt die Hitparade, und der pfeift auch mal einer Frau nach“), wusste eines Tages plötzlich ganz Deutschland, dass er im Puff gewesen war, dort eine Menge Spaß gehabt, aber anschließend dennoch die Höhe der Rechnung beanstandet hatte. Die Schlagzeile damals lautete: „Wie oft kann Töppi?“
Doch warum wusste die Presse eigentlich so genau von Töpperwiens Techtelmechtel – er soll es in einer Nacht viermal mit einer „willigen Melanie“ („Die Welt“) getrieben haben – und konnte diese delikaten Informationen so ausgiebig ausschlachten? Es klingt kurios, aber Töppi selbst ist es gewesen, der die Sache an die Öffentlichkeit gebracht hat. Denn fahrlässigerweise hatte er auf Original-ZDF-Briefpapier die Höhe der Summe für seinen Ausflug ins Etablissement infrage gestellt. Die 4.000 Mark, die er für seinen Abend im Münchener Amüsierbetrieb „Leierkasten“ zahlen sollte, empfand Töpperwien als viel zu hoch. Und seine spitzfindige Erklärung klang dabei durchaus plausibel: „Ich bin doch kein Marathon-Mann!“
Dummerweise nahm der „Leierkasten“ anschließend die freundliche Einladung zu ganz viel kostenloser Werbung dankend an und schickte das Schreiben über einen „Münchener Szene-Anwalt“ an die „Abendzeitung“. Und die veröffentlichte den Brief natürlich mit Genuss. Danach machte die Nachricht in ganz Deutschland die Runde. Und auch wenn die Geschichte selbstverständlich für Töppi nicht ohne war – irgendwie passt sie zu seinem kunterbunten Leben voller Storys und Skandale.
Heute feiert der Mann, der vielen Fußballfans noch immer unvergessen ist, seinen 70. Geburtstag.
Als es bei Paul Breitner ganz flüssig lief
Die einen haben die Hosen voll, Thomas Müller verwandelt im Stil von Harald Nickel, Mönchengladbach schießt den Vogel ab – und Toni Schumacher erhält im „Tatort“ den entscheidenden Tipp. Die kuriose Geschichte des Elfmeters in der Bundesliga.
Gefühlt ist es die Saison der Elfmeter. Vor allem für die Mönchengladbacher Borussia. Vor dem Wochenende hatte sie neun Strafstöße in zehn Pflichtspielen verschuldet und damit den Grundstein für den holprigen Start in die Saison gelegt. Patrick Hermann hatte vollkommen zu Recht geschlussfolgert: „Es ist schwer, Spiele zu gewinnen, wenn wir in jedem Spiel einen Elfmeter verursachen.“
Und die allermeisten Schiedsrichter-Pfiffe gegen Gladbach waren wohl auch noch berechtigt. Dabei bieten Strafstöße ansonsten gerne einmal Anlass zu hitzigen Diskussionen. Außer man hat Franz Beckenbauer als Sitzplatznachbarn neben sich, wie einst Olaf Thon, der anschließend meinte: „Der Herr, der neben mir sitzt, hat gesagt: ,Das war kein Elfmeter.‘ Und wenn er das sagt, dann stimmt das. Denn dieser Herr hat immer Recht.“
Elfmeter treffsicher zu verwandeln, ist eine Sache für sich. Oder wie es Paul Breitner nach dem legendären Halbfinale gegen Frankreich bei der WM 1982 in Spanien ausdrückte: „Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief’s ganz flüssig.“
Ganz wichtig ist die Psychologie des Schützen. Gegen Manchester City scheiterte Gladbachs Raffael beim Stand von 0:0 die Tage an Englands Nationalkeeper Joe Hart ziemlich kläglich. Warum? Weil er in allerletzter Sekunde die Schussrichtung geändert hatte, wie Raffael hinterher reumütig zugab. Ein typischer Fehler – und eine reine Kopfsache. Man glaubt nicht, was sich bei den Protagonisten da oben im Hirn so alles abspielt vor einem Strafstoß. In der Saison 1986/87 ballerte Bochums Ata Lameck etwa einen Elfmeter links am Tor vorbei und sagte danach: „Normalerweise schieße ich in die andere Ecke. Aber ich habe überlegt: Hat der Vollborn vielleicht beim letzten Mal Fernsehen geschaut, als ich einen Elfmeter geschossen habe? Das war ein Fehler. Man soll sich immer treu bleiben.“ Genau.
Noch aberwitziger hat es einmal Fortuna-Torwart Wolfgang Kleff 1983 nach dem Spiel seiner Düsseldorfer gegen Hertha ausgedrückt: „Ich wusste, dass der Remark immer in die rechte Ecke schießt. Nur: Weiß der Remark, dass ich weiß, welches seine Ecke ist? Und wenn er weiß, dass ich es weiß, schießt er dennoch in seine Ecke? Aber als er sich den Ball hingelegt hatte und zurückging, um anzulaufen, schaute er ganz kurz in die rechte Ecke. Da wusste ich Bescheid!“
Der ehemalige Bayern-Torjäger Roy Makaay hat das ganze Phänomen einmal sehr anschaulich auf den Punkt gebracht: „Wenn ich denke, dass der Torwart denkt, und der Torwart denkt, dass ich denke – dann kann ich auch einfach schießen. Es macht keinen Unterschied.“
Bis heute hält der Stuttgarter Michael Nushöhr einen Bundesligarekord. Am 8. Februar 1986 verwandelte er drei Strafstöße in einer Partie – was sich leichter anhört, als es sich in Wahrheit darstellte: „Beim dritten Elfmeter war ich verdammt nervös – ich wusste nicht mehr, wohin ich schießen sollte.“
Die beste Quote unter den Bundesligakeepern hat immer noch Rudi Kargus inne: 70-mal trat ein gegnerischer Spieler zum Mann-gegen-Mann-Duell gegen ihn an, und 24-mal behielt Kargus die Oberhand. Er begründete dies einmal so: „Hat man erst einen Ruf als Elfmetertöter, dann ist das psychologisch ein großer Vorteil. Der Schütze wird unsicher. Aber Herzog, Hoeneß, Höttges und Gersdorff haben mir den Ball doch schon ins Netz gesetzt. Nicht immer genügen meine Kenntnisse und Reaktionen.“
Auffällig ist die Schusstechnik des Bayern-Stürmers Thomas Müller in dieser Saison. Doch völlig neu ist auch diese in der Bundesliga-Historie nicht. Harald Nickel entwickelte damals diese einzigartige Variante: Er schoss, wie heute Müller, quasi aus dem Stand. Sein Erfolgsgeheimnis erläuterte der Braunschweiger selbst so: „Ich muss dem Torwart möglichst wenig Zeit geben, sich auf meinen Schuss einzustellen. Das kann ich aber nur, wenn er nicht weiß, wann ich wirklich abziehe. Und das wiederum ist nur bei einem Schuss aus dem Stand möglich.“
Eine der kuriosesten Storys rund um einen Elfmeter ereignete sich in der langen Bundesliga-Geschichte am 32. Spieltag der Saison 1978/79. Beim Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach kam es in der ersten Halbzeit zum Duell Seppl Pirrung gegen Keeper Wolfgang Kneib. Der Torhüter erzählte später: „Ich habe beim Schuss von Pirrung seinen Anlauf beobachtet und mich danach in die linke Ecke geworfen.“ Erfolgreich gehalten! In der Halbzeit traf Kneib den etatmäßigen Lauterer Elfmeterschützen Reinhard Meier, der ihm sagte, dass er den Ball in die andere Ecke geschossen hätte. Zweite Halbzeit, erneuter Elfmeter für Lautern – diesmal trat Meier an. Und Kneib präsentierte ein Lehrstück in Psychologie. Hinterher dachte er laut nach: „Nachdem er mir das gesagt hat, schießt er jetzt wohl in die andere Ecke!“ Und genau so kam es: Links unten, Kneib hielt und war der Held des Spiels.
Unter die Kategorie „Dumm gelaufen“ fällt wohl folgende Geschichte. Werner Weist wollte sich einst einen Spaß erlauben und rief Düsseldorfs Torhüter Büns flapsig zu: „Pass auf, gleich haue ich ihn dir ins rechte Eck!“ Werder hatte gerade einen Elfmeter zugesprochen bekommen, und der Mittelstürmer ging davon aus, dass wie immer sein Mannschaftskamerad Höttges ausführen würde. Doch der lag verletzt am Spielfeldrand. Trainer Burdenski entschied: Weist solle schießen. Der schluckte, zog dann aber kurz entschlossen ab: „Ich habe mir gesagt, jetzt bleibst du bei deinem Wort, und prompt rannte Büns in die falsche Ecke.“ Der gehörnte Düsseldorfer Torwart kratzte sich noch nach Spielschluss verwirrt am Hinterkopf: „Ich habe doch nicht geglaubt, dass er das ernst meinte!“
Bei einer anderen Partie schoss dann aber wieder Horst-Dieter Höttges höchstpersönlich. Nach der Begegnung zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV (1:3) des 15. Spieltags der Saison 1975/76 schaute der Werderaner gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden die Zusammenfassung des Spiels im Fernsehen an. Als Höttges im TV zu seinem verschossenen Elfmeter antrat, starrten seine Kollegen wie gebannt auf den Bildschirm. Der Abwehrspieler schnauzte sauer in die Runde: „Warum guckt ihr da hin, meint ihr, ich kriege ihn jetzt rein?“
Über den ehemaligen Nationaltorwart Oliver Kahn erzählt man sich die schöne Geschichte, dass er beim Thema Strafstöße kein Erbarmen kannte. Bei einem Benefiz-Elfmeterschießen in Karlsruhe sollten einmal Kinder gegen ihn antreten. Für jeden Ball, den sie dem Keeper ins Netz legten, floss Geld für einen guten Zweck. Doch der Nationaltorwart trieb die kleinen Dötze in die Verzweiflung. Kahn, so heißt es, habe keinen einzigen Ball durchgelassen.
Die großartigste Begründung für einen gehaltenen Elfmeter lieferte übrigens einmal ein anderer Nationaltorhüter. Am 33. Spieltag der Saison 1983/84 parierte FC-Torwart Toni Schumacher beim 4:6 seiner Kölner in Uerdingen einen Elfmeter von Friedhelm Funkel. Hinterher lautete seine kuriose Begründung: „Wie der Funkel Elfmeter schießt, hatte ich bei einem Tatort-Krimi im Fernsehen gesehen.“ Häh? Tatsächlich hatte es kurz vorher in der Folge „So ein Tag …“ einen kleinen Ausschnitt der Partie Frankfurt gegen Kaiserslautern zu sehen gegeben. Und in einer Szene: der damalige Lauterer Friedhelm Funkel beim Elfmeterschießen. Unglaublich!
Man sieht: Das Thema Strafstöße ist endlos und facettenreich. Und vor allem ganz und gar nicht so, wie der erfolgreichste Schütze unter den Keepern, Hans Jörg Butt, es nüchtern formulierte: „Elfmeterschießen ist wie Zähneputzen, da denkt man nicht nach.“ Da sind wir doch gedanklich eher bei Bastian Schweinsteiger. Der meinte einmal nach einem erfolgreichen Versuch: „Ich hab zum Spaß gesagt: Ich hab kurz vor meinem Elfmeter meine Eier vergessen oder verloren, aber sie dann rechtzeitig wiedergefunden. Im Elfmeterschießen gehört Glück dazu, meistens haben es wir Deutsche.“
Die irre Geschichte des verschollenen WM-Pokals
Der erste Pokal für den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft hat eine fast schon filmreife Geschichte mit vielen herausragenden Darstellern hinter sich. Und: Es gibt ihn nicht mehr! Das Rätsel um sein Verschwinden ist bis heute nicht gelöst. Doch das ist nur eine Story von vielen.
Es fing alles schon nicht gut an. Als Fifa-Präsident Jules Rimet nach dem spektakulären Endspiel der WM 1930 in Montevideo zwischen dem Gastgeber Uruguay und dem Herausforderer Argentinien die etwa 35 Zentimeter hohe, goldene Statue, die er kurz zuvor vom Bildhauer Abel Lafleur in Paris hatte erstellen lassen, übergeben wollte, fand sich zuerst niemand, der den Pokal entgegennehmen wollte.
Die Uruguayer waren ob des Sieges im ersten Fußball-Weltmeisterschafts-Finale der Geschichte außer Rand und Band – was interessierte da noch diese geradezu bescheidene, ja, ungewöhnlich kleine Trophäe, die Rimet dort unten auf dem Rasen im Tumult in seinen Händen hielt? Und da Uruguays Spielführer José Nasazzi weit und breit nicht aufzufinden war, überreichte der Fifa-Vorsitzende die Statue schließlich in den Katakomben recht formlos an den Verbandspräsidenten Raúl Jude. Auf einem Schnappschuss dieses historischen Moments ist zu erkennen, wie Jude äußerst lässig den Pokal mit der rechten Hand in Empfang nimmt, während seine linke in der Hosentasche steckt. Aber wenigstens war die Siegestrophäe so schon einmal übergeben.
Und eigentlich ging es für den „Coupe du Monde“, wie er damals noch hieß, auch erst einmal gar nicht so schlecht weiter. Denn nachdem die Italiener zweimal hintereinander den Weltpokal für sich gewinnen konnten, war die mittlerweile begehrte Trophäe zu Beginn des Zweiten Weltkrieges dementsprechend im Besitz der Südeuropäer – und sollte es auch bis nach Ende des Krieges im Mai 1945 bleiben. Denn der pfiffige Fifa-Offizielle Ottorino Barassi hatte irgendwann die fixe Idee nicht mehr aus dem Kopf bekommen, den Pokal aus dem Bankschließfach, wo er nach seiner Auffassung nur vermeintlich sicher aufbewahrt wurde, zu holen und bei sich zu Hause zu verstecken. Genauer: Er packte den „Coupe du Monde“ in einem einfachen Schuhkarton unter sein Bett. Da machte es sich zum ersten Mal bewährt, dass die Trophäe so vergleichsweise mickrig war.
Und tatsächlich: Der Weltpokal überlebte die dunkle Zeit und erstrahlte 1950 wieder in seiner vollen goldenen Pracht bei der ersten WM nach zwölf Jahren Pause in Brasilien. Und dort nahm das Drama so langsam seinen Lauf. Mittlerweile hatte man die Trophäe zu Ehren des langjährigen Fifa-Präsidenten in „Coupe Jules Rimet“ umgetauft. Doch der Pokal sollte dem Gastgeber kein Glück bringen. Im letzten, entscheidenden Spiel unterlagen die Brasilianer den Uruguayern äußerst unglücklich und mussten mitansehen, wie die Statue das Land wieder verließ.





























