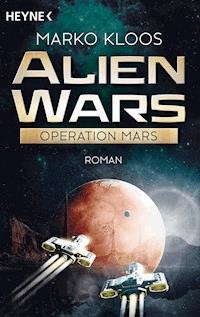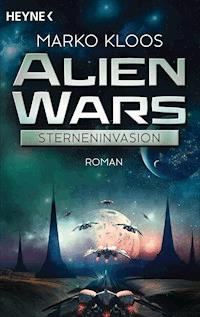
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alien Wars
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Angriff!
Anfang des 22. Jahrhunderts ist die Welt restlos überfüllt: Die Menschen leben auf allerengstem Raum zusammen, die Lebensmittel sind knapp – die Tagesration eines Erwachsenen besteht aus 2000 Kalorien Sojamehl –, und jeder, der es sich leisten kann, lebt längst auf einem anderen Planeten. Davon träumt auch der junge Andy Grayson. Um endlich von der Erde wegzukommen, tritt er der Army bei, die sich gerade auf einen interstellaren Krieg mit einer feindlich gesinnten Alien-Spezies vorbereitet. Und ehe er sichs versieht, landet Andy auf einem weit abgelegenen Kolonialplaneten der Erde – im härtesten Bootcamp des Universums ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Ähnliche
Das Buch
Wir schreiben das Jahr 2108, und die Erde ist restlos überfüllt: In den Megacities des Nordamerikanischen Commonwealth vegetieren die Menschen in gigantischen Sozialsiedlungen vor sich hin, die Lebensmittel sind knapp – die Tagesration eines Erwachsenen besteht aus 2000 Kalorien Sojamehl –, und wer es sich leisten kann, ist längst auf einen anderen Planeten ausgewandert. Davon träumt auch der junge Andy Grayson. Um endlich von der Erde wegzukommen tritt er der Army bei, die sich gerade auf einen interstellaren Krieg mit einer feindlich gesinnten Alien-Spezies vorbereitet. Doch bevor Andy sein neues Leben als Soldat beginnen kann, landet er erst einmal auf einem abgelegenen Kolonialplaneten der Erde – im härtesten Bootcamp des Universums …
Der Autor
Marko Kloos wurde 1971 in Deutschland geboren und ist dort auch aufgewachsen, bevor er nach Amerika übersiedelte. Er arbeitete u.a. als Soldat, Verkäufer und IT-Administrator, bevor er seine Leidenschaft für Fantasy und Science Fiction zu seinem Beruf machte und Autor wurde. Er lebt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in New Hampshire.
Mehr über Marko Kloos und seine Romane erfahren Sie auf:
MARKO KLOOS
ALIEN
WARS
STERNENINVASION
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. Titel der amerikanischen Originalausgabe:
terms of enlistment
Deutsche Übersetzung von Martin Gilbert Deutsche Erstausgabe 07/2015 Redaktion: Werner Bauer Copyright © 2014 by Marko Kloos Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung einer Coverillustration von Marc Simonetti
Für Robin: Ehefrau, beste Freundin und die fähigste Person,
1
ABSCHIEDE
»Du solltest dich auch noch von deinem Vater verabschieden«, ruft meine Mom aus der Küche.
Ich sehe von meinem E-Reader auf und werfe einen Blick rüber. Sie nimmt gerade eine Schale mit einem Fertiggericht aus dem Minibackofen, heißt, sie kriegt das verschmitzte Lächeln, mit dem ich sie mustere, nicht mit. Ich widme mich wieder der Lektüre des Untergangs der Pequod, was ich im Moment viel interessanter finde.
»Hast du mich gehört, Andrew?«
»Ja, hab dich gehört. Ich hab dir bloß nicht zugehört.«
»Lass doch diese Haarspaltereien. Willst du ihm denn nicht noch ›Auf Wiedersehen‹ sagen, bevor du abreist?«
»Wieso zum Teufel sollte ich? Er wird sich doch eh nur wieder die Birne zugedröhnt haben.«
Mom kommt mit dem Fertigfutter an den Tisch und stellt die Schale schwungvoll vor mich hin.
»Leg das Ding bitte beim Essen weg.«
Ich stoße einen Seufzer aus und drücke die Off-Taste.
»Deine Ausbildung wird ein paar Monate dauern, Andrew. So schnell, wie der Krebs bei ihm voranschreitet, wirst du ihn vielleicht gar nicht mehr sehen.«
»Gut«, sage ich.
Mom sieht mich mit einem Gesichtsausdruck an, den man als eine Mischung aus Trauer und Zorn bezeichnen könnte. Und für einen Moment glaube ich fast, sie will mir eine Ohrfeige geben – etwas, das sie nicht mehr getan hat, seit ich zehn war. Dann wird ihr Blick wieder sanfter, und sie sieht aus dem Fenster. Der Regen prasselt in Strömen auf das Beton-Hamsterlabyrinth unserer Sozialwohnungs-Kolonie mit der amtlichen Kurzform PRC. Ich hasse Regentage – die Nässe verstärkt den Gestank nur noch. Urin und verrottender Müll: der Duft des Gettos.
»Er ist immer noch dein Vater«, sagt sie. »Du wirst keine Gelegenheit mehr bekommen, mit ihm zu sprechen. Wenn du dich jetzt nicht von ihm verabschiedest, wirst du es eines Tages bereuen.«
»Du hattest ihm sogar die Nase gebrochen, als du ihn verlassen hast«, erinnere ich sie. »Dich hatte der Krebs doch auch nicht allzu sehr tangiert. Wieso zum Teufel sollte ich jetzt viel Trara darum machen?«
»Das war vor sieben Jahren«, versucht Mom sich zu rechtfertigen. Sie zieht einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzt sich. »Seitdem ist viel geschehen. Er war stolz auf dich, als ich ihm von deinem Zulassungsschreiben erzählte, musst du wissen.«
Sie sieht mich an, und ich versuche ihren Blick zu ignorieren, während ich den Deckel von der Aluschale abziehe. Die Geschmacksrichtung des Tages ist Huhn mit Reis. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, aus dem verarbeiteten Protein in der Basisration eine schmackhafte Mahlzeit zu zaubern. Ich stochere mit der Gabel im Ersatz-Hühnerfleisch herum. Dann blicke ich auf und sehe, dass Mom mich noch immer mit diesem niedergeschlagenen Ausdruck ansieht, den sie immer aufsetzt, wenn sie mir ein schlechtes Gewissen einreden will. Ich erwidere ihren Blick für einen Moment und zucke schließlich die Achseln.
»Na schön, ich werde mich noch von ihm verabschieden«, sage ich. »Und wenn ich unterwegs ausgeraubt und getötet werde, hoffe ich, dass du dich wenigstens schlecht fühlst.«
Mein Zimmer ist gerade groß genug für mein Bett, den Schreibtisch und eine Kommode. Die Einrichtung besteht aus Edelstahl und ist am Boden verschraubt, damit wir sie nicht wegschaffen und als Schrott verhökern können. Die Kommode ist nur halb voll; ich habe halt nicht so viele Klamotten, um sie ganz zu füllen.
Ich öffne die oberste Schublade und werfe den E-Book-Reader auf den kleinen Kleiderstapel. Letztes Jahr habe ich ihn für eine Schachtel mit alten Randfeuerpatronen eingetauscht, und der Typ, mit dem ich den Deal machte, hielt mich für einen kompletten Vollidioten. Die Aufkleber mit der Aufschrift »Schuleigentum« lassen sich nämlich nicht entfernen – aber die Sozialpolizei interessiert sich sowieso nicht für Schuleigentum. Wenn sie ihre Razzien durchführen, suchen sie nur nach Waffen und Drogen. Ich könnte den E-Book-Reader auch verstecken, aber die Bullen werden misstrauisch, wenn sie gar nichts Illegales finden.
Während ich durch das Apartment zur Haustür gehe, steckt meine Mutter den Kopf aus der Kochnische.
»Andrew?«
»Ja, Mom?«
»Es ist Sonntag. Gehst du noch bei der Lebensmittelausgabe vorbei und holst deine Wochenration ab?«
»Ich fahre doch morgen zur Grundausbildung. Ich könnte die Rationen gar nicht mehr essen.«
Mom sieht mich nur an, und sie macht fast den Eindruck, als ob sie sich schämen würde. Dann begreife ich, worum es ihr wirklich geht, und ich zucke die Achseln.
»Ich werde meine Ration abholen, Mom.«
Sie öffnet den Mund, um noch etwas zu sagen, aber ich drehe mich um und schließe die Tür hinter mir. Ihre Antwort geht im hohlen Scheppern der zufallenden Tür unter.
Der Aufzug in unserem Trakt des Gebäudes ist wieder einmal defekt. Ich öffne die Tür zum Treppenhaus neben dem Aufzug und lausche. Die Treppen sind ein beliebter Treffpunkt für die verschiedenen Rudel von Nachwuchs-gangstern, die in den beengten Räumlichkeiten gern Leute überfallen. Die Sozialpolizei taucht nur in nennenswerter Stärke auf, wenn sie eine Drogen- oder Waffenrazzia durchführt; ansonsten halten sie sich von den Apartmentgebäuden fern. Wir haben zwar Überwachungskameras auf jeder Etage, aber die meisten sind defekt. Niemand interessiert sich für die Belange von Sozialhilfeempfängern.
Unser Apartment ist im elften Stock eines dreißigstöckigen Gebäudes. Ich gehe die Treppe runter, wobei ich drei oder vier Stufen auf einmal nehme. Schnelligkeit geht vor Sicherheit. Unten angekommen, halte ich wieder inne und lausche. Dann öffne ich die Tür zur Eingangshalle und verlasse eilig das Gebäude, um meine Waffe zu holen.
Waffenbesitz in Sozialwohnungen ist illegal, aber es hat trotzdem fast jeder eine. Ich bewahre meine nicht im Haus auf, weil stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden und Mom ausrasten würde, wenn sie sie fände. Also verstecke ich sie in einem wasserdichten Rohr, das in einem Spalt der großen, mobilen Müllverbrennungsanlage des Gebäudes steckt. Es ist ein super Versteck – dort schnüffelt keiner rum, und der Container steht auch immer am selben Ort. Andererseits bin ich so immer eine leichte Beute, bis ich das Gebäude verlasse. Ich vergewissere mich, dass niemand in der Nähe ist, und gehe zum Müllcontainer rüber.
Jedes Mal wenn ich die Hand in die Spalte stecke, rechne ich damit, ins Leere zu greifen. Und jedes Mal wenn die Hand sich um das kühle Metall der magnetischen Metallbox schließt, stoße ich erleichtert den Atem aus. Ich öffne den Deckel und nehme die Waffe heraus. Es ist ein alter Revolver, vor über anderthalb Jahrhunderten hergestellt. Es ist nur ein Sechsschüsser, funktioniert dafür aber auch mit Munition »Marke Eigenbau«, die viel gängiger ist als Originalmunition. Meine knappen Munitionsreserven bestehen hauptsächlich aus Messinghülsen, die ich mit Bleischrot befüllt habe. Revolver sind beliebter als Pistolen, weil bei ihnen keine Ladehemmung auftreten kann.
Ich stecke den Revolver in die Hose, direkt hinter den Hüftknochen, wo die Waffe durch die Spannung des Hosenbunds fixiert wird. Es ist riskant, mit einer illegalen Waffe herumzulaufen, aber es ist noch riskanter, sich unbewaffnet in der Sozialwohnungs-Kolonie zu bewegen.
Und ein Gutes hat der Regen doch. Die meisten Leute bleiben nämlich zu Hause – sogar die Räuber. Wenn es regnet, sind die Straßen draußen beinahe friedlich. Ich ziehe mir die Kapuze der Jacke über den Kopf und betrete die Straße.
Innerhalb von fünf Minuten bin ich nass bis auf die Knochen. Man könnte auch trockene Füße behalten, wenn man die Markisen und Gebäudevorsprünge als Schutz nutzt, aber ich werde gern nass. Türeingänge und andere dunkle Orte in der Nähe von Gebäuden sind außerdem gefährlich. Wenn man an einem solchen Ort vorbeigeht, an dem sich Nachwuchsgangster versteckt haben, ist die Reise vorbei. Ich wurde im letzten Jahr zweimal fast ausgeraubt, und deshalb bin ich ausgesprochen vorsichtig.
Das Apartmentgebäude meines Vaters befindet sich fast am anderen Ende des PRC. In der Nähe ist eine Station des öffentlichen Nahverkehrs, aber ich käme dort nicht rein, ohne dass die Waffenscanner am Eingang anschlagen würden. Also gehe ich zu Fuß.
An diesem Ort bin ich aufgewachsen. Ich bin auch noch nie aus der Boston-Metroplex herausgekommen. Morgen beginnt die Grundausbildung, und wenn ich nicht durchfalle, werde ich diesen Ort auch nie wieder sehen. Ich lasse mein vertrautes Umfeld zurück und alle meine Bekannten. Und ich kann es kaum erwarten.
Nach dem dritten Summton öffnet Dad die Tür. Ich habe ihn zuletzt vor über einem Jahr gesehen, und im ersten Moment bin ich geschockt, wie sehr er sich seitdem verändert hat. Sein Gesicht ist eingefallen. Als er noch jünger war, war er ein stattlicher Mann, aber der Krebs hat bereits den Großteil seiner Substanz aufgefressen. Er hat schreckliche Zähne. So schlimm, dass ich fast zurückgewichen wäre, als er den Mund zu einem Lächeln öffnet.
»Na sieh mal einer an«, sagt er. »Bist gekommen, um Auf Wiedersehen zu sagen, was?«
»Mom hat mich geschickt«, sage ich.
»Natürlich hat sie das.«
Wir sehen uns für ein paar Augenblicke an, und dann dreht er sich um und geht ins Apartment zurück.
»Dann komm doch rein.«
Ich betrete den Flur seines Apartments und schließe die Tür hinter mir. Dad geht ins Wohnzimmer und lässt sich mit einem Seufzer auf die Couch fallen. Auf dem Tisch vor ihm steht eine ganze Kollektion von Medikamenten. Er registriert meinen Blick und zuckt die Achseln.
»Bringt alles nichts. Der Quacksalber in der Klinik sagt, dass mich in einem halben Jahr die Würmer fressen werden.«
Mir liegt eine sarkastische Antwort auf der Zunge, aber irgendwie bringe ich es doch nicht übers Herz. Im Raum riecht es förmlich nach Krankheit, und mein Vater sieht elend aus. Der Krebs frisst ihn innerlich auf, und er wird in diesem Haus sterben, wo es im Treppenhaus nach Pisse riecht. Ich könnte nichts sagen oder tun, wodurch er sich schlechter fühlt als sowieso schon und nichts, wodurch ich mich besser fühlen würde.
Als ich vierzehn war, hätte ich alles für eine Chance gegeben, meinen Dad zu töten und Rache für all die Schläge und Demütigungen zu nehmen. Und nun sehe ich ihn vor mir: so schwach, dass ich nicht einmal die Waffe bräuchte, die im Hosenbund steckt. Ich kann ihn nicht mehr hassen.
»Ich dachte, deine Mutter würde mich anlügen«, sagt er. »Ich glaubte nicht daran, dass du bestehen würdest. Du und deine Bücher.«
»Ja, vielleicht war gerade das das Geheimnis meines Erfolgs«, sage ich. »Sie brauchen dort nämlich auch Leute mit Köpfchen.«
»Du wirst irgendwo Knöpfe drücken. Völlig ausgeschlossen, dass sie dich losschicken werden, um andere Menschen zu töten. Das steckt einfach nicht in dir drin.«
Wieso – weil ich mich nie gewehrt habe, als du mich als Sandsack benutzt hast?
Diese Bemerkung ist eine regelrechte Steilvorlage, um ihm jetzt auch etwas an den Kopf zu werfen. Doch dann begreife ich, dass er mich nur provozieren will, und diese Genugtuung gönne ich ihm nicht.
»Das werden wir noch sehen«, sage ich, und er quittiert das mit einem müden Lächeln. Ich sehe ihm so ähnlich, dass es mich geradezu schmerzt. Falls ich durchfalle, werde ich hierher ins PRC zurückkehren, und dann werde ich eines Tages vielleicht auch so enden: allein und verängstigt, eingesperrt auf ein paar Quadratmetern inmitten eines Gettos. Eine Wohnung im PRC steht nicht lange leer, wenn jemand stirbt. Sie werfen deinen Kram raus, gehen mit dem Kärcher durch die Wohnung, setzen den Öffnungscode für die Tür zurück und übergeben das Apartment noch am selben Tag einem neuen Sozialmieter.
»Wann geht’s los?«
»Morgen Abend«, sage ich. »Ich melde mich um acht bei der Registrierungsstelle.«
»Bleib sauber. Wenn sie dich einbuchten, besetzen sie deinen Posten mit jemandem von der Warteliste.«
»Mach dir deswegen mal keine Sorgen«, sage ich. »Im Zweifel denke ich einfach daran, was du tun würdest, und dann tue ich das genaue Gegenteil.«
Dad bringt gerade einmal ein raues glucksendes Lachen hervor. Als wir noch unter einem Dach lebten, hätte ein solches »Kontra« mir Schläge eingetragen, doch der Krebs hat ihm den Hang zur Gewalt ausgetrieben.
»Du hast dich in einen kleinen Scheißer verwandelt«, sagt er. »In einen sturen Hund. Aber ich war genauso, als ich in deinem Alter war, weißt du.«
»Ich bin nicht wie du, Dad. Überhaupt nicht.«
Er beobachtet amüsiert, wie ich mich umdrehe und sein Apartment verlassen will.
An der Tür drehe ich mich noch einmal um.
»Hau schon ab«, sagt er, als ich den Mund öffne, um Auf Wiedersehen zu sagen. »Ich sehe dich wieder, sobald du durchgefallen bist.«
Ich richte den Blick auf ihn, den Mann, dem ich die Hälfte meines genetischen Codes verdanke. Ich sage mir, dass dies das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe – dass ich etwas sagen sollte, das mir das Gefühl vermittelt, ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht. Stattdessen drehe ich mich einfach um und gehe.
Den versifften Hausflur lasse ich möglichst schnell hinter mir und gehe zum Treppenhaus an seinem Ende. Als ich die Treppe erreiche, höre ich, wie die Tür des Apartments meines Vaters sich leise schließt.
Auf dem Heimweg schaue ich bei der Lebensmittelstation vorbei, um meine Wochenration abzuholen. Die Rationen werden als Gebinde von einundzwanzig Schalen in einer Box ausgegeben. Jeder Sozialhilfeempfänger erhält eine Box pro Woche – eine Nahrungsmittel-Grundversorgung mit vierzehntausend Kalorien.
Diese »NGV«-Rationen bestehen aus verarbeitetem Protein, das mit Nährstoffen und Vitaminen angereichert und mit künstlichen Aromen versetzt wird, um ihm etwas Geschmack zu verleihen. Es heißt zwar, der Geschmack sei bewusst ziemlich fade, um übermäßigen Verzehr zu verhindern, aber ich glaube nicht, dass man mit irgendeinem wissenschaftlichen Prozess der Welt aus NGV-Rationen eine kulinarische Delikatesse zaubern kann. Letztlich schmeckt es immer noch so, als ob man Mehl aus Füßen und Arschlöchern zur Gewinnung des Rohproteins verwendet hätte. Was vielleicht gar nicht mal so weit von der Wahrheit entfernt ist. Einer meiner Schulfreunde behauptete, dass NGV-Rationen zum Teil aus zurückgewonnener menschlicher Scheiße aus Kläranlagen bestünden, was vielleicht auch nicht sehr weit von der Wahrheit entfernt ist.
Der Regen hält unvermindert an. Vor dem Apartmenthochhaus neben unserem hängen ein paar Typen unter dem Vordach des Eingangs rum. Sie bemerken die Box unter meinem Arm, als ich vorbeitrotte. Allerdings dürfte keiner von ihnen von der Vorstellung angetan sein, sich für ein paar Schalen mit fadem Soja bis auf die Knochen durchnässen zu lassen: Also bleiben sie alle dort, wo sie sind.
Während ich die Treppe zur Haustür unseres Apartmentkomplexes hinaufgehe, erinnere ich mich wieder an die Waffe an der Hüfte.
Es gibt noch etwas, das ich heute Abend erledigen muss.
Eddie und ich treffen uns in einer schmutzigen Gasse zwischen zwei Wohntürmen. Eddie kauft und verkauft fast alles, was von Wert ist – Waffen, Drogen, Lebensmittelgutscheine für die Geschäfte außerhalb des Gettos und gefälschte Ausweise, die manchmal sogar einer Prüfung standhalten.
»Wie viel Munition hast du für dieses Ding?«
»Acht Originalpatronen und siebenundzwanzig selbst gemachte«, sage ich.
Eddie öffnet den Zylinder und dreht ihn dann – etwas, das er während unserer Verhandlungen schon dreimal gemacht hat. Es schmerzt mich beinahe, meine Waffe in den Händen von jemand anderem zu sehen. Ich weiß, dass ich sie nie wieder in der Hand halten werde, falls das Geschäft über die Bühne geht.
»Die legst du natürlich noch drauf«, sagt er.
»Natürlich. Was sollte ich auch ohne die Waffe mit den Kugeln anfangen?«
»Eine .38er Special ist auf der Straße immer begehrt«, sagt er. »Du könntest die Munition auch an jemand anderen verkaufen.«
»Ich trete morgen in die Armee ein. Da habe ich keine Zeit, auch noch auf Verkaufstour zu gehen. Nennen wir es ein Kombigeschäft.«
»Ein Kombigeschäft«, wiederholt Eddie. »Okay.«
Er wirft noch einmal einen Blick auf die Waffe und nickt.
»Zwei Bezugsscheine und zwei Unzen Canada Dry. Reicht für mindestens eine Woche, wenn du nicht damit hausieren gehst und was davon abgibst.«
Ich schüttle den Kopf.
»Dope kommt gar nicht infrage. Wenn sie mich positiv testen, werfen sie mich raus. Vier Bezugsscheine.«
Eddie kneift sich nachdenklich mit Daumen und Zeigefinger ins Kinn. Ich weiß, dass er sich schon in dem Moment für mein Angebot entschieden hat, als ich es aussprach. Aber ich warte trotzdem, bis er mit dem Ritual fertig ist.
»Drei Scheine und zehn Pillen – reguläre Medikamente für deine Hausapotheke.«
Ich tue so, als ob ich darüber nachdenken würde.
»Drei Scheine, fünfzehn Pillen«, sage ich.
»Abgemacht.«
Eddie reicht mir die Hand, und wir besiegeln die Transaktion per Handschlag. Dann verschwindet meine Wumme unter einer der vielen Schichten von Eddies Kleidung.
»Was für Sorten von Pillen hast du denn?«
»Mal schauen«, sagt er. »Schmerzmittel, Antibiotika, Blutdruck-Zeugs, Aufputschmittel und ein paar Beruhigungsmittel.«
»Wie gut sind die Schmerzmittel?«
»Für Kopfschmerzen und so, aber nicht für Schmerzen durch Schussverletzungen.«
»Das reicht mir«, sage ich. »Die nehme ich.«
Eddie greift in seinen Mantel, holt ein Pillenröhrchen heraus und zählt mir fünfzehn Pillen in die Hand.
»Die sind hoffentlich auch echt«, sage ich und stecke das Zeug in die Tasche.
»Natürlich sind sie das«, erwidert Eddie leicht pikiert. »Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren, musst du wissen. Wenn ich den Leuten Fälschungen andrehe, werden sie nicht mehr bei mir kaufen.«
Er greift wieder in eine seiner Taschen und zückt drei Bezugsscheine, als ob er Asse aus dem Ärmel ziehen würde.
»Vielen Dank für deinen Einkauf«, sagt er, als ich die Scheine entgegennehme.
»Bis zum nächsten Mal, Eddie«, sage ich, obwohl ich ohne jeden Zweifel weiß, dass es kein nächstes Mal geben wird.
Mom blickt von ihrer Network-Show auf, als ich ins Apartment zurückkehre.
»Und wie war’s?«
»Sinnlos«, sage ich.
Ich gehe zum Wohnzimmertisch rüber und lasse die Handvoll Pillen daraufrieseln. Mom beäugt die Medikamente und runzelt eine Augenbraue.
»Nichts Illegales«, sage ich. »Nur ein paar Schmerzmittel. Ich dachte, du könntest sie vielleicht wegen deiner Zahnschmerzen gebrauchen.«
Sie beugt sich vor und nimmt die Pillen in die Hand.
»Woher hast du die, Andrew?«
»Hab sie gegen ein paar Sachen getauscht.«
Ich hole die Bezugsscheine aus der Tasche und lege sie vor Mom auf den Tisch. Sie beugt sich vor, um sie in Augenschein zu nehmen und schlägt dann die Hände vor den Mund.
»Andrew! Wo hast du die her?«
»Ich habe sie gegen ein paar Sachen getauscht, Mom«, wiederhole ich.
Sie nimmt die Scheine vorsichtig in die Hand, als ob sie aus sprödem Papier bestünden. Jeder dieser Scheine berechtigt den Inhaber zum Einkauf von Waren im Wert von hundert neuen Dollar in einem Geschäft außerhalb der Sozialwohnungs-Kolonie. Die Regierung gibt solche Bezugsscheine jeden Monat aus und verteilt sie auf einer Lotteriebasis in einer gesicherten Ausgabestelle aus Beton nahe der Station für den öffentlichen Nahverkehr.
»Verwende sie selbst, oder tausch sie gegen irgendetwas ein«, sage ich. »Aber lasse sie dir nicht von irgendjemand abluchsen.«
»Mach dir deswegen mal keine Sorgen«, sagt Mom, während sie die Bezugsscheine stapelt und in eine Tasche steckt. »Es ist schon anderthalb Jahre her, seit wir einen Bezugsschein erhalten haben. Ich könnte sterben für etwas Brot und Käse.«
Ich hatte mir für meine Mutter schon eine schöne Geschichte über den Kram zurechtgelegt, den ich für diese Scheine eingetauscht hatte. Aber sie ist so aufgeregt, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, weiter nachzufragen.
»Gute Nacht«, sage ich und gehe zur Tür meines Zimmers. Mom lächelt mich an – das erste Lächeln, das ich seit Tagen in ihrem Gesicht sehe.
Dann richtet sie die Aufmerksamkeit wieder auf den an der Wand befestigten Plasmabildschirm, auf dem in gedämpfter Lautstärke irgendeine blöde Network-Show läuft.
»Andrew?«, sagt sie, als ich die Tür erreiche. Ich drehe mich um, und sie lächelt mich wieder an.
»Ich werde versuchen, morgen ins Lebensmittelgeschäft zu gehen. Vielleicht können wir noch einmal anständig zu Mittag essen, bevor du gehst.«
Ich verbringe meine letzte Nacht in PRC Boston-7 mit der Lektüre der letzten fünfzig Seiten von »Moby Dick«. Morgen werde ich mich vom E-Reader verabschieden müssen. Ich habe den Roman zwar schon ein Dutzend Mal oder noch öfter gelesen, aber ich will ihn jetzt nicht unvollständig gelesen zurücklassen – für immer mit dem Lesezeichen an der Stelle, wo die Pequod in den Wellen versinkt.
Am zweiten Tag kam ein Segel nah und näher und las mich schließlich auf. Es war dieRachel, die umherirrend vom Wege abgekommen war; auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern fand sie nur eine weitere Waise …
2
EINFÜHRUNG
»Mach das nicht«, sagt die Frau.
Ich bin ein offensichtliches Ziel für die Demonstranten, die sich vor der militärischen Registrierungsstelle versammelt haben. Ich trage eine schäbige Reisetasche und habe dem Militär die Kosten für einen Haarschnitt erspart, indem ich mir das Haar selbst bis auf eine Länge von drei Millimetern gestutzt habe.
»Wie bitte?«, frage ich.
Die Frau hat ein gütiges Gesicht und langes Haar, das an manchen Stellen schon grau wird. Vor der Station hat sich eine große Traube von Menschen versammelt, die protestieren, Schilder hochhalten und Slogans gegen das Militär skandieren. Dennoch halten sie gebührenden Abstand von den Türen der Station, wo zwei Soldaten in Kampfanzügen Wache stehen und die Zulassungsschreiben kontrollieren. Die Soldaten sind mit Pistolen und Elektroschockern bewaffnet. Und wenn sie die Demonstranten auch keines Blickes würdigen, nähert keiner von ihnen sich der gelben Linie, die den Gehweg von der Registrierungsstelle trennt, auf weniger als drei Meter.
»Mach das nicht«, wiederholt sie. »Du bedeutest ihnen doch gar nichts. Sie brauchen dich nur als Kanonenfutter. Du wirst da draußen sterben.«
»Jeder muss irgendwann mal sterben«, sage ich. Doch dann spüre selbst ich den Stich dieser Binsenweisheit. Ich bin einundzwanzig, sie scheint schon jenseits der sechzig zu sein, und sie weiß wahrscheinlich viel mehr über Leben und Tod als ich.
»Aber doch nicht so jung wie du«, sagt die Frau. »Sie versprechen dir das Blaue vom Himmel herunter, und zum Schluss legen sie dich in einen mit einer Flagge drapierten Sarg. Mach das nicht. Nichts ist es wert, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen.«
»Ich hab aber schon unterschrieben.«
»Du weißt, dass du jederzeit zurücktreten kannst, oder? Du könntest jetzt wieder gehen, und sie könnten gar nichts dagegen tun.«
Spätestens jetzt weiß ich, dass sie noch nie auch nur im Umkreis von zehn Meilen um eine Sozialwohnung gewesen ist. Sollte ich wirklich wieder zu diesem Ort zurückgehen?
»Das will ich nicht, Ma’am. Ich habe meine Wahl getroffen.«
Sie schaut mich mit traurigen Augen an, und ich schäme mich etwas, als sie mich anlächelt.
»Denk noch mal darüber nach«, sagt sie. »Wirf dein Leben doch nicht nur für ein Bankkonto weg.«
Sie streckt die Hand aus und legt sie mir sanft auf die Schulter.
Und im nächsten Moment liegt die alte Lady auf dem Boden, und die zwei Soldaten vom Eingang knien auf ihr. Ich habe nicht einmal gesehen, wie sie ihren Posten verlassen haben. Sie schreit vor Überraschung und Schmerz auf. Ihre Mitdemonstranten hören auf zu skandieren und brüllen ihren Protest heraus, aber die Soldaten nehmen nicht einmal von ihnen Notiz.
»Körperlicher Eingriff beim Zugang zu einer Registrierungsstelle ist ein Vergehen der Klasse D«, sagt einer der Soldaten und holt ein paar flexible Handschellen hervor. Sie reißen die Frau vom schmutzigen Asphalt hoch und stellen sie wieder auf die Füße. Einer von ihnen führt sie ins Gebäude, während der andere Soldat wieder am Eingang Position bezieht. Der Soldat, der die Frau am Arm abführt, hat mit seinem klobigen Kampfanzug wahrscheinlich das Doppelte ihrer Masse; sie wirkt sehr zerbrechlich neben ihm. Sie blickt über die Schulter und sieht mich noch einmal mit diesem traurigen Lächeln an, und ich wende den Blick ab.
»Das Gebäude besteht aus Stahlbeton«, sagt der Sergeant. »Es ist extrem massiv. Da musst du es nicht noch mit der Schulter abstützen.«
Die Frau neben mir löst sich von der Wand, gegen die sie sich gelehnt hat, und sieht den Sergeant mit einem kessen Lächeln an. Dann geht sie weg, als ob sie keinen Sinn darin sähe, noch mehr Zeit in dieser Angelegenheit zu vergeuden.
Wir stehen in einer Reihe in einem Flur des Empfangsgebäudes. Am Ende des Flurs steht ein Klapptisch, an dem jemand die ID-Karten der neuen Rekruten einscannt. Die Schlange wird nur langsam kürzer. Als ich endlich an der Reihe bin, ist es schon spät am Abend. Ich bin eine Stunde vor Ablauf der Meldefrist um acht Uhr hier eingetroffen, und jetzt ist es schon fast zehn. Der Sergeant am Klapptisch streckt die Hand nach meiner ID-Karte und dem Zulassungsschreiben aus, und ich gebe ihm beides.
»Grayson, Andrew«, sagt er zum Soldaten neben ihm. Der geht einen altmodischen Ausdruck durch und setzt dann neben meinem Namen ein Häkchen.
Der Sergeant nimmt meine ID-Karte und steckt sie in das Kartenlesegerät auf dem Tisch.
»Collegeabsolvent, hä?«, sagt er mit gleichen Anteilen von Belustigung und Spott in der Stimme. »Ein akademischer Überflieger. Vielleicht machen sie dich eines Tages noch zum Offizier.«
Er stößt ein leises, glucksendes Lachen aus. Dann zieht er die ID-Karte aus dem Lesegerät und wirft sie in einen Eimer neben dem Tisch, in dem schon ein Haufen anderer IDs liegt. Der Drucker seines Computerterminals summt und spuckt einen schlichten Zettel aus, den er mir dann gibt.
»Das ist dein Zulassungsschein, Professor. Verliere ihn nicht. Geh durch diese Tür zum Flugsteig mit der Nummer, die auf dem Zettel steht. Melde dich beim Gate-Sergeant. Er wird dir dann das richtige Shuttle zuweisen. Der Nächste.«
Das Shuttle zu meiner Grundausbildungs-Basis ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Sitzpolster sind verschlissen, die Sicherheitsgurte ausgefranst, und der Teppichboden im Mittelgang ist nur noch eine Sammlung von losen Fasern, die längst jede Ähnlichkeit mit einer zusammenhängenden Struktur und einem Muster verloren haben. Es scheint, als ob sie die älteste Ausrüstung einsetzen, die sie auftreiben können, um ja nicht einen Dollar zu viel für die neuen Rekruten ausgeben zu müssen.
Die Triebwerke des Shuttles versetzen die Hülle in Schwingungen, und ein paar Minuten später steigen wir in den trüben Abendhimmel auf. Ein paar der neuen Rekruten recken die Hälse und sehen aus den verkratzten Fenstern, aber ich mache mir nicht die Mühe. Selbst wenn man überhaupt etwas erkennen könnte, würde man doch nur genau das sehen, dem alle unbedingt entkommen wollen: identisch aussehende, dicht gedrängte Hochhäuser, die eine Betonwüste bilden, welche an ein Kleintiergehege erinnert. Nur dass diese Zone fünfmal schlimmer stinkt und nicht halb so sauber ist.
Ich habe mein ganzes Leben in der Sozialwohnungs-Kolonie verbracht, die wir hinter uns lassen. Und wenn die Sino-Russische Allianz just in diesem Moment eine Atombombe über dem Ort abgeworfen hätte und ich im Nachthimmel hinter dem Shuttle einen Feuerball hätte aufsteigen sehen – ich hätte rein gar nichts gefühlt.
Wir erreichen die Basis um vier Uhr morgens.
Das Shuttle war vier Stunden in der Luft. Wir könnten überall im Nordamerikanischen Commonwealth sein, vom nördlichen Kanada bis hinunter zum Panamakanal. Im Grunde ist es mir aber auch egal. Hauptsache ist, dass wir vier Flugstunden von PRC Boston-7 entfernt sind.
Nachdem wir das Shuttle verlassen haben, werden wir zu einem wartenden Hydrobus gebracht. Als der Bus die Shuttlestation verlässt, sehe ich, dass wir uns in einer urbanen Gegend befinden. Es gibt aber nirgends Hochhäuser, und am Horizont hinter den Gebäuden der Stadt erkenne ich schneebedeckte Gipfel. Dieser Ort macht einen sauberen, ordentlichen und adretten Eindruck – das genaue Gegenteil einer Sozialwohnungs-Kolonie. Hier draußen ist alles so ungewohnt, als ob man sich auf einem anderen Planeten befinden würde.
Die Busfahrt dauert noch einmal zwei Stunden. Bald lassen wir die sauberen Straßen dieser unbekannten Stadt hinter uns. Die Landschaft macht in ihrem unberührten Zustand einen geradezu fremdartigen Eindruck: wie die Oberfläche eines exotischen, entfernten Kolonialplaneten. Ich sehe felsige Hügelketten, deren Hänge mit einer kargen buschartigen Vegetation bewachsen sind.
Schließlich erreichen wir unser Ziel.
Der plötzliche Übergang in die militärische Basis verwirrt mich. Eben betrachten wir noch die eigentümlich karge Landschaft, und im nächsten Moment fahren wir in eine Sicherheitsschleuse ein, die wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein scheint. Kurz bevor der Bus die Schleuse erreicht, sehe ich noch, wie Zäune sich meilenweit in die Ferne erstrecken.
Dann fahren wir noch einmal eine Viertelstunde lang weiter, vorbei an Reihen identisch aussehender Gebäude und künstlicher Rasenflächen. Schließlich biegen wir – nach vielen scharfen Rechtskurven auf zunehmend belebten Nebenstraßen – auf einen Exerzierplatz vor einem geduckten, unansehnlichen eingeschossigen Gebäude ein, das wie ein übergroßer Speicherbehälter aussieht.
Die Türen des Busses öffnen sich, und bevor jemand von uns sich noch fragen kann, ob wir sitzen bleiben oder Initiative zeigen und aussteigen sollen, steigt ein Soldat in den Bus ein. Er trägt eine Tarnuniform. Die Ärmel sind akkurat hochgekrempelt, mit scharfen Falten in den Ellbogen. Die Innenseite des hochgekrempelten Ärmels wird durch die Armbeuge verdeckt, sodass das Tarnmuster das hellere Futter der Uniformjacke kaschiert. Am Kragen ist ein Rangabzeichen. Überhaupt hat der Mann viel mehr Winkel und Bögen am Kragen als der Sergeant, der in der Rekrutierungsstation mein Zulassungsschreiben entgegengenommen hat. Dieser Soldat hat einen leicht gereizten Gesichtsausdruck, als ob unsere Ankunft ihn bei irgendeiner angenehmen Tätigkeit gestört hätte.
»Achtung«, sagt er. »Ihr werdet der Reihe nach diszipliniert aus dem Bus aussteigen. Der Platz ist mit gelben Fußsymbolen markiert. Jeder von euch stellt sich auf zwei dieser Symbole. Ihr werdet weder reden noch irgendwelche Faxen machen oder euch am Sack kratzen. Falls ihr noch etwas im Mund habt, spuckt es aus und werft es in den Abfallbehälter neben dem Sitz. Ausführung«, fügt er in einem Ton der Endgültigkeit hinzu, und dann steigt er wieder aus, ohne sich noch einmal umzusehen. Als ob er über jeden Zweifel erhaben wäre, dass wir seinen Anweisungen exakt Folge leisten werden.
Wir verlassen unsere Plätze und versammeln uns auf dem Exerzierplatz. Der Betonboden ist mit mehreren Reihen gelber Fußsymbole markiert, und jeder von uns stellt sich wie befohlen auf. Als wir in unordentlichen Reihen angetreten sind, geht der Soldat aus dem Bus um unseren zusammengewürfelten Haufen herum, zieht mit einem energischen Ruck die Uniform straff, verschränkt die Arme hinter dem Rücken und stellt die Füße eine Schulterbreite auseinander.
»Ich bin Master Sergeant Gau. Ich bin keiner von euren Ausbildern, also müsst ihr euch mein Gesicht nicht einprägen. Ich habe nur den Auftrag, euch in den ersten zwei Tagen anzuleiten, während wir euch aufnehmen und in die Ausbildungszüge einteilen.
Achtung«, sagt er wieder. Und so, wie er dieses Wort betont, hat es den Anschein, dass er nicht nur unsere Aufmerksamkeit verlangt, sondern sicherstellen will, dass wir in diesem Moment mental und körperlich voll präsent sind.
»Ihr gehört zu den zehn Prozent der Bewerber, die zu den Streitkräften des Nordamerikanischen Commonwealth zugelassen wurden. Vielleicht glaubt ihr jetzt, dass das euch irgendwie zu etwas Besonderem macht. Das macht es keineswegs.
Ihr glaubt vielleicht, dass wir, weil ihr die erste Hürde genommen habt, jetzt viel Mühe darauf verwenden werden, euch zu Soldaten zu formen und euch dabei zu helfen, eure persönlichen Schwächen zu überwinden. Das werden wir nicht.
Ihr glaubt vielleicht, dass dieses Bootcamp eine Ähnlichkeit mit den Einrichtungen hat, die ihr in den Netzen gesehen habt. Hat es nicht.
Wir werden euch nicht schlagen oder auch nur schlecht behandeln. Ihr könnt jederzeit einen Befehl oder eine Anweisung missachten. Wenn ihr aber einen Befehl missachtet, seid ihr raus. Wenn ihr eine Abschlussprüfung oder einen Befähigungstest nicht besteht, seid ihr raus. Wenn ihr einen Kameraden oder einen Vorgesetzten angreift, seid ihr raus. Wenn ihr einen Diebstahl begeht, krumme Touren macht oder wenn ihr es an der richtigen Einstellung fehlen lasst, seid ihr raus. Es steht im Ermessen eurer Ausbilder, euch ohne Angabe von Gründen rauszuwerfen.
Bei einem Rauswurf habt ihr nichts zu befürchten. Ihr werdet nur in ein Shuttle gesetzt und fliegt nach Hause. Ihr schuldet dem Staat kein Geld und müsst keine rechtlichen Sanktionen fürchten. Wir lösen euren Vertrag einfach auf, und dann seid ihr wieder Zivilisten.
Wir sieben schon in der Grundausbildung fünfzig Prozent der Rekruten aus, und ein Viertel von euch wird während der Dienstzeit getötet oder verstümmelt, ohne dass ihr am Ende eure Dienstzeitbescheinigung erhaltet. Von den vierzig Leuten, die jetzt vor mir stehen, werden nur zwanzig die Grundausbildung schaffen. Und nur fünfzehn von euch werden in fünf Jahren ausgemustert.
Falls ihr eure Aussichten eher pessimistisch beurteilt, könnt ihr jetzt gehen und wieder in den Bus einsteigen. Falls meine Ansprache bei euch einen Sinneswandel bezüglich des Dienstes in der Armee bewirkt hat, erspart euch und euren Ausbildern doch die Mühe und den Schweiß und steigt gleich wieder in den Bus ein.«
Sergeant Gau hält inne und sieht uns erwartungsvoll an. Man hört ein Rascheln und Schlurfen in den Reihen, und drei Leute treten aus und gehen zum Bus zurück. Jetzt, wo der Anfang gemacht ist, nehmen auch die ängstlicheren Naturen ihren Mut zusammen und folgen dem Beispiel ihrer Vorgänger: Vier ehemalige Rekruten verlassen die Formation und trotten mit hängenden Schultern zum Bus zurück. Mir fällt auf, dass keiner von ihnen sich noch einmal umsieht.
»Vielen Dank, Leute«, ruft Sergeant Gau ihnen nach. »Das meine ich ernst. Es freut mich, dass manche Leute doch klug genug sind, ihre Grenzen zu erkennen.«
Dann wendet er sich wieder uns zu.
»Der Rest von euch ist dümmer als ein Meter Feldweg, und das meine ich auch ernst. Jetzt geht nacheinander durch diese Tür, setzt euch auf die Stühle im Raum dahinter und verhaltet euch ruhig, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Ausführung.«
Der Raum ist leer – bis auf ein paar Reihen wackeliger Stühle mit Schreibplatten. Jeder von uns nimmt auf einem Stuhl Platz. Ich zähle die leeren Stühle, nachdem alle sich gesetzt haben; es sind exakt genauso viele Stühle im Raum, wie vor dem Ende von Sergeant Gaus Ansprache Leute auf den gelben Fußsymbolen auf dem Exerzierplatz standen. Das einzige Utensil auf den Schreibplatten ist ein schwarzer Filzstift. Ein paar der Rekruten nehmen die Kappen von den Stiften ab. Das erregt das Missfallen von Sergeant Gau, der jetzt den Raum betritt.
»Ich habe nichts davon gesagt, die Stifte aufzunehmen. Ich sagte, ihr solltet euch hinsetzen und ruhig verhalten.«
Die getadelten Rekruten legen die Stifte schnell wieder auf die Schreibplatte. Ein paar von ihnen sehen den Sergeant besorgt an, als ob dieses Vergehen schon ein Grund für einen Rauswurf sei.
»Nehmt die Stifte jetzt auf und entfernt die Kappe.«
Wir tun wie geheißen.
»Ihr schreibt mit dem Stift die folgenden Zahlen auf den linken Handrücken: eins-null-sechs-sechs.«
Ich schreibe die Zahl »1066« auf meinen Handrücken.
»Das ist die Nummer eures Zuges. Ihr gehört jetzt zum Ausbildungszug 1066. Ihr werdet euch die Zugnummer merken.«
1066 war das Jahr der Schlacht bei Hastings. Ich speichere die Nummer meines Zuges im Kopf ab. Streiflichtartig frage ich mich, ob die Zugnummern als laufende Nummer vergeben werden und wo man mit der Zählung begonnen hat. Sind wir die tausendsechsundsechzigste Gruppe von Rekruten in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahr oder in diesem Monat? Wie viele Züge müssen bei einer Durchfallquote von fünfzig Prozent in einem Jahr durch das Bootcamp geschleust werden, um die Personalstärke der NAC-Streitkräfte aufrechtzuerhalten?
Sergeant Gau hat einen Stapel Papier dabei, den er auf die Schreibplatte des Rekruten direkt vor sich fallen lässt.
»Ihr nehmt jetzt jeweils ein Formular von oben weg und gebt den Stapel dann dem Rekruten neben euch weiter. Ihr legt das Formular auf den Tisch und öffnet es erst, wenn ich es euch sage.«
Der Stapel mit den Formularen macht die Runde durch den Raum. Als er schließlich bei mir ankommt, nehme ich das oberste Formular weg und gebe den Stapel dann nach rechts weiter. Es ist ein seltsam befreiendes Gefühl, exakt nach Anweisung zu handeln. Ich muss nicht befürchten, den Sergeant zu verärgern, solange ich genau seine Befehle befolge. Ich beschließe, nicht einmal mehr in der Nase zu bohren, bis ich von jemandem mit Winkeln am Kragen dazu aufgefordert werde.
»Ihr nehmt jetzt euren Stift und füllt das Formular aus. Wenn ihr damit fertig seid, steckt ihr wieder die Kappe auf den Stift und legt ihn auf das ausgefüllte Formular. Ausführung.«
Das ist verwaltungstechnischer Papierkram, der in diesem Stadium überflüssig erscheint. Nachdem ich den Aufnahmeantrag im Rekrutierungsbüro unterschrieben hatte, verbrachte ich schon in der Registrierungsstelle viele Stunden damit, auf unzähligen Formularen alle möglichen Angaben zu machen. Wenn man in einer Sozialwohnungs-Kolonie lebt, weiß der Staat alles über einen, einschließlich des DNA-Profils ab dem Alter von einem Monat. Allerdings scheint die Kommunikation zwischen den zivilen und militärischen Dienststellen nicht sonderlich gut zu funktionieren.
Also fülle ich die Formulare aus und trage zum x-ten Mal die Kennzahlen meiner Existenz ein.
Die letzte Seite ist ein Vertrag – fünf klein gedruckte Paragrafen in Juristenjargon. Ich lese sie quer: Es sind die gleichen Informationen, die sie uns im Rekrutierungsbüro gegeben haben. Früher hatte der Rekrutierungsunteroffizier den Auftrag, potenziellen Rekruten den Eintritt in die Armee schmackhaft zu machen, indem er die Vorteile des Militärdiensts betonte und die Nachteile herunterspielte. Heute ist das aber nicht mehr so. Heute werden die Vorteile kaum noch erwähnt. Jeder weiß, dass man verpflegt wird und dass ein echtes Bankkonto und eine Dienstzeitbescheinigung winken, falls man die gesamte Dienstzeit durchhält, für die man sich verpflichtet hat. Vielmehr will man heute möglichst viele Leute vom Eintritt in die Armee abschrecken, indem man die Nachteile des Militärdienstes hervorhebt. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass es eine monatliche Quote für die Ablehnung von Leuten gibt, die einen Antrag auf Eintritt in die Streitkräfte stellen.
Am Ende meiner Dienstzeit wird das Konto aktiviert, und ich kann frei über den bis dahin aufgelaufenen Saldo von zweiundsechzig Gehaltsschecks verfügen. Falls ich sterbe, bevor die Dienstzeit abgelaufen ist, fließt das ganze Geld auf meinem Konto an den Staat zurück – als Ausgleich für die Kosten meiner Ausbildung und der Ausrüstung.
Ich unterzeichne den Vertrag. Deshalb bin ich schließlich auch hier – um aus dem PRC rauszukommen und eine Chance auf ein richtiges Bankkonto zu haben. Es ist mir auch egal, was sie mit dem Geld machen, falls ich sterbe. Bis ich die Dienstzeitbescheinigung in den Händen halte, ist dieses Geld sowieso eine Abstraktion, nur eine Reihe von Zahlen in einer Datenbank.
Als alle fertig sind, befiehlt Sergeant Gau einem der Kameraden, die Formulare wieder einzusammeln und sie auf dem Pult an der Stirnseite des Raumes abzulegen.
»Glückwunsch«, sagt Sergeant Gau. »Ab sofort sind Sie offiziell Angehörige der Streitkräfte des Nordamerikanischen Commonwealth. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies ein Dienstverhältnis auf Probe ist, bis Sie die Grundausbildung bestanden haben.«
Es gibt keine Zeremonie, keine Vereidigung, kein pompöses Ritual. Man unterzeichnet ein Formular, und schon ist man Soldat. Irgendwie enttäuschend, aber wenigstens sind sie auch in dieser Hinsicht konsequent.
3
BEEILT EUCH UND WARTET
Am ersten Tag stehen wir größtenteils nur herum und warten darauf, dass es irgendwie weitergeht. Dann findet eine weitere medizinische Untersuchung statt, wobei zwei Ärzte sich um den ganzen Zug kümmern; deshalb dauert es fast drei Stunden, bis wir alle untersucht worden sind. Wir werden kurz gescannt und bekommen Blut abgenommen, um sicherzustellen, dass wir uns nicht noch in letzter Minute einem Drogenexzess hingegeben haben. Dann bekommen wir eine Reihe von Spritzen – sechs verschiedene Präparate, die uns in schneller Folge verabreicht werden. Ich hätte mich wohl dafür interessieren müssen, was für ein Zeug man mir da injiziert hat, aber irgendwie juckt es mich nicht. Zumal ich die Spritzen sowieso nicht hätte verweigern können.
Nach der medizinischen Untersuchung führt Sergeant Gau uns zu einem anderen Gebäude, wo wir Aufstellung nehmen. Wir sehen, dass weitere Züge nacheinander durch die Tür verschwinden. Die anderen Züge tragen bereits Uniformen: eine sackartige Kluft mit einem grün-blauen Fleckmuster, mit dem man wohl überall auffallen würde wie ein bunter Hund.
»Essen fassen«, verkündet Sergeant Gau. Diese Worte zaubern meinen Kameraden das erste Lächeln ins Gesicht, das ich gesehen habe, seit wir heute am frühen Morgen hier eingetroffen sind.
»Wir betreten die Kantine in einer Reihe. Sie nehmen sich ein Tablett vom Stapel am Anfang der Essensausgabe. Sie können sich bei allen Speisen bedienen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Wenn das Tablett voll ist, suchen Sie sich einen Tisch und setzen sich. Sobald Sie sich gesetzt haben, fangen Sie an zu essen. Sie können sich während des Essens mit Ihren Kameraden unterhalten. Sobald ich Ihre Zugnummer rufe, beenden Sie die Mahlzeit und die Gespräche, bringen die Tabletts zu den Gestellen an der Tür und nehmen vor der Kantine wieder in einer Reihe Aufstellung.«
Die meisten von uns haben nichts mehr gegessen, seit sie zu den heimischen Registrierungsstellen aufgebrochen sind. Ich bin hungrig, und aus der plötzlichen Wallung in den Reihen des Zuges schließe ich, dass ich da nicht der Einzige bin.
»Noch ein wohl gemeinter Ratschlag«, sagt Sergeant Gau, bevor er uns in die Kantine führt. »Achten Sie darauf, nicht zu viel zu essen. Sonst kotzen Sie sich die Gedärme aus dem Leib, wenn die körperlichen Übungen anfangen. Ich rate Ihnen, den Appetit zu zügeln.«
Die Kantine hallt schon vom Summen gedämpfter Gespräche zwischen den Rekruten wider, die vor Zug 1066 Tische besetzt haben. Wir bewahren jedoch Stillschweigen, während wir in der Schlange darauf warten, unsere Tabletts zu füllen. Aber wir haben die Möglichkeit, uns umzuschauen. Davon machen wir auch Gebrauch und sehen uns mit ungläubigem und aufgeregtem Gesichtsausdruck an. Da stehen große Metalltabletts mit Speisen hinter der gläsernen Trennwand zwischen der Kantine und der Küche. Etwas so Gutes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und gerochen.
Das Essen auf den Tabletts vor uns ist real. Ich sehe Kartoffelbrei, Bratenaufschnitt mit Soße, Nudeln und Reis. Ich muss ein hohes Maß an Selbstbeherrschung aufbringen, um mir nicht ein Tablett zu schnappen und mich bis zum Anfang der Schlange vorzudrängeln, wo ich Donuts, Kuchenstücke und eine Art Fruchtdessert sehe. Es ist wahrscheinlich die plötzliche Überlastung des Geruchssinns, aber ich bin mir sicher, den Schokoladenüberzug auf den Donuts noch am Ende der Schlange riechen zu können.
Wir alle laden unsere Tabletts dann doch mit zu viel Essen voll. Ich nehme einen Salat, eine Schüssel mit Suppe, in der Gemüse und ein paar Stücke Hähnchenfleisch schwimmen, einen ordentlichen Klacks Kartoffelbrei und zwei Scheiben Braten. Dann verschiebe ich das Geschirr auf dem Tablett, um noch Platz für zwei Donuts und ein Stück Apfelkuchen zu machen. Als ich mich zur Schlange hinter mir umdrehe, sehe ich nur sehr wenige Tabletts, die weniger beladen sind als meines.
Ich suche mir einen Platz an einem der langen Tische in der Kantine und haue rein, sobald mein Hintern den Sitz berührt hat. Wir dürfen jetzt zwar miteinander sprechen, aber in den ersten paar Minuten sind wir alle zu sehr damit beschäftigt, uns Essen in den Mund zu stopfen.
»Daran könnte ich mich gewöhnen«, sagt schließlich einer der Rekruten am Tisch. Er selber ist das, was man gewöhnlich als eine halbe Portion bezeichnet, mit Aknenarben und einem struppigen Kinnbart.
»Man wird dir sicher befehlen, das abzurasieren«, sage ich und deute zur Veranschaulichung auf mein Kinn. Er zuckt nur die Achseln.
»Wenn sie mir jeden Tag so was servieren, können sie mich meinetwegen am ganzen Körper rasieren, dass ich aussehe wie ein Nacktmull.«
Es sitzen noch vier weitere Rekruten an unserem Tisch, die alle herausfinden wollen, wie viel Essen sie in den Mund stopfen können, ohne eine Maulsperre zu bekommen. An unserem Tisch herrscht Geschlechterparität – drei Männer, drei Frauen –, und als ich den Blick über die anderen Tische schweifen lasse, stelle ich fest, dass dieses zahlenmäßige Geschlechterverhältnis sich auch in den anderen Zügen widerzuspiegeln scheint.
»Das ist echtes Fleisch«, sagt irgendwer am Tisch – eine große Frau mit kurzem, dunklem Haar. »Es ist sogar schön marmoriert. Ich hatte kein richtiges Stück Fleisch mehr, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin.«
»Rindfleisch«, sagt ihr Sitznachbar und deutet mit der Gabel darauf. »Das ist ein Hundert-Dollar-Filetstück.«
Die junge Frau schneidet sich ein ordentliches Stück von ihrem Fleisch ab und stopft es sich in den Mund.
»Da verschwinden zehn Dollar«, sagt sie mit vollem Mund.
Ich bin mir sicher, dass sie uns für jeden Bissen später ordentlich schwitzen lassen. Doch im Moment bin ich entschlossen, das Essen zu genießen, und stopfe so viele Kalorien wie möglich in mich rein, ohne dass mir dabei schlecht wird. Das Essen allein ist die Mühe des Eintritts in die Armee schon wert; und wenn die Verpflegung beim Militär immer so gut ist wie jetzt, werde ich mit Freuden über jedes Stöckchen springen, das sie mir hinhalten.
Nach dem Essen führt Sergeant Gau uns zu einem Lagerhaus voller Uniformen und militärischer Ausrüstung. Die Ausgabe der Ausrüstung erfolgt im Grunde nach dem gleichen Prinzip wie die Essensausgabe: Wir gehen in einer Reihe an den Ausgabestationen vorbei.
An der ersten Station zieht ein mürrisch blickender Angestellter einen großen Rucksack und einen noch größeren Seesack von einem Stapel und wirft beides auf die Theke vor mir. Das robuste Segeltuch ist stellenweise aufgescheuert, die olivgrüne Farbe verblasst, und ich sehe das von Nahtstichen eingefasste Rechteck, wo das Namensschild des Besitzers von der Außenklappe des Rucksacks entfernt wurde.
Der Rest der Ausrüstung ist ebenfalls gebraucht und rangiert im Erhaltungszustand von »mit leichten Gebrauchsspuren« bis »fast unbrauchbar«. Die Messerklinge zeigt die Spuren von hundertfachem Schleifen. Der Klappspaten war ursprünglich olivfarben lackiert, aber die Farbe ist zum größten Teil abgeplatzt, und die Kante des Spatenblattes ist schartig. Es sieht so aus, als ob sie uns hauptsächlich Zeugs geben, das gerade noch gut genug ist für einen Ausbildungszyklus und dann entsorgt werden kann.
Sie nehmen bei uns Maß für die Uniformen und geben dann jedem von uns ein paar Bekleidungsgarnituren. Diese Bekleidung ist ebenfalls gebraucht, doch stelle ich erfreut fest, dass wenigstens die Unterwäsche und die Strümpfe brandneu zu sein scheinen. Ich sage mir, dass selbst der Sparwut des Staates Grenzen gesetzt sind.
»Das könnt ihr behalten«, sagt Sergeant Gau, als er sieht, wie ich die neuen grauen Kniestrümpfe inspiziere und sie auf meiner »Ausrüstungsempfangs«-Liste abhake. Ich verstaue die Strümpfe im Seesack.
»Wenn ihr rausfliegt, nehmt ihr die Strümpfe und Unterwäsche mit. Es würde sie dann sowieso niemand mehr tragen wollen. Betrachtet die Sachen als ein Souvenir für euer kurzes Leben beim Militär.«
Wir verbringen den Nachmittag damit, die Rucksäcke und Seesäcke zu füllen: Uniformen, Regenschutz, Stiefelbeutel, Helme, Kampfstiefel, ABC-Schutzausrüstung, Sportschuhe, Duschsandalen, Nähzeug und noch einige andere Artikel mit unbekanntem Verwendungszweck. Als wir schließlich die letzte Station verlassen, ist es schon später Nachmittag. Mit dem Rucksack und dem Seesack hat man uns ein Gewicht von schätzungsweise hundert Pfund insgesamt aufgebürdet. Ein paar der kleineren Angehörigen unseres Zugs schwanken unter der Last, während wir wieder vor dem Gebäude antreten. Uns mit einem Zentner Ausrüstung zu den Quartieren marschieren zu lassen wäre die ideale Gelegenheit für ein Ausdauertraining, aber Sergeant Gau hat einen Bus für uns vorfahren lassen.
Unsere Quartiere befinden sich in einem großen Gebäude mit Flachdach, das in einer langen Reihe identischer Gebäude steht. Das einzige Unterscheidungsmerkmal ist das taktische Zeichen über dem Eingang und ein großer Bildschirm, auf dem die Anzahl der dort untergebrachten Züge angezeigt wird. Wir teilen unser Gebäude mit fünf weiteren Zügen. Das zentrale Treppenhaus teilt das Gebäude in der Mitte: Von jedem Flur zu beiden Seiten des Treppenhauses geht ein großer Raum ab. Als Sergeant Gau uns zu dem Bereich führt, der für unseren Zug reserviert ist, sehen wir zwei Reihen von Etagenbetten – eine auf jeder Seite des Raums. Vor jedem Etagenbett stehen zwei Spinde, die zum Mittelgang ausgerichtet sind.
»An den Betten sind Namensschilder«, sagt Sergeant Gau, als wir unser Zugquartier betreten. »Suchen Sie Ihre Betten, und legen Sie den Rucksack und Seesack darauf ab. Ausführung.«
Es geht etwas chaotisch zu, als dreiunddreißig Rekruten ausschwärmen, um ihr Bett zu finden, aber wir stellen dann fest, dass sie in alphabetischer Reihenfolge gekennzeichnet sind. Auf jedem Bett liegt ein kleiner Stapel Bettwäsche, eine Decke und ein Kissen am Kopfende.
Mein »Kojenkamerad« erweist sich als die dunkelhaarige Frau vom Tisch in der Kantine. Wir lächeln uns aufmunternd an, während wir unsere Sachen auf die Betten legen. Sie hat das obere Bett, was allein der alphabetischen Reihenfolge geschuldet ist: Sie ist HALLEYD, und ich bin GRAYSONA.
Dann verbringen wir eine weitere Stunde damit, unsere Sachen wieder auszupacken und alles unter der Anleitung von Sergeant Gau in die Spinde zu sortieren. Er steht in der Mitte des Zugquartiers und hat den Inhalt der Tasche eines Rekruten vor sich auf dem Boden verteilt. Jeweils einen Gegenstand hält er hoch, nennt seine Bezeichnung und wartet, bis wir das gleiche Objekt unter unseren Sachen gefunden haben. Nachdem er sich vergewissert hat, dass wir alle das gleiche Ding hochhalten, sagt er uns, wo wir es im Spind deponieren müssen.
Nachdem wir die Ausrüstung verstaut haben, befiehlt Sergeant Gau uns, die Spinde erneut zu öffnen und den Trainingsanzug und die Sportschuhe herauszuholen. Wir ziehen die Trainingsanzüge an, und zum ersten Mal zeigt der Zug ein einheitliches Erscheinungsbild.
»Nehmen Sie Ihre Zivilkleidung und verstauen Sie diese in der Schublade rechts unten im Spind. Die meisten von Ihnen werden sie sowieso bald wieder brauchen.«
Nachdem wir die Ausrüstung im Spind verstaut haben, führt Sergeant Gau uns wieder in die Kantine. Das Abendessen ist nicht weniger grandios als das Mittagessen, und wir hauen wieder rein, bis wir nicht mehr können: gegrillte Käse-Sandwiches, Fleischeintopf und drei verschiedene Obstsorten.
Nach dem Essen gehen wir in unsere Unterkunft zurück, wo wir Persönliche Daten-Pads auf den Betten finden. Die Pads haben einen Aufkleber über dem Display, auf dem der Nachname des neuen Besitzers steht. So etwas wie diese PDPs habe ich noch nie gesehen. Sie sind groß, klobig und haben ein Monochrom-Display wie aus den Anfängen des Computerzeitalters. Sie haben durchscheinende Kunststoffabdeckungen, mit denen das Pad im Feld geschützt wird, und das Ding passt genau in die Seitentasche der Bekleidungsgarnituren, die sie uns vorhin ausgegeben haben.
»Nicht gerade die modernste Technologie«, sagt meine Kojen-Kameradin mit gedämpfter Stimme, während sie ihr Pad inspiziert. »Ich hatte schon in der Grundschule bessere Geräte.«
»Das sind eure neuen Begleiter«, sagt Sergeant Gau in der Mitte des Zugquartiers. »Sie machen vielleicht nicht viel her, aber sie sind robust und zuverlässig. Macht euch mit eurem PDP vertraut und geht Kapitel 1001 mit dem Titel ›Zeitsoldaten und Offiziere‹ durch.«
Wir setzen uns in zwei Reihen an den Mittelgang, rufen das entsprechende Kapitel auf, und Sergeant Gau befiehlt uns, die Dienstgrade der Streitkräfte vom höchsten bis zum niedrigsten Rang aufzusagen. Nachdem wir die Litanei ein paar Dutzend Mal wiederholt haben, befiehlt Sergeant Gau uns, die PDP auszuschalten und die Dienstgrade noch ein paar Dutzend Mal aus dem Gedächtnis zu rezitieren. Als er sich vergewissert hat, dass wir die militärische Hierarchie aus dem Effeff kennen, befiehlt er uns, die Pads wegzustecken.
»Und jetzt wollen wir mal sehen«, sagt er, »wer von euch mir vorhin wirklich zugehört hat. In Dreierreihe vor dem Gebäude antreten. Ausführung.«
Wir sehen uns mit zunehmender Besorgnis an. Wir haben uns beim Mittagessen und Abendessen alle den Bauch vollgeschlagen – beim Abendessen noch mehr, weil wir nicht den ganzen Tag lang trainieren mussten –, und ich verspüre noch immer ein unangenehmes Völlegefühl. Schon der bloße Gedanke zu laufen oder Liegestütze zu machen verursacht mir Übelkeit.
»Ich meinte sofort, Leute«, bellt Sergeant Gau, und wir alle verlassen im Laufschritt das Zugquartier.
Nachdem wir in drei unordentlichen Reihen angetreten sind, führt Sergeant Gau uns die Straße entlang. Zuerst gehen wir noch, doch nach ein paar Schritten fällt Sergeant Gau in einen Trab.
»Schritt halten«, sagt er. Und der Ton, in dem er das sagt, macht deutlich, dass das kein unverbindlicher Vorschlag ist.
Sergeant Gau legt kein besonders hohes Tempo vor, doch nach zehn Minuten bekomme ich schon Seitenstechen und der Magen hüpft wie ein schlecht ausgewuchtetes Gegengewicht auf und ab. Stöhnend und hustend versuchen wir, mit Sergeant Gau Schritt zu halten. Er läuft in Uniform und Kampfstiefeln und atmet nicht einmal schwer.
Nach einer halben Stunde bleiben die ersten Angehörigen des Zugs schwankend am Wegrand stehen und kotzen das Abendessen wieder aus. Ich spüre selbst schon die Magensäure aufsteigen, als mein Magen diesem Beispiel folgen will, aber es gelingt mir noch, den Deckel draufzuhalten.
Dann verlangsamt Sergeant Gau wieder auf Schritttempo. Er bedeutet dem Zug kehrtzumachen, und dann befiehlt er uns, uns um die drei Rekruten zu versammeln, die noch immer gekrümmt und mit gespreizten Beinen über Lachen von Erbrochenem am Straßenrand stehen. Der Gestank von frisch Erbrochenem löst eine neue Welle der Übelkeit bei mir aus, und jetzt kotze ich doch den Inhalt meines Magens in den Rinnstein.
Als ich mich ausgekotzt habe, sehe ich, dass ich nicht der Einzige war, der den Gestank nicht ertragen konnte. Der halbe Zug sorgt fleißig für Nachschub für die stinkende Suppe, die nun den Rinnstein entlangfließt.
»Ich nehme an, dass Sie diese Lektion gelernt haben«, sagt Sergeant Gau ohne Häme oder Bösartigkeit.
Nach der Rückkehr ins Zugquartier lässt Sergeant Gau uns wieder vor den Spinden antreten. Es fällt schwer, mit Erbrochenem an der Kleidung einen würdevollen Eindruck zu machen.
»Das soll für heute mal reichen«, sagt er. »Wenn Sie sich fragen, wieso bisher noch niemand von Ihnen rausgeflogen ist – die Antwort ist ganz einfach: Sie haben die eigentliche Ausbildung noch nicht begonnen. Also haben wir Ihnen auch noch nicht die Gelegenheit gegeben, Scheiße zu bauen. Das wird sich morgen früh aber ändern, exakt um vier Uhr dreißig. Sie haben jetzt zehn Minuten Zeit für Körperhygiene im Wasch- und Toilettenraum des Zugquartiers. Exakt um einundzwanzig Uhr werden Sie wieder vor den Spinden antreten, und Sie tragen dann die ausgegebenen Schlafanzüge. Ausführung.«
Der Waschraum ist ein großer Raum mit Toiletten an einer Wand, Duschbuchten an der anderen und einer kreisförmigen Anordnung aus Edelstahlwaschbecken in der Mitte des Raums. Privatsphäre gibt es hier nicht. Weder die Toiletten noch die Duschen haben Türen oder Trennwände.
Wir waschen uns und ziehen wie befohlen die Pyjamas an. Die Versionen für Männer und Frauen sind identisch: formlose blaue Lappen, die überhaupt nicht militärisch wirken. Als alle wie von Sergeant Gau befohlen am Mittelgang angetreten sind, sehen wir aus wie eine Schar hoch aufgeschossener Waisenkinder, die um eine Schale Suppe anstehen.
»Schlafenszeit«, sagt Sergeant Gau, nachdem er den Zug einer flüchtigen Inspektion unterzogen hat. »Sie legen sich jetzt ins Bett. Es wird nicht mehr geredet, sobald das Licht aus ist. Bei einem Notfall klopft einer von Ihnen an die Tür des Ausbildungsleiters. Ich werde heute dort schlafen, anstatt in meinem Quartier bei meiner Frau. Stören Sie mich nicht, wenn es sich nicht um etwas wirklich Ernstes handelt.«
Als wir dann in den Betten liegen und uns in die kratzigen Decken gewickelt haben, werden die LEDs an der Decke langsam dunkler, bis sie schließlich ganz verlöschen. Es ist dunkel im Raum, und ich höre nur das Atmen der Kameraden und das Summen der Klimaanlage, das die Raumtemperatur bei exakt zwanzig Grad hält und alle Schadstoffe in der Luft ausfiltert. Wir sind zwar weit von den Metroplexen entfernt, doch weil Chicagoland, Los Angeles-San Diego-Tijuana und der Großraum New York schon heute jeweils fünfzig Millionen Einwohner haben, gibt es kaum noch Gegenden im ganzen Land, wo man kein solches Klimagerät braucht.
Meine Kojenkameradin beugt sich über die Bettkante, und ich erkenne gerade noch die Konturen ihres Kopfs in der fast völligen Finsternis.
»Es ist gar nicht so schlimm«, flüstert sie.
»Bis auf die Episode mit dem Kotzen«, antworte ich ebenfalls im Flüsterton, und sie kichert leise.
Das Essen war das Beste, das ich jemals genossen hatte, aber die Schlafgelegenheiten beim Militär sind nicht besser als die, die ich in Moms Apartment im PRC hatte. Die Matratze fühlt sich so an, als sei sie im selben Staatsbetrieb hergestellt worden wie die in meinem Kinderzimmer.
Während ich einzuschlafen versuche, verspüre ich zu meinem Erstaunen Heimweh. Sosehr ich mich darauf gefreut hatte, aus dem PRC rauszukommen – ein Teil von mir will überhaupt nicht hier sein, mit so vielen völlig fremden Leuten in einem Raum zu schlafen, ihren Atem und gelegentliches Husten zu hören. Zu Hause hatte ich wenigstens so etwas wie Privatsphäre, wenn ich es denn wollte. Ein Teil von mir will die Berechenbarkeit meines alten Lebens zurück. Wenn ich zu Hause aufwachte, wusste ich genau, was der Tag bringen würde. Doch ich habe keine Ahnung, was geschehen wird, wenn ich morgen früh aufwache. Es ist ein befreiendes, aber auch ein unglaublich beängstigendes Gefühl.
Ich ziehe mir das dünne Schaumstoffkissen um den Hinterkopf, sodass es die Ohren bedeckt. In der plötzlich herrschenden Stille drifte ich endlich in den Schlaf ab, heißt: Das Gehirn kapituliert vor dem übermüdeten Körper.
4
ALLES IST IM FLUSS
Um exakt 0430 morgens gehen die Decken-LEDs an, und Sergeant Gau betritt das Zugquartier.
»Raus aus den Betten – sofort«, schreit er als Morgengruß. »Erledigen Sie Ihre Verrichtungen, waschen Sie sich, und ziehen Sie die Grün-Blaue an. Das ist die Uniform mit den Flecken. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie auf dem PDP ›UNIFORM, KAMPF, PERSÖNLICH‹ auf. Der Morgenappell ist um 0455. Also beeilen Sie sich.«
Zwanzig Minuten später sind wir alle in Montur und vor den Spinden angetreten. Falls Sergeant Gau überhaupt angenehm berührt ist, weil wir schon fünf Minuten vor der Zeit fertig sind, zeigt er es nicht. In die Wand des Büros des Ausbildungsleiters ist ein Fenster eingelassen. Und wie ich sehe, weiß er ganz genau, dass der Zug angetreten ist und auf den Appell wartet. Aber er kommt erst wieder aus dem Büro, als die Uhr an der Stirnseite des Raums 0455 zeigt.
Wir marschieren zum Frühstück. Es ist erst unsere dritte Mahlzeit beim Militär, doch an den Tischen, an die wir uns am ersten Tag nach dem Zufallsprinzip gesetzt hatten, bilden sich bereits feste kleine Gruppen heraus. Unser Sechsertisch hatte bisher bei jeder Mahlzeit die gleiche Zusammensetzung. Da wären ich und meine Kojenkameradin Halley. Dann Ricci, der schmächtige Junge mit der Akne und dem albernen Ziegenbart, sowie Hamilton, eine athletisch wirkende junge Frau mit langen blonden Haaren. Und dann wäre da noch Cunningham, die überall mit Tattoos bedeckt ist und die schon einen Kurzhaarschnitt trägt, lange bevor sie beschlossen hat, in die Armee einzutreten. Und schließlich Garcia, ein Typ mit dunklen Augen, der nie etwas sagt, es sei denn, man spricht ihn an. Halley ist von SeaTacVan, Ricci aus der Dallas-Fort Worth-Metroplex und Hamilton aus Utah. Cunningham hat sich in irgendeinem Kaff in Tennessee registrieren lassen, und Garcia schüttelt bloß den Kopf, wenn man ihn nach seinem Heimatort fragt.
»Welche Teilstreitkraft würdet ihr euch aussuchen, wenn ihr die Wahl hättet?«, fragt Ricci uns bei Rührei und Toast.
»Scheiße«, sagt Halley lachend. »Ich wäre schon froh, wenn ich die Grundausbildung schaffe. Dann können sie mich überall hinstecken, wo sie wollen.«
»Komm schon«, hakt Ricci nach. »Jeder hat doch eine besondere Vorliebe.«
Halley schiebt sich noch einmal eine Gabel mit Eiern in den Mund und zuckt die Achseln, bevor sie antwortet.