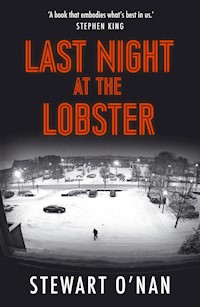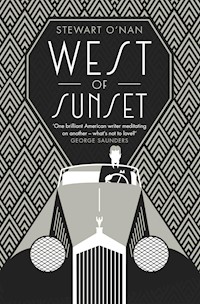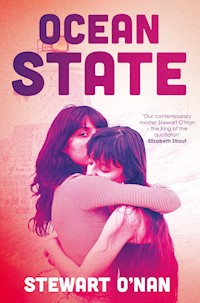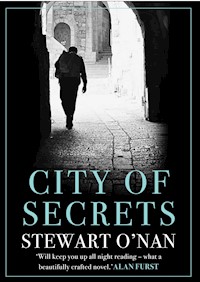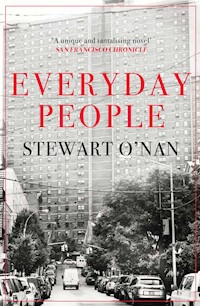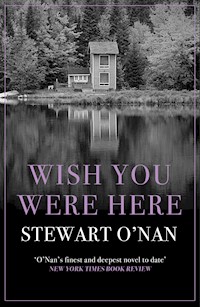9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
«Ein grandioser Generationenroman.» (Die Zeit) «Man ist nach wenigen Seiten von der Stadt und ihren Personen vollkommen absorbiert und möchte sie so schnell nicht mehr verlassen – buchstäblich bis zum bitteren Ende.» (Neue Zürcher Zeitung) «Stewart O'Nan erweist sich einmal mehr als ein glänzender Erzähler.» (Süddeutsche Zeitung) «Der Meister des subtilen Schreckens.» (Der Spiegel) «Ein phantastischer Autor.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Meisterlich.» (Brigitte)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Ähnliche
Stewart O’Nan
Alle, alle lieben dich
Roman
Deutsch von Thomas Gunkel
Für Trudy, Caitlin und Stephen
Someday I’ll wish upon a star
and wake up where the clouds are far
behind me
Where troubles melt like lemon drops
away above the chimney tops
that’s where you’ll find me
Beschreibung der vermissten Person
Juli 2005.Es war der Sommer, als Kim die Chevette fuhr, mit J.P. zusammen war und sich das Haar wachsen ließ. Der letzte Sommer, der beste Sommer, der Sommer, von dem sie seit der achten Klasse geträumt hatten, der anhaltende Stolz und die Freude, die ältesten Schüler zu sein, die Verlängerung ihres besten Jahres. Sie, Nina und Elise, die drei Amigos. Im Herbst würden sie aufs College gehen, wo sich Kim, wenn sie sich genug Mühe gab, hoffentlich in einen anderen Menschen verwandeln würde, der geheimnisvoll und unabhängig war und nichts mehr mit Kingsville zu tun hatte.
Die Sünden des Mittelwestens: die flache, menschenleere Landschaft, die notwendige Hinnahme des Vertrauten. Was ist daran romantisch, lebendig begraben zu sein? Langsam alt zu werden?
Sie hasste das Städtchen nicht, wie ihre Schwester es Jahre später von sich behauptete. Nicht Kim, nicht die gute Tochter. Sie mochte den See und dass man an einem klaren Tag von der Steilküste bis nach Kanada schauen konnte. Sie mochte den Fluss, der sich, verborgen in der moosbewachsenen Schieferschlucht, zum Hafen schlängelte. Sie mochte sogar die verfallenden viktorianischen Herrenhäuser in der Grandview Avenue, die ihr Vater zu verkaufen versuchte, die Sandsteinkirchen in der Innenstadt und das Edelstahlrestaurant gegenüber vom Postamt. Sie war erst achtzehn.
An der Conoco-Tankstelle überquerte sie in der Pause gern den Parkplatz und die Auffahrt, stellte sich ans niedrige Geländer der Überführung und rauchte im Dunkeln Mentholzigaretten, während unten der Verkehr vorbeibrauste und die Rücklichter westwärts in die Zukunft preschten. Toledo lag drei Stunden entfernt, auf der anderen Seite von Cleveland, beinahe in einem anderen Land. Lastwagen, die beleuchtet waren wie Raumschiffe, fuhren bebend unter Kims Füßen entlang und zogen heißen Wind und Abgase hinter sich her, die Anhänger beladen mit unbekannter Fracht. Langsam, mit jedem Abend, rückte die Erfüllung ihres Traums vom Weggehen näher – mit dem Segen ihrer Eltern, ihren allergrößten Hoffnungen. Da gab es nichts zu bedauern. Sie konnte nur dankbar sein.
Im Laden der Tankstelle war die Klimaanlage so hoch eingestellt, dass Kim ein T-Shirt unter der Uniform trug. Nina und sie steckten sich alte Namensschilder an, die sie in der Ramschschublade unter der Kasse gefunden hatten. Kim war Angie, und Nina war Sam. Sie drehten sich auf ihren Hockern und beobachteten die Monitore, drückten die Nummern der Zapfsäulen und gaben Wechselgeld heraus. Sie lasen dicke, verrückte Modezeitschriften, riefen bei den anderen an, um zu erfahren, was später noch los war – obwohl auch sie von der Überwachungskamera gefilmt wurden–, und stritten sich darum, wer den Nacho-Topf nachfüllen musste. Ihre Stechkarte steckte im Schlitz, und die Uhr daneben klonkte jede Minute, ein Zeugnis ihrer Beständigkeit. Seit der Abschlussfeier arbeitete sie sieben Tage die Woche und hatte noch keine einzige Schicht versäumt. Die Polizei bezeichnete diese Beständigkeit später als wichtigen Faktor. Insgeheim war sie stolz darauf. Sie war noch nie so zielstrebig gewesen. Dazu hatte sie noch nie einen Grund gehabt.
Die Conoco war eine Oase aus Licht: Sie lockte die Autos vom Highway wie die Mücken an, die gegen die Fensterscheiben prallten. Wenn die Fahrer eintraten, kniffen sie die Augen zusammen, rieben sich den Hals und blieben auf der Matte hinter der Tür stehen, als wäre das Ganze völlig neu und zu viel für sie, als würden die hellen Gänge voller Süßigkeiten und Chips ihr Gehirn so überlasten, dass sie die Schilder direkt vor ihnen nicht lesen konnten.
Dann blinzelten sie Kim entschuldigend an. «Wo sind die…?»
«Dahinten.»
Fünfzig- bis hundertmal pro Abend. Sie zeigte mit dem ganzen Arm darauf, wie ein Gespenst.
«Stimmt echt», sagte Nina. «Je mehr man fährt, desto dümmer wird man.»
«Danke, danke, Sam I Am.»
Die lebenden Toten hatten Mundgeruch. Sie kauften Kaffee, Limonade und Wasser, Zigaretten und Kaugummi, Tootsie Pops und Trockenfleisch, alles, was sie bis zur nächsten Rast benötigten. Dann standen sie, den Kopf wiegend, in der Schlange und bewegten die Lippen zum Text des Uraltpops, der drinnen und draußen ununterbrochen lief, einer höllischen werbefreien Satelliteneinspielung, die anscheinend aus Stücken von U2 und den Doobie Brothers bestand. Sie bezahlten doppelt so viel wie im Giant Eagle und waren dankbar, wenn Kim ihnen mit einem Penny aus der kleinen Schüssel aushalf.
«Vielen Dank, Angie.»
«Vielen Dank, Angie», äffte Nina die Leute nach, drückte sich an Kim wie eine geistig Zurückgebliebene und ließ ihr die Zunge fast bis zum Ohr schnellen.
«Uäh. Hast du gemerkt, wie der gerochen hat?»
«Er wollte dich streicheln und umarmen und es mit dir treiben.»
«Nein, mit dir.»
«Erzähl bloß Hinch nichts davon.»
«Zu spät.»
Am gruseligsten waren die alten Typen, die Kondome kauften und darüber Witze reißen wollten, als wären sie mit ihnen im selben Team. Einer ihrer Stammkunden, den Nina Fat Joe-Bob getauft hatte, wog bestimmt hundertdreißig Kilo und trug das ganze Jahr über eine klotzige Goldkette und dieselbe schwarze Steelers-Jogginghose.
«Ich glaub eigentlich nicht, dass er die Dinger benutzt», sagte Nina. «Wenigstens nicht auf die normale Art.»
«Vielleicht ist er ja verheiratet.»
«Au, meine Augen!», kreischte Nina und hielt sich die Hände vors Gesicht. «Da darf kein Fettfick reinkommen.»
Acht Stunden in einem eiskalten Glaskasten. Nicht mal mit Nina verstrich die Zeit schnell genug.
Ihre Kunden waren nicht alle Fremde. Freunde und Klassenkameraden kamen vorbei und schoben ihnen ihre gefälschten Ausweise über den Tresen. Nina fand es komisch, dass Kim ein schlechtes Gewissen hatte, denn sie besaßen ja selbst welche. Kim befürchtete nicht, dabei erwischt zu werden, sondern fühlte sich ausgenutzt, aber wenn sie sich ein paar Stunden später mit ihren Freunden trafen, trank sie gerne von dem Bier mit und war froh, nichts dafür bezahlen zu müssen.
Jeden Abend führten sie einen Krieg gegen die Langeweile, den sie immer verloren. Kim fand, nach einem ganzen Monat hätten sich ihre Körper eigentlich an die Spätschicht gewöhnen müssen. Nina glaubte, dass es etwas mit den Neonröhren zu tun hatte, mit dem matten, schattenlosen Licht, das die Adern an ihren Händen zum Vorschein brachte, die Handflächen fleckig wie rohe Hamburger. Es war, als lebten sie unter Wasser, zwei gefangene Seejungfrauen, die in einem Aquarium zur Schau gestellt wurden.
Doch eine halbe Stunde vor Feierabend rissen sie sich zusammen, als würden sie jetzt, wo der Tag fast vorbei war, gerade erst aufwachen. Sie wischten bei der Slush-Maschine und der Mikrowelle den Tresen ab, füllten die Kaffeemaschine wieder auf und bereiteten alles für die Übergabe an Doug-o und Kevin vor. Wer war an der Reihe, die Herrentoilette zu putzen?
Danach glich es einem Countdown. Eine brachte vor dem trüben Stahlspiegel auf der Damentoilette ihr Make-up in Ordnung und bürstete sich das Haar, während die andere vorn bediente. Wenn die Nachtschicht kam, hängten sie ihre Tops auf – «Nacht, Angie», «Nacht, Sam» – und gingen zu ihren Seite an Seite geparkten Fluchtwagen.
Alle hatten verschiedene Arbeitszeiten. Bei Pape’s in der Stadt hatte Elise schon Feierabend, während J.P. noch half, das Giant Eagle zu schließen. Hinch und Marnie mussten beim Dairy Queen noch eine Stunde lang arbeiten, also trafen sich alle dort. Das war praktisch. Sie konnten ihre Autos auf dem Parkplatz stehen lassen, direkt am Friedhof. Der Sheriff wohnte genau auf der anderen Straßenseite, also würde sie niemand stören.
Neuerdings musste Kim um zwei Uhr zu Hause sein, ein für alle unbefriedigender Kompromiss. Ihre Mutter arbeitete in der Notaufnahme und hatte ständig Angst, sie könnten bei einem Autounfall ums Leben kommen. Ihr Vater war gelassener und argumentierte mit Versicherungsprämien. Kim dürfe nicht vergessen (als könnte ihr das je entfallen), dass sie noch unter ihrem Dach lebte.
Zum Teil lag es an ihrem neuen Freund J.P., einem lockeren Typ, der auf Frisbee und Rumhängen stand und kein so selbstsicherer Sportler war wie seine Vorgänger. Seine Mutter hatte ihn allein großgezogen, das sprach ebenfalls gegen ihn. Und es machte die Sache auch nicht besser, dass er hinterm Hafen wohnte, in dem Viertel, aus dem ihre Eltern vor vielen Jahren geflohen waren, dass er einen klapprigen Cavalier fuhr und schulterlanges Haar hatte. Ihre Mutter gab J.P. die Schuld an Kims Tattoo, obwohl er Angst vor Nadeln hatte. Ihre Eltern glaubten ihr nicht, wenn sie sagte, er wäre harmlos und unheimlich nett. Wenn überhaupt, dann hatte sie einen schlechten Einfluss auf ihn, aber sie sahen in ihm bloß den Versager, der vielleicht Kims Zukunft zerstörte.
«Sag einfach Bescheid, wo ihr hinfahrt», verlangte ihre Mutter, als sei es das mindeste, was Kim tun könnte. Womit ihre Mutter hauptsächlich meinte, Kim sollte nicht im Polizeibericht des Star-Beacon auftauchen, um den Geschäften ihres Vaters nicht zu schaden. Das hätte der Wahlspruch ihrer Familie sein können: Ein Grundstücksmakler hat nichts außer seinem guten Namen.
«Bei schönem Wetter fahren wir wahrscheinlich an den Strand», sagte Kim, und das war nicht gelogen. Vielleicht würden sie vorher noch in ein paar Kneipen gehen, aber am Ende der Nacht würden sie im kalten Sand um ein Treibholzfeuer sitzen und dem sanften Klatschen der Wellen lauschen. Wenn es regnete, würden sie wahrscheinlich zu Elise fahren und bei ihr im Keller Poolbillard spielen.
«Sag Bescheid, wenn du irgendwo anders hinfährst. Du hast ja dein Handy dabei.»
Eigentlich meinte ihre Mutter das nicht ernst, da sie spätestens um zehn ins Bett musste, um morgens rechtzeitig aufstehen und zur Arbeit fahren zu können. Ihr Vater blieb wach und wartete auf Kim, aber seit der Abschlussfeier hatte sich das geändert. Am Wochenende schlief er immer schon auf dem Sofa, den Fernseher stumm geschaltet, die Fernbedienung auf dem Schoß, und jetzt, wo sie jeden Abend weg war, ließ er nur das Licht hinten im Flur und bei der Treppe an, damit sie den Weg zu ihrem Zimmer fand.
Die Schlafzimmertür ihrer Eltern war zu. Lindsays Tür auch. Wenn Kim ihre Tür schloss, vervollständigte sie bloß das Bild.
Allein im Bett, las sie Madeleine L’Engle und Lloyd Alexander– Geschichten aus anderen Welten, die sie als Kind verschlungen hatte–, als wollte sie diese entschwundene Zeit zurückrufen. Selbst wenn J.P. und Nina sie nach Hause fahren mussten, konnte sie sich einreden, dass sie noch nicht müde war. Sie konnte morgens ausschlafen, kämpfte in der wohligen Wärme ihrer Bettdecke gegen das Karussell in ihrem Kopf an, indem sie sich auf die Sätze konzentrierte, die sich die Seite hinabschlängelten, und wachte am nächsten Tag mit mörderischen Kopfschmerzen im zu hellen Zimmer auf. Dann zog sie das Kissen über den Kopf, bis die Schmerzen nachließen.
An diesem Tag wurde sie gegen elf wach, weil Cooper sich das Fell ableckte. Er hatte die Tür aufgestoßen und lag mit dem Kopf unter der Frisierkommode. «Aus», sagte sie, «Cooper, aus», und konnte dann nicht mehr einschlafen. Zum Ausgleich duschte sie in aller Ruhe und schloss im herabprasselnden Wasser die Augen.
Auf der Weißwandtafel hatte ihre Mutter die Nachricht hinterlassen, sie sollte mit Lindsay eine Übungsfahrt machen, und hatte ein kleines Comic-Auto mit zwei Köpfen im Innern dazugemalt. Lindsay durfte schon fahren, aber nur in Begleitung einer Person, die einen Führerschein besaß, und ihre Mutter hatte passenderweise mal wieder keine Zeit.
«Ich glaub, ich spinne!», sagte Kim, denn sie hatte vor, mit den anderen im Fluss zu schwimmen. Wenn sie das gewusst hätte, wäre sie früher aufgestanden.
Lindsay lag unten auf dem Sofa, sah sich zum x-ten Mal Bubble Boy an und lachte immer schon, bevor die Schauspieler ihren Text sprechen konnten. Sie waren drei Jahre auseinander und in Kims Abschlussjahr noch zusammen auf der Highschool gewesen. Lindsay war das Nesthäkchen und die Intelligentere. Sie trug immer noch eine Zahnspange und hatte scheußliche Pickel, die sie mit Grundierung abzudecken versuchte. Sie war mit den anderen Streberinnen aus der Blechbläsergruppe und dem Robotikclub befreundet. Letzten Frühling hatte sie mit ihren Freundinnen nachts vor dem Kino gezeltet, um in der Schlange für den neuen Krieg der Sterne ganz vorn zu sein. Seit damals nannte Nina sie Obi Wan Ke Nonsens. Kim dachte nur ungern daran, dass Lindsay hier mit ihren Eltern allein sein würde, als würde sie ihre Schwester in einer endlosen Vorhölle zurücklassen.
Aber heute ging Lindsay ihr auf den Wecker. Kim wusste, dass sie sich egoistisch verhielt – genau das hatte ihre Mutter ihr bei ihrem letzten Streit vorgehalten–, doch das machte alles bloß noch schlimmer.
«Auf geht’s», sagte sie. «Zieh die Schuhe an.»
«Ist gleich zu Ende.»
«Drück auf Pause. Ich hab noch was anderes zu tun.»
«Okay, deshalb musst du dich noch lange nicht so idiotisch aufführen.»
«Ich heul mich jedenfalls nicht alle fünf Sekunden bei Mom aus.»
«Ich auch nicht», entgegnete Lindsay. «Dad hat gesagt…»
«Egal, komm einfach. Ich muss um eins wieder da sein.»
Lindsay huschte an ihr vorbei und lief nach oben.
«Wohin willst du?»
«Ich brauche meine Brille.»
Über diese Antwort schüttelte Kim den Kopf. Wer trug denn heutzutage noch eine Brille?
In der Einfahrt sah sie zu, wie Lindsay die Idiotenlichter im Armaturenbrett anstarrte und sich an die richtige Reihenfolge der einzelnen Schritte zu erinnern versuchte. Ihre Hand hielt über dem Schaltknüppel inne wie die eines Neulings beim Bombenentschärfen. Sie hatte das Lehrbuch dabei, als könnte ihr das helfen.
«Handbremse», sagte Kim.
«Ich weiß.»
«Dann mach’s doch.»
Vorsichtig setzte sie zurück, beugte sich nach links, um in den Seitenspiegel zu schauen, und rollte auf den Briefkasten zu. Kim schaltete das Radio aus, um sich konzentrieren zu können.
«Zieh ihn gerade. Gut. Und jetzt ein bisschen Gas.»
Sie folgten den Bahngleisen und übten das Rechtsabbiegen in der heruntergekommenen Gegend rings um die Buffalo Street. Die Straßen dort bestanden noch aus roten Ziegelsteinen, vom Frost angehoben und mit hässlichen Asphaltflicken gesprenkelt. Die Häuser waren vermietet, schiefe italienische Villen und vinylverkleidete Zweifamilienhäuser mit verrosteten Drahtzäunen, an denen man sich Tetanus holen konnte. Kims Vater betrachtete die Häuser als Hindernis im endlosen Kampf um die Erhaltung der Grundstückswerte in Kingsville und gab weniger den Mietern als den Vermietern die Schuld, als müsste der Besitz sie irgendwie verantwortungsvoller machen. Kim hatte mal mit Nina spätnachts vor einem dieser Häuser gewartet, während J.P. und Hinch reingegangen waren. Jeder in der Stadt wusste, wo man Drogen bekam.
Jetzt, mitten am Tag, saßen stämmige Frauen in Shorts rauchend und Limonade trinkend auf den Stufen, während ihre Kinder sich gegenseitig durch die sonnenverdorrten Gärten jagten. Sie bemerkten es jedes Mal, wenn Lindsay zu weit ausholte und gegenlenkte, und ihre Blicke folgten der Chevette, als wären sie Polizisten, bis Kim ihre Schwester schließlich aufforderte, durch die Unterführung zur Highschool zu fahren.
Sie war überrascht, auf dem Parkplatz so viele Autos vorzufinden. Wie Idioten trainierten die Mitglieder des Footballteams in der Hitze. Eine Mutter hatte einen Gartenstuhl mitgebracht, um zuzuschauen, daran befestigt ein Sonnenschirm, der ihr Schatten spenden sollte. Ganz hinten, wo keine Autos standen, parkte Lindsay ein ums andere Mal ein. Kim hatte dasselbe mit ihrem Vater geübt und bemühte sich, ebenso geduldig zu sein: Sie lobte Lindsay, wenn sie das Auto zwischen die beiden Linien fuhr (auch wenn sie selbst es im Firmenwagen geschafft hatte, der fast doppelt so groß war wie die Chevette), und bat sie in ruhigem Ton zu bremsen, wenn sie auf den Bordstein zusteuerte.
«Bist du schon oft mit Dad gefahren?»
«Nicht so oft. Warum?»
«Du bist wirklich gut.»
«Danke.» Lindsay war verwirrt, als könnte das Ganze ein abgekartetes Spiel sein. Kim war in letzter Zeit nicht besonders nett zu ihr gewesen. Sie hatte sich deswegen bei ihrer Mutter beschwert, die wie immer nichts unternahm.
«Lass uns mal die Durchfahrt am DQ ausprobieren.» Erst als die Worte schon ausgesprochen waren, begriff Kim, was sie da gesagt hatte. Die Fahrspur, die ums Dairy Queen herumführte, war schmal, das Abholfenster von zwei betongefüllten Stahlpfosten geschützt.
«Ich dachte, du hättest noch was anderes zu tun.»
«Stimmt, aber es ist Mittag. Ich lade dich ein.»
Die Fahrt dauerte ewig, und am DQ wartete schon eine Schlange.
«Ich kann das nicht», sagte Lindsay.
«Geh von der Bremse und schieb dich langsam hinter den Typ da. Auf meiner Seite ist notfalls noch Platz.»
Ganz am Anfang war Kim mal zu dicht an ein paar geparkte Autos herangekommen, und ihr Vater hatte ihr wortlos ins Lenkrad gegriffen und daran gezogen, bis sie wieder geradeaus fuhren. Jetzt widerstand sie dem Drang, es ihm nachzutun. Lindsay reckte das Kinn zur Windschutzscheibe, um über die Motorhaube zu spähen.
«Fahr einfach hinterher», sagte Kim. «Der ist größer als du.»
Am Bestellschalter bremste Lindsay zu stark, und sie wurden beide nach vorn geschleudert.
«Tut mir leid.»
«Du musst die Scheibe runterlassen.»
«Was zum Teufel wollt ihr denn?», plärrte der Lautsprecher– Marnie, die vom Abholfenster mit dem Finger auf sie zeigte. Erst als sie hielten, sah sie, dass Lindsay fuhr. Sie waren so weit weg, dass Lindsay die Tür öffnen musste, um die Tüte nehmen zu können.
«Gute Arbeit», sagte Marnie.
«Lass dir das bloß nicht von ihr gefallen», sagte Kim und streckte die Zunge raus.
«Passt auf, dass ihr keinen Unfall baut», sagte Marnie.
«Du auch.»
Die Fritten im Fahren zu essen war zu viel verlangt, deshalb suchten sie sich hinten auf dem Parkplatz ein schattiges Plätzchen und schalteten das Radio ein. Die Bäume innerhalb des spitzen Eisenzauns waren alt, ihre Wurzeln schauten aus dem trockenen Gras hervor wie Fingerknöchel. Zwischen dem ausgeblichenen Schmuck, Kränzen an grünen Drahtständern und Fahnen, die vom Memorial Day übrig geblieben waren, hüpften Spatzen herum. Lindsay drückte Ketchup in den Deckel ihrer Verpackung, damit sie es sich teilen konnten. Tunkend und kauend saßen sie nebeneinander. Sie verbrachten nicht besonders viel Zeit miteinander, und Lindsay war unsicher, weil sie nicht alles verderben wollte.
«Hast du heute Abend ein Spiel?»
«Ja», sagte Lindsay bedrückt, als wollte sie nicht daran erinnert werden.
«Gegen wen spielt ihr?»
«Keine Ahnung. Wir kriegen sowieso nichts auf die Reihe.»
«Da sagt Dad aber was anderes.»
«Du hast uns noch nie gesehen.» Kim hatte auch für ihn gespielt und sein erbarmungslos übertriebenes Training ertragen, während Edgewater Immobilien auf den angemessenen Platz am Ende der Liga sank. Aber Kim konnte wirklich spielen. Lindsay hatte ihre Baseballschuhe geerbt, doch das war auch alles. Mit ihren Knubbelknien und der Zahnspange hatte sie Angst vor dem Ball und sah jedem Spiel mit Schrecken entgegen.
«Ich dachte, ihr würdet es in die Playoffs schaffen.»
«Inzwischen erreichen alle die Playoffs. Das ist wie bei den Special Olympics.»
«Wie viele Spiele habt ihr denn noch?»
«Fünf und dann noch die Playoffs. Also sechs.»
«Viel Glück.»
«Ja, danke.»
Sie aßen zu der Musik von Weezer und Franz Ferdinand und drückten die matschigen Endstücke ihrer Hamburger zusammen, um nichts vollzutropfen. Kim war zuerst fertig, und obwohl sie befürchtete, es könnte lahm oder melodramatisch klingen, wusste sie, dass es vielleicht die perfekte Gelegenheit war, solange Lindsay noch den Mund voll hatte.
«Weißt du», sagte sie, «du wirst mir echt fehlen.»
«Ach was», erwiderte Lindsay und hob das Kinn, damit ihr nicht der Salat aus dem Mund spritzte.
«Du glaubst mir nicht.»
«Du bist dann bestimmt zu sehr mit deinen neuen Freunden und allem beschäftigt.»
Sie musste nicht «genau wie jetzt» hinzufügen. Okay, das stimmte schon, aber Linds würde ihr trotzdem fehlen. Konnte nicht beides stimmen?
«Du kannst mich besuchen.»
«Ich glaube nicht, dass Mom das erlaubt.»
«Vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes. Dann musst du dir sowieso langsam eine Uni suchen. Aber nicht Bowling Green.»
«Gott, hoffentlich nicht», sagte Lindsay – das sollte ein Witz sein, und sie war erleichtert, als Kim lachte. Tief im Innern wusste Lindsay, dass Bowling Green für Kim eine Enttäuschung war – genau wie für ihre Eltern, obwohl die nichts sagten. Case Western war ihr Erstwunsch gewesen, aber sie hatte es nicht mal bis auf die Warteliste geschafft. Nina ging zur Denison, Elise hatte sich früh für Kenyon entschieden. Lindsay bedauerte Kim zwar, schwor sich aber, es besser zu machen als sie alle.
Als sie beide aufgegessen hatten, war es kurz vor eins. Kim schaltete das Radio aus. «Fertig?»
Lindsay nickte mit ernstem Gesicht und setzte sich aufrecht hin wie ein Testpilot. Sie brauchte beide Hände, um den Handbremsenknopf zu drücken.
«Na los, du Muskelprotz», sagte Kim.
Sie fuhren am Krankenhaus mit dem Hubschrauberlandeplatz in der Ecke des Parkplatzes vorbei. Der Subaru ihrer Mutter stand auf seinem üblichen Platz, eine silberne Folie schützte das Armaturenbrett vor der Sonne. Bestimmt saß ihre Mutter am Fenster in der Notaufnahme, notierte geduldig die Informationen, die ihr irgendwer gab, und hakte Kästchen ab, die Königin der Klemmbretter. Wenn sie nach Hause kam, würde Kim auf der Arbeit sein. Zurzeit sahen sie sich nur am Wochenende. Lindsay fand es einfacher so. Seit Kim mit der Schule fertig war, stritten sich die beiden über J.P. oder weil Kim zu viel trank und zu spät nach Hause kam. Ihre Mutter war einfach völlig aus dem Häuschen wegen Kims bevorstehendem Auszug.
Das ging ihnen allen so, besonders Kim selbst. Sie stand die ganze Zeit unter Strom, weil sie wusste, dass in einem Monat all das hier aus ihrem Leben verschwinden würde. Sie fuhr gern durch die Gegend und stellte sich vor, dass es so weit war, so wie jetzt, als die stuckverzierten Gebäude mit den Arztpraxen und die niedrigen, motelähnlichen Pflegeheime hinter ihr verblassten, als die Kartonfabrik und der Firmenpark mit dem Fangzaun vor den Bahngleisen wie eine Luftspiegelung flimmerten und immer undeutlicher wurden, bis alles bloß noch ein Nebel war, der vom Seewind davongeweht wurde. Doch unterschwellig verspürte sie eine schwindelerregende Angst vor dem Unbekannten und der verwirrenden Erkenntnis, dass sie beim Weggehen vielleicht alles verlor. Das versuchte sie genauso zu ignorieren wie die Sorge ihrer Mutter. Ihr blieben noch neununddreißig Tage. Und nichts würde daran etwas ändern.
Lindsay fürchtete sich vor dem Briefkasten und bog zu früh ab, sodass der Hinterreifen auf ihrer Seite über den Bordstein holperte.
«Tut mir leid.»
«Ist schon okay», sagte Kim, «Mom macht das ständig. Du hast dich gut geschlagen. Und ein Mittagessen rausgeholt.»
Im Haus trennten sich ihre Wege. Lindsay ließ sich aufs Sofa fallen und sah sich weiter Bubble Boy an, während Kim nach oben ging, in ihren Badeanzug und eine abgeschnittene Jeans schlüpfte und sich das Haar mit einem Gummi nach hinten band. Cooper wusste, was der Badeanzug bedeutete, und folgte ihr die Treppe runter, als wollte sie mit ihm rausgehen. Doch heute blieb ihr keine Zeit, und sie hatte ein schlechtes Gewissen.
«Ruf ihn mal», bat sie Lindsay, und ihre Schwester tat ihr den Gefallen.
Im Wagen war Kim wieder stinkwütend. Es war schon kurz vor halb zwei, und sie hatte gerade bemerkt, dass sie kaum noch Benzin hatte. Es lohnte sich nicht, die ganze Strecke bis zur Tankstelle zu fahren, weil sie in einer Stunde wieder hier sein musste, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Sie fragte sich, ob Nina wütend sein würde, wenn sie sich krank meldete. Wahrscheinlich schon, obwohl Nina es selbst ständig tat. Kim rumpelte über die Bahngleise, bog links ab und raste die lange, freie Gerade an den alten Getreidesilos entlang, statt sich mit den Ampeln in der Main Street herumzuschlagen. Sie war so auf die Straße konzentriert, dass sie den Streifenwagen fast nicht gesehen hätte.
«O Scheiße.»
Es war der Sheriff, der an der Abzweigung des unbefestigten Wegs zum Umspannwerk lauerte und auf jemanden wie sie gewartet hatte. Statt zu bremsen, nahm sie den Fuß vom Gas und ließ den Wagen an ihm vorbeigleiten, mit immer noch weit überhöhtem Tempo. Voller Hoffnung blickte sie in den Spiegel. Er fuhr los und bog in ihre Richtung, hatte bis jetzt aber noch nicht das Licht eingeschaltet, und sie blinkte rechts wegen des nahenden Stoppschilds und nahm sich vor, in die Seitenstraßen zu verschwinden und sich zu verstecken.
Doch dann blitzte das Licht, die Sirene heulte kurz auf, und er hielt hinter ihr. Das passte einfach zu diesem Tag.
Die Vorträge ihrer Mutter hatten gewirkt. Während Kim darauf wartete, dass der Sheriff aus seinem Wagen stieg, konnte sie nur daran denken, dass sie Ed Larsens Tochter war.
Der Sheriff musste sich bücken, um in ihr Fenster blicken zu können. Er war Stammkunde an der Conoco und erkannte sie auch ohne ihre Uniform. «Tag», sagte er. «Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind?»
«Ungefähr fünfzig?»
«Ich hab fünfundsiebzig gemessen. Sie wissen, dass hier ein Tempolimit von vierzig gilt.»
Sie musste ihren Fahrzeugbrief aus dem Handschuhfach kramen und dann warten, während er mit einem Klemmbrett in seinem Wagen saß und irgendwas aufschrieb. Dann kam er mit dem Klemmbrett zurück und riss vorsichtig das oberste Blatt ab.
«Miss Larsen, weil es das erste Mal ist, gebe ich Ihnen nur eine schriftliche Verwarnung. Meinen Sie, dass Sie das in Zukunft unter Kontrolle haben?»
«Ja, Sir. Danke.» Hatte er sie wegen ihres Vaters mit dem Nachnamen angeredet? Am liebsten hätte sie den Zettel zerrissen und die Fetzen in die nächste Mülltonne geworfen, doch sie hatte das Gefühl, er würde irgendwie davon erfahren – auf dem allmonatlichen Rotariertreffen oder bei der Wagenwäsche im Feuerwehrhaus.
«Es gibt keinen Grund, hier fünfundsiebzig zu fahren.»
«Ja, Sir.»
«Also halten Sie sich zurück.»
Das tat sie eine Weile und schlich geradezu durch die Stadt. Sie war schon so spät dran, dass es keine Rolle mehr spielte, und im Moment war ihre Erleichterung größer als ihr Ärger. Aber als auf dem Flachstück der Route 7 niemand zu sehen war, beschleunigte sie auf hundertdreißig. «Okay», rief sie, «hier kannst du mich nicht erwischen! Niemand kann mich erwischen!»
Am Fluss gab ihr J.P. einen Kuss und wollte wissen, warum sie so lange gebraucht hatte, und sie zog das Ganze ins Lächerliche.
«Fünfundsiebzig», sagte er grinsend. «Weißt du, was der in diesem Fall mit mir gemacht hätte?»
«Dein Wagen fährt nicht mal fünfundsiebzig.»
«Aber wenn.»
Das Wasser im Fluss stand niedrig, die Felsen ragten hoch und weiß heraus. An der tiefen Stelle unterhalb des Wasserfalls trieben Nina und Hinch in gelben Schläuchen und spritzten sich gegenseitig nass. Elise und Sam saßen abgewandt weiter unten auf einem riesigen Felsblock und waren in ein ernstes Gespräch vertieft (Elise hatte Nina erzählt, dass sie mit ihm Schluss machen wollte, doch das war schon ein paar Wochen her). Kim konnte nur kurz schwimmen und sich dann neben J.P. auf den Felsvorsprung legen, um wieder trocken zu werden, den Kopf auf den verschränkten Armen. Der Geruch erinnerte sie daran, wie sie als Kind mit ihrer Mutter ins Schwimmbad gegangen war, wie der nasse Abdruck, den ihr Körper auf dem heißen Beton hinterlassen hatte, langsam verdunstet war. Der Stein unter ihr war warm, die Sonne brannte auf ihren Rücken und drang tief in ihre Haut. Sie hätte den ganzen Tag so daliegen und dem Rauschen des Wassers lauschen können.
J.P. konnte der Versuchung nicht widerstehen, an den Trägern ihres Badeanzugs rumzufummeln.
«Viel Erfolg. Der Haken ist vorn.»
«Das ist ungerecht.»
Mit dem Finger schrieb er seinen Namen auf ihr Schulterblatt.
«Ich will nicht zur Arbeit», sagte sie mit geschlossenen Augen.
«Und? Dann schwänz doch.»
«Würd ich ja gern.»
Nina kletterte aus dem Wasser und wrang ihr nasses Haar über ihnen aus. «Auf geht’s, faules Stück!»
«Eigentlich hab ich keine Lust», sagte Kim. «Weißt du was? Wir sollten uns beide krank melden, dann müsste der Trottel arbeiten.»
«Dann müssten bloß Kevin und Doug-o die Schicht übernehmen. Los, komm schon.»
«Ich hab echt keine Lust.»
«Bla bla bla. Wenn ich hingehe, gehst du auch. Ich setz mich nicht den ganzen Abend hin und hör mir Kevins Kriegsgeschichten an.»
«Wie lange ist er wieder da?», fragte Hinch von unten.
«Etwa zwei Jahre. Er war bloß fünf Monate weg.»
«Wooze war ein ganzes Jahr weg und redet nie drüber», sagte J.P.
«Weil Wooze ein Leben hat», erwiderte Hinch.
Nina packte Kim am Knöchel, doch sie strampelte sich frei. «Los, hoch mit dem Arsch.» Nina bohrte ihr den großen Zeh in den Hintern.
«Stopp. Lass das, ich steh ja schon auf.»
Sie zog ihre abgeschnittene Jeans an, aber für das Top war es echt zu heiß.
Evan, ein Freund von Hinchs Bruder, war heute Türsteher bei der Three Ls, deshalb wollten sie sich später dort treffen.
«Bring das dicke Geld mit», sagte J.P. und küsste sie.
«Na klar», sagte Kim und stieß ihn ins Wasser. Er rollte sich zusammen und nahm den anderen Schlauch.
«Hoffentlich haltet ihr’s ohne uns aus», rief sie.
«Wir probieren’s.»
«Mach’s gut, Elise!», rief sie flussabwärts und winkte mit dem Handtuch. Elise winkte zurück. Sam nicht.
«Ich kapier’s nicht», sagte Nina, während sie die Felsen überquerten. «Wenn sie den Sommer nicht mit ihm zusammen sein wollte, hätte sie gleich nach dem Highschool-Ball mit ihm Schluss machen sollen.»
«Typisch Elise. Bei ihr muss es immer dramatisch sein.»
«Damit sie im Mittelpunkt steht.»
«Sam tut mir leid. Er ist ein netter Kerl.»
«Hinch würde sich so was nicht bieten lassen.»
«J.P. auch nicht.» Aber J.P. war nicht in sie verliebt. J.P. wusste, dass es nur diesen Sommer lief, und das störte ihn nicht. Im Herbst würde er wie die Hälfte ihrer Klasse in Columbus sein. Sie waren beide bloß realistisch.
«Wollen wir wetten, dass er heute Abend auch da ist?»
«Lohnt sich nicht.»
Sie stiegen den Pfad zur Straße hinauf, der sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte, und setzten im Schersprung über den Stahldraht der Straßenbegrenzung. «Okay», sagte Kim. «Bis die Tage, du Plage.»
Sie fuhren zusammen los, auf der 7 in Richtung Stadt.
Sie mussten sich beeilen, wie Nina später erklärte. Ihnen blieb eine Dreiviertelstunde, um nach Hause zu fahren, sich zu duschen und umzuziehen und es bis um drei zur Conoco zu schaffen. Inzwischen war das für sie reine Routine. Nina wohnte näher. An guten Tagen brauchte sie nur zweiunddreißig Minuten, und heute war ein guter Tag. Sie war mühelos schneller als Kim und löste Dave und Leah pünktlich ab.
Als Kim um Viertel nach drei noch nicht aufgetaucht war, rief Nina sie auf dem Handy an, erreichte aber nur die Voicemail. Wahrscheinlich hatte Kim es ausgeschaltet.
«Du nervst», sagte Nina. «Ich hab deine Karte schon abgestempelt. War nur Spaß. Mach dir einen schönen Abend, du Luder. Ich grüß Kevin von dir.»
Als Lindsay kurz vor dem Abendessen von den Hedricks zurückkehrte, hingen Kims Badeanzug und Handtuch wie immer ordentlich über dem Duschvorhang im Bad.
J.P. versuchte gegen Mitternacht, sie vom Parkplatz des DQ aus zu erreichen. In dem dunklen Winkel brachte das aufgeklappte Handy sein Ohr zum Leuchten. Er ärgerte sich, weil sie ihm nicht Bescheid gesagt hatte, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr. «Anscheinend schläfst du oder willst bloß nicht rangehen. Wenn du Lust hast zu kommen, wir sind in der Three Ls. Ich bezahle. Melde dich, wenn du das hier gehört hast.»
Sie blieben, bis die Bar zumachte, und endeten schließlich am Strand, wo sie Coronas tranken, die sie in der Conoco gekauft hatten. Die zerrissene Pappe des Zwölferpacks kräuselte sich in den blauen Flammen. Über den steinernen Armen des Wellenbrechers zog Rauch vor den Mond. Weit draußen auf dem See lag still und reglos ein Erzschiff, das seinen langen Weg zurück nach Superior oder Duluth antrat.
«Ist irgendwie seltsam», sagte Sam, «dass Kim nicht da ist.»
«Ich weiß», erwiderte Nina. «Das ist, als fehlte mir meine Zwillingsschwester.»
«Ja», sagte Hinch, «die gute Zwillingsschwester», und sie schlug nach ihm und schmiegte sich dann wieder an seine Brust.
Es wurde langsam kalt, Sweatshirtwetter, und die Sterne waren zu sehen. In der Stadt stand der Streifenwagen des Sheriffs gegenüber vom Friedhof mit der Schnauze zur Straße, um Raser abzuschrecken. Im DQ und den Häusern in der Main Street war alles dunkel, und die Straßenlaternen verströmten ein schwaches Silberlicht, als bekämen sie nicht genug Strom. An der Ecke Euclid und Harbor Street ertönte das vom Band abgespielte Läuten der Lakeview United Methodist Church – zwei Uhr, die Zeit, um die Kim zu Hause sein sollte.
Ihre Mutter schlief. Ihr Vater schlief. Lindsay, die zweimal ausgemacht worden war und sich an der zweiten Base einen schweren Fehler geleistet hatte, schlief, und Cooper schnarchte neben ihr auf dem Bett.
Mitten in der Nacht wachte Kims Vater auf, weil er auf die Toilette musste, und sah den Lichtstreifen unter der geschlossenen Tür. Am Morgen brannte das Licht immer noch. Kims Tür war nicht abgeschlossen, das Bett unberührt. Das Licht unten im Flur brannte, genau wie das Außenlicht neben der Hintertür, tagsüber unsichtbar. Ihr Wagen stand nicht in der Einfahrt.
Als Erstes rief ihre Mutter Nina an.
Als Nächstes J.P.
Dann Connie im Krankenhaus.
Und schließlich die Polizei.
Letzter bekannter Aufenthaltsort
Ed wusste, dass Fran es machohaft und dumm fand, allein loszufahren, aber sie wusste auch, dass er sich von ihr nicht abhalten ließ. Zu diesem Zeitpunkt ihrer Ehe handelten sie das durch den Tonfall oder, wenn die Mädchen im Zimmer waren, durch einen warnenden Blick aus. «Sei kein Esel», sagte sie immer, wenn Ed uneinsichtig war, und dann verstummte er und zog sich zurück. Stunden später fand sie ihn an seiner Werkbank in der Garage oder in seinem Arbeitszimmer, wo er wie ein Kind noch einen letzten Funken Groll hegte, und obwohl nichts geklärt war, versuchte sie sich zu entschuldigen.
Beide waren sich der Abmachung bewusst. Obwohl sie keinen Augenblick glaubte, er könnte etwas erreichen, würde sie ihm erlauben, sich auf die Suche zu machen, ihm und (jenseits jeglicher Logik) auch sich selbst zuliebe. Rasch jetzt, solange Lindsay noch schlief. Die Polizei wollte jemanden vorbeischicken, um eine Anzeige aufzunehmen, und sie befürchtete, nicht allein klarzukommen.
«Ich lasse mein Handy an», sagte er, gab ihr einen Kuss und lief zur Tür hinaus.
Er stocherte nach dem Zündschloss, als würde ihn jemand verfolgen, drehte das Handgelenk, ließ den Motor des Taurus aufheulen und würgte den Rückwärtsgang rein. Das Heckfenster war beschlagen, und er musste kurz rausspringen und das Kondenswasser mit dem Unterarm wegwischen. Aus der Küche beobachtete sie, wie er im Slalom die Einfahrt hinunterfuhr, und sie dachte, wenn er sich oder jemand anderen verletzte, wäre es ihre Schuld.
Er hatte weder geduscht noch sich rasiert und befürchtete, zu stinken und zerzaust auszusehen, deshalb war er dankbar, dass keiner der Nachbarn draußen war und ihn wegfahren sah. Übers Lenkrad gebeugt raste er die Lakewood Street entlang, wollte um jeden Preis verhindern, dass sich irgendwer vor ihn drängte. Die Luft im Wagen war kühl, weil der Taurus die ganze Nacht draußen gestanden hatte, und Ed atmete tief durch, um wach zu werden, brachte sich auf Touren, wie sein Highschool-Trainer es mit den Spielern gemacht hatte und Ed es noch immer bei seinen Mädchen versuchte: «Auf geht’s, jetzt machen wir ein paar Hits!»
In der Stadt musste er sich zwingen, die Lahmärsche vor ihm nicht zu überholen. Er bog von der Buffalo in die Main Street, Kims übliche Strecke, und ließ den Blick über die Autos in den Einfahrten gleiten. Die Chevette war eigentlich schon ein Oldtimer, nicht zu übersehen, aber sie war auch klein, und während Ed danach Ausschau hielt, stellte er sich bei jedem Haus vor, dass der Wagen, unter einer Plane versteckt, in der dunklen Garage stand.
«Mein Gott», knurrte er, «fahr doch!», und dann schaffte er die Ampel an der Geneva Street nicht mehr.
Vielleicht hatte J.P. gelogen, und sie hatte letzte Nacht bloß zu viel getrunken und bei ihm übernachtet. Nina und Elise würden sie aus Prinzip decken und so tun, als wüssten sie von nichts. Kim war nicht so ehrlich zu ihnen, wie Fran sich gern einredete, vielleicht lag das an ihm. Als Jugendlicher hatte er auch oft gelogen, um keinen Ärger zu bekommen.
Der Parkplatz des DQ war leer, der Streifenwagen des Sheriffs verschwunden, das hieß, zum Glück war Perry im Dienst. Ed hatte nach dem Tod von Perrys Mutter ihr Haus verkauft und konnte sich auf die Verschwiegenheit des Sheriffs verlassen.
Als Person des öffentlichen Lebens legte Ed Larsen vor allem Wert auf seine Privatsphäre. Wie bei einem Geistlichen oder einem Arzt gehörte es zu seinem Beruf, die Geheimnisse seiner Klienten zu bewahren und die der Stadt zu kennen. Wie zum Beispiel, dass ein registrierter Sexualtäter in der Sandusky Street wohnte – ein verheirateter Mann namens Greene, der einem Mädchen in Kims Alter, das er in einer Bar kennengelernt hatte, ein Betäubungsmittel verabreicht hatte. Wegen der Offenlegungsvorschriften hatte Ed Probleme gehabt, in der nächsten Straße ein Vierzimmerhaus loszuwerden. Die Sandusky Street lag nicht auf seinem Weg, aber für seinen Seelenfrieden machte er einen Umweg durch die schattigen Seitenstraßen und musste an mehreren Stoppschildern halten, bevor er an einem kleinen braunen zweistöckigen Haus vorbeikam, in dessen Einfahrt ein Anhänger mit einem Sportfischerboot stand. Doppelgarage, schicke Wetterfahne mit Pfeil. Der Rasen war erst vor kurzem ausgelegt worden, und der Tau glitzerte in der Sonne. Der Anblick war trügerisch und besorgniserregend. Im blassen Morgenlicht sah alles harmlos aus.
Ihm blieb keine Zeit, in der Innenstadt oder bei den Bars oberhalb des Hafens nachzusehen. Er hinkte dem Zeitplan schon hinterher.
Er folgte der 7 südwärts aus der Stadt in Richtung Interstate, wo sich die Straße an einer Verkehrsinsel teilte und dann an einem grasbewachsenen Mittelstreifen entlanglief, bis sie bergab führte und den Fluss überquerte. Unter ihm befanden sich auf einer Seite die zerbröckelnden, mit Graffiti übersäten Doppelbögen der alten Steinbrücke, die durch die neue ersetzt worden war. In Filmen beschwerten Mörder ihre Opfer immer mit Steinen und warfen sie in die reißende Strömung, aber hier war das Wasser rostbraun und nur knöcheltief, und mitten im Fluss lag ein umgestürzter Einkaufswagen.
Weiter vorn kam die lange Steigung vor dem Flachstück, auf dem die Jugendlichen gern Rennen austrugen. Als er hinauffuhr, lugte die Sonne gerade über die Bäume, und er klappte die Sonnenblende herunter. Auf den Seitenstreifen war kein Auto zu sehen. Er blieb auf der rechten Spur und ließ den Blick über das eingezäunte, zugewucherte Farmland mit verfallenen Scheunen und im Morast stehenden, abgestorbenen Bäumen schweifen. Unbefestigte Straßen säumten die Maisfelder und schlängelten sich dann in die Hügel. Türlose Wohnwagen und offene Traktorschuppen, Silos und Jauchegruben, Maisspeicher, Hühnerställe und ein Teich nach dem anderen. Je weiter entfernt von der Straße, desto mehr Verstecke gab es.
Langsam glaubte er, dass Fran recht hatte. Er hatte die ganze Sache mit Kim an sich gerissen und sich in seiner Angst auf die einfachste Lösung gestürzt.
Es war achtzehn Stunden her. Inzwischen konnte sie in Iowa sein. In New York oder Chicago.
In der Nähe der Interstate änderte sich die Flächennutzung. Er drosselte das Tempo, um die weißgetünchte, seit Ende der achtziger Jahre zapfsäulenlose und verlassene Arco-Tankstelle zu mustern, und drehte sich im Sitz um, als könnte er dahinterblicken. Auf dem Parkplatz des Days Inn standen ein paar Sattelschlepper und Harleys und ganz in der Ecke zwei Auslegerkräne eines Stromkonzerns. Ed blinkte und bog ab, um rasch nachzusehen, umrundete das Gebäude und brauste dann aus der Ausfahrt über die Gegenfahrbahn.
Er schindete Zeit. Natürlich würde sie nicht an der Conoco sein.
Er war schon fast da, als ihm ein Staatspolizist entgegenkam, der ohne Eile dahinrollte. Einen Augenblick überlegte Ed, mit dem Taurus über den Mittelstreifen zu holpern und den Polizisten einzuholen, ihn an der Suche zu beteiligen, und stellte sich vor, wie sie zu zweit die Interstate abgrasten, Straßensperren errichteten und alle Wagen kontrollierten.
Am liebsten hätte er J.P. und ihren Freunden die Schuld gegeben. Mit ihnen verbrachte sie mehr Zeit als zu Hause. Deshalb war es auch passiert. Zu viel Freiheit, zu viel freie Zeit. Er war selbst ein Schlüsselkind gewesen und hatte als Jugendlicher Sachen angestellt, über die er jetzt nur den Kopf schütteln konnte, gefährliche Dummheiten, von denen seine Mutter nichts geahnt hatte, und er befürchtete, Kim müsse vielleicht durch eine ausgleichende Fügung des Schicksals für seinen Leichtsinn büßen. Sie war ihm ähnlicher, als Fran je erfahren würde. Er hätte besser auf sie aufpassen müssen.
An der Conoco wimmelte es von Pendlern, die für die Fahrt nach Erie auftankten. Er hielt an, überzeugte sich mit einem Blick, dass die Chevette nicht da war, und rollte dann zum Luftschlauch hinüber, wo er sehen konnte, wie die Lastwagen nebeneinander über die Interstate rasten. Auf der anderen Seite der Überführung verlockte eine rotschimmernde, auf einer Kuhweide stehende Reklametafel die Fahrer, die nach Osten unterwegs waren, das ERWACHSENENPARADIES direkt hinter der Grenze nach Pennsylvania anzusteuern. Er ließ den Motor laufen, stieg aus, stellte sich ans Geländer, die Hand über den Augen wie ein Seemann, und blickte in beide Richtungen. Die Autos zischten vorbei, und die Lücken zwischen ihnen füllten sich mit der Musik von den Zapfsäulen. Wie gebannt betrachtete er die Fahrspuren und kaute auf der Lippe, als könnte Kim jeden Moment vorbeifahren.
«Komm schon, Kimba», sagte er, wollte den Bann brechen, aber trotzdem brauchte er lange, um sich loszureißen.
Er überprüfte, ob sein Handy eingeschaltet war. Es war bereits kurz vor acht – frustrierend. Er musste nach Hause, dachte aber zugleich, dass es falsch war, schon aufzugeben. Es dauerte vielleicht länger, bis zur nächsten Ausfahrt zu fahren und dann erst zurückzukehren, aber wenigstens würde er neues Gelände absuchen, und bevor Fran ihn anrufen und es ihm ausreden konnte, stieg er in den Taurus und bog wieder auf die 7.
Vor der Auffahrt stand ein Verbotsschild für Fußgänger, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Tiere. Er brauste daran vorbei, genau wie am Vorfahrtsschild, und fuhr einem schwerfälligen Kipper davon. Schweigsam und stirnrunzelnd saß er hinterm Lenkrad und versuchte ein Zucken im rechten Auge loszuwerden. Er stellte sich vor, dass später alle über ihn lachen würden – Dad flippt aus und fährt wie ein Wahnsinniger durch die Gegend. Das war schon in Ordnung, solange es Kim gutging.
Er rechnete nicht damit, irgendetwas zu finden, hielt aber genügend Abstand, um sich umschauen zu können, und heftete den Blick auf alles Mögliche, als handelte es sich um Spuren. Ein Stück Reifen von einem Lastwagen. Das Fellbüschel eines überfahrenen Tieres. Eine aufgerissene Mülltüte, der Inhalt im Gras verstreut. Auf dem Mittelstreifen standen zwei völlig gleiche Traktoren aneinandergeschmiegt, die Mähbalken über Nacht angehoben. Er verstand die Welt nicht mehr, klammerte sich an den Gedanken, eine Mission zu haben, und vergaß alles andere. Noch diese letzte Etappe und dann nach Hause.
Als er weit vor sich den Wagen auf dem Seitenstreifen stehen sah, fuhr er unwillkürlich langsamer.
Die Größe stimmte, ein Kleinwagen. Er schaltete das Warnblinklicht ein, bremste und scherte aus, während die nachfolgenden Autos vorbeischossen. Er sah vor sich, wie es passiert war. Der Wagen hatte seiner Mutter gehört, war uralt und launisch und passte nicht zu Kim, aber er gefiel ihr nun mal. Er war auf halber Strecke zwischen den Ausfahrten liegen geblieben – selbst in der Hitze zu Fuß machbar, doch statt auf den Pannendienst zu warten, war sie zu irgendwem ins Auto gestiegen und einfach verschwunden.
Aber als er näher heranfuhr, sah er, dass es nicht ihr Auto war. Der Wagen war gedrungener und hatte die falsche Farbe, ein alter Toyota. Als Ed hielt, sah er, dass das Kennzeichen aus Pennsylvania stammte. Er beschloss, für alle Fälle die Nummer aufzuschreiben, und notierte sie auf dem Block, der mit einem Saugnapf am Armaturenbrett befestigt war. Da er schon mal da war, konnte er auch einen Blick hineinwerfen, und er stieg aus, ging um den Corolla herum, spähte zum Fenster hinein, während der Verkehr vorbeifegte, und untersuchte alles wie an einem Tatort. Um den Schaltknüppel war ein schwarzes Haarband geschlungen, und in dem Fach neben der Handbremse lag eine Packung zuckerfreies Kaugummi – bei beidem musste er gleich an Kim denken, und einen Augenblick stellte er sich vor, sie hätte den Wagen gefahren. Er sah vor sich, wie sie sich mit erhobenen Armen wehrte, beide Handgelenke in der Faust eines Mannes, doch dann schüttelte er den Kopf, um das Bild zu verscheuchen.
Fran hatte recht, er hatte keine Ahnung, was er tat. Er war ein guter Verkäufer, trotz der Niederlagen, die ihm der Markt in letzter Zeit zugefügt hatte, ein mittelmäßiger Trainer, ein passabler Ehemann und Vater, im Großen und Ganzen kein schlechter oder unfähiger Mensch (wie er hoffte), doch er würde sie nicht finden, nicht so. Manchmal hatte er sich hilflos gefühlt, in letzter Zeit wegen Geldsorgen oder noch öfter, weil ein Familienmitglied traurig war. Das hier war etwas anderes. Seine sonst hilfreiche Geschäftigkeit und Aufmerksamkeit fürs Detail war angesichts des Unbekannten nutzlos, und er hatte Angst.
Warum war Perry nicht hier? Wo waren die ganzen Staatspolizisten?
Er war in Gedanken noch immer bei Kim, als ihn plötzlich sein Klingelton aus seiner Grübelei riss. Weil der Verkehr so laut war, steckte er sich den Finger ins Ohr.
«Lindsay ist wach», sagte Fran. «Wo bist du?»
«Auf dem Weg zurück.»
«Irgendwas gefunden?»
«Nichts», sagte er, und musste dann hinzufügen: «Aber das dürfte gut sein.»
«Komm nach Hause», sagte sie. «Ich brauche dich hier.»
Er versprach, so schnell wie möglich zurückzukommen, und zum zehnten Mal an diesem Tag bat sie ihn, vorsichtig zu sein. Er versprach es und dachte, dass er wenigstens das für sie tun konnte. Als er ihr sagte, dass er sie liebe, sah er, wie die vorbeibrausenden Leute ihn anstarrten. Lastwagenfahrer, eine Frau im Alter seiner Mutter, Kinder in einem Schulbus. «Ich liebe dich auch», sagte sie. Als er sein Handy zuklappte und zum Taurus ging, fühlte er sich immer noch beobachtet und beurteilt, den Blicken der ganzen Welt ausgesetzt. Aus der Ferne kamen weitere Autos. Wenn er schnell lief, konnte er es vorher zu seinem Wagen schaffen, aber er ging weiter mit entschlossenem Schritt. Die Gesichter wandten sich ihm misstrauisch und besorgt zu, als wäre er entweder ein Verbrecher oder eine arme gescheiterte Existenz.
Opferlehre
Der Detective befragte sie getrennt, als wären sie Verdächtige. Er war älter, als Fran erwartet hatte, dickbäuchig und dunkelhäutig, mit blassen Leberflecken auf den Lidern und einem Toupet, das weder richtig saß noch zu seinen Koteletten passte. Er ging mit Ed in den Hobbyraum und schloss die Tür, während sie und Lindsay in der Küche Formulare ausfüllen mussten. Ein blonder Hilfssheriff, nicht viel älter als Kim, stand am Kühlschrank, als sollte er sie beaufsichtigen. Er hatte nur einmal den Mund aufgemacht, um höflich den angebotenen Kaffee abzulehnen, und Fran hielt sein Schweigen für ein schlechtes Zeichen.
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Haar- und Augenfarbe – das war einfach. Fran war jedoch auf der Arbeit gewesen, als Kim gefahren war, und hatte deshalb keine Ahnung, was Kim trug. Lindsay behauptete, das hellblaue Old Navy T-Shirt und eine Jeans. Fran hatte Kims Kommode und den Wäschekorb durchsucht, um sich zu vergewissern. Lindsay wusste auch, dass Kims Turnschuhe Asics waren, und hatte ihr den Karton oben im Wandschrank gezeigt.
«Danke», sagte Fran unterwürfig und fragte sich, warum sie Lindsay aus der Sache hatte heraushalten wollen. Es war, als wüsste Lindsay alle Antworten.
Fran hatte sie schon unter vier Augen gefragt, ob Kim in letzter Zeit erzählt habe, dass sie weggehen wolle, ob sie irgendwas über J.P. oder überhaupt irgendwas Seltsames gesagt habe. Hier ging es nicht ums Trinken oder um Drogen, darüber wusste sie Bescheid. Sie wollte Lindsay keine Angst einjagen, brauchte aber ehrliche Antworten und bekam sie auch. Da war sich Fran ziemlich sicher.
Führen Sie alle besonderen Kennzeichen auf (Muttermale, Narben, Tattoos, Piercings):
Ihr Tattoo natürlich, aber Fran hatte Kims Schmuck vergessen – den Kameenring von Eds Mutter und den Schmetterlingsanhänger, den Fran ihr zum sechzehnten Geburtstag ausgesucht hatte, doch welche Ohrringe, und trug sie ihre Armbänder? Sie glaubte, es wissen zu müssen. Als Lindsay es auch nicht wusste, war sie geradezu erleichtert. Sie mussten oben nachsehen.
Als Fran aufstand, streckte der Hilfssheriff die Hand aus und bedeutete ihr, sich wieder zu setzen. «Schon okay, Ma’am. Wenn wir hier fertig sind, sehen wir uns um.»
Gesundheitliche Einschränkungen. Zählten da auch Allergien, oder musste es etwas Schwerwiegendes sein? Doch dann wurde ihr klar, dass es um Leute mit Alzheimer ging, die nicht mehr nach Hause fanden.
Im Krankenhaus saß sie beim Ausfüllen solcher Formulare auf der anderen Seite des Schreibtisches, nahm die Bewusstlosen und Unidentifizierten auf, übersetzte das Schmerzhafte und Lebensverändernde in die blutleeren Akronyme der Notfallmedizin. Von Berufs wegen ging ihr Gelassenheit über alles, fand sie vertrauensvolle Effizienz wichtiger als Gefühlsausbrüche. Sie wollte nicht die hysterische Mutter sein, die auf der Stelle ihr Kind sehen will, aber es kam ihr vor, als würden sie Zeit vergeuden. Sie sollten längst nach ihr suchen.
Das Feld Besondere Interessen ließ sie vorläufig leer. Lindsay schrieb noch, und Fran warf einen verstohlenen Blick hinüber.
Pferde, hatte sie geschrieben, Softball, Schlittschuhlaufen, Zeichnen – alles, worum Lindsay sie beneidete, und Fran hätte sie am liebsten gebremst und ihr gesagt, das genüge der Polizei.
Der Hilfssheriff sagte, sie sollten ihre Blätter behalten, also warteten sie. Da sie sich weder mit dem Radio noch mit dem Fernsehen ablenken konnte, ging sie die Möglichkeiten noch einmal durch, wie sie es alle paar Minuten getan hatte, seit Ed ihr gesagt hatte, Kim sei nicht nach Hause gekommen. Unwillkürlich befürchtete sie das Schlimmste und konzentrierte sich dann auf etwas nicht ganz so Schreckliches, wie einen Unfall, eine Kopfverletzung. Sie hatte schon erlebt, wie Leute eingeliefert wurden, die tagelang nicht aufwachten. Ihr Auto konnte in eine Schlucht gestürzt sein. Sie konnte irgendwo im Wald liegen, verletzt und orientierungslos, während sie hier herumsaßen.
Lindsay beobachtete sie, deshalb warf sie ihr ein erschöpftes Kopf-hoch-Lächeln zu – unglaubwürdig, fand sie, aber Lindsay erwiderte ihr Lächeln, und Fran hätte sie am liebsten wieder vor der ganzen Sache geschützt.
«Du bist dran», sagte Ed, als er schließlich aus der Tür trat. Er bemühte sich, kühl und sachlich zu sein, wirkte aber angespannt, und sie nahm seine Hand und drückte sie im Vorbeigehen. Während sie dem Detective folgte, fragte sie sich, ob sie einen Anwalt brauchten.
Der Detective blickte kaum auf ihr ausgefülltes Formular und schob es in eine Mappe. Sein Name war Ronald Holloway, und er gehörte zu den Leuten des Bezirkssheriffs. Fran entnahm seinen Worten, dass er der einzige Detective dort war, also sollten sie sich an ihn gewöhnen. Er schüttelte ihr die Hand, zählte seine Referenzen auf, um sie zu beruhigen, und betonte, er habe schon mehrere Vermisstenfälle im Bezirk Erie erfolgreich bearbeitet. Fran fragte nicht, wie lange das her sei oder was «erfolgreich» bedeute.
Sie hätten Glück, sagte er. Weil Kim erwachsen sei und es keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen gebe, hätte die Polizei bis letztes Jahr vierundzwanzig Stunden warten müssen, bevor sie eine Anzeige aufnehmen konnte. Jetzt, dank «Suzanne’s Law», könnten sie die Informationen sofort weitergeben. Fran brauchte nicht zu fragen, was dieser Suzanne zugestoßen war.
«Mrs.Larsen, das Folgende habe ich bereits Ihrem Mann erklärt, und ich werde Ihnen dasselbe sagen. Neunundneunzig Prozent aller vermissten Erwachsenen, die gefunden werden wollen, werden auch gefunden, okay? Das sollten wir nicht vergessen.»
Aber sie ist noch keine Erwachsene, hätte sie am liebsten gesagt.
Er blätterte in seinem gelben Block bis zu einer leeren Seite und notierte ihren Namen. «Kommt so was bei Ihrer Tochter zum ersten Mal vor?»
«Ja.»
«Verantwortungsbewusstes Mädchen?»
«Ja.»
«Sagt sie Ihnen immer, wo sie sich aufhält?»
«Meistens.»
«Aber nicht immer.»
«Wenn sie mit ihren Freunden unterwegs ist, vergisst sie’s manchmal. Wie alle Jugendlichen.»
Er zog ein anderes Blatt aus der Mappe, schob es ihr auf dem Couchtisch herüber und deutete mit einem Kugelschreiber auf eine Namenliste. «Fehlt hier noch jemand?»
«Nein, das sind alle.» Sie war überrascht, dass Ed alle eingefallen waren, denn er hörte nie richtig zu.
«Sie haben von allen die Telefonnummer und Adresse?»
«Ich glaube schon, ja.»
«Und was ist mit ihrem Arbeitsplatz?»
«Ich hab die Nummer neben dem Telefon liegen.» Wie durch ein Wunder klingelte plötzlich das Telefon in der Küche, und sie drehte den Kopf, als Ed ranging.
«Wie gut kennen Sie die Arbeitskollegen Ihrer Tochter?»
«Nina kennen wir sehr gut. Den anderen bin ich noch nie begegnet.»
«Wo hält sie sich in der Regel auf? Bei Freundinnen? Ihrem Freund?»
Das war so offenkundig, dass sie nicht wusste, warum sie es nicht zugeben wollte. Widersetzte sie sich aus Stolz oder bloß, weil ihr die anmaßende Art des Mannes nicht gefiel? «Meistens sind sie bei Elise.»
«Irgendwelche öffentlichen Orte– Bars, Partyplätze?»
«Sie fahren oft zum Strand.»
«Und zum Fluss?»
«Tagsüber.»
«Waren sie da auch nachts schon mal?»
«Nicht dass ich wüsste.»
«Trinken sie Alkohol?»
«Ja.»
«Harte Sachen?»
«Meistens nur Bier.»
«Ist sie schon mal betrunken nach Hause gekommen?»
Hatte Ed das nicht schon beantwortet? «Ja.»
«Ist sie Ihres Wissens je betrunken gefahren?»
«Nein.» Aber Fran hatte sie im Verdacht.
«Und wie steht’s mit Drogen?»
«Weiß ich nicht mit Sicherheit. Aber wahrscheinlich hat sie schon Gras geraucht.»
«Irgendwelche Probleme mit ihrem Freund, soweit Sie wissen?»
«Nein.»
«Also ist es was Ernstes.»
«So weit würde ich nicht gehen. Die beiden sind erst seit Ostern zusammen.»
«Kein anderer.»
«Ich glaube nicht.»
«Niemand, von dem Sie wissen.»
«Nein.» Wobei Kim ihr das sowieso nicht erzählt hätte.
«Nimmt sie Verhütungsmittel?» Er blickte nicht auf, als er die Frage stellte.
«Ja», sagte Fran. Wenigstens in der Hinsicht war sie verantwortungsbewusst gewesen.
«Wie lange schon?»
«Seit sie sechzehn ist.»
«Sind ihre Pillen hier?»
«Ja.»
«War sie schon mal schwanger?»
«Nein.»
«Irgendwelche Gesundheitsprobleme?»
«Nichts Besonderes.»
«Knochenbrüche, unerklärliche Blutergüsse oder so was?»
«Nein.»
«Depressionen, Selbstmordversuche.»
«Nein.»
«Irgendwelche Feinde oder Rivalinnen?»
Der Gedanke brachte sie zum Lachen – als gehörte Kim einer Bande an. In ihrem ganzen Leben hatte sie sich nur einmal geprügelt. Das war in der Middleschool gewesen, und das Mädchen war schließlich ihre Freundin geworden.
«Hat ihr Freund vielleicht irgendwelche Feinde?»
«Nicht dass ich wüsste.»
«Irgendwelche Exfreunde, die ihr Ärger machen könnten?»
«Nein.» Adam Vozza hatte eines Nachts betrunken vor der Haustür gestanden, aber er war eigentlich nicht ihr Freund gewesen.
«Zu Hause alles in Ordnung?»
Der Richtungswechsel brachte sie aus dem Konzept. War das eine Anschuldigung? Denn es klang so. In den letzten vier Jahren hatten sie und Kim sich bis aufs Messer bekämpft, doch das war jetzt vorbei. Fran war todunglücklich, dass Kim wegging, aber auch erleichtert. Noch nie hatte jemand sie so unglücklich gemacht, so unsicher. So hasserfüllt und hilflos. Sie wollte ehrlich sein und spürte, dass er wartete. Er musste doch wissen, wie kompliziert diese Fragen waren. «Wir haben unsere Auseinandersetzungen, wie alle Mütter mit ihren Töchtern.»
«Irgendwelche größeren Probleme in den letzten paar Wochen?»
«Nein.»
«Wann haben Sie zum letzten Mal mit ihr geredet?»
«Am Sonntag.» Er notierte es, und sie beeilte sich, ihm ihren Dienstplan zu erläutern. An jenem Morgen waren sie alle gemeinsam in die Kirche gegangen, das war doch nicht bedeutungslos.
«Worüber haben Sie gesprochen?»
Sie drehte den Kopf, um sich zu erinnern, und kniff die Unterlippe mit den Fingern zusammen. Mittags hatten sie hinten auf der Veranda gegessen, Ed und Kim hatten über irgendeine Pointe bei den Simpsons gelacht. Lindsay hatte Ralph Wiggum gespielt.
«Wenn Sie’s nicht mehr wissen, macht das nichts.»
«Keine Ahnung, über nichts Besonderes. Sie hat gelacht.»
«Würden Sie sagen, die Beziehung zu Ihrer Tochter ist gut?»
«Sie ist keineswegs perfekt, aber gut.»
«Und bei Ihrem Mann?»
«Gut. Er ist der gute Bulle, ich bin der böse.»
«Und wie läuft es zwischen Ihnen beiden?»
Sie zuckte mit den Schultern, als gäbe es keinen Grund, darüber nachzudenken. «Gut.»
«Die Familienfinanzen?»
Ed hatte ihren Anteil an einem Investmentfonds verkauft, um im Juni die Steuerschätzung bezahlen zu können, aber das hatte nichts mit dieser Sache zu tun. «Okay, soweit ich weiß. Wir müssen nicht hungern.»
Er hielt inne, um irgendwas an den unteren Rand der Seite zu schreiben, und blätterte danach weiter.
«Ihre Töchter kommen miteinander aus?»
«Meistens.»
«Die üblichen Probleme zwischen Geschwistern.»
«Ja.»
«Irgendwer in der Verwandtschaft, mit dem sie sich besonders gut versteht?»
«Ihre Großmutter– Eds Mutter.»
«Wo wohnt die?»
«In Erie, in einem Pflegeheim. Ed hat schon mit ihr gesprochen.»
«Sonst noch jemand, an den sie sich wenden könnte, wenn sie in der Klemme sitzt?»
«Nina und Elise, das wär’s dann auch schon.»
«Nachbarn?»
«Die Hedricks nebenan. Die haben sie nicht gesehen.»
«Gute Gegend.»
«Sehr gut.»
«Wie lange wohnen Sie schon hier?»
Sie musste nachrechnen. «Dreizehn Jahre.»
«Jeder kennt jeden.»
«Ja.»
«Irgendwelche verdächtigen Typen?»
«Nein.»
«Ist in den letzten paar Jahren irgendwer zu- oder weggezogen?»
«Nein.»
Er fragte nach dem Verkehr und wollte wissen, was für Leute sich tagsüber in der Gegend aufhielten – Landschaftsgärtner, Lieferanten, Stromableser. Er fragte nach Kims Handyrechnungen und E-Mail-Adressen, danach, wer auf ihrer Instant-Messaging-Liste stand. Er fragte, ob Fran wisse, wann Kim ihren letzten Lohn erhalten und ob sie in letzter Zeit größere Einkäufe getätigt habe. Ob Kleidungsstücke oder Taschen fehlten. Was für einen Fahrstil sie habe. Wie hoch der Tachostand ihres Wagens sei. Ob er in letzter Zeit in der Werkstatt gewesen sei, und sei es nur zum Ölwechsel. Pausenlos, mit derselben bürokratischen Gleichgültigkeit, von einem Thema zum nächsten springend, scheinbar völlig unverbindlich. Er bedrängte sie nicht, aber es war unerbittlich und ermüdete sie, sich um Antworten bemühen zu müssen. Es gab so vieles, was sie nicht wusste.
Schließlich legte er den Block weg. «Okay, vorletzte Frage. Wären Sie nötigenfalls bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen?»
«Ja.»
«Danke. Jetzt werde ich Ihnen die allerwichtigste Frage stellen. Ich möchte, dass Sie nicht darüber nachdenken, sagen Sie einfach das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt, egal, was es ist, okay? Fertig?» Er machte eine Pause, als wäre er Talkshow-Moderator. «Was glauben Sie ist Kim zugestoßen?»
Die Antwort war sofort da, fix und fertig, keineswegs frisch, aber natürlich schreckte sie davor zurück. Jetzt begriff sie, warum Ed so schlecht ausgesehen hatte, als er aus dem Zimmer kam, und die Mutter in ihr meldete sich unerschütterlich. Sie würde auf keinen Fall zulassen, dass er das Lindsay antat.
«Mrs.Larsen?», sagte er, und sie nahm ihm übel, dass er sie zu der Antwort drängte, als würde sie Kim damit verraten.
«Ich glaube, jemand hat sie entführt.»
Rundruf
Da der Detective sich auskannte, befolgten sie seine Anweisungen. Als Erstes mussten sie überall anrufen und den Leuten mitteilen, dass sie Kim suchten. Falls sie wirklich weggelaufen war, würde sie dadurch erfahren, dass sie ihr auf der Spur waren. Keiner von ihnen glaubte, sie sei ausgerissen, doch Lindsay erinnerte sich mit Unbehagen, dass Kim gesagt hatte, sie würde ihr fehlen (das hatte sie dem Detective verschwiegen, und jetzt bereute sie es). Hatte Kim sie zum Essen eingeladen, um sich insgeheim zu verabschieden?
Sie warteten oben im Flur, während der Detective Kims Zimmer durchstöberte und der Hilfssheriff mit seiner Taschenlampe unter Bett und Kommode und auf den Boden des Wandschranks leuchtete. Er interessierte sich für die Sea Wolves-Tickets, die an ihrem Spiegel steckten, und die Eintrittskarte zu einem Cake-Konzert im Agora Ballroom und deutete an, dass sie sich in Erie und Cleveland anscheinend gut auskannte. Ihr Vater erklärte, sie wären alle gemeinsam mit ihrer Großmutter zu diesen Spielen gefahren, das wäre eine Tradition, und das Konzert hätte vor drei Jahren stattgefunden, bevor Kim den Führerschein hatte. Sie hätten Kim, Nina und Elise nach Cleveland gebracht, bei einem schönen Abendessen ihren Hochzeitstag gefeiert und die Mädchen nach dem Konzert wieder abgeholt. Doch dem Mann fiel sofort auf, was Lindsay erst nach einer Weile bemerkt und dann Kim wie etwas Neues berichtet hatte: In der Fotocollage, die über ihrem Bett an der Wand hing, gab es kein einziges Bild von ihr und J.P.
Ansonsten entdeckte er bloß einen Bunsenbrenner in einem Schuhkarton voller Newports, von dem Lindsay schon wusste. Da es keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen gab, würden sie eine Vermisstensuche durchführen, statt wegen verdächtigen Verschwindens zu ermitteln.
«Ist die Tatsache, dass sie verschwunden ist, nicht verdächtig genug?», fragte ihr Vater.
Nein. Ohne echte Beweise hielten sie Kim nicht für gefährdet.
«Das ist doch idiotisch», sagte ihre Mutter. «Sie ist noch ein Kind, ganz allein da draußen. Gefährdeter geht’s gar nicht.»
«Ich verstehe Sie», sagte der Detective. «Ich bin selbst kein Freund dieser Vorgehensweise. Andererseits bin ich froh, dass ich nichts gefunden habe, was in eine andere Richtung deutet. Wenn ich mit ihren Freunden gesprochen habe, kann sich da durchaus noch was ändern.»
Er bat um ein möglichst neues Foto, am besten eine Frontalaufnahme, auf der sie lächelte. Lindsay empfand das als kitschigen Versuch, die Aufmerksamkeit der Leute zu wecken – helfen Sie uns, dieses hübsche Mädchen zu finden! Später las sie im Internet, dass auf die Art der Gerichtsmediziner die Aufnahme eines Schädels über die ihres Gesichts legen und die Zähne direkt miteinander vergleichen konnte.