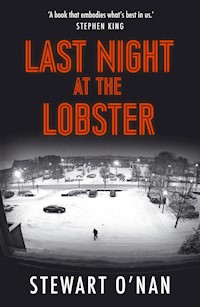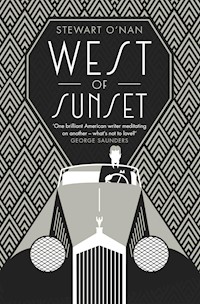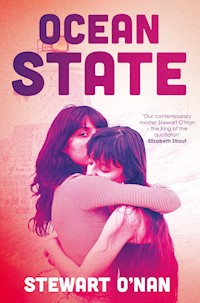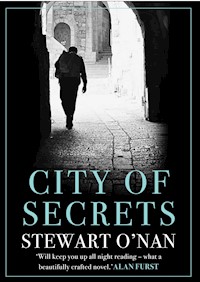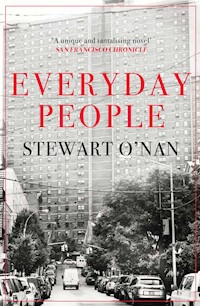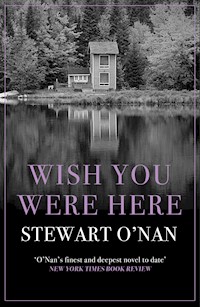9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Emily Maxwell, eine Witwe, deren Kinder längst eigene Familien gegründet haben, führt in ihrem schönen, überschaubaren Routine-Universum ein ziemlich unspektakuläres Leben, allein mit ihrem Hund. Dann und wann trifft sie sich mit ihrer Schwägerin Arlene zum Essen, aber das ist es dann auch schon. Als Arlene bei einem gemeinsamen Frühstück im Lieblingslokal zusammenbricht und ins Krankenhaus muss, wird für Emily alles anders. Sie verbringt ganze Tage damit, Besuche ihrer Enkel aufwendig zu planen, sie kauft sich ein kleines Auto, lernt, die bislang noch nie erfahrene Unabhängigkeit in vollen Zügen zu genießen. Auf einmal offenbart ihr das Leben neue Möglichkeiten. Eine alte Frau wie Emily meint jeder zu kennen, und doch wurde sie in der zeitgenössischen Literatur selten so einfühlsam und treffend porträtiert. Stewart O'Nan zeigt uns ihre kräftig in alle Richtungen ausschlagenden Gefühle – des Bedauerns, des Stolzes, der Trauer, der Freude – in völlig überraschenden Zusammenhängen. Indem er das scheinbar Gewöhnliche als etwas Außergewöhnliches enthüllt und sich – heiter, ergreifend – mit ernsten Themen wie Einsamkeit, Alter und nahem Tod befasst, schärft er den Blick des Lesers, sein Verständnis. «Aus scheinbar gewöhnlichen Momenten ganz große Geschichten machen – das kann niemand besser als Stewart O'Nan.» Brigitte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Ähnliche
Stewart O'Nan
Emily, allein
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter, die mich immer zum Bücherbus mitnahm
Konnte das sein, dass dies, selbst noch für ältere Menschen, das Leben war? – verblüffend, unerwartet, unbekannt?
Virginia Woolf
Zum halben Preis
Jeden Dienstag legte Emily Maxwell das wenige, was von ihrem Leben noch übrig war, in die Hand Gottes und die zittrigen Hände ihrer Schwägerin Arlene, und dann fuhren sie gemeinsam nach Edgewood, um im Eat ’n Park zum halben Preis am Frühstücksbuffet teilzunehmen. Zu den vielen Vorzügen der Sonntagsausgabe der Post-Gazette gehörten die Rabattgutscheine. An den übrigen Tagen begnügte sich Emily zum Frühstück mit Tee und Melba-Toast oder schälte vielleicht eine Klementine, um etwas Vitamin C zu sich zu nehmen, aber das Angebot des Eat ’n Park war so günstig, dass sie es sich nicht entgehen lassen konnte, und zudem bot es ihr einen Vorwand, aus dem Haus zu kommen. Dr. Sayid sagte immer, sie müsse mehr essen.
Es war nicht weit – ein paar Kilometer durch East Liberty, Point Breeze und Regent Square, auf breiten Straßen, die sie so gut kannten wie alte Freunde –, doch die Fahrt war für Emilys Nerven stets eine Belastungsprobe. Arlene sah nicht mehr so gut, und wenn sie ein Gespräch führten, beeinträchtigte das ihre Aufmerksamkeit für das Geschehen um sie herum. Sobald sie sich auf einen Gedanken konzentrierte, fuhr sie langsamer, woraufhin die anderen Fahrer hupten oder ihr, wie vor kurzem eine Frau mittleren Alters, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Emilys Tochter Margaret gehabt hatte, den Mittelfinger zeigten.
«Anscheinend hab ich irgendwas falsch gemacht», hatte Arlene gesagt.
«Scheint so», hatte Emily erwidert, doch sie hätte eine ganze Reihe von Fehlern aufzählen können. Es hatte keinen Zweck, Arlene nachträglich zu kritisieren, egal, wie konstruktiv die Kritik auch sein mochte. Am besten hielt man sich fest und schnappte nicht bei jedem Beinaheunfall nach Luft.
Anfangs hatten sie sich abgewechselt, aber ehrlich gesagt, so ungeschickt Arlene sich auch anstellte, ihren eigenen Fahrkünsten traute Emily noch weniger. Bei ihnen war immer Henry gefahren. Das war für ihn eine Frage des Stolzes gewesen. Noch kurz vor seinem Tod hatte er darauf beharrt, eigenhändig zur Chemo ins Krankenhaus zu fahren. Nur auf der Heimfahrt, wenn er kreidebleich und schweigend über eine Plastikschüssel auf seinem Schoß gebeugt neben ihr saß, lenkte Emily seinen riesigen Olds die gewundene Ausfahrt des Klinikparkhauses hinunter, voller Angst, sie könnte mit dem Wagen die zerkratzten Betonwände entlangschrammen. Ein paar Jahre lang hatte sie mit dem alten Schiff ihre persönlichen Besorgungen erledigt, ohne sich je aus dem von Bank, Bücherei und Giant Eagle gebildeten Dreieck hinauszuwagen, doch als sie gegen einen Hydranten prallte und kurz darauf mit einem Wagen der Stromgesellschaft zusammenstieß, hatte sie – wenn auch schweren Herzens, weil es ihrer angeborenen Sparsamkeit zuwiderlief – zugeben müssen, dass es vielleicht vernünftiger war, ein Taxi zu nehmen. Jetzt stand der Olds zusammen mit ihren rostigen Golfschlägern hinten in der Garage, als wäre er endgültig ausgemustert, die Windschutzscheibe staubig, die Reifen schlaff. Emily fuhr nicht gern Bus, und Arlene hatte ihr angeboten, sie jederzeit mit ihrem Taurus zu kutschieren, der ebenfalls ein unförmiger, wenn auch nicht ganz so imposanter Oldtimer war. In ihrem Freundeskreis wurde darüber gescherzt, dass Arlene inzwischen Emilys Chauffeurin sei, doch da dieser Freundeskreis immer kleiner wurde, kannten immer weniger Leute ihre Geschichte, und manchmal wurden sie, weil sie denselben Nachnamen trugen, von wohlmeinenden jungen Leuten auf einer Veranstaltung des University Clubs oder nach einem von Donald Wilkins’ wunderbaren Orgelkonzerten in der Calvary Episcopal Church für Schwestern gehalten, eine Vorstellung, die Arlene im Gegensatz zu Emily ausgesprochen amüsant fand.
Arlene kam wie immer zu spät. Es war grau und regnerisch, typisches Novemberwetter für Pittsburgh, und Emily stand im Wohnzimmer am Erkerfenster, beugte sich über den niedrigen Heizkörper und schob den dünnen Vorhang zur Seite. Das Sturmfenster war fleckig und schmutzig. Ihr direkter Nachbar Jim Cole hatte die Fenster freundlicherweise vor ein paar Wochen eingehängt, hatte jedoch vergessen, sie richtig sauber zu machen, und nun ließ sich bis zum Frühling nichts daran ändern. Irgendwann würde sie sich selbst darum kümmern, wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte, mit Essig und Wasser, würde alles mit Zeitungspapier streifenfrei trocken wischen, doch das lag noch in weiter Ferne.
Die Bäume und Hecken draußen an der Grafton Street waren schwarz und kahl, und die tief hängenden Wolken gaben einem das Gefühl, es wäre spätnachmittags, nicht morgens. Das Haus der Millers stand immer noch zum Verkauf. Das Laub war noch nicht zusammengeharkt worden und bedeckte den ganzen Garten, eine dunkle, durchnässte Masse. Emily fragte sich, wer um diese Jahreszeit wohl ein Haus kaufen würde. Als Letztes hatte sie gehört, Kay Miller sei in eine Anlage für betreutes Wohnen in Aspinwall gezogen, aber das war im August gewesen. Emily dachte, dass sie sie einmal besuchen sollte, doch in Wahrheit hatte sie dazu nicht die geringste Lust.
Wenn sie sich die elegante, flatterhafte Kay Miller in einer Wohnanlage wie in Aspinwall vorstellte, stand ihr unwillkürlich Louise Pickerings letztes Krankenzimmer vor Augen. Die kahlen beigen Wände, das Pflegebett, der Plastikkrug mit dem Knickstrohhalm auf dem Rolltisch. Eigentlich wusste sie, dass solche Zimmer sehr schön sein konnten, fast so gemütlich wie das eigene Schlafzimmer, doch das Bild von Louise ging ihr nicht aus dem Kopf, genauso wenig wie die Vorstellung, in einem Alter zu sein, das von Stille und Warten geprägt war – was zwar nicht stimmte, aber sie wurde den Gedanken nicht los.
Emily ging allmählich dem Tod entgegen, ja, schön und gut, das galt für sie alle. Wenn Dr. Sayid glaubte, sie sei deshalb am Boden zerstört, zeigte das nur, wie jung er noch war. In Hysterie zu verfallen hatte keinen Sinn. Es war nicht das Ende der Welt, nur ihr eigenes Ende, und in letzter Zeit war sie zu der Überzeugung gelangt, dass es ganz natürlich und vielleicht sogar wünschenswert war, wenn es mit einem Mindestmaß an Würde ablief und nicht sinnlos in die Länge gezogen wurde wie bei Louise, die all diese qualvollen, verzweifelten Eingriffe über sich ergehen lassen musste, weil Timothy und Daniel sich geweigert hatten aufzugeben. Emily hatte nicht vorgehabt, achtzig zu werden. Eigentlich hatte sie auch nicht vorgehabt, Henry zu überleben.
Von der Heizung stieg eine abgestandene, metallische Wärme auf, und ihre Schienbeine glühten. Mit ihrem bis zum Hals zugeknöpften Mantel und dem hineingesteckten Schal war es drückend heiß. Sie ließ den Vorhang los und drehte sich um.
Auf dem Läufer in der Diele saß Rufus in Habachtstellung und starrte die Tür an, als könnte er sie durch reine Gedankenkraft öffnen.
«Ich hab dir gesagt, dass du nicht mitkommst», ermahnte ihn Emily. «Leg dich hin. Los.»
Widerwillig trottete er zu seinem Platz am Fuß der Treppe, drehte sich zweimal im Kreis und ließ sich dann mit einem beleidigten Schnaufen auf den Flickenteppich sinken, die Schnauze auf Emily gerichtet.
«Jaah», sagte sie, «ich behalte dich auch im Auge, Freundchen. Ich will nichts vorfinden, wenn ich nach Hause komme. Du weißt, wovon ich rede.»
Er sah sie schuldbewusst an, als könnte er ihre Worte verstehen, und sie sagte sich, dass es nicht seine Schuld war. Genau genommen war er älter als sie, steinalt für einen Springer Spaniel, und in letzter Zeit hatte er sich angewöhnt, den größten Teil des Tages zu schlafen, genau wie Duchess vor ihrem Tod. Im Gegensatz zu früher konnte er auch ungezogen sein und im Müll herumwühlen, ein Stuhlbein anknabbern oder direkt vor ihren Augen auf den Teppich pinkeln, als wäre er altersschwach. «Was soll ich bloß mit dir machen?», fragte sie dann, als spräche sie mit einem Kind, denn eine Antwort bekam sie nicht. Sie konnte ihn nur ausschimpfen und hinter ihm sauber machen, und wenn sie ihn, wie jetzt, allein zu Hause ließ, machte sie sich Sorgen.
Sie hörte Arlenes Wagen zuerst. Als sie durch die dünnen Vorhänge blickte, sah sie einen großen dunklen Fleck in der Einfahrt.
Rufus bellte drohend und stemmte sich vom Teppich hoch. «Danke», rief sie, während er bellend zur Tür lief. «Das ist doch jemand, den wir kennen.»
Aber er wollte nicht aufhören, woraufhin sie «Platz!» rief und ihn mit dem Finger stupste, und als er zurückzuckte, bekam sie ein schlechtes Gewissen.
«Ich komme ja wieder», sagte sie und zog ihre Handschuhe an. «Sei brav.»
Sie hatte sich erst gestern das Haar frisieren lassen und zurrte ihre durchsichtige Plastikregenhaube fest, bevor sie die Sturmtür aufstieß, sie mit der Hüfte offen hielt und den Regenschirm aufspannte. Als sie sich nach draußen schob, schlug ihr die Kälte entgegen – feucht, aber nicht so rau, wie sie befürchtet hatte. In letzter Zeit klemmte der Riegel der Sturmtür und blieb am Rahmen hängen, und dann drang kühle Luft herein, die sich im ganzen Erdgeschoss ausbreitete. Deshalb blieb Emily noch einen Augenblick auf der Treppe stehen, um sicherzugehen, dass er zuschnappte.
Arlene war nicht weit genug hinaufgefahren, und Emily musste mit dem tückisch abfallenden Rasen und dem erhöhten Randstein fertigwerden, während sie sich mit der Beifahrertür abmühte. Sofort roch sie den Zigarettengestank, der von den Bezügen aufstieg, als hätte Arlene gerade erst geraucht. Emily schüttelte den Regenschirm aus, bevor sie ihn in den Wagen zog, und dennoch tropfte sie sich den ganzen Mantel voll.
«Wie ich sehe, gehst du kein Risiko ein», sagte Arlene, die ihr Haar seit ein paar Jahren hennarot färbte, was Emily, genau wie Arlenes karmesinroten Lippenstift, zu grell und nicht altersgemäß fand. Ihre eigene Haarfarbe war zwar auch nicht natürlich, aber immerhin glaubwürdig: ein grau meliertes Mausbraun. In ihrem Alter gab es Grenzen des Tragbaren, vor allem musste es geschmackvoll bleiben.
«Das hat fünfzig Dollar gekostet», sagte Emily, «da muss die Frisur bis Thanksgiving halten.»
«Weiß Margaret schon, was sie macht?»
Als Arlene zurücksetzte, reckte Emily den Hals, um zu sehen, ob irgendein Fahrzeug kam. Die Grafton Street war an dieser Stelle abschüssig, und bei dem Regen kam man nicht so schnell zum Stehen.
«Auf meiner Seite ist alles frei», sagte Emily. «Seit unserem letzten Gespräch hat sie sich nicht mehr gemeldet, aber ich weiß, dass sie sich den Flug nicht leisten können.» Emily verschwieg, dass sie nicht einmal sicher war, ob Margaret einen Job hatte, und dass sie ihr jeden Monat einen Scheck schickte, damit sie die Hypothek abbezahlen konnte.
«Und was ist mit Kenneth?»
«Die fahren nach Cape Cod, zu Lisas Eltern.»
«Da kannst du schwerlich mithalten.»
«Wem sagst du das», erwiderte Emily. «Ich würde gern nach Cape Cod fliegen, aber das kommt nicht ernsthaft in Betracht.»
«Stimmt.»
«Wenn ich bereit wäre, neunhundert Dollar für ein Flugticket hinzublättern, könnte ich’s tun. Hätte Lisa rechtzeitig Bescheid gesagt, wäre es vielleicht machbar gewesen, aber so läuft das bei ihr nicht.»
«Schade.»
«Ist ja nichts Neues.»
«Tja», sagte Arlene betroffen, als könnte das Emily trösten.
Sie fuhren am Haus der Pickerings vorbei und erreichten das Stoppschild an der Highland Avenue. Emily schwieg, während Arlene auf eine Lücke im Verkehr wartete. Auf WQED lief kaum hörbar das übliche ungestüme Vivaldistück. Im Lauf der Jahre hatte Emily an dieser Kreuzung jede Menge Unfälle erlebt – oder sie gehört: erst das entsetzliche Reifenquietschen und dann die kurze geräuschlose Verzögerung vor dem krachenden Aufprall. Die Highland Avenue war eben, breit und schnell, und wenn Emily durchs Haus streifte und Pflanzen abstaubte oder Zeitschriften aussortierte, wurde sie regelmäßig von der Sirene eines Streifenwagens oder einer Ambulanz vorn ans Fenster gelockt, um zu sehen, was diesmal passiert war. Bei den schlimmsten Unfällen waren ihre Nachbarn aus den Häusern geströmt und hatten sich auf dem Gehsteig gedrängt, um sich die Feuerwehrautos anzusehen und die Einrichtung einer Ampel zu diskutieren (auf keinen Fall, hatten Doug und Louise gesagt, das drücke die Grundstückspreise in den Keller).
Hinter einem Bus tat sich eine Lücke auf, doch Arlene zögerte.
«Hast du das mit dem Busfahrer in Wilkinsburg gehört?», fragte sie und wandte Emily den Kopf zu.
«Nein», sagte Emily und deutete auf die Straße.
Als sich wieder eine Lücke auftat, bog Arlene betulich in die größere Straße.
«Kam heute früh auf KDKA. Dieser Fahrer, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Er hat seinen Bus mit laufendem Motor vor einem McDonald’s stehen lassen, und irgendjemand ist damit abgehauen. Sie haben den Bus auf der North Side gefunden, direkt hinter dem Heinz Field.»
«Vielleicht war’s einer von den Steelers», mutmaßte Emily, denn die hatten ein paarmal Ärger mit der Polizei gehabt.
«Kannst du dir das vorstellen: Du kommst mit einem Egg McMuffin nach draußen, und dein Bus ist weg?»
Emily betrachtete das als rhetorische Frage und musterte im Vorbeifahren die imposanten Backsteinhäuser entlang der Highland Avenue, die mit ihren Säulenportiken und den vielen Schornsteinen eine Hinterlassenschaft des einstigen Reichtums der Stadt waren. Sie thronten hoch über der Straße, jedes mit einer großen Rasenfläche und bogenförmigen Zufahrt, von der öffentlichen Straße durch schmiedeeiserne Tore und schwarze Granitmauern getrennt, die auch einem Friedhof gut angestanden hätten. Als junge Frau aus einem so rückständigen Nest wie Kersey hatte sie diese Herrenhäuser verlockend gefunden, aber verglichen mit dem Fricks’ Clayton, dem Mellon House oder den Kalksteinmonstrositäten an der Fifth Avenue wirkten sie ziemlich bescheiden. Henry hatte diesbezüglich eher praktisch gedacht. Das Haus in der Grafton Street war ihnen nie zu groß oder zu klein gewesen. Auch als die Kinder nicht mehr da waren, konnten sie und Henry es ausfüllen.
Sie dachte an Rufus, der es sich bestimmt unter dem Esszimmertisch gemütlich gemacht oder sich neben das Warmluftgitter beim Geschirrschrank gelegt hatte. Wenn die Sonne vormittags durch die in den Garten führende Verandatür fiel und ein Teppichstück beleuchtete, das ungefähr so groß war wie Rufus, war über seiner schlafenden Gestalt eine Galaxie schwebender Staubkörner zu sehen. Manchmal musste sie sich vergewissern, dass er noch atmete. Sie wünschte, sie könnte es ihm gleichtun und einfach den Tag vertrödeln. Der graue Himmel, die Bäume, die Straße – für die nächsten fünf Monate stellte der Winter von Pittsburgh nichts Besseres in Aussicht. Sie verstand, warum Leute in ihrem Alter nach Florida flüchteten.
«Dann sind also nur wir zwei alten Hühner da?», fragte Arlene.
«So ist es», sagte Emily.
«Willst du in den Club, oder sollen wir was anderes unternehmen?»
«Hast du irgendwelche Vorschläge?»
«Wann müssten wir denn reservieren?»
«Bald», erwiderte Emily und dachte daran, wie sie einmal an Margarets Geburtstag dort gegessen hatten. Das musste schon fünfundvierzig Jahre zurückliegen, denn Margaret war damals in ihrem Trägerkleid schlank wie eine Ballerina gewesen und hatte spaßeshalber vor allen Leuten einen Knicks gemacht. Ausnahmsweise waren Emilys Eltern dabei gewesen, ihr Vater unbeholfen in seinem billigen braunen Anzug, beeindruckt von den hohen Fenstern und den Deckengemälden im Ballsaal, von den weiß behandschuhten Kellnern, die von Tisch zu Tisch gingen, um eisgekühlte Butterstücke mit aufgeprägtem Clubwappen zu bringen. Emily hatte bestimmt Margarets Lieblingsspeise bestellt – gelben Kuchen mit Schokoladenglasur –, und Henry hatte per Unterschrift bezahlt. Fünfundvierzig Jahre.
Emily konnte die Bilder nicht verscheuchen, obwohl sie es gern getan hätte. Sie quälten sie wie eine Migräne, machten sie hilflos und unzufrieden, als wäre ihr eigenes Leben und das der Menschen, die sie geliebt hatte, im Sande verlaufen, nur weil jene Zeit vorbei war, weil sie sogar aus ihrem Gedächtnis schwand und von dieser tristen Gegenwart ersetzt wurde. Wenn es ihr wie eine andere Welt vorkam, dann deshalb, weil es so war, und all ihre Sehnsucht konnte diese Welt nicht zurückbringen.
Als sie sich East Liberty näherten, wurden die Häuser immer schäbiger – durchhängende Veranden, mit Brettern vernagelte Fenster, graffitibesprühte Wände. Die Gärten und Gehsteige waren mit Müll übersät, und an jeder Kreuzung drängten sich die Wahlplakate der letzten Woche zu Hexenringen zusammen, Gewinner und Verlierer gleichermaßen vom Regen durchnässt. Arlene hatte die Heizung voll aufgedreht. Sie funktionierte nur stotternd, weil ein Blatt im Gebläse steckte, doch Arlene schien es nicht zu bemerken.
«Könnten wir vielleicht die Heizung ein bisschen runterdrehen?», fragte Emily. «Mir ist furchtbar heiß.»
«Ist das dein Ernst?», wollte Arlene wissen. «Ich friere schon den ganzen Morgen.»
«Du brauchst wahrscheinlich bloß was zu essen.»
«Ich hab Kaffee getrunken. Scheint nichts genützt zu haben.»
Arlene beklagte sich gern über ihren niedrigen Blutdruck, doch Emily hatte manchmal das Gefühl, sie sei geradezu stolz darauf, als wäre es etwas Besonderes, das nur auserwählten Menschen zu schaffen mache. Um sich keinen Vortrag anhören zu müssen, schloss Emily ihren Lüftungsschlitz, zog die Handschuhe aus, löste die Regenhaube, öffnete den obersten Knopf ihres Mantels und nahm den Schal ab. Gleichsam als Zugeständnis stellte Arlene das Gebläse eine Stufe niedriger.
«So besser?», fragte sie.
«Danke.»
Sie fuhren an der modernisierten Fassade der Peabody Highschool vorbei, die zu Henrys Schulzeit nur Weiße besucht hatten. Obwohl es schon nach neun Uhr war, prügelten ein paar barhäuptige Jungen neben einem Bushäuschen lachend mit ihren Rucksäcken aufeinander ein. Emily fragte sich, ob ihre Mütter wohl wussten, dass sie die Schule schwänzten.
«Hast du das Licht an?», fragte sie, weil die entgegenkommenden Autos die Scheinwerfer eingeschaltet hatten.
«Ja, hab ich.»
«Ich habe doch bloß gefragt.»
«Und ich habe bloß geantwortet.»
Sie konnte sich nicht an das hässliche orangefarbene Home Depot gewöhnen, das den Platz des hässlichen blauen Sears eingenommen hatte. Als junge Mutter hatte sie mit den Kindern dort Kleidung gekauft und Weihnachtsgeschenke besorgt. Margaret war ganz wild auf die Parfümproben und die Schmucktheke gewesen, und Kenneth hatten die Aufzüge, die Wand aus Tropenfischen und der Schlüsseldienst fasziniert. Henry hatte dort sein gesamtes Werkzeug erstanden. Seine Schraubenzieher, Schraubenschlüssel und Zangen hingen noch immer, nach Größe geordnet, ordentlich aufgereiht im Keller und hatten ihre lebenslange Garantie erfüllt. Das Home Depot gab es schon seit zehn Jahren, doch sie hatte es kein einziges Mal betreten. Die Gegend hatte sich verändert. Nicht dass es gefährlich war, zumindest nicht tagsüber. Hier war sie vermutlich schon eine Ewigkeit nicht mehr zu Fuß unterwegs gewesen.
«Guck dir das mal an», sagte Arlene und deutete auf den Geländewagen, der sie rechts überholte. Der Fahrer, ein junger Schwarzer mit dünnem Bart und zerdrücktem Afrolook, telefonierte mit einem Handy. «Und du findest mich schlimm.»
«Bist du auch», sagte Emily.
«Wenigstens telefoniere ich nicht.»
«Wen solltest du schon anrufen – etwa mich?»
«Ja», sagte Arlene. «Ich würde dich auffordern, dir eine andere Fahrgelegenheit zu suchen.»
«Eins zu null für dich.»
Und als wollte sie Emily auf die Probe stellen, drosselte Arlene das Tempo und bog in den Penn Circle ein, den grauenhaftesten Teil der Fahrt. Ende der sechziger Jahre hatten die Stadtplaner zur Umgehung der Fußgängerzone, die sie ins Herz von East Liberty geschnitten hatten, einen riesigen fünfspurigen Kreisel mit einem Durchmesser von achthundert Metern entworfen, der den Verkehr von den Hauptverkehrsadern und Zubringerstraßen aufnahm, die dort einmal aufeinandergetroffen waren, die Fahrzeuge im Kreis herumwirbelte und sie dann, ohne die Hilfe einer Ampel, in alle vier Richtungen ausspuckte. Der endlose Kreisbogen sollte eigentlich für eine angemessene Geschwindigkeit sorgen, doch herausgekommen war eine ebene Rennstrecke, auf der die Fahrer durch die Kurven preschten und im letzten Moment zu ihrer Ausfahrt hinüberschossen.
Dieser Fahrstil lag Arlene nicht, und statt sich nahtlos in den Verkehrsfluss einzureihen, hielt sie am Vorfahrtsschild und wartete unglaublich lange, ehe sie in den Kreisel fuhr, schlich dann die rechte Spur entlang, während die anderen Autos raketengleich an ihr vorbeizischten und ihre Windschutzscheibe bespritzten, sodass sie die Scheibenwischer auf volle Kraft stellen musste. Arlene beugte sich übers Lenkrad und umklammerte es. In Erwartung eines Zusammenstoßes legte Emily die Hand aufs Armaturenbrett, aber da sie so langsam fuhren, bildete sich rasch eine Schlange von Autos, die hinter ihnen festsaßen und nicht auf die Innenspuren biegen konnten. Ein weißer Lieferwagen füllte das Heckfenster aus und ließ das Fernlicht aufblitzen.
«Dann überhol doch endlich», schimpfte Arlene.
Die Autos begannen zu hupen, ein penetranter Chor, der noch von einem langen, anhaltenden Ton übertroffen wurde. Ein Honda brauste vorbei, drängte sich direkt vor sie und zwang Arlene zu bremsen, bevor er wieder davonschoss.
«Idiot», rief Arlene. «Fünf Spuren, und du musst ausgerechnet auf meiner sein.»
Sie fuhr, als würde sie Scheuklappen tragen, und hielt ihre Position, nur auf die vor ihr liegende Straße konzentriert. Als sie von weiteren Autos überholt wurden, starrte auch Emily aus Angst vor dem, was sie zu sehen bekommen könnte, einfach geradeaus. Endlich überholte der Lieferwagen. Sie riskierte einen Blick zurück. Hinter ihnen war niemand mehr; sie waren allein. Arlene blinkte weit vor der Ausfahrt. Der Blinker klickte unaufhörlich, und Emily hätte am liebsten die Hand ausgestreckt und ihn ausgeschaltet.
«Das macht doch jedes Mal Spaß», sagte Arlene, als sie den normalen Verkehr auf der Penn Avenue wieder erreicht hatten.
«So gut hätte ich das nie hinbekommen», erwiderte Emily.
«Ist es dir immer noch zu heiß?»
«Nein.»
«Ach», sagte Arlene, als sie an der ehemaligen Nabisco-Fabrik vorbeikamen, entkernt und luxussaniert, ein Werbeplakat für Eigentumswohnungen an der Fassade, «hast du schon gehört, wie viel sie da für eine Einzimmerwohnung verlangen?»
«Wie viel?»
«1,2 Millionen.»
«Das ist ja Wucher. Wer will für eine Wohnung in East Liberty schon so viel Geld bezahlen?»
«Die Gegend wird jetzt Eastside genannt.»
«Von wem? Von niemandem, den ich kenne. Die reinste Geldverschwendung.»
Abgesehen von dem Gierfaktor hatte sie nichts gegen die Eigentumswohnungen. Besser, als das Gebäude leer stehen zu lassen. Das wirklich Traurige war, dass man, als die Fabrik noch lief, im Sommer wie im Winter selbst bei geschlossenem Fenster riechen konnte, dass dort gebacken wurde. Sie hatten Ritz Cracker hergestellt, und der warme Buttergeruch hatte das Gebäude wie eine Wolke umhüllt. Im Frühling, wenn das Arts Center im französischen Garten auf dem Plateau des Mellon Parks seine alljährliche Spendengala veranstaltete, konnte man mit seiner Limonade in der Hand über den von Wegen durchschnittenen, langgezogenen Hang und die Fifth Avenue blicken, über die Tennishalle, den Spielplatz und die fernen Felder hinweg, konnte aus der Fabrik Rauch aufsteigen sehen und die Luft geradezu schmecken. Wie alle Pittsburgher hatte Emily das Gefühl gehabt, die Fabrik würde ihr gehören, als hätte sie die Cracker selbst hergestellt, und sie bedauerte, dass es Nabisco nicht mehr gab.
In der Stadt war so vieles verschwunden, aber diese Sehnsucht war auch ein Teil von ihr. Da sie aus der Provinz stammte, hatte sie ihr neues Zuhause von Anfang an mit dem Blick einer Außenstehenden betrachtet und alles Sehenswerte zu schätzen gewusst, das ein Einheimischer wie Henry als selbstverständlich oder banal empfand. Obwohl sie schon fast sechzig Jahre hier lebte und den größten Teil ihres gesellschaftlichen Lebens mit ihren Freunden aus dem Country Club verbracht hatte, war sie im Grunde ihres Herzens immer noch eine Landpomeranze. Die gotische Cathedral of Learning kam ihr immer noch unglaublich hoch vor, die eichengetäfelten Räume mit den Steinkaminen erschienen ihr ungeheuer prunkvoll, zu schön für Studenten wie sie. Wenn sie ihre Enkelkinder zu einer Fahrt in der Standseilbahn mitnahm, war sie von dem Blick auf die Landspitze genauso ergriffen wie Ella oder Sam. Sie fuhr nicht deshalb mit Sarah und Justin auf dem Gateway Clipper zum Spiel der Pirates, weil Großmütter solche idyllischen Fahrten unternahmen oder weil sie es schon mit Margaret und Kenneth getan hatte, als sie in deren Alter waren, sondern weil Emily, wenn das nachgebaute Dampfschiff den zweifarbigen Zusammenfluss von Mon und Allegheny erreichte, sich vorstellen konnte, wie George Washington am Flussufer stand, die Stadt hinter ihm nicht mehr als ein aus Erde gebautes Fort im Urwald, ihre eigene Geschichte, wie die von Amerika, noch ungeschrieben. Als sie noch jung war, bedeutete die Stadt für sie eine neue Welt. Doch jetzt schien Emily sie Stück für Stück zu verlieren.
Jede Straße triefte von Erinnerungen. Sie folgten der Penn Avenue, die als rote Linie zwischen Homewood und Point Breeze verlief, und fuhren an Mr. Fricks geliebtem Clayton vorbei, unantastbar hinter dem spitzen Eisenzaun. Auf dem Gelände gab es ein Café, in dem sie und Louise hin und wieder etwas gegessen hatten, und ein Gewächshaus mit spitzem Dach, das für die Allgemeinheit geöffnet war. Wie der Frick Park mit seinen urigen Waldwegen und malerischen Rasenflächen war es eine Oase, solange man nicht darüber nachdachte, woher das Geld stammte.
Von der Penn in die Braddock Avenue und dann über die Forbes Avenue, an den Baseballfeldern vorbei, wo Kenneth immer gespielt hatte, nach Regent Square, Arlenes Viertel, inzwischen begehrt mit seinen scheckigen Platanen und den Ziegelsträßchen, die sich bis an die Senken des Parks zogen. Ruheständler und alte Jungfern mit festem Einkommen wie Arlene harrten in Zweifamilienhäusern und Bungalows aus den zwanziger Jahren aus, doch im Gegensatz zu East Liberty waren auch junge Familien hergezogen, die sich Point Breeze nicht mehr leisten konnten. Die kurze Einkaufsstraße an der Grenze zu Edgewood entwickelte sich gut. Das Kino zeigte eine Bergman-Retrospektive (Louise war verrückt nach Bergman gewesen, Henry hatte ihn langweilig gefunden), und Arlene deutete auf ein neues Slow-Food-Bistro, das einmal ein Grußkartenladen gewesen war.
«Da gibt’s nur acht Tische.»
«Klingt teuer», sagte Emily.
«Es soll sehr gut sein.»
«Ich frage mich, ob sie an Thanksgiving geöffnet haben.»
«Ich könnte mich erkundigen», schlug Arlene vor.
«War nur Spaß. Der Club ist doch in Ordnung.»
«Ich hab vergessen, wer Weihnachten dran ist.»
«Margaret, aber bei ihr gibt’s keine Garantien.»
«Ich sterbe vor Hunger», sagte Arlene, denn sie waren fast da.
«Ich auch.»
Sie glitten an der ansteigenden Auffahrt vorbei unter den Parkway, und da die Überführung sofort den Regen abhielt, quietschten die Scheibenwischer, als sie an der Ampel auf der anderen Seite hielten. Das Eat ’n Park lag gleich oben am Hügel, der Parkplatz schon ziemlich voll, die Fenster warm und einladend.
Als die Ampel umsprang, fuhr Arlene ein Stück vor und blinkte links, machte aber nicht so viel Platz, dass die anderen vorbeikonnten. Während sie wartete, bis der Gegenverkehr vorbei war, atmete Emily langsam durch die Nase ein und aus und versuchte den Kopf leer zu bekommen. Fahr doch, befahl sie im Stillen, als hätte sie die Fähigkeit zur Gedankenübertragung. Zweimal hätte Arlene es schaffen können, aber sie wartete und ging auf Nummer sicher. Fahr doch, wünschte sich Emily, und diesmal klappte es. Als sie auf den Parkplatz bogen und auch nachdem Arlene eingeparkt hatte, verkniff sich Emily jegliche Bemerkung. Dass ihre Seite deutlich über die weiße Linie ragte, war nicht wichtig. Es war eine Erleichterung, aus dem Wagen zu steigen, und als sie sich zwischen den Pfützen hindurchschlängelten, sah Emily, dass Arlene die Totes-Gummistiefel trug, die sie ihr vor Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte, und bereute ihre Ungeduld.
Unterm Türvorsprung schüttelte sie ihren Regenschirm aus. Drinnen, durch den Kaffeeduft und das Stimmengewirr der Gespräche wieder mit Tatkraft erfüllt, faltete sie ihre Regenhaube zusammen, nahm den Schal ab, stopfte ihn in den Ärmel ihres Mantels und hängte den Mantel auf. Im Eat ’n Park war es stets kalt. Genau wie Arlene hatte sie extra einen Pullover angezogen. Eine Schlange von Gästen wartete darauf, an einen Tisch geführt zu werden, und die beiden stellten sich vor die Gebäckvitrine. Bewundernd deuteten sie auf die Obstkuchen, achteten jedoch darauf, dass sie das Glas nicht verschmierten. Es war ihre allwöchentliche Gewohnheit, den schönsten Kuchen auszuwählen, aber da sie allein lebten, war keine von beiden so übermütig, einen zu kaufen.
«Im Club gibt’s bestimmt Kürbiskuchen», sagte Arlene.
«Bestimmt.»
Rhonda, die uniformierte Empfangsdame mit der Cornrow-Frisur, kannte sie schon. «Morgen, meine Damen», sagte sie, ohne ihnen Speisekarten zu geben, und ließ den Blick durch den fast vollen Saal wandern.
«Bitte ein warmes Plätzchen», bat Arlene und rieb die Hände aneinander.
«Wie Sie sehen, ist heute ziemlich viel los. Macht es Ihnen was aus, in der Nähe der Küche zu sitzen?» Das hieß in der Nähe der Toiletten.
«In unserem Fall», sagte Arlene, «könnte das sogar praktisch sein.»
Rhonda führte sie zwischen den anderen Gästen hindurch zu einer Nische auf der gegenüberliegenden Seite, von wo man durch die Schwingtür einen Blick auf die Geschirrspülmaschine hatte. Emily hätte lieber am Fenster gesessen, aber eine Nische war besser als ein frei stehender Tisch, und das Buffet war ganz in der Nähe, die vereinten Düfte von French Toast, Speck und Ahornsirup verlockend. Peinlich berührt merkte sie, dass ihr das Wasser im Mund zusammenlief.
«Kein Wunder», sagte Arlene. «Es ist schon kurz vor halb zehn.»
«Ich hätte gern erst einen Kaffee.»
«Ich auch.»
Emily zog ihren Gutschein aus der Handtasche, um ihn bereitzuhalten, wenn die Kellnerin kam. Auf den Fensterplätzen saßen im flach hereinfallenden Licht Paare mittleren Alters, die an ihren Getränken nippten, sich unterhielten und es nicht eilig hatten, den Tag zu beginnen, und Emily fragte sich, was für einer Arbeit sie wohl nachgingen.
«Und», sagte Arlene, «ich nehme an, dann kommen Kenneth und Lisa zu Ostern.»
«Wer weiß. Ich habe ihn wieder und wieder gefragt und immer noch keine klare Antwort erhalten.»
«Man sollte meinen, dass sie sich so bald wie möglich Tickets besorgen wollen.»
«Stimmt. Oh, da kommt ja unsere Freundin.»
Sandy arbeitete schon länger im Eat ’n Park als Rhonda. Sie war Polin, blond, breitschultrig, Mitte fünfzig, hatte einen abgebrochenen Zahn und einen starken Pittsburgher Akzent. Durch ihre kurzen Gespräche kannte Emily einen Teil ihres Lebenslaufs. Ihr Mann hatte etwas weiter den Hügel hinauf bei Union Signal gearbeitet, bis die Fabrik geschlossen wurde; jetzt gehörte er dem Sicherheitsdienst des Gateway Centers in der Innenstadt an. Ihr Sohn hatte für die Central Catholic Highschool Basketball gespielt und war dann aufs Providence College gegangen. Emily konnte sich gerade nicht erinnern, wo er war oder was er machte, obwohl Sandy es ihr schon oft erzählt hatte. Eine weitere Gefahr des Altwerdens.
«Und wie geht’s Ihnen heut?», fragte Sandy, stellte klirrend zwei Becher auf den Tisch und goss ihnen, ohne zu fragen, Kaffee ein.
«Danke, gut», sagte Emily und reichte ihr den Gutschein, den Sandy in ihre Schürze gleiten ließ. «Was macht Stephen?»
«Dem geht’s gut, danke.»
«Kommt er an Thanksgiving nach Hause?»
«Wir fliegen fürs ganze Wochenende rüber», erwiderte Sandy und deutete mit dem Daumen über die Schulter, als stünde Stephens Haus direkt vor der Tür.
«Das ist schön», sagte Arlene.
«Ja, gut, diesem Wetter mal zu entkommen. Möchte eine von Ihnen Orangensaft haben?»
«Nein, danke.»
«Okay, bedienen Sie sich. Sie kennen sich ja aus.»
«Tun wir», bestätigte Emily.
«Jetzt geht’s mir besser», sagte Arlene, als Sandy weg war. «Der Kaffee hilft. Weißt du, was ich gern unternehmen würde, wenn Sarah und Justin da sind?»
«Was denn?» Warum konnte Arlene nicht davon aufhören? Emily hatte ihr doch gerade gesagt, dass noch nicht klar war, ob sie kamen. Sarah war inzwischen mit dem College fertig und arbeitete, und vielleicht würde sie nicht freibekommen.
«Ich würde gern mit den beiden in Panther Hollow Schlittschuh laufen. Dort hatten wir immer so viel Spaß.»
«Wenn der Teich zugefroren ist. Ist er aber vielleicht noch nicht.»
«Hoffentlich doch.»
Es sah Arlene ähnlich, Emilys empfindlichste Punkte zu treffen – ihr nicht nur die Aussicht auf den Besuch der Enkelkinder, sondern auch jene lange zurückliegenden Abende ins Gedächtnis zu rufen, an denen Emily und Henry mit seinen Verbindungsbrüdern und deren Freundinnen Schlittschuh gelaufen waren und später, wenn sie am Feuer saßen, Hot Toddys getrunken hatten, der Wald ringsum dunkel, die Sterne am Himmel hell und klar. Den Teich, die Senke und die Sterne gab es immer noch. Nur Henry war nicht mehr da.
«Sieht aus, als hätten sie den leckeren Corned-Beef-Eintopf», sagte Arlene.
«Oh, gut.»
Sie warteten, bis sich die Schlange aufgelöst hatte. Manchmal waren die Teller kochend heiß, frisch aus der Küche, doch heute hatten sie Zimmertemperatur. Der, den Emily vom Stapel nahm, war noch feucht. Statt ihn von jemandem trocken wischen zu lassen, hielt sie ihn schräg und ließ die Tropfen auf den Teppichboden rinnen. Arlene nahm wie immer einen Salatteller, als hätte sie gar keinen Hunger.
Das Buffet sah auf beiden Seiten gleich aus, eine Reihe identischer Speisenwärmer, angefangen mit Zucker- und Honigmelonenscheiben, Bananen und halbierten Orangen, Ananasstücken aus der Dose und Pfirsichen im eigenen Saft, Hüttenkäse und Apfelmus, drei pastellfarbenen Joghurtsorten, einem Tablett voll Muffins und Plundergebäck, mehreren Brotsorten, von denen man sich eine Scheibe abschneiden und sie auf einer Art Fließband toasten lassen konnte, an dessen Ende Schalen mit Butter, Margarine und Frischkäse warteten, dann blubbernde Töpfe mit echtem Hafer- und Grießbrei, gefolgt von kleinen Cornflakes-Schachteln und den dazugehörigen Karaffen mit Mager-, fettarmer und Vollmilch und schließlich die dampfenden Berge von Belgischen Waffeln, Pfannkuchen, Rührei, Würstchen und Bratkartoffeln – und all das unablässig wieder aufgefüllt. Es war nicht gerade Gourmetkost, aber das machte Emily nichts aus. Sie konnte in vielen Dingen ein Snob sein – Lisa würde sagen, in allen –, doch zu diesem Preis war es schon ein Luxus, nicht kochen zu müssen.
«Ich sollte vielleicht zweimal gehen», sagte Arlene auf der anderen Seite des Niesschutzes, auf ihrem Teller bereits eine Riesenportion.
«Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach einen normalen Teller benutzen kannst», erwiderte Emily.
«Ich will nicht nooooh ahhhhh laaah», sagte Arlene, als wollte sie sich über sie lustig machen oder als würde Emily plötzlich schlecht hören. Emily blickte von dem Gebäckstück auf, das sie gerade mit einer Zange packte. Arlene starrte sie bestürzt an, als hätte ihr jemand ein Messer in den Rücken gestoßen. Ihre Augen quollen hervor, der Blick war auf etwas Unsichtbares gerichtet. Ihr Mund stand offen und bewegte sich nicht.
«Aaah waaah», sagte sie. «Aaah laaah.»
In dem Augenblick, bevor Arlene nach vorn kippte, wich Emily reflexartig einen Schritt zurück, als wollte sie ihr für den Sturz Platz machen, obwohl sich zwischen ihnen das Buffet befand. Ihren Teller noch immer umklammernd, stürzte Arlene und prallte mit dem Gesicht auf den Niesschutz.
Erst da reagierte Emily, ließ ihren eigenen Teller fallen und lief um das Buffet herum. Arlene lag auf dem Boden, ringsum war alles mit Obst übersät. Zusammengerollt lag sie auf der Seite, versuchte noch immer zu sprechen, und aus einer Risswunde über ihrem Auge floss Blut.
Die Leute in den Fensternischen saßen da und starrten herüber.
«Um Gottes willen», rief Emily, die auf allen vieren hockte, «helfen Sie uns doch bitte!»
Nur zu Besuch
Es sei bloß einer ihrer Schwächeanfälle gewesen, beteuerte Arlene. Die bekomme sie immer bei zu niedrigem Blutdruck. Sie wirkte nicht überrascht. Die Schnittwunde an ihrer Stirn, deren bläuliche Ränder durch eine faltige Naht zusammengehalten wurden, schien ihr mehr auszumachen. Nach diesem Geständnis stellte sich Emily vor, wie Arlene in ihrer Wohnung oder, noch beängstigender, hinter dem Lenkrad in Ohnmacht fiel. Arlene verstand nicht, was der ganze Wirbel sollte. Es war ihre eigene Schuld. Sie hätte etwas essen müssen.
Weil die Ärzte das anders sahen, behielten sie Arlene da, um weitere Untersuchungen vorzunehmen, und verlegten sie in ein durch Vorhänge unterteiltes Patientenzimmer mit Blick auf die Reihenhäuser von Bloomfield. Zumindest hatten sie hier einen Fensterplatz. Die Wolken trieben über die Brücke hinweg, die das Tal überspannte und in den Bigelow Boulevard mündete. Die fünf Stockwerke tiefer liegenden, regennassen Straßenzüge sahen grau aus, die Ampeln in der Liberty Avenue die einzigen Farbtupfer.
Als die Rettungssanitäter Arlene aus dem Eat ’n Park schoben, hatte Emily gefragt, ob sie mitkommen könne. Nein, das sei gegen die Vorschriften, aber sie könne hinter ihnen herfahren, darum hatte sie in Arlenes Handtasche nach den Schlüsseln gekramt und den rutschigen Straßen die Stirn geboten. Sie hatte keine Angst gehabt, vermutlich wegen des freigesetzten Adrenalins. Doch als die Krankenschwester vorschlug, sie solle ein paar Sachen aus Arlenes Wohnung holen, damit sie es behaglicher habe, hätte Emily am liebsten gesagt, das Ganze sei eine einmalige, nicht wiederholbare Angelegenheit gewesen. Sie könnten den Wagen abschleppen lassen, und Emily würde mit einem Taxi nach Hause fahren.
«Kümmerst du dich um meine Handtasche?», fragte Arlene.
«Natürlich», erwiderte Emily.
«Sie wollen bestimmt Ihren Morgenrock und Ihre Hausschuhe haben», warf die Schwester ein. «Die meisten Leute tragen lieber ihre eigenen Schlafanzüge als unsere.»
«Wenn du mir mein Buch mitbringen könntest. Es müsste auf dem Nachttisch liegen. Entweder da oder auf dem Beistelltisch neben dem Sofa. Und könntest du bitte die Fische füttern? Die brauchen nur drei Prisen Trockenfutter. Das steht neben dem Aquarium.»
Emily verließ das Zimmer mit einer Liste und einem klaren Auftrag. Sie würde den Taurus bei Arlene stehenlassen, ihre Sachen holen und mit einem Taxi zurückkommen. Ihr größtes Problem wäre, auf der Straße zu parken. Hoffentlich gab es am Bordstein eine große Parklücke, in die sie einfach vorwärts hineinfahren konnte. Die musste nicht direkt vor der Tür liegen. Sie hatte keine Bedenken, ein paar Häuser weiter zu parken. Sie selbst fand die Gegend nicht besonders sicher, ein Puffer zwischen Wilkinsburg und Swissvale, doch Arlene ließ den Wagen jede Nacht draußen stehen.
Sie fuhr die unkomplizierteste Strecke, durch Shadyside, um den Penn Circle zu meiden. Es nieselte und war dunstig. Vielleicht traute sich bei dem Regen kaum jemand vor die Tür, denn in der Fifth Avenue war nicht viel los. Als sie am Arts Center und dem Grün des Mellon Parks vorbeikam, schätzte sie sich schon glücklich. Sie passte sich der Geschwindigkeit des Verkehrs an, achtete auf vor ihr aufleuchtende Rücklichter und bremste, wenn nötig. Niemand klebte ihr an der Stoßstange, niemand hupte. Es war schon eine Ewigkeit her, seit sie zum letzten Mal Auto gefahren war, doch an diesem Morgen stellte sie fest, dass sie hinterm Lenkrad viel weniger Angst hatte, als wenn sie neben Arlene saß.
Sie hatte sich ohne Grund Sorgen gemacht. Zu dieser Tageszeit lag Arlenes Straße verlassen da. Sie lenkte den Taurus zu dem freien Platz vor Arlenes Wohnung und rollte so dicht an den Bordstein, wie sie sich traute. Na also, dachte sie und schaltete die Zündung aus, doch als sie den Schlüssel abziehen wollte, steckte er fest.
Sie drückte ihn hinein, denn sie wusste, dass man das bei manchen Autos tun musste, aber es nützte nichts. Sie hatte ihre Mitgliedschaft im Automobilclub gekündigt und sah schon vor sich, wie sie hier festsaß und eine Werkstatt verständigen musste.
Sie drehte den Schlüssel, als wollte sie den Wagen wieder anlassen. Nichts. Das ergab keinen Sinn, und sie kontrollierte den Schaltknüppel. Der kurze neonfarbene Pfeil zeigte auf D.
«Du meine Güte.» Das war die Strafe für ihre Selbstzufriedenheit.
Wegen Arlenes Sachen hatte sie keine Hand für den Regenschirm frei. Sie zurrte die Regenhaube fest und stapfte mit gesenktem Kopf die Treppe hinauf. Auf der Veranda musste sie alles auf einem Gartenstuhl ablegen, um den Schlüssel ins Schloss stecken zu können, dann alles wieder zusammenraffen und es eine weitere Treppe hinaufschleppen. Sie war außer Atem und dachte, Arlene könne von Glück sagen, dass sie nicht hier umgekippt war und sich das Genick gebrochen hatte.
Oben machte das Treppenhaus einen Bogen, und es gab eine weitere Tür, die unverschlossen war und in einen engen Flur führte, durch den man zur Wohnung gelangte. Die Wohnung hatte eine seltsame Aufteilung, da sie früher wohl zu einem geräumigen Haus gehört hatte. Schon die Idee eines Zweifamilienhauses ging Emily gegen den Strich. Sie konnte sich nicht vorstellen, über jemandem zu wohnen, der jeden ihrer Schritte hörte. Sie wusste ihre Nachbarn zu schätzen, konnte sogar behaupten, dass sie Louise und Doug, Ginny und Gene Alford, Isabel und Ev Conroy, Dotty und Fred Engelmann, die ganze alte Clique, gemocht hatte, doch sie hätte nicht gewollt, dass sie jedem Schritt lauschten, den sie und Henry machten. Das war nur eine weitere Seite Arlenes, die sie nie verstehen würde.
In der Wohnung war es dunkel und stank nach abgestandenem Zigarettenrauch. Die einzigen Lichtquellen waren die Fenster und das summende Aquarium, das in grellem Unterwassergrün neben dem sargähnlichen Baldwin-Klavier von Henrys Mutter leuchtete. An den Wänden, von der Düsternis gnädig verborgen, hingen die unbeholfenen, missratenen Stillleben, die Arlene für ihre Volkshochschulkurse gemalt hatte – gewissenhaft schattierte Äpfel, Birnen und Weinflaschen, die, statt dreidimensional zu wirken, so flach wie Höhlenmalereien blieben. Sie und Henry besaßen selbst eins mit mehreren pockennarbigen, perspektivisch gezeichneten Orangen, das in Henrys Arbeitszimmer verbannt worden war. Obwohl Emily mit niemandem so viel Zeit verbrachte wie mit Arlene, beschränkte sich ihre Geselligkeit auf das öffentliche Leben und bestand aus Verabredungen, festlichen Anlässen und Unterhaltung. Nur selten drangen sie in die Privatsphäre des anderen ein, und allein in Arlenes Allerheiligstem hermzuschleichen kam ihr wie eine Sünde vor. Sie fragte sich, ob Arlenes Nachbar wohl unten war und insgeheim jeden ihrer Schritte verfolgte.
Sie benutzte die Küche als Basis, legte die Sachen auf den Tisch und hängte ihre Regenhaube über den Wasserhahn, ging dann durch die Zimmer und knipste überall das Licht an. In der Wohnung war es so ordentlich wie in einer Hotelsuite, alles abgeräumt und sauber gewischt, dabei kam Betty erst am Freitag. Da sie selbst einen endlosen Feldzug gegen die Unordnung führte, war Emily neidisch, doch zugleich hegte sie den Verdacht, dass diese Sauberkeit übertrieben, ja vielleicht sogar neurotisch war, ein Nebenprodukt des Umstands, dass Arlene, genau wie sie, nicht genug zu tun hatte.
Das Schlafzimmer war ein Museum, alle Möbel Erbstücke. Als wären es Arlenes eigene Kinder, lehnten die vertrauten Schulfotos von Margaret und Kenneth mit ihren zotteligen Siebziger-Jahre-Frisuren in schweren Silberrahmen auf der Kirschbaumkommode. Davor standen, aufgereiht wie Schachfiguren, kleinere Bilder der Enkelkinder und, ungerahmt, die neuesten Weihnachtsfotos der beiden Familien, aber keine einzige Aufnahme von Emily.
Sie fand Arlenes Buch auf dem Nachttisch – einen britischen Krimi, den Emily ihr geliehen hatte. Er lag auf einer kompakten Kunstlederbibel mit Goldschnitt, ein geknicktes Seidenband an der zuletzt aufgeschlagenen Stelle. Einen Augenblick dachte Emily, es sei Henrys Bibel, die sie für die stürmischen Nächte, in denen sie nicht schlafen konnte, neben dem Bett liegen hatte, aber nein, Arlenes Name war auf den Einband geprägt. Arlene hatte Margaret und Kenneth ähnliche Bibeln zur Konfirmation geschenkt, später auch den Enkelkindern, womit sie den Brauch aufs neue Jahrhundert übertragen hatte, aber als Geschenke hatten sie nie den angemessenen Dank geerntet. Emily überlegte, ob sie die Bibel auch mitnehmen sollte, doch vielleicht fände Arlene das anmaßend, und hier war sie ohnehin besser aufgehoben. Emily hatte alle möglichen Horrorgeschichten über Sachen gehört, die in Krankenhäusern verschwanden.
Sie durchsuchte Arlenes Kommodenschubladen nach einem BH, Unterwäsche und einem Paar Socken. Ihr Morgenrock und ihre Hausschuhe waren im Wandschrank, zusammen mit Dutzenden von Hutschachteln aus vergangenen Jahrzehnten, und obschon Emily versucht war herumzuschnüffeln, wusste sie, wie aufgebracht sie selbst wäre, wenn Arlene in ihren Sachen kramen würde, und schloss die Tür. Im Bad sammelte sie die Toilettenartikel ein und packte sie in einen Dopp-Kulturbeutel mit Monogramm.
Die Fischfütterung war einfach. Sie hob den Deckel an, streute drei Prisen übelriechender Flocken hinein und beobachtete, wie sie sich auf dem Wasser ausbreiteten.
«Na los, fresst», sagte sie, weil die Fische anfangs kein Interesse zeigten. Erst als sie den Deckel wieder geschlossen hatte und einen Schritt zurückgetreten war, tauchten sie auf und küssten die Wasseroberfläche. Als die Flocken Feuchtigkeit aufnahmen und hinabsanken, schossen die Fische heran, um sie abzufangen und einzusaugen.
Arlene gab ihren Fischen Namen und sprach von ihnen, als hätten sie ausgeprägte Persönlichkeiten, doch Emily konnte sie nicht auseinanderhalten. Die Katzenfische waren Katzenfische und die Skalare Skalare; die übrigen waren das, was sie waren. Sie hatte immer gedacht, Arlene würde ein richtiges Haustier, wie zum Beispiel eine Katze, gefallen, aber jedes Mal, wenn sie das Thema ansprach, sagte Arlene, sie könne die Haare und Schuppen nicht ausstehen, ganz zu schweigen vom Katzenklo. Emily empfand Arlenes striktes, sauberkeitsfanatisches Bedürfnis nach totaler Kontrolle als einschränkend. So entging ihr jeglicher Spaß. Haustiere mussten hingebungsvoll und chaotisch sein, wie Rufus, jemand, den man lieben konnte und der einen trotz aller Unzulänglichkeiten ebenfalls liebte. Über die Fische konnte Emily bestenfalls sagen, dass sie dekorativ waren, nett anzusehen, aber nicht gerade die herzerwärmendsten Gefährten.
Als sie alles erledigt hatte, bestellte sie ein Taxi. «In fünf Minuten», hieß es in der Zentrale. Sie schaltete überall das Licht aus und hinterließ die Wohnung genau so, wie sie sie vorgefunden hatte.
Statt sich in die Kälte zu stellen, wartete sie im Hausflur. Nach einer Viertelstunde stieg sie wieder die Treppe hinauf und rief an, um zu fragen, warum es so lange dauerte.
«Der Fahrer ist unterwegs», versprach man ihr.
«Inzwischen könnte ich längst da sein», sagte Emily, und das stimmte.
Außerdem wollte sie Arlene einen Strauß Blumen besorgen, und der Laden im Krankenhaus war wesentlich teurer als das Giant Eagle. Sie überlegte – wenn auch nicht ernsthaft –, ob sie das Taxi abbestellen und selbst fahren sollte, doch dann musste sie eventuell im Dunkeln zurückkehren, und das wollte sie nicht riskieren.
Mit Arlene würde alles in Ordnung kommen. Inzwischen schien es ihr wieder gutzugehen, doch Emily sah ständig Arlenes Mund vor sich, sah, wie er sich, kurz bevor sie umgekippt war, bewegt und Wörter zu bilden versucht hatte – «waaah luuhh wuuh». Emily konnte sich an keinerlei Warnsignale erinnern, anders als bei Henry mit seinen Hustenanfällen. Sie hatte befürchtet, es könnte ein Schlaganfall sein, dass Arlene letztlich aus dem Mundwinkel sprechen würde wie Louise oder an den Rollstuhl gefesselt wäre wie Cat Osborn, doch im Krankenhaus war sie wieder ganz die Alte gewesen und hatte – nur teilweise entschuldigend – gewitzelt, sie habe Emily wohl einen ziemlichen Schrecken eingejagt.
Der Taurus stand am Bordstein. Die Schlüssel steckten in ihrer Tasche. Sie könnte zu Hause vorbeifahren, Rufus rauslassen und seinen Wassernapf auffüllen.
«Das ist albern», sagte sie zu den nassen Platanen.
Sie war immer noch hin und her gerissen, als das Taxi am Ende der Straße auftauchte und ihr die Entscheidung abnahm.
Auf der Fahrt stellte sie fest, dass der Taxifahrer nicht besser fuhr als sie. Sie ärgerte sich über den Zähler, und obwohl der Mann anbot, ihr mit Arlenes Sachen zu helfen, lehnte sie ab und gab ihm nur zehn Prozent Trinkgeld.
«Du bist meine Rettung», sagte Arlene überschwänglich, als hätte sie die Sahara durchquert. Sie saß von Kissen gestützt da und sah sich dieselbe Seifenoper an wie ihre Bettnachbarin, das Tablett zur Seite geschoben, der Wackelpudding unangetastet. In zehn Minuten sollte sie zu irgendeiner Untersuchung abgeholt werden.
«Du musst halb verhungert sein», sagte Arlene. «Du solltest dir was aus der Cafeteria holen.»
Damit wollte sie Emily bitten zu bleiben, als wäre sie bloß kurz vorbeigekommen, um Arlenes Sachen abzuliefern. Emily hängte ihren Mantel auf, um zu zeigen, dass sie nirgends hinwollte. Sie half ihr mit dem Morgenrock und richtete dann den Stuhl so aus, dass sie beide fernsehen konnten.
Sie setzte sich absichtlich so hin, dass sie die Verletzung an Arlenes Stirn nicht sehen konnte. Besonders beunruhigend fand sie, wie groß die Wunde war. Emily konnte sich vorstellen, dass alles heilte, doch es würde eine entstellende Narbe zurückbleiben, und sie musste wieder an Louise denken, an die langen Tage, an denen sie bis zum Ende der Besuchszeit in Erinnerungen geschwelgt und in dem kahlen Zimmer gelacht hatten, obwohl sie beide wussten, dass Louise nicht mehr nach Hause kommen würde. Sie fragte sich, ob Arlenes Versicherung eine Schönheitsoperation bezahlen würde oder ob in ihrem Alter so etwas nicht mehr in Erwägung gezogen wurde.
«Hast du eine Ahnung, wer diese Leute sind?», fragte Arlene und deutete auf den Fernseher.
«Sie tragen ziemlich viel Schminke», sagte Emily. «Besonders die Männer.»
Sie hatte Hunger, wartete aber, bis die Schwester Arlene geholt hatte, bevor sie mit dem Aufzug ins Erdgeschoss fuhr, doch letztlich fand sie ihren klebrigen Käsetoast und die lauwarme Tomatensuppe ungenießbar. Die Blumen im Geschenkartikelladen sahen lachhaft aus und hatten schon bessere Tage erlebt. Irgendwie würde sie es morgen zum Giant Eagle schaffen.
Als sie nach oben kam, war Arlene noch nicht von der Untersuchung zurück. Emily trat ans Fenster und blickte auf ihr Reich hinab. Es war kurz vor vier, und der Himmel wurde allmählich dunkler. Rufus hatte bestimmt den Abfalleimer umgekippt, um sein Missfallen zum Ausdruck zu bringen. Emily kehrte zu ihrem Stuhl zurück und sah sich auf CNN die Nachrichten an, bis sie sich wiederholten. Aus Sorge, dass etwas passiert sein könnte, machte sie das Schwesternzimmer ausfindig, doch dort konnte man ihr nichts sagen. Sie kehrte zu ihrem Stuhl zurück, ging ans Fenster und setzte sich dann wieder auf den Stuhl, diesmal, um sich die Lokalnachrichten anzusehen, doch inzwischen spielte sie in Gedanken alle schrecklichen Möglichkeiten durch und konnte sich kaum noch konzentrieren.
Als Arlene endlich wieder hereingeschoben wurde, war sie vom Beruhigungsmittel noch ganz benommen.
«Wir sollten sie jetzt schlafen lassen», sagte die Schwester und zog die Vorhänge zu.
Die Besuchszeit war um acht zu Ende. Sie empfahl Emily, nach Hause zu fahren und am nächsten Morgen wiederzukommen. «Ich denke, Sie hatten beide einen langen Tag.»
Am liebsten wäre Emily geblieben, um da zu sein, wenn Arlene aufwachte, aber die Frau hatte recht, sie war ziemlich erschöpft. Sie nahm ein Taxi, saß bedrückt im Fond und gab dem Fahrer widerwillig ein Trinkgeld.
Das Haus war dunkel, der Weg voller Pfützen. Die Sturmtür klemmte schon wieder. Kaum steckte sie im Lichtschein der Straßenlaterne den Schlüssel ins Schloss, fing Rufus an zu bellen. Als sie die Tür öffnete, drehte er sich auf dem Läufer immer wieder im Kreis, begrüßte sie mit flehentlichem Knurren und hüpfte, verzweifelt um ihre Aufmerksamkeit heischend, herum.
«Ja», sagte Emily. «Ja. Alles ganz schön aufregend.»
Die Rätsel des Gehirns
Die Ärzte fanden nicht heraus, was Arlene fehlte. Es war nichts so Offensichtliches und Unheilvolles wie ein Schlaganfall oder ein Gehirntumor. In Ermangelung eines besseren Begriffs nannten sie es eine Episode, als könnten davon noch einige folgen. In ihrem Alter, gab Emily Arlenes Erklärung telefonisch an Margaret weiter, handle es sich wahrscheinlich um eine Verkettung verschiedener kleinerer Probleme. Zunächst einmal sei sie vermutlich dehydriert gewesen, was morgens bei ihr häufig vorkomme. Die Ärzte meinten auch, dass sie an niedrigem Blutzucker leide. Sie selbst fühle sich schwach und habe Kopfschmerzen, wenn sie nichts esse, und Arlene neige wie sie dazu, Mahlzeiten auszulassen und sich mit Kaffee oder Süßigkeiten zu begnügen. Das sei eine der großen Gefahren des Alleinlebens.
«Im Sommer wirkte sie dünner», sagte Margaret.
«Und wer weiß schon, wie viel Schaden ihre Raucherei angerichtet hat. Du weißt ja, dass sie immer die Filterlosen geraucht hat. Das waren die wahren Sargnägel, diese alten Pall Malls. Ein Wunder, dass sie so lange überlebt hat. Dein Vater hat dieselbe Marke geraucht. Er hat aufgehört, als ich mit dir schwanger war, weil mir der Gestank buchstäblich auf den Magen schlug, aber er hat bestimmt gut fünfzehn Jahre geraucht. Ich bin mir sicher, sein Tod hatte etwas damit zu tun.»
«Aber sie ist doch noch frohen Mutes, oder?»
«Du kennst sie ja, sie tut so, als wäre alles in Butter. Sie sieht nicht ein, warum sie im Krankenhaus liegen muss. Da kann sie nicht rauchen, das ist ihr großes Problem. Ich hätte jedenfalls schreckliche Angst. Sie würde sich bestimmt über einen Anruf freuen.»
«Ich ruf sie an, wenn wir fertig sind. Und wie kommst du klar? Soll ich kommen und dir helfen?»
Wochenlang hatte Margaret sie bezüglich ihrer Pläne für Thanksgiving hingehalten. Doch plötzlich war sie bereit, alles stehen- und liegenzulassen, und Emily war unerklärlicherweise eifersüchtig. Mehr aus Stolz als aus Bosheit schwor sie sich, das Thema nicht anzuschneiden.
«Nett von dir, das anzubieten, aber ich finde, es ist nicht nötig. Wir hoffen, dass sie am Wochenende entlassen wird. Sie wird flüssig ernährt. Du solltest sie mal sehen, sie hängt an mehreren Monitoren. Das kostet bestimmt ein Vermögen.»
«Gib Bescheid, wenn du mich brauchst.»
«Mir geht’s gut, ich bin bloß ein bisschen aufgewühlt. Du hättest ihren Gesichtsausdruck sehen sollen. Einen Augenblick habe ich wirklich geglaubt, sie wäre tot. Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht selbst einen Herzinfarkt bekommen habe. Das Eat ’n Park hat einen schönen Blumenstrauß geschickt.»
«Wie nett von ihnen.»
«Wir sind ja auch sehr treue Gäste.»
Sie hatte es nicht als Aufforderung gemeint, dennoch fragte Margaret pflichtschuldig nach Arlenes Zimmernummer.
«So», sagte Emily, «sonst ist hier nichts Aufregendes passiert. Und was ist in euren Breiten so los?»
«Nicht besonders viel.»