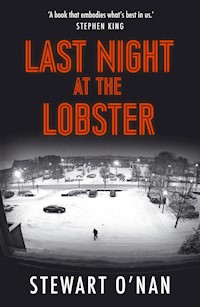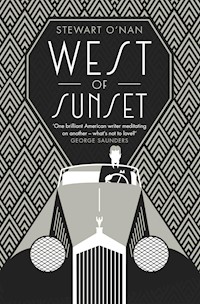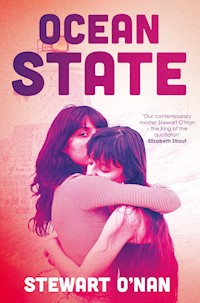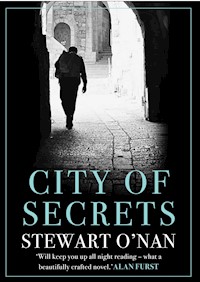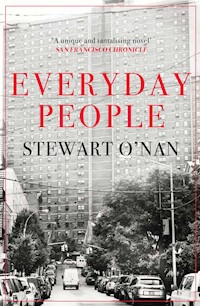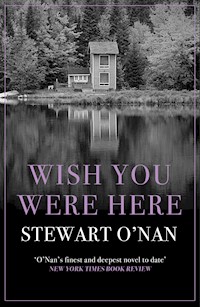10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Stewart O'Nan zeigt sich als ein Meister darin, das Leben eines gar nicht so besonderen Mannes und Ehemannes auf eine zärtliche, einfühlsame Weise zu beschreiben. Seit fast fünfzig Jahren ist Henry Maxwell verheiratet – mit Emily, die wir schon aus O'Nans hinreißendem Bestseller "Emily, allein" kennen. Da ist sie achtzig und schon Jahre verwitwet, führt in ihrem schönen, überschaubaren Routine-Universum ein ziemlich gleichförmiges Leben, allein mit Rufus, ihrem Hund. Nun hat O'Nan die Zeit zurückgedreht und Henry, dem Ehemann, ein eigenes Buch gewidmet, vielmehr ihm und Emily als Ehepaar. Die beiden leben in Pittsburgh, und ihre Kinder und Enkel sind weit entfernt. Emily kocht, und Henry macht den Abwasch, sie hält die Kontakte zu Nachbarn und Familie, und wenn sie ihm davon erzählt, hört er ihr immer gerne zu. Er steht an seiner Werkbank und repariert, was im Haus kaputt geht, trifft sich mit Freunden zum Golfen, engagiert sich im Kirchenvorstand und lädt – zu besonderen Anlässen – Emily zu Restaurantbesuchen ein. Ein mit viel Puderzucker bestreuter Zitronenkuchen macht ihn glücklich, erfüllt ihn mit Wohlwollen gegenüber der ganzen Welt. "Henry persönlich" ist das Porträt eines liebenswert-verschrobenen Mannes, der am Ende seines Lebens erkennt, dass das Alter nicht etwa eine Sackgasse, sondern voller Überraschungen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Ähnliche
Stewart O'Nan
Henry persönlich
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Über dieses Buch
Stewart O’Nan zeigt sich als ein Meister darin, das Leben eines gar nicht so besonderen Mannes und Ehemannes auf eine zärtliche, einfühlsame Weise zu beschreiben.
Seit fast fünfzig Jahren ist Henry Maxwell verheiratet – mit Emily, die wir schon aus O’Nans hinreißendem Bestseller «Emily, allein» kennen. Da ist sie achtzig und schon Jahre verwitwet, führt in ihrem schönen, überschaubaren Routine-Universum ein ziemlich gleichförmiges Leben, allein mit Rufus, ihrem Hund. Nun hat O’Nan die Zeit zurückgedreht und Henry, dem Ehemann, ein eigenes Buch gewidmet, vielmehr ihm und Emily als Ehepaar.
Die beiden leben in Pittsburgh, und ihre Kinder und Enkel sind weit entfernt. Emily kocht, und Henry macht den Abwasch, sie hält die Kontakte zu Nachbarn und Familie, und wenn sie ihm davon erzählt, hört er ihr immer gerne zu. Er steht an seiner Werkbank und repariert, was im Haus kaputtgeht, trifft sich mit Freunden zum Golfen, engagiert sich im Kirchenvorstand und lädt – zu besonderen Anlässen – Emily zu Restaurantbesuchen ein. Ein mit viel Puderzucker bestreuter Zitronenkuchen macht ihn glücklich, erfüllt ihn mit Wohlwollen gegenüber der ganzen Welt.
«Henry persönlich» ist das Porträt eines liebenswert-verschrobenen Mannes, der am Ende seines Lebens erkennt, dass das Alter nicht etwa eine Sackgasse, sondern voller Überraschungen ist.
Vita
Stewart O’Nan wurde 1961 in Pittsburgh/Pennsylvania geboren und wuchs in Boston auf. Bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete er als Flugzeugingenieur und studierte an der Cornell University Literaturwissenschaft. Für seinen Erstlingsroman «Engel im Schnee» erhielt er 1993 den William-Faulkner-Preis. Er veröffentlichte zahlreiche von der Kritik gefeierte Romane, darunter «Emily, allein» und «Die Chance», und eroberte sich eine große Leserschaft. Stewart O’Nan lebt in Pittsburgh.
Thomas Gunkel, geboren 1956, übersetzt seit 1991 Werke u. a. von Stewart O’Nan, John Cheever, William Trevor und Richard Yates. Er lebt in Schwalmstadt/Nordhessen.
Für meinen Vater und dessen Vater
Der Herbstwind
Auf seinem Weg
lässt er die Scheuche tanzen
Buson
In Memoriam
Seine Mutter gab ihm den Namen Henry, nach ihrem älteren Bruder, einem Geistlichen, der im Ersten Weltkrieg gefallen war, als könnte er dessen Platz einnehmen. Der Familiengeschichte zufolge war der tote Henry ein weichherziger Junge gewesen, ein Retter hilfloser Regenwürmer und aus dem Nest gefallener Sperlinge, was seine Berufung zum Seelenretter bereits erahnen ließ. Zweitbester Absolvent im Priesterseminar, hatte er sich freiwillig zum Felddienst in Europa gemeldet und Gedichte und Kohlezeichnungen vom Alltag in den Schützengräben nach Hause geschickt. Das Buntglasfenster in der Kirche, das einen barfüßigen Christus zeigte, mit einem eigensinnigen Lamm wie eine Stola um den Hals, war dem liebenden Angedenken an den Right Reverend Henry Leland Chase, 1893–1917, gewidmet, die pseudogotische Inschrift so kunstvoll, dass sie fast unlesbar war, und wenn sie sich sonntags nach vorn zu ihrer Kirchenbank begaben, neigte seine Mutter jedes Mal beim Vorübergehen den Kopf, als wollte sie die Frömmigkeit seines Onkels nochmals betonen. Als kleiner Junge glaubte Henry, der edle Tote liege dort begraben und modere unter dem kalten Steinfußboden der Calvary Episcopal Church, wie in den mittelalterlichen Kathedralen Europas, in spinnwebverhangenen Katakomben, wo auch er selbst eines Tages liegen würde.
Mit acht Jahren wurde Henry von seiner Mutter als Messdiener angemeldet, eine Aufgabe, zu der er sich nicht berufen fühlte, und in der gewichtigen Stille und bei den schwülstigen Liedern pulte er in seinen weiten Ärmeln an den Fingernägeln, besorgt, er könnte sein Stichwort verpassen. In seinen Albträumen erschien er in Baseballausrüstung, mit klackenden Stollenschuhen, zu spät zur Prozession, wenn die heilige Versammlung den Gang entlangdefilierte. Das Kreuz war schwer, und er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um mit dem Messingstab die große Osterkerze anzuzünden. Beerdigungen waren am schlimmsten, sie fanden samstagnachmittags statt, wenn sich all seine Freunde hinten im Park in ihrem geheimen Clubhaus trafen. Die trauernde Familie drängte sich neben dem Sarg und betete mit Pater McNulty für die Seelenruhe des geliebten Menschen, doch kaum waren die Kerzen gelöscht und der Gottesdienst vorbei, hatte der Bestattungsunternehmer das Sagen und kommandierte die Sargträger herum wie Bedienstete, während sie den Sarg die Stufen hinunterschleppten und in den Leichenwagen schoben. Immer wieder stellte sich Henry den Onkel vor, wie er, die Nase nur wenige Zentimeter vom geschlossenen Deckel entfernt, in einem Zug die bombenzernarbten französischen Felder durchquerte oder im dunklen Laderaum eines Schiffes mit dünner Stahlhaut durchs kalte Wasser glitt. Es hieß, er habe so viele Freunde und Bekannte gehabt, dass der Totenbesuch – im Wohnzimmer seiner Großeltern, wo seine Schwester Arlene ihm «Heart and Soul» auf dem Baldwin-Klavier beibrachte – drei Tage und Nächte gedauert hatte.
Arlene wurde nach Arlene Connelly benannt, der Lieblingssängerin seiner Mutter, was Henry ungerecht fand.
In Gesellschaft nannte seine Mutter ihn stets Henry Maxwell und seinen Onkel Henry Chase, um Verwechslungen vorzubeugen. Auf diese Unterscheidung verzichtete ihr Zweig der Familie und taufte ihn Little Henry.
Henry machte zwar nie großes Getue, aber ein selbstgewählter Spitzname, etwas Raues, Männliches wie Hank oder Huck, wäre ihm lieber gewesen. Er empfand «Little Henry» als ein Unglück, und in ungestörten Momenten, wenn er auf der Werkbank seines Vaters im Keller nach einer Rolle Drachenschnur kramte, sich an einem Regentag in der Abstellkammer unterm Dach vor Arlene versteckte oder nach Mitternacht mit einem stibitzten Gebäckstück die Hintertreppe hinaufstieg, fühlte er sich von einem Geist überwacht, weder wohlgesinnt noch böswillig, eher eine stille Erscheinung, die jeden seiner Schritte wie ein Richter zur Kenntnis nahm. Seine Mutter erzählte nie genau, wie sein Onkel gestorben war, und es blieb Henry überlassen, sich mit der düsteren Phantasie eines Kindes vorzustellen, dass eine deutsche Granate den Soldaten wie eine Stoffpuppe blitzartig durch die Luft geschleudert und seine Glieder auf verkratertes Niemandsland gestreut hatte, ja dass der eine Arm in Stacheldrahtgeflecht verheddert und die Hand noch um ein kleines goldenes Kreuz geklammert war.
Auf der Kommode seiner Mutter stand in einem Silberrahmen mit Fingerabdrücken und umringt von anderen, uninteressanteren Verwandten aus der Zeit vor Henrys Geburt ein verblasstes Foto ihres Bruders auf dem Steg in Chautauqua. Voller Stolz hielt er einen glitzernden Muskellunge hoch. Jedes Mal, wenn Henry ins Schlafzimmer seiner Eltern schlich, um über dieses Bild zu grübeln, als wäre es der Schlüssel zu seiner Zukunft, sagte er sich, dass der Fisch genau wie sein Onkel längst tot war, wohingegen Haus und Steg noch immer am Seeufer standen und sie jeden Sommer wie ein Bühnenbild erwarteten. Wie beides genau zusammenhing, wusste er nicht, nur dass er sich beim Betrachten des jungen und glücklichen, noch nicht zum Geistlichen ernannten Henry Chase irgendwie schuldig fühlte, als hätte er ihm etwas gestohlen.
Ahnentafel
Die Pittsburgher Maxwells – es gab keinerlei Verbindung zur Automarke oder zur Kaffeefirma – stammten aus den Mooren North Yorkshires und waren rings um Skelton am zahlreichsten gewesen. Ursprünglich Schafhirten oder Pachtbauern, zogen ihre Nachfahren nach Unterzeichnung der Magna Carta in das eigentliche Dorf, wurden zunächst Zunftgenossen und dann Kaufleute, und einer von ihnen, John Lee Maxwell, war schließlich als Steuereintreiber und Diakon in der anglikanischen Kirche tätig. Mehrere Generationen später segelte ein furchtloser oder vielleicht in Ungnade gefallener Spross dieser Abstammungslinie, John White Maxwell, auf der Godspeed nach Jamestown in der Kolonie Virginia, wo er die vierzehnjährige Susanna Goode zur Frau nahm. All das ergab sich aus einer von einem pensionierten Apotheker aus Olathe, Kansas, namens Arthur Maxwell erstellten Ahnentafel, von der Emily, deren AOL-Adresse in der Woche von Thanksgiving einer Massenmail hinzugefügt worden war, unbesehen zwei Exemplare als Weihnachtsgeschenke für ihre beiden erwachsenen Kinder Margaret und Kenny erstand. Anstelle von ledergebundenen Goldschnittausgaben mit Erinnerungswert trafen, mehrere Tage nachdem die Kinder die Enkelkinder und so viele Essensreste, wie Emily ihnen aufdrängen konnte, eingepackt hatten und geflüchtet waren, mit der normalen Post in einem zerdrückten Amazon-Karton zwei vollgestopfte Ringordner mit lächerlichen Fotokopien ein, in denen es von Druck- und Sachfehlern wimmelte, darunter auch das falsche Todesjahr seines Onkels.
Henry beging den Fehler zu lachen.
«Freut mich, dass du es witzig findest», sagte Emily. «Ich hab dafür ziemlich viel Geld bezahlt.»
«Wie teuer waren die?»
«Spielt keine Rolle. Ich hol’s mir zurück.»
Er bezweifelte, dass das möglich war, nickte aber bedächtig. «Wenn das alles hier stimmt, ist es faszinierend. Hier steht, wir waren Pferdediebe.»
«Ich bin damit unzufrieden. Es sollte ein besonderes Geschenk sein. Inzwischen ist es sowieso zu spät. Im Moment denke ich, ich sollte es einfach zurückschicken.»
Sie waren fast fünfzig Jahre verheiratet, doch noch immer musste er den männlichen Drang unterdrücken, ihr zu erklären, wie die Welt funktionierte. Zugleich würde sie eine allzu schnelle Zustimmung als Beschwichtigung ansehen, ein noch schlimmeres Vergehen, und so entschied er sich, wie so oft in Angelegenheiten von geringer Bedeutung, für die ungefährlichste Reaktion und schwieg.
«Und?», fragte sie. «Hast du gar keine Meinung?»
Er hatte vergessen: Indifferenz war nicht erlaubt.
«Ich finde es interessant. Behalten wir doch ein Exemplar für uns.»
«Also wirklich», sagte sie, die Hand auf der Stelle, die sie gerade las. «Das hätte ich auch selbst gekonnt. Ich schicke ihm eine E-Mail.»
Die Feiertage setzten ihr zu. Es hätte nicht die Ahnentafel sein müssen, es hätte auch Rufus sein können, der sich auf den Teppich erbrach, oder eine beiläufige Bemerkung Arlenes über den Kartoffelbrei. In letzter Zeit ließen die unbedeutendsten Kleinigkeiten sie an die Decke gehen, und obwohl sie zuweilen freimütig zugab, schon immer eine Plage gewesen zu sein, ein Einzelkind, das seinen Kopf durchzusetzen wusste, befürchtete er als ihr Ehemann, dass ihre Ungeduld auf eine tiefere Frustration über das Leben und damit auch über ihre Ehe hindeutete. Im jetzigen Fall hoffte er, dass sie sich beruhigen und irgendwann einlenken würde, dass die lästige Aufgabe, die Ordner wieder einzupacken und zur Post zu bringen, schwerer wog als ihr Ärger. Ihre Launen waren vergänglich, und der Mann hatte sich offenbar viel Arbeit gemacht. Wie um das Problem zurückzustellen, räumte sie den Karton auf die Zederntruhe in Kennys früherem Zimmer, wo er im neuen Jahr noch stehen sollte (1998, unglaublich), bis sie eines Tages beim Mittagessen fragte, ob sie noch Paketklebeband hätten.
«Hast du dein Geld zurückbekommen?»
«Erst, nachdem ich ihm tausendmal auf die Nerven gegangen bin. Er hat gesagt, wir könnten die Exemplare behalten, aber das will ich nicht. Er muss begreifen, dass er so was nicht tun darf.»
«Richtig.» Also auch sein Exemplar. Er war ein Verräter, er hatte Gefallen daran gefunden, mehr über seine Cousins in Kentucky und über General Roland Pawling Maxwell, den Helden von Yorktown, herauszufinden.
«Ich wollte es dir nicht sagen, sie haben sechzig Dollar pro Stück gekostet. Für sechzig Dollar sollten sie was hermachen, aber davon kann keine Rede sein.»
«Stimmt», sagte er, aufrichtig schockiert über den Preis. Bei all ihren Unterschieden, sparsam waren sie beide.
«Es ist schade, denn es gab noch andere, die ich hätte bestellen können.»
«War eine schöne Idee.»
«Wenn du’s versuchen willst, nur zu. Ich mach das nicht noch mal.»
«Wenigstens hast du dein Geld zurück.»
Wieder hatte er das Wesentliche nicht begriffen. Sie hatte sich für die Kinder etwas Besonderes einfallen lassen, und daraus war ein Debakel geworden.
Er würde nie verstehen, warum sie sich diese Niederlagen so zu Herzen nahm. Man konnte doch nichts daran ändern.
«Tut mir leid», sagte er.
«Warum? Ist ja nicht deine Schuld. Lass mich einfach wütend sein. Dazu hab ich ein Recht.»
Er musste später noch neue Wischerblätter für den Olds besorgen. Das Postamt lag auf seinem Weg.
«Das wäre hilfreich», sagte sie. «Wenn es dir nichts ausmacht.»
Es machte ihm nichts aus, doch als er allein im Olds mit laufendem Gebläse die Highland Avenue entlangfuhr, musterte er den Karton auf dem Sitz neben ihm und runzelte die Stirn, als hätte sie ihn reingelegt.
Um ein Haar
Er hatte sein ganzes Leben in Highland Park verbracht, deshalb wäre es verzeihlich gewesen, wenn er das Stoppschild an der Bryant Street – vor mehr als zehn Jahren dort aufgestellt – als neu betrachtet hätte, aber in Wahrheit nahm er es an jenem Nachmittag gar nicht wahr. Er war noch mit dem Grund für Emilys Unzufriedenheit beschäftigt, als er bemerkte, dass vorne ein Schulbus anfuhr, groß wie ein Güterwagen, und er ihn mit voller Breitseite rammen würde, wenn er nicht stoppte. Zu spät, der Fahrer sah ihn und hupte, und erst im letzten Moment stieg Henry auf die Bremse. Die Reifen quietschten, und die Schnauze des Olds senkte sich. Der Karton flog vom Sitz, prallte gegen das Armaturenbrett und knallte auf den Boden.
Es fehlten nur ein, zwei Meter. Er hatte Glück, dass die Straße trocken war.
«Verdammt», sagte er, denn es war seine Schuld. Das Schild befand sich hinter ihm. Er hatte es nicht mal gesehen.
Der Fahrer riss die Arme in die Luft und starrte ihn wütend an.
«Tut mir leid», sagte Henry und hob die Hände zum Zeichen, dass es nicht böse gemeint war. Über ihm blickten Kinder, vielleicht noch Erstklässler, aus den Fenstern, zeigten auf ihn, schnitten Grimassen und hüpften auf ihren Sitzen wie auf Trampolinen. Er war die Attraktion. So was kam allabendlich in den Lokalnachrichten, der alte Knacker, der statt auf die Bremse aufs Gas trat und mitten in einer chemischen Reinigung landete.
Henry rechnete damit, dass der Fahrer herausspringen und ihn anbrüllen würde, doch der Bus machte die Kreuzung frei und fuhr weiter. Der nächste Wagen wartete, bis Henry abgebogen war.
Er nickte. «Danke.»
Er hätte gern beteuert, dass er ein vorsichtiger Fahrer war, anders als Emily, die nachts nichts sah und über Bordsteine bretterte, und auf der restlichen Strecke zum Postamt und danach auf dem Heimweg konzentrierte er sich, die Lippen zusammengekniffen und der Blick zu jedem Auto schießend, das aus einer Seitenstraße hervorschaute. Es war nur ein einziger Fehler, aber einer genügte schon, und er befürchtete, es könnte nicht zum ersten Mal passiert sein, er hatte es vielleicht bloß nicht gemerkt. Gegen Ende seines Lebens hatte sein Vater nicht mehr gut sehen können. Wenn sie ihn besuchten, gab es an allen vier Ecken seiner Stoßstangen Spuren von andersfarbigem Lack. Obwohl ihn die Polizei mehrmals wegen zu langsamen Fahrens angehalten hatte, weigerte er sich, den Führerschein abzugeben. Nach dem Tod seines Vaters öffnete Henry die Garage von dessen Eigentumswohnung und entdeckte, dass die gesamte Front des Cutlass eingedrückt war, als hätte er eine Mauer gerammt.
Sein Vater hatte ihm im Park das Fahren beigebracht, auf der kurvigen Straße rings um den See. «Je größer der Abstand zwischen dir und dem Vordermann, umso besser», hatte sein Vater gesagt. «Man weiß nie, was er anstellt. Am besten hältst du dich so weit wie möglich von ihm entfernt.» Henry hatte diese Weisheit an seine eigenen Kinder weitergeben wollen, doch sie glaubten, im Fahrunterricht alles Nötige gelernt zu haben. Als Jugendlicher hatte Kenny ihren Kombi am Silvesterabend auf Glatteis zu Schrott gefahren, wobei Tim Pickering sich das Bein brach, und Margaret hatte, als sie spät von einer Party nach Hause kam, einen Teil vom Zaun der Prentices demoliert, den Henry sie bezahlen ließ. Er hatte gehofft, die Unfälle würden ihnen eine Lehre sein. Doch er war sich da nicht so sicher.
An der Bryant Street hielt er diesmal vor dem Stoppschild. Als er nach Hause kam, wendete er den Olds am Ende der Einfahrt in drei Zügen, fuhr ihn rückwärts schnurgerade in die Garage, bis die Hinterreifen das Kantholz berührten, das er am Boden befestigt hatte.
Emily stand am Spülbecken und schälte Möhren.
«Wie lief’s auf dem Postamt?», fragte sie.
«Ohne Zwischenfälle.»
Erst als er die Schlüssel aufhängte, fielen ihm die Scheibenwischer ein.
Versteckspiel
Henry betrachtete seine Familie zwar nie als reich, aber ihr Haus in der Mellon Street hatte, wie viele der um die Jahrhundertwende in Highland Park errichteten Häuser, Buntglasfenster auf den Treppenabsätzen und in den Dienstbotenzimmern unterm Dach. Als er geboren wurde, gab es keine Dienstboten mehr, und die zweite Etage wurde als Abstellfläche genutzt, Gas- und Wasseranschluss waren gekappt, sodass die Fensterscheiben im Winter innen mit Reif überzogen waren. Dort, inmitten der verstaubten Stubenwagen und aufgerollten Teppiche, der ausrangierten Lampenschirme und abgelegten Kleidungsstücke aus den wilden Zwanzigern, spielten er und Arlene Vater-Mutter-Kind und taten so, als würden sie in der Küche Mahlzeiten zubereiten oder in der Wanne ein Bad nehmen. Als Erstgeborene regierte Queen Arlene nach göttlichem Recht. Je nach ihrer Lust und Laune waren sie Mutter und Baby, Lehrerin und Schüler oder Mann und Frau (das schloss Umarmungen und ernste Gespräche an einem imaginären Esstisch ein), und manchmal spielten sie ein Spiel, bei dem sie das Dienstmädchen und er der Butler war, und übernahmen so in aller Unschuld die Rollen der früheren Zimmerbewohner. Egal, um welches Szenario es sich handelte, irgendwann verlor Henry das Interesse, und Arlene musste ihn besänftigen, indem sie sich auf sein Lieblingsspiel einließ, Verstecken.
Er versteckte sich gern, denn das konnte er gut. Wenn Arlene in der Schule war und es nichts zu tun gab, übte er allein, zwängte sich in Überseekoffer und geflochtene Wäschekörbe, kauerte in der moderigen Finsternis und lauschte seinem Herzschlag und den wuselnden Mäusen. Wenn er den Rost herausnahm, konnte er sich sogar in den Backofen zwängen.
«Ich geb’s auf», rief Arlene aus dem Flur. «Komm raus, komm raus, wo auch immer du bist. Komm schon, Henry. Ich hab doch gesagt, ich gebe auf.»
Er wartete, bis sie nach unten ging, ehe er wieder zum Vorschein kam. Er hütete sich, seine besten Verstecke preiszugeben.
Wenn er Arlene suchen musste, war sie sehr berechenbar, zu ungeduldig. Sie versteckte sich hinter Türen oder in Wandschränken und wartete bis zum letzten Moment, um schreiend hervorzuspringen. Er schlich mit angehaltenem Atem umher, die Finger vor sich zu Klauen geformt, auf einen Angriff gefasst, und trotzdem kreischte er.
Das Haus existierte noch. Seine Eltern hatten es zu lange behalten, bis in die siebziger Jahre, und es erst verkauft, nachdem sein Vater ausgeraubt und ihnen ihr Wagen gestohlen worden war. Der neue Besitzer teilte es in Wohnungen auf und machte aus dem hinteren Garten einen asphaltierten Parkplatz. Seitdem war die Veranda vermodert und ersetzt worden durch Fertigbetonstufen, die das Ganze entblößt aussehen ließen. Buntglas und Schieferdach waren verschwunden, die verzierten Giebel mit Vinyl verkleidet. Vor ein paar Jahren hatte das Haus wegen einer Zwangsversteigerung für achttausend in der Zeitung gestanden, es hatte ihn gelockt, doch in der Straße standen Crack-Häuser. In Sommernächten, wenn sie bei offenem Fenster schliefen, konnten sie vereinzelte Schüsse auf der anderen Seite von Highland hören, die wie Hammerschläge klangen. Ob am Tag oder nachts, er mied die Mellon Street, und obwohl die Grafton Street noch nicht an Wert verlor, befürchtete er, Emily und er würden irgendwann vor demselben Dilemma stehen.
«Beziehungsweise du. Denn ich bin dann tot.»
«Das ist nicht witzig», sagte sie.
Mit vierundsiebzig war er fünf Jahre älter als sie, und außerdem übergewichtig, sein Cholesterin ein Problem. Es stand außer Frage, dass er zuerst sterben würde. Als sie noch jünger waren, hatten sie Scherze darüber gemacht, was sie mit der Versicherungssumme anfangen würde. Doch jetzt schimpfte sie ihn aus.
«Ich will dich bloß vorbereiten.»
«Lass es», sagte sie. «So schnell stirbst du nicht.»
«Das weiß man nie», sagte er, «es kann jederzeit passieren», doch sie hatte sich umgedreht, das Gesicht abgewandt, gekränkt.
«Hör bitte auf.»
Er entschuldigte sich, massierte ihre Schultern und schlang von hinten die Arme um sie, ein Wink für Rufus, sich wie ein Ringrichter zwischen sie zu drängen und die Umklammerung aufzubrechen.
«Da ist jemand eifersüchtig», sagte er.
Emily griff nach ihm. «Du weißt, dass ich das nicht ausstehen kann.»
«Ich weiß.»
«Ich sorge mich um dich, und du machst dich bloß über mich lustig.»
«Das wollte ich nicht.»
«Ich glaube, du hast keine Ahnung, was du mir antust, wenn du so etwas sagst. Sonst würdest du es sein lassen.»
Er verstand ihre Sichtweise und versprach, rücksichtsvoller zu sein, doch irgendwie fühlte er sich unschuldig. War es nicht besser, über den Tod zu lachen?
Draußen wurde es langsam dunkel. Sie musste das Abendessen zubereiten und entließ ihn. Er zog sich zu seiner Werkbank im Keller zurück – genau wie sein Vater, dachte er –, wo er den Briefkasten, den Kenny und Lisa ihnen zu Weihnachten geschenkt hatten, für Chautauqua präparierte. Der alte (wer wusste schon, wie alt) war durchgerostet, von den Jahreszeiten zerfressen, und als Henry die Schablonen ausschnitt und sie auf das glatte neue Metall klebte, wurde ihm bewusst, dass der hier, genau wie das Sommerhaus, ihn überleben würde. Sein Vater war allein in seiner Eigentumswohnung in Fox Chapel gestorben, bis zum Schluss stur auf seine Unabhängigkeit beharrend, obwohl sie ihm Kennys Zimmer angeboten hatten. Beim Ausräumen der Wohnung hatte Henry auf dem Nachttisch eine dicke Biographie von Teddy Roosevelt entdeckt, mit der sein Vater fast durch war. Wie zum Gedenken hatte Henry das Buch, statt es auf den Stapel für den Ramschverkauf der Bücherei zu legen, nach Hause mitgenommen, um es zu lesen. Jetzt lag es oben irgendwo, das Lesezeichen seines Vaters immer noch an derselben Stelle.
Über ihm ging Emily durch die Küche. Du hast keine Ahnung, hatte sie ihm vorgeworfen, aber das stimmte nicht. Er war sich nicht sicher, warum er es tat. Er war nicht absichtlich grausam. Irgendwann – den exakten Zeitpunkt konnte er nicht mehr bestimmen – hatte sich der Scherz in die witzlose Wahrheit verwandelt. Das durfte er nicht vergessen, doch nach dem Vorfall neulich wusste er nicht genau, ob ihm das gelingen würde. Er hebelte die Dose Rustoleum auf, vermischte alles mit einem Stäbchen und rührte das glänzende Weiß wie Schlagsahne um, nahm einen sauberen Pinsel und beugte sich konzentriert über seine Arbeit, stützte den Arm auf der Kante der Bank ab und trug geduldig in einer dicken Farbschicht die Ziffern auf, damit sie lange hielten.
Frühlingslied
Das ganze Schuljahr hindurch nahm Arlene zweimal pro Woche Klavierunterricht am YWCA in Shadyside. An den anderen fünf Tagen übte sie, vom stetigen Ticken des Metronoms begleitet, auf dem Klavier im hinteren Wohnzimmer und arbeitete sich Seite um Seite durch ein weiteres rotes Thompson-Buch. «Spinnliedchen». «Hasche-Mann». «Träumerei». Den Höhepunkt des Jahres bildete ein Osterkonzert, zu dem sie sich kleideten wie zum Kirchgang und an dessen Ende Henry auf den Fingerzeig ihrer Mutter hin die Bühne betrat und Arlene, auch wenn ihr ein halbes Dutzend Fehler unterlaufen waren, einen Strauß rote Rosen überreichte. Als seine Mutter ihm kurz vor dem Schulanfang eines Abends beim Essen fragte, ob er Lust habe, wie seine Schwester Klavierunterricht zu nehmen, war die Frage rhetorisch gemeint. Sie hatte ihn bereits angemeldet.
Der flehende Blick zu seinem Vater zeigte ihm, dass Widerspruch zwecklos war. Wie in allen Fragen waren seine Eltern sich einig. Henrys Erziehung fiel wie die von Arlene in den Zuständigkeitsbereich seiner Mutter, und jede weitere Beschwerde würde sie ihm übelnehmen. Henry saß entrüstet vor seinem Hackbraten und gab sich geschlagen. Wie lange hatten sie das geplant?
Er gab sich alle Mühe, es geheim zu halten, denn ihm war klar, dass seine Freunde erbarmungslos sein würden, wenn sie es herausfanden. Das YWCA war, wie der Name schon sagte, eine Einrichtung für Frauen, das hieß, es war eine doppelte Schmach. Als er in das Gewand eines Messdieners geschlüpft war, hatten sie ihn schon bezichtigt, ein Kleid zu tragen. Die Beleidigung hatte einen Ringkampf ausgelöst, der damit endete, dass Chet Hubbard versehentlich Henrys Kragen zerriss. Beim Geräusch des zerreißenden Stoffs waren die sie anstachelnden Clubmitglieder totenstill geworden, als läge ein Verstoß gegen eine heilige Regel vor. Während Chet sich zu entschuldigen versuchte, inspizierte Henry den Riss – unübersehbar, irreparabel –, wohl wissend, was ihn zu Hause erwartete. Das Einzige, wovor er sich noch mehr fürchtete, als Muttersöhnchen genannt zu werden, war seine Mutter.
Jetzt betrat er eine Welt, die komplett weiblich und fremdartig war. Die Lehrerinnen am YWCA waren Studentinnen vom Frick Conservatory, überspannte junge Frauen, die aus der ganzen Welt herbeiströmten, um bei Madame LeClair zu lernen, die bei Liszt gelernt hatte, der wiederum bei Czerny gelernt hatte, der bei Beethoven persönlich gelernt hatte, eine Herkunftslinie, mit der sich seine Mutter gleichermaßen vor Verwandten und Essensgästen brüstete, als könnte Henry oder Arlene ein unentdecktes Genie sein. Um das Geld für Kost und Logis zu verdienen, halfen Madame LeClairs Studentinnen den Töchtern aus Pittsburghs aufsteigender Mittelschicht bei ihrem Spiel vom Blatt und ihrer Fingerfertigkeit und brachten sie Note um Note, Takt um Takt weiter. Bei dem Konzert erhoben sie sich, um ihre Schülerinnen vorzustellen, und setzten sich dann wieder in die erste Reihe, um die unvermeidlichen Schnitzer mit heiterer Gelassenheit zu ertragen. Sie blieben zwei, manchmal drei Jahre, bevor sie zu einem Leben auf Konzertbühnen aufbrachen und man nie wieder von ihnen hörte.
Arlenes Lehrerin Miss Herrera war zurückgekehrt, doch die von Henry war neu. Miss Friedhoffer war eine gertenschlanke Deutsche mit rotblondem Haar und einem leichten Überbiss, deren unberingte Finger anderthalb Oktaven umspannten. Sie war größer als seine Mutter, aber schlank wie ein Mädchen, was ihre Hände noch sonderbarer erscheinen ließ. Der Übungsraum war eine kleine Kammer – bloß das Klavier und an der gegenüberliegenden Wand eine mit Notenlinien versehene Tafel, kein Fenster. Miss Friedhoffer schloss die Tür und nahm neben Henry auf der Bank Platz. Zu seiner Verwirrung war sie geschminkt, ihre Wangen rosig vom Rouge. Durch ihre Körperhaltung hatte sie etwas Wachsames, wie ein strammstehender Soldat.
«Setz dich gerade hin», sagte sie und zog behutsam seine Schultern zurück. «Lockere deine Ellbogen. So, hier.»
Mit zehn war für Henry die Gesellschaft junger Frauen, ob fremdartig oder nicht, ungewohnt. Die Lehrerinnen in der Schule waren im Alter seiner Mutter oder noch älter, die Mädchen in seiner Klasse boshaft und hochnäsig. Mit ihrem Akzent und dem Lippenstift wirkte Miss Friedhoffer wie jemand aus einem Spionagefilm. Als sie über die Tasten hinweggriff, um seine Handgelenke festzuhalten, duftete sie warm und hefig, wie frisches Brot. Am Hals hatte sie ein karamellfarbenes Muttermal von der Größe einer Zehn-Cent-Münze, das wie eine riesige Sommersprosse aussah. Unter ihrer blassen Haut zuckte eine bläuliche Ader.
«Wir fangen mit dem C an», sagte sie, deutete mit dem manikürten Fingernagel darauf, und Henry gehorchte. «Gut. So. Wenn du weißt, dass hier das C ist, kann dir nichts mehr passieren. Dann weißt du immer, wo du bist.»
Sie drückte die Taste und sang: «C, C, C, C. Jetzt du. Sing mit. Gut. Jetzt gehen wir einen Ganztonschritt zum D hinauf, hier.»
Anfangs zuckte er zusammen, wenn sie seinen Rücken tätschelte, damit er sich gerade hinsetzte. Doch schon bald ahnte er es voraus und freute sich darauf, dass sie seine Fingerhaltung korrigierte. Er stellte sich vor, wie sich die Leute über ihre Hände lustig gemacht hatten, als sie in seinem Alter war. Wie ein Ritter hätte er sie am liebsten vor ihnen beschützt. Während er durch die Dur-Tonleiter stolperte, merkte er, dass sie neben ihm mitsummte und ihre Beine sich fast berührten, und als der Unterricht vorbei war und sie die nächste Schülerin hereinließ, blieb er an der Tür stehen, das steife neue Übungsheft unter den Arm geklemmt, als hätte er etwas vergessen.
«Auf Wiedersehen, Henry», sagte sie und belohnte ihn mit einem Lächeln. «Üb schön.»
«Danke», sagte er. «Mach ich.»
In der Straßenbahn dachte er, dass ihm sein Name zum allerersten Mal gefallen hatte.
«Wie war dein Unterricht?», fragte seine Mutter.
«Ganz gut.»
Später, beim Abendessen, stellte ihm sein Vater die gleiche Frage.
«War okay.»
«Seine Lehrerin ist hübsch», spottete Arlene.
«Stimmt das?» Sein Vater war amüsiert.
Henry wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Er dachte, nur er könnte Miss Friedhoffers wahre Schönheit sehen.
«Magst du sie?», fragte sein Vater.
Jede Antwort, die Henry geben konnte, würde falsch klingen. Er zuckte mit den Schultern. «Ich glaub schon.»
«Anscheinend ist sie eine Deutsche», sagte seine Mutter. Sie würde den Deutschen nie verzeihen, dass sie seinen Onkel umgebracht hatten.
«Ich bin mir sicher, dass sie in Ordnung ist», sagte sein Vater.
«Ganz bestimmt.»
Dass seine heimliche Liebe verboten war, gab seinem Verlangen eine opernhafte Schuld. Um ihr Herz zu erobern, beschloss er, ein perfekter Schüler zu sein, nur war das Üben ohne ihre inspirierende Anwesenheit eine Plackerei, und trotz allerbester Absichten hinkte er schon bald hinterher. Statt sich auf die Wonne von Miss Friedhoffers Gesellschaft zu freuen, fürchtete er, sie zu enttäuschen, und dachte sich eine Reihe von Krankheiten aus, die ihn zu einem verdächtigen Zeitpunkt befielen. Nach einem Treffen mit Miss Friedhoffer beauftragte seine Mutter Arlene, ihn zu beaufsichtigen. Jetzt kommandierte sie ihn fünf Tage in der Woche vom Sofa aus herum, während er im Wohnzimmer die eine Stunde lang übte, sah von ihrem Buch auf, wenn er zu lange verstummte, und Tag für Tag, Seite um Seite, begann er sich wie durch ein Wunder zu verbessern.
«Das ist sehr gut, Henry», sagte Miss Friedhoffer und sah ihn an. «Du siehst, was passiert, wenn du übst.»
Als sie ihm in die Augen blickte, verspürte er eine lähmende Hilflosigkeit, als könnte sie seine Gedanken lesen. Er malte sich aus, wie sie ihn in die Arme schloss und ihr warmer Duft ihn umhüllte, seine Wange an ihrer glatten Seidenbluse lag. Stattdessen befeuchtete sie die Fingerspitze und blätterte zur nächsten Seite, zu einer Übung, die seine linke Hand kräftigen sollte.
Die Wahrheit ließ sich nicht lange verbergen. Als er und Arlene an einem grauen Donnerstag im November die Straßenbahn verließen, warteten Marcus Greer und sein kleiner Bruder Shep darauf einzusteigen. Henry befand sich noch in dem entrückten Traumzustand, der ihn nach dem Unterricht ergriff, und besaß nicht die Geistesgegenwart, sein Buch zu verstecken. Der rote Umschlag war ein verräterischer Hinweis. Marcus nickte anzüglich grinsend, um ihm zu zeigen, dass er es gesehen hatte, und am nächsten Tag machte sich Henry nach einer langen, ruhelosen Nacht auf das Schlimmste gefasst. Er kam früh in der Schule an, die Klingel hatte noch nicht geläutet. Seine Freunde warteten an der üblichen Stelle auf der Treppe, neben dem Fahnenmast. Aus einem Gefühl für ausgleichende Gerechtigkeit hoffte er, Marcus würde etwas zu ihm sagen, doch noch bevor Henry bei ihnen angekommen war, rief Charlie Magnuson, der bei der Mutprobe, mit dem Fahrrad die Stufen hinunterzufahren, seine Schneidezähne eingebüßt hatte: «Hey, Mozart!»
Als seine Mutter ihn im Büro des Direktors fragte, warum er sich mit einem Freund geprügelt habe, sagte Henry die Wahrheit. «Weil ich Klavierunterricht nehmen muss.»
«Das ist keine Antwort», sagte seine Mutter.
«Ich weiß, dass du nicht gern zum Unterricht gehst», sagte sein Vater später, als sie nach dem Essen zu zweit in seinem Arbeitszimmer waren. Er saß in Hemdsärmeln an seinem Rollschreibtisch. Auf der Schreibunterlage verstreut lagen aufgerollte Baupläne für das Gebäude, an dem seine Firma in der Innenstadt arbeitete. Es gab keinen Stuhl für Henry, der wie ein Häftling dastand, die Arme seitlich am Körper. «Wir alle müssen im Leben Dinge tun, auf die wir keine Lust haben. Wir tun sie für die Menschen, die wir lieben, oder zum Wohl der Allgemeinheit. Manchmal tut man sie zu seinem eigenen Besten, ohne es in diesem Augenblick zu wissen. Gefällt es dir, jeden Tag zur Schule zu gehen?»
Henry zögerte, da er nicht genau wusste, ob er antworten sollte. «Nein.»
«Nein, aber du verstehst, dass es zu deinem Besten ist. Deine Mutter und ich wollen aus gutem Grund, dass ihr beide Unterricht nehmt, deshalb schlage ich vor, dass du das Beste draus machst.»
Henry wollte fragen, ob sein Vater je Klavierunterricht nehmen musste, doch es hatte keinen Sinn, das Ganze in die Länge zu ziehen. Er hatte gegenüber allen Beteiligten seinen Tribut entrichtet und bekommen, was er wollte. «Ja, Sir», sagte er bußfertig, schüttelte seinem Vater die Hand, um die Vereinbarung zu besiegeln, und dann war er frei.
In jenem Winter lebte er dafür, mit Miss Friedhoffer zusammen zu sein. Für die Klarheit, die sie in der Abenddämmerung dem Himmel verlieh, wenn er und Arlene auf die Straßenbahn warteten und der Abendstern in der Oberleitung gefangen war. Zu Weihnachten schenkte er ihr eine Dose Kekse, die er selbst glasiert hatte, und eine Karte mit einem selbstgezeichneten Tannenbaum, auf der Frohe Weihnachten stand. Für Fraulein Friedhoffer, hatte er in Druckschrift geschrieben. Er kannte noch immer nicht ihren Vornamen.
Für die Aufführung wählte sie Schumanns «Frühlingslied» aus, dessen beschwingtes Tempo für Henry nicht leicht zu meistern war. Zur Freude seiner Mutter übte er zusätzlich nach der Schule. Sie kam aus der Küche mit einem Geschirrtuch hereingeschlendert, stand in der Tür und lobte ihn jedes Mal, wenn er strauchelte. «Das klingt wunderbar», sagte sie, doch sie war seine Mutter. Er wusste, es war nicht gut genug. Er musste perfekt sein und versetzte das Metronom von neuem in Schwingung.
Sie hieß Sabine. Ihr Name stand im Konzertprogramm, direkt neben seinem. Sie trug zu diesem Anlass das Haar geflochten und ein schwarzes Paillettenkleid, als wollte sie selbst auftreten. Hinter der Bühne hörte er, gekleidet wie zum Kirchgang und in seine Noten vertieft, das Gemurmel des Publikums. Die jüngsten Schüler spielten zuerst. Früher hatte Henry über ihre Fehler gelacht; jetzt begriff er, wie grausam das gewesen war. Ein Mädchen verspielte sich ständig und kehrte in Tränen aufgelöst zurück. Ein anderes stockte, völlig ratlos, mitten in einer Chopin-Etüde und musste von ihrer Lehrerin gerettet werden. Als Nächstes war Henry dran.
Er hatte noch nie vor Publikum gespielt, und als Miss Friedhoffer ihre Einführung beendet hatte und er aus den Kulissen ins blendende Licht hinaustrat, erschreckte ihn der Applaus. Er verebbte, bevor Henry die Bank erreichte, nur noch seine Schritte waren zu hören. Im Dunkeln hustete jemand. In der Kirche konnte er sich hinter Pater McNulty und dem ganzen Pomp und Gepränge verstecken. Hier ruhten alle Blicke auf ihm.
Sein Notenheft raschelte, als er es auf den Ständer legte. Mechanisch richtete er sich auf und lokalisierte das eingestrichene C, lockerte die Ellbogen und Handgelenke und ließ die Hände über den Tasten schweben. Ihre Stimme im Kopf, zählte er, bevor er zu spielen begann.
Zu Hause hatte er es geschafft, nur mit ein paar kleinen Wacklern durch das ganze Stück zu gelangen, aber da hatte er das Metronom gehabt. Jetzt musste er allein den Takt halten, und auch wenn er und Miss Friedhoffer daran gearbeitet hatten, er hatte nicht ausreichend geübt. Kaum hatte er angefangen, da spürte er schon, dass seine linke Hand hinterherhinkte, und begann schneller zu spielen. Er versuchte, sich zurückzuhalten, ihr Summen heraufzubeschwören, um das Tempo zu verlangsamen, doch seine Finger schienen sich von selbst zu bewegen, als wären sie von ihm losgelöst. Von einem fernen Aussichtspunkt tief in seinem Kopf sah er sich selbst beim Spielen zu. Die Töne klangen korrekt, wenn auch überhastet, statt panischer Angst überkam ihn fassungsloses Staunen, und er trat ganz aus sich heraus, seine Gedanken wirbelten davon, hinaus ins Publikum, wo er sich Miss Friedhoffer in ihrem schwarzen Kleid und seine Eltern vorstellte, den gesamten dunklen Zuhörerraum. Er war da und zugleich nicht da. Er hörte das Klavier, leise, wie aus einem anderen Raum, obwohl es direkt vor ihm stand, sein verschwommenes Spiegelbild im polierten Lack gefangen. Sein Fuß klopfte den Takt. Seine Finger hoben und senkten sich wie von selbst und preschten durch das Stück, die vertrauten Berge und Täler. Komm zurück, sagte er sich, als könnte er es erzwingen, gerade als er bei den letzten Takten angelangt war. Er hob die Hände, und die letzten Töne gingen in Stille über. Einen Augenblick dachte er, er hätte die Orientierung verloren und an der falschen Stelle aufgehört, ja dass noch ein Refrain käme, doch dann brach das Publikum in Beifall aus. Als wäre er gerade erwacht, wandte er sich um und sah Miss Friedhoffer nicken und ihm zulächeln. Er hatte es geschafft. Es war ihm unmöglich erschienen, und trotzdem hatte es geklappt. In seiner Erleichterung vergaß er, sich zu verbeugen, und verschwand direkt nach hinten in die Kulissen, wo Arlene bei den älteren Mädchen darauf wartete, dass sie an die Reihe kam.
«Glück gehabt», sagte sie.
Er widersprach nicht. Er wusste, dass es stimmte.
Sie selbst hatte weniger Glück, dennoch überreichte ihre Mutter ihnen beiden Rosen.
Anschließend fand in der Turnhalle ein Empfang mit Punsch und Keksen statt. Dort belohnte ihn, stellte er sich tagträumend vor, Miss Friedhoffer mit einem Kuss. Stattdessen überreichte sie ihm eine Urkunde und ein neues Heft, mit dem er im Lauf des Sommers üben sollte. Auf den Umschlag hatte sie in ihrer perfekten Handschrift seinen Namen geschrieben. Wochen später, als ihm der September noch unglaublich weit weg vorkam, zeichnete er die Schwünge mit dem Finger nach und erinnerte sich, wie ihre Hände seine geführt hatten.
Wieder schwor er sich zu üben, doch sobald die Ferien angefangen hatten, verbrachte er den ganzen Tag im Park. Im August waren sie in Chautauqua, wo es kein Klavier gab, und selbst Arlene geriet in Verzug. Er hatte sich damit abgefunden, Miss Friedhoffer zu enttäuschen, als ihm seine Mutter eine Woche vor Schulbeginn plötzlich sagte, er bekomme eine neue Lehrerin.
Miss Friedhoffer war nach Deutschland zurückgekehrt. Mehr als das wussten sie nicht.
Er würde in Zukunft bei Miss Segeti aus Ungarn Unterricht haben, in die er sich in seinem Kummer, unfreiwillig, ebenfalls verlieben sollte.
Auf der Highschool hatte er Flammen, die er zum Anbeten und Verzweifeln fand, und richtige Freundinnen, die ihn in schuldbeladene Wollust versetzten, doch Miss Friedhoffer vergaß er nie. Als seine Division im Krieg durch eine ausgebombte Kleinstadt im Elsass rumpelte, überrollten sie ein altes Klavier, das dann, zu Kleinholz zerschmettert, mitten auf einer Straße lag, die Tasten wie Zähne über das Kopfsteinpflaster verstreut, und da fragte er sich, was wohl aus ihr geworden war. Sie hätte inzwischen Ende dreißig sein müssen. Vielleicht war sie tot, begraben unter den Trümmern einer Kirche wie der in Metz, wo sie sich, als sie vorbeigezogen waren, wegen des Gestanks die Nasen hatten zuhalten müssen. Nachts sickerten, egal, wo ihre Kolonne hielt, Frauen ins Lager ein und gingen von Zelt zu Zelt, oft mit hohläugigen Kindern im Schlepptau. Er stellte sich vor, wie sie die Zeltklappe zurückschlug und ihn erkannte, und obwohl jeder wusste, dass es den Vorschriften der Armee zuwiderlief, beschloss er, sie irgendwie zu retten.
Als er und Emily sich nach dem Krieg kennenlernten, spielte sie im Salon ihrer Studentinnenverbindung für ihn, und ihre Haltung und ihre schmalen Finger riefen ihm den stickigen Übungsraum und den Geruch von Kreidestaub ins Gedächtnis. Er kannte die Melodie aus Dutzenden von Konzerten.
«Mendelssohn», sagte er und setzte sich neben sie auf die Bank.
«Spielst du auch?»
«Eigentlich nicht. Als Kind hatte ich mal Unterricht.»
«Jetzt bist du dran.»
«Nein, das ist schon Jahre her.»
«Bitte. Mir zuliebe.»
Er ließ die Hände über den Tasten schweben und versuchte, sich das «Frühlingslied» ins Gedächtnis zu rufen. Nach ein paar Takten zerfaserte es. Er war überrascht, dass er sich überhaupt noch daran erinnerte.
«Nicht aufhören», sagte sie und setzte ein, wo er unterbrochen hatte, so langsam, dass er mitspielen konnte. Er hatte ihr nie davon erzählt, wie also sollte sie wissen, als er ihren Hals küsste, was sie zu einem Ende gebracht hatte?
Eines Morgens kurz nach dem Überfahren des Stoppschilds hockte er auf allen vieren in der Küche, den Kopf unters Spülbecken getaucht, und versuchte, den Fettfang abzumontieren, als plötzlich aus dem Radio im Wohnzimmer die vertrauten ersten Töne des Schumann-Stücks herüberdrangen. Er legte den Schraubenschlüssel hin, zog sich an der Küchentheke hoch und wollte es Emily erzählen, doch ihr Sessel war leer. Rufus, neben dem Kamin zusammengerollt, hob kurz den Kopf und ließ ihn dann wieder sinken.
Das Klavier stand in der Ecke, gekrönt vom alten Metronom seiner Mutter aus der Mellon Street. Weder Margaret noch Kenny hatten den Unterricht zu schätzen gewusst, und irgendwann hatte Emily die Streitereien mit den beiden sattgehabt. Zu Weihnachten hämmerten die Enkelkinder darauf herum, aber den Rest des Jahres stand es, abgesehen von Bettys Staubwischen alle vierzehn Tage, unbehelligt da.
Wie lange war es her, dass sie zusammen darauf gespielt hatten? Damals sangen sie immer Duette. Button up your overcoat, when the wind is free. Take good care of yourself, you belong to me. Auf ihren Partys versammelten sich alle um das Klavier und schmetterten alte Lieblingslieder. Das war vor Ewigkeiten, als die Kinder noch klein waren. Doch die Nachbarschaft hatte sich verändert. Gene Alford war tot, Don Miller und auch Doug Pickering. Von der alten Gang war er der letzte Überlebende.
Er hob den Deckel an und klappte ihn mit einem Klacken zurück, enthüllte die Tastatur, zog die Bank hervor und setzte sich aufrecht hin. Rufus kam, um sich das Ganze anzuschauen.
«Mal sehen, was der alte Bursche noch so draufhat.»
Er streckte die verkrumpelten Finger, sammelte sich und spielte die ersten Takte. Immer noch da, nach all den Jahren. Ihm fiel noch mehr ein, und er spielte weiter, erstaunt über sein Gedächtnis. Miss Friedhoffer wäre stolz.
Mit dem Wäschekorb auf dem Weg nach unten, blieb Emily wie vom Blitz getroffen stehen, und beide drehten sich zu ihr um. «Was in aller Welt machst du da?»
«Üben», sagte er.
Ist das nicht romantisch?
Für den Valentinstag wählte er eins ihrer alten Lieblingsrestaurants aus, das Tin Angel. Auf dem Mount Washington thronend, über den Abgrund kragend, bot es einen Ansichtskartenblick auf die Landspitze und ein Prix-fixe-Menü mit Filet Mignon und Mousse au Chocolat. «Sieh mal einer an», sagte Emily. «Schwer elegant.» Sie gingen kaum noch woanders hin als in den Club, und sie ergriff die Chance, um vorher zum Friseur zu gehen und den Pelz auszulüften. Sie würde ihn brauchen. Die gefühlte Temperatur lag weit unter null. Sie waren spät dran, und Henry sollte Rufus nach draußen lassen und ihm seinen Hundekuchen geben. Er nutzte die Gelegenheit und ließ den Olds warm laufen. Im Scheinwerferlicht funkelte der verharschte Schnee. Emily zog klugerweise ihre Stiefel an und nahm die Stöckelschuhe mit. Eine frische Schneedecke machte die Steinplatten tückisch, und er bot ihr seinen Arm an.
Die Highland Avenue war von Reifenspuren durchzogen, die Ampeln schaukelten im Wind. Die Brücken würden heikel sein. Er würde langsam fahren müssen und möglichst nicht bremsen. Wenn sie zu spät kamen, dann war es halt so.
Als sie den Bigelow Boulevard entlangrollten, sagte Emily: «Ich frage mich, wie es Margaret geht.»
Ihr Name war ein Alarmsignal. Er konzentrierte sich auf die Straße.
«Ich muss sie anrufen. Ich glaube, Weihnachten ist nicht so gut gelaufen.»
Sein erster Gedanke war – ungerechtfertigt –, dass sie wieder trank. «Wann hast du mit ihr gesprochen?»
«Letzten Mittwoch, als du beim Zahnarzt warst. Sie und Jeff kommen nicht klar.»
«Das ist doch nichts Neues.»
«Immer dasselbe. Er will, dass sie einen Entzug macht.»
«Und sie will nicht.»
«Sie sagt, sie hat erst im Herbst eine Kur gemacht.»
Davon wusste er nichts. «Und er findet, sie soll noch eine machen.»
Im Dunkeln konnte er ihr Gesicht nicht sehen. So ließ es sich einfacher reden, körperlos, kühl und unbeteiligt, als ließen sich Margarets Probleme durch Logik lösen.
«Ich weiß nicht», sagte Emily. «Ich habe das Gefühl, nicht die ganze Geschichte zu kennen.»
«Vielleicht könnten wir Jeff eine E-Mail schreiben.»
«Das dürfte nicht hilfreich sein. Sie würde denken, dass wir seine Partei ergreifen. Ich muss sie einfach mal anrufen. Ich habe es immer hinausgeschoben, weil ich eigentlich keine Lust dazu habe. Ist das nicht schrecklich?»
Nein, hätte er am liebsten gesagt, schrecklich ist bloß, wie sie dich behandelt, aber darüber hatten sie schon zu oft gestritten. Er würde stets verlieren. Er sollte sich schämen, dass er Margaret nicht verzeihen konnte; als hätten sie die ganzen Jahre ihr Unrecht getan und nicht umgekehrt.
«Ich finde, du bist sehr geduldig mit ihr.»
«Das glaube ich nicht», sagte Emily. «Aber trotzdem danke. Ich wollte dir nicht die Laune verderben, es ging mir bloß durch den Kopf. Ich mache mir Sorgen um sie.»
«Das weiß ich.»
Er wartete darauf, dass sie weitersprach. Auch wenn er es nie zugeben würde, er redete gern so mit ihr, hörte gern, wie sie sich über Familienmitglieder und Freunde – sogar über Margaret – ausließ, als weihte sie ihn in Geheimnisse ein. Sie wusste alles über ihre Nachbarn und jeden im Club, war über deren Leben auf dem Laufenden, als wären sie Figuren aus ihrer Lieblingsseifenoper. Sie wusste mehr über das, was in der Gemeinde vorging, als er, obwohl er dem Kirchenvorstand angehörte. Erst heute hatte er ein Telefongespräch mit Louise Pickering belauscht, bei dem Emily spekuliert hatte, ob Kay Miller wohl das Haus verkaufte. Er war ein zurückhaltender Mensch, doch ihr Tratsch faszinierte ihn. Es war auch beruhigend zu wissen, dass sie meistens übereinstimmten. Im Lauf ihrer Ehe war ihm klargeworden, dass er, vielleicht willentlich, kaum etwas von den Kämpfen anderer ahnte, nicht mal derer, die ihm besonders nahestanden, und auch wenn er Emily mitunter vorwarf, vom großen Ganzen nichts zu verstehen, ohne sie wüsste er gar nichts.
«Sie wird keine Entziehungskur machen», sagte Emily. «Sie sagt nein, und dann trennen sie sich. Genau das befürchte ich.»
«Du meinst, er sucht einen Vorwand?»
«Ich schätze, es gäbe viele, wenn er einen braucht. Viele Männer hätten sich nicht so viel bieten lassen wie er.»
«Ich auch nicht.»
«Du hast es leicht. Deine Frau ist perfekt.»
«Verrat’s ihr nicht. Sonst steigt es ihr noch zu Kopf.»
«Zu spät. Ehrlich gesagt, ich glaube, er ist nur noch wegen der Kinder da. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.»
«Für Margaret oder für beide?»
«Vielleicht muss er sie verlassen. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, dass sich was ändert.»
Diese Aussicht machte ihn sprachlos. Sie würde die Kinder und das Haus verlieren und wieder bei ihnen wohnen. Er sah es vor sich, wie sie hinter geschlossener Tür in ihrem alten Zimmer hauste und im Bademantel zum Essen herunterkam.
«Tut mir leid. Ich hätte nicht davon anfangen sollen.»
«Nein», sagte er. «Gut, dass du’s getan hast.»
«Ich verspreche, es nicht mehr zu erwähnen.» Sie hob die Hand wie zum Schwur.
«Bis morgen.»
«Bis morgen.»
Mit surrender Heizung glitten sie durch die Innenstadt und zur Fort Pitt Bridge hinauf. Die Fahrbahn war glasiert.
«Auf dem Fluss schwimmt Eis», sagte sie, doch er wechselte gerade die Spur und konnte nicht hinschauen.
Sie fuhren auf einen verschneiten Parkplatz am Fuß der Standseilbahn – eine weitere Überraschung für Emily. Es war ein alter Lieblingsort. Aus der Provinz nach Pittsburgh verpflanzt, war sie der Seilbahn genauso verfallen wie der Stadt und Henry.
«Du bist närrisch», sagte sie.
«Ich hab gedacht, wo wir schon mal hier sind …»
Er suchte einen Platz in der Nähe der Treppe.
«Ich weiß nicht, ob ich in diesen Schuhen so weit gehen kann», sagte sie.
«Behalt einfach die Stiefel an.»
«Ich betrete das Tin Angel nicht in meinen schäbigen alten Stiefeln, danke. Du musst mich tragen.»
Er entschied sich für die beste Alternative und schlurfte über den festgefahrenen Schnee, während sie bei ihm eingehakt war.
Zu seinem Entsetzen wartete bereits ein anderes Paar – jung und wettergerecht gekleidet. Er hatte gehofft, er und Emily würden allein sein, als hätte er wie ein Industriemogul eine Privatkabine bestellt. Er überlegte, ob sie auf die nächste warten sollten, doch Emily bibberte. Schließlich kam die Bahn – leer –, und sie fuhren aufwärts, machten eine Kurve und blickten auf die dampfende Stadt hinab, auf den Verkehr auf der Brücke und die Lichter der Wolkenkratzer, die sich im dunklen Wasser spiegelten. Eisschollen trieben flussabwärts, in Richtung Cincinnati, Cairo, St. Louis. Auf halber Strecke begegneten sie der anderen Kabine, die nach unten glitt. Er beugte sich zu Emily hinüber, um einen Kuss zu erhaschen, und sie hielt ihm die Wange hin und tätschelte seinen Arm, als wäre es ein Versprechen.
In der Grandview Avenue war vor den Restaurants alles vollgestopft mit Autos, und die Leute vom Parkservice liefen zwischen Parkplatz und Straße hin und her. Er hatte an das Le Pont gedacht, wo sie ihren fünfundzwanzigsten Hochzeitstag gefeiert hatten, aber bei ihrem letzten Besuch waren sie beide vom Essen enttäuscht gewesen. Überraschenderweise war es geschlossen, die Fenster mit weißem Packpapier abgeklebt.
«Wann ist das denn passiert?», fragte er.
«Schon vor Monaten. Ich hab’s dir gesagt. Es kam in den Nachrichten.»
«Man sollte meinen, dass jemand an den Räumlichkeiten interessiert ist.»
«Sie verlangen bestimmt ein Vermögen dafür.»
Im Tin Angel war es warm und laut. In der Bar spielte ein Pianist, vor sich ein Glas voller Trinkgeld, mit leichter Hand «Anything Goes». Ihr Fensterplatz erwartete sie. Neben einer flackernden Votivkerze stand in einer kristallenen Langhalsvase eine einzelne rote Rose. Die Empfangsdame führte Emily zu dem Platz mit Blick auf die Stadt, während Henry auf den Ohio hinunterblickte. Wirbelnder Schnee trieb im Dunkeln, schwebte wie Bodensatz. Er konnte den donutförmigen Betonklotz des Three River Stadium am North Shore erkennen und daneben, undeutlicher, das Skelett vom neuen Zuhause der Steelers.
Als Erstes brachte der Kellner beiden ein Glas Champagner.
Henry prostete Emily zu. «Auf uns.»
«Auf uns. Mmm, gut. Du weißt, dass all das nicht nötig gewesen wäre.»
«Kommt nicht in Frage, dass du am Valentinstag kochst.»
«Wir hätten einfach in den Club gehen können.»
«Da gehen wir ständig hin.»
«Dafür bin ich auch dankbar. Ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen.»
«Da sind wir schon zwei.»
Sie stießen an und tranken, aber nach dem Gespräch im Wagen arbeitete es noch in ihm. Hatten Margaret und Jeff einfach Pech gehabt und passten nicht zueinander? Das konnte doch nicht alles sein. In einer Ehe ging es um Ausgeglichenheit, darum, sich zu ergänzen. Er fragte sich, was die beiden an diesem Abend wohl machten, und ungebeten wie eine Heimsuchung sah er plötzlich Arlene vor sich, wie sie in ihrer Wohnung vor dem Fernseher saß. Hatte sie ebenfalls Pech gehabt? War sie unglücklich, wie er manchmal befürchtete, oder war sie allein glücklicher, und er bedauerte sie zu Unrecht?
Da es ein Prix-fixe-Menü war, brauchten sie nichts zu bestellen. Ihr Krabbencocktail kam, die Tierchen waren speichenförmig um den Rand eines Martiniglases drapiert. Trotz des Prilosec würde der Meerrettich in der Cocktailsoße ihm später Magenprobleme bereiten, doch einstweilen genoss er jeden einzelnen aromatischen Bissen.
Als er sein zweites Glas Champagner zur Hälfte geleert hatte und zu «Night and Day» mit dem Kopf wippte, sah er plötzlich im Fenster sein Spiegelbild, seinen gespenstischen Zwilling, der über dem Abgrund schwebte.
«Da draußen tobt ein Schneesturm», sagte Emily. «Merkst du, wie kalt es ist?»
«Der Wind ist stärker geworden.»
«Wir sollten einfach hier übernachten.»
«Ich frage mich, ob’s hier Brunch gibt.»
Ihr Filet war perfekt – außen dunkel, innen rot –, und wieder beglückwünschte er sich, das richtige Restaurant ausgesucht zu haben. Ringsum feierten andere unbeschwerte Paare und stießen auf ihr Glück an. Er leerte sein Glas. Der letzte Schluck war herb, geradezu sauer, und er dachte an Margaret, die sich nicht mal an einem solchen Tag ein Tröpfchen gönnen durfte.
Weihnachten war nicht gut gelaufen. Was bedeutete das? Er hatte sie und Jeff kabbeln, aber nie offen streiten gehört. Als Jugendliche hatte sie oft unschöne Szenen am Esstisch gemacht und einen Streit vom Zaun gebrochen, der zu einem Brüllduell ausuferte, dann hatte sie ihren Stuhl zurückgestoßen und war nach oben gerannt, hatte Emily in Tränen aufgelöst und ihn und Kenny verwirrt zurückgelassen. Jetzt, angeblich nüchtern, war sie am Telefon reizbar und kurz angebunden, verstummte schnell, wenn sie ausgefragt wurde. Nach allem, was Emily gelesen hatte, vermutete sie, dass Margaret manisch-depressiv war, eine Diagnose, die, ob sie nun stimmte oder nicht, kein großer Trost war. Henry fand, dass sie versagt hatten. Er bedauerte Jeff, als hätten sie ihn warnen sollen.
«Ich würde das wirklich gern aufessen», sagte Emily, «aber dann schaffe ich keinen Nachtisch mehr.»
«Nimm’s mit für morgen Mittag», sagte er.
Er hätte zu seiner Mousse au Chocolat gern einen Cognac getrunken, bestellte aber verantwortungsbewusst einen Kaffee.
«Ich fürchte, das gehört nicht zur Diät», sagte sie.
«Das gilt auch für alles andere.»
«Ich erzähle Dr. Runco nichts davon, wenn du’s auch nicht tust.»
«Abgemacht.»
Zusammen mit der Rechnung brachte der Kellner die Reste für Emily, wie dort üblich verpackt in Aluminiumfolie, die zu einem Schwan geformt war.
«Das erinnert mich an England», sagte sie. In London hatte man ihr schon einmal so ein Ding mitgegeben, und im Taxi hatte es auf ihren guten Mantel getropft. Diesmal inspizierte sie es genau und sah nach, ob die Tischdecke schon befleckt war. «Man kann nicht vorsichtig genug sein.»
«Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste», sagte er.
«Danke, es war wunderbar.»
«War wirklich schön, oder?»
«Kannst du noch fahren?»
«Ja.»
Das Garderobenmädchen half Emily in ihren Pelz und hielt ihnen beiden die Tür auf. «Seien Sie vorsichtig, draußen ist es glatt.»
Die geparkten Autos waren schneebedeckt, aber auf dem Gehsteig war Salz gestreut – bis auf das vernachlässigte Stück vor dem Le Pont. Er trug den Schwan, während Emily sich an seinem Arm festhielt und sie im Wind die Köpfe einzogen.
«Tut mir leid», sagte sie stöckelnd. «Ich hätte die Stiefel mitnehmen sollen.»
«So weit ist es ja nicht.»
In der Station war es still und warm. Abgesehen von dem Mann am Kartenschalter und dem Ingenieur in seinem erhöhten Kontrollraum war es menschenleer. Die Bahn war gerade losgefahren, und ihr Dach verschwand aus dem Licht der Scheinwerfer. Während Emily das Durcheinander historischer Fotos an den Wänden betrachtete, sah er sich das Zahnrad an, von dem das Kabel ablief, und ihm fiel wieder ein, wie er sich am College mit Seilzugproblemen beschäftigt hatte, mit den entgegengesetzten Pfeilen der Diagramme. σ1 = σ2 + σ3. Die Standseilbahn war eine simple Maschine, die schon vor der Geburt seines Vaters in Betrieb gewesen war und noch lange nach seinem und Emilys Tod Touristen auf den Mount Washington befördern würde. Während er auf den Schnee hinausschaute, versuchte er, sich die Stadt von damals vorzustellen, die Hüttenwerke und Eisenbahnbrücken, die belebten Rangierbahnhöfe auf der Landspitze. Die Firma seines Vaters hatte im Gulf Building die elektrischen Leitungen verlegt, jahrzehntelang das höchste Gebäude der Stadt, bis, lange nach dem Ausscheiden seines Vaters, das U. S. Steel Building errichtet wurde. Im Laufe seines eigenen Lebens war die Skyline so unübersichtlich geworden, dass er nicht mehr wusste, was sich in jedem Gebäude befand, und während er darauf wartete, dass die andere Kabine aus der Dunkelheit auftauchte, musste er sich wieder mal des Gefühls erwehren, der Vergangenheit anzugehören.
«Ist sie bald da?», fragte Emily.
«Sie kommt schon.» Zum Beweis deutete er auf das Rad.
«Hoffentlich, denn ich muss mal.»
«Da gibt es eine Toilette.»
«Hier geh ich nicht.»
Als die Kabine schließlich eintraf, war sie leer. Sie setzten sich in eine Ecke, schmiegten sich aneinander gegen die plötzliche Kälte. Er war überzeugt, dass im letzten Moment noch ein anderes Paar hereinplatzen würde, doch der Warnton ertönte, und die Tür schloss sich. Das Glöckchen klingelte zweimal, und als hätte man sie losgeschnitten, ging es ruckelnd abwärts.
Er schloss die Augen, während sie sich küssten, hatte das Gefühl zu fallen.
Sie lachte. «Deshalb also wolltest du die Standseilbahn nehmen.»
«Kannst du dich an unsere erste Fahrt erinnern?»
«Ich weiß noch, dass du ein perfekter Gentleman warst.»
«Vielleicht nicht perfekt.»
«Du wirst gleich voll mit Lippenstift sein.»
«Das hoffe ich.»
Unten ließ er sie an der Treppe warten, während er den Wagen holte. Der Parkplatz war nicht geräumt, und als er über den festgefahrenen Schnee eilte, glitt er aus. Er fuchtelte mit den Armen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, und der Schwan flog durch die Luft. Henry landete hart auf dem Hintern, und seine Brille verrutschte.
«Alles in Ordnung?», rief Emily.
«Ja», sagte er, doch ihm tat das Steißbein weh. Vielleicht hatte er sich das Knie verstaucht. Er stand auf und überprüfte es. «Nichts gebrochen.»
«Sei vorsichtig.»
«Danke.»
Der Hals des Schwans war verkrümmt. Er bog ihn zurecht und ging wieder los, vorgebeugt wie ein Schlittschuhläufer, sich an den geparkten Autos abstützend, um zum Olds zu gelangen. Emily wartete, deshalb schaltete er Scheibenwischer und Gebläse an und fuhr zu ihr, bevor er die Scheinwerfer und die anderen Fenster freikratzte. Er hatte sich eindeutig am Knie verletzt.
«Bist du dir sicher, dass alles in Ordnung ist?», fragte Emily. «Es sah aus, als hättest du dich verletzt.»
«Nur meinen Stolz.»
«Sei froh, dass du dir nicht die Hüfte gebrochen hast.»
Seit Audrey Swanson nach einem Sturz an einem Blutgerinnsel gestorben war, war das Emilys Schreckgespenst.
«Wenn die Deutschen mich nicht umbringen konnten, schafft das auch ein kleiner Sturz nicht.»
«Ich mach mir keine Sorgen wegen der gottverdammten Deutschen», sagte sie. «Ich mach mir Sorgen um dich.»
Er rollte im Schneckentempo über die Brücke. Ein Schneepflug fuhr mit klirrenden Ketten an ihnen vorbei, und der Schild schob eine brechende Schneewelle vor sich her. Am Heck war ein Streugerät befestigt, das Asche verteilte.
«Wie fährt es sich?»
«Nicht besonders gut.»
Auf dem Bigelow Boulevard mussten sie wegen eines Unfalls langsamer fahren, ein holzverkleideter Kleinbus wie der von Margaret hing auf der Mittelleitplanke. Die Polizei hatte Leuchtfackeln aufgestellt, die alles in rosafarbenes Licht tauchten. Als sie vorbeischlichen, befürchtete Henry, dass sie zu Hause den Berg nicht schaffen würden.
«Schaffen wir’s den Berg rauf?», fragte Emily.
«Genau das hab ich mich auch gerade gefragt.»
«Genau deshalb sind wir verheiratet. Beide Pessimisten.»
«Stimmt», gestand er.
«Ich muss immer noch aufs Klo.»
«Soll ich irgendwo halten?»
«Ich will bloß nach Hause.»
Wegen eines weiteren Unfalls war die Bloomfield Bridge gesperrt. Zwei Streifenwagen standen mit kreisendem Blaulicht Schnauze an Schnauze, um die Straße zu blockieren.
Die Umleitung führte den Verkehr durch Oakland. Emily half ihm, sich zurechtzufinden.
«Sieht nicht so schlimm aus», sagte sie über die Baum Boulevard Bridge.
Auch die Highland Avenue war in gutem Zustand, doch sie passten jetzt beide auf, und es gab keine richtige Gelegenheit für ein Gespräch. Das ewige Margaret-Problem musste warten.
Als sie in die Grafton Street bogen, rechnete er mit einer Eisbahn und war überrascht zu sehen, dass die Straße geräumt war. Er war fast enttäuscht, als hätten sie eine Herausforderung verpasst. Die Einfahrt war freigeschaufelt – ohne Zweifel John Cole, der ihn vor einem Herzinfarkt bewahrte. Das Garagentor öffnete sich, und Henry fuhr den Olds vorwärts hinein, Stück für Stück, bis die Vorderreifen an das Kantholz stießen.
«Also», sagte Emily, «das war ja ziemlich aufregend.» Sie belohnte ihn, wie immer nach einer abendlichen Unternehmung, mit einem flüchtigen Kuss.
«Willst du deine Stiefel nicht anziehen?»
«Das lohnt sich doch nicht mehr.»
Er widersprach nicht. Sie wartete, bis er ihr über die Steinplatten half. Sein Knie war vom Sitzen ganz steif, und er war froh, langsam gehen zu können. Drinnen bellte Rufus ununterbrochen, als wären sie Einbrecher.
«Sei still», sagte Henry und ging mit einer Hand seine Schlüssel durch. «Wir sind’s doch bloß.»
«Schließ die Tür auf», sagte Emily. «Sonst mach ich mir in die Hose.»
Er stellte den Schwan auf die Hollywoodschaukel, um Emily ins Haus zu lassen, und Rufus stürmte an ihm vorbei, hockte sich in den Schnee und blickte die ganze Zeit über die Schulter. Es war zu kalt, auch für ihn. Sobald er fertig war, kam er wieder hereingeflitzt und rannte hinter Emily her die Treppe hoch.
«Ja», sagte Henry, «du hast mir auch gefehlt», und schaltete den Strahler aus.
Er stellte den Schwan in den Kühlschrank und hängte seinen Mantel auf. Jetzt, wo sie wieder zu Hause waren, spürte er, wie die Nähe des Miteinanderausgehens verblasste. Er wollte einen Scotch und rief nach Emily, um zu fragen, ob auch sie Lust auf einen Drink hatte.
«Ein Gläschen Portwein wär schön, danke.»
Als er ihr an der Anrichte den Portwein eingoss, musste er an Margaret und die Vorstellung von Glück und Zufriedenheit denken. Wie viel im Leben war Zufall, und wie viel war Arbeit, und ganz praktisch betrachtet, was sollten sie tun?
Er stellte Emilys Glas neben ihren Sessel und entfachte ein Feuer, dessen Flammen im Luftzug flackerten. Er trat an den Kaminsims und wärmte sich. Seine Hose war an den Knien feucht, zwei dunkle Flecke. Das Knie selbst war schmerzempfindlich und leicht geschwollen. Er würde es später kühlen.
Rufus kam als Erster nach unten und sah jeden ihrer Schritte voraus. Sie trug wieder ihren Pullover und hatte ihr Buch dabei. Henry, noch immer in Jackett und Krawatte, lächelte, um seine Enttäuschung zu verbergen. Er hätte das Licht dimmen oder ganz ausschalten sollen.
«Ich schätze, du hast es noch geschafft.»
«Gerade so.»
Sie blieb am Bücherregal stehen, um QED einzustellen, und plötzlich war das Zimmer vom feierlichen Pomp eines Trompetenkonzerts erfüllt. Sobald sie Platz genommen hatte, ließ auch Rufus sich nieder und rollte sich auf dem Kaminvorleger zu ihren Füßen zusammen.
In Chautauqua waren sie, als sie noch frisch verheiratet waren, vom Schlittschuhlaufen hereingekommen und hatten am Feuer miteinander geschlafen, ohne großes Vorspiel, sie hatten einfach ihre Sachen abgestreift und waren übereinander hergefallen. Sie hatten es nicht erwarten können, allein zu sein. Er dachte, dass das immer noch galt, doch diese Phase ihres Lebens war längst vorbei.
Er hob sein Glas. «Frohen Valentinstag.»
«Frohen Valentinstag. Ich danke dir, es war herrlich.»
«Stimmt.»