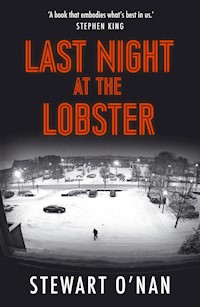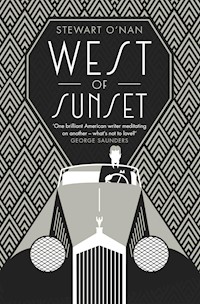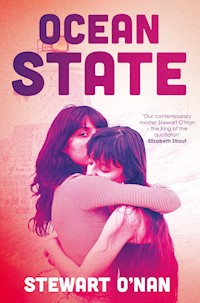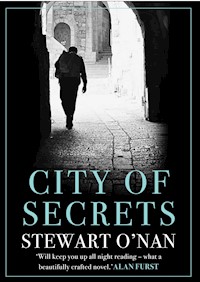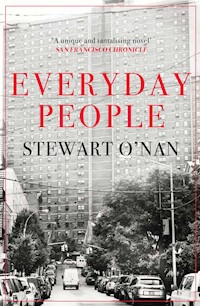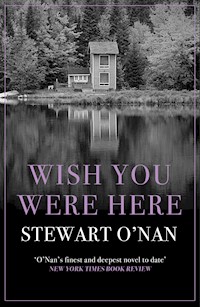10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt: Westerly, eine heruntergekommene Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel. Täterin und Opfer verband die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean State» erzählt die Vorgeschichte und die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren Schicksale in einem ebenso tragischen wie unvermeidlichen Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin bleibt Angels jüngere Schwester Marie. Stewart O'Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser Mädchen und Frauen am unteren Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über das Leben der Armen in einem System, das den Reichen dient.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Ähnliche
Stewart O′Nan
Ocean State
Roman
Über dieses Buch
Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt: Westerly, eine heruntergekommene Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel. Täterin und Opfer verband die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen.
«Ocean State» erzählt die Vorgeschichte und die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren Schicksale in einem ebenso tragischen wie unvermeidlichen Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin bleibt Angels jüngere Schwester Marie.
Stewart O’Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser Mädchen und Frauen am unteren Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über das Leben der Armen in einem System, das den Reichen dient.
Vita
Stewart O’Nan wurde 1961 in Pittsburgh/Pennsylvania geboren und wuchs in Boston auf. Bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete er als Flugzeugingenieur und studierte an der Cornell University Literaturwissenschaft. Für seinen Erstlingsroman «Engel im Schnee» erhielt er 1993 den William-Faulkner-Preis. Er veröffentlichte zahlreiche von der Kritik gefeierte Romane, darunter «Emily, allein» und «Die Chance», und eroberte sich in seiner Heimat wie im deutschsprachigen Raum eine große Leserschaft. Stewart O’Nan lebt in Pittsburgh.
Thomas Gunkel, 1956 in Treysa geboren, arbeitete mehrere Jahre als Erzieher. Nach seinem Studium der Germanistik und Geografie in Marburg begann er, englischsprachige literarische Werke ins Deutsche zu übertragen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören u.a. Larry Brown, John Cheever, William Trevor und Richard Yates. Thomas Gunkel lebt und arbeitet in Gilserberg (Hessen).
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «Ocean State» bei Grove Press, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Ocean State» Copyright © 2022 by Stewart O'Nan
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Roman wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung HANDKE + NEU/plainpicture
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01147-2
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Angel Olsen
Hi-Five.
Sometimes our enemies
are closer than we think
ANGEL OLSEN
Shut up kiss me hold me tight
ANGEL OLSEN
Im Haus bei der Line & Twine
Als ich im achten Schuljahr war, half meine Schwester dabei, ein anderes Mädchen zu töten. Sie sei verliebt gewesen, sagte meine Mutter, als wäre das eine Entschuldigung. Sie habe nicht gewusst, was sie tat. Ich war damals noch nie verliebt gewesen, nicht richtig, deshalb wusste ich nicht, was meine Mutter meinte, aber inzwischen weiß ich es.
Das Ganze spielte sich in Ashaway, Rhode Island, ab, in der Nähe von Westerly, unten am Strand. In jenem Herbst wohnten wir in einem Haus am Fluss, auf der anderen Straßenseite von der Garn- und Schnur-Fabrik, in der meine Großmutter meinen Großvater kennengelernt hatte. Die Line & Twine war geschlossen, überall hingen rostige BETRETEN VERBOTEN-Schilder, doch direkt oberhalb vom Wehr hatte jemand mit einem Bolzenschneider ein Loch in den Zaun geschnitten, sodass man von hinten reinschleichen konnte. Wir liefen in den Gängen zwischen den verstaubten Webstühlen immer Rollschuh, Angel fuhr Schlangenlinien und brachte mir Crossovers und Rückwärtsfahren bei. Sie konnte Pirouetten drehen wie eine Eiskunstläuferin, wobei ihre Hände Figuren in die Luft malten. Auch ich wollte Pirouetten drehen und elegant sein, so wie sie, doch ich war ein pummeliger Trampel, und wenn ich in der Kirche neben ihr stand, war ich unsichtbar. Meine Mutter sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, ich würde mein spezielles Talent schon noch entdecken. «Ich war eine Spätentwicklerin», sagte sie, als ob das ein Trost sein könnte. Und was, wenn ich kein spezielles Talent habe, wollte ich fragen. Was, wenn ich bloß eine hoffnungslose Streberin bleibe?
Das Talent meiner Mutter bestand darin, jedes Mal einen neuen Verehrer zu finden und eine neue Bleibe für uns. Sie arbeitete als Hilfspflegerin im Elms, einem Altersheim in Westerly, in dem meine Großtante Mildred lebte, und verdiente so gut wie nichts. Wenn sie freitags nach Hause kam, zog sie sich um, bürstete ihr Haar aus, schminkte sich und benutzte zu viel Parfüm. Sie war Cheerleaderin gewesen und konnte gut tanzen. Sie hielt Diät oder versuchte es wenigstens. Wenn sie vor dem schmalen Spiegel an ihrem Wandschrank stand, beklagte sie sich, dass ihr nichts mehr passte. «Ich hab mal so ausgesehen wie du», sagte sie zu Angel, als wäre es eine Drohung, und es stimmte, auf ihren alten Fotos hätte man sie für Angels Zwillingsschwester halten können. Hätte sie es gewollt, sagte sie, hätte sie einen Arzt geheiratet, aber die waren alle Arschlöcher. «Euer Vater war lieb.»
Wir wussten, dass unser Vater lieb war. Wir wussten aber nicht, wann oder warum er sich in ein Arschloch verwandelt hatte. Meine Großmutter hatte ihn nie leiden können, weil er aus einer portugiesischen Familie stammte. Er hatte meine Mutter überredet, katholisch zu werden, und sie dann verlassen. Vertrau nie einem Portugiesen, sagte sie, als wäre es ein Witz. Ich hatte sein dunkles Haar und seine dunklen Augen, wozu machte mich das dann?
Die Verehrer meiner Mutter bemühten sich, lieb zu sein, doch es waren Fremde. Manchmal bezahlten sie unsere Miete, und manchmal teilten wir sie uns. Wenn sie mit meiner Mutter Schluss machten – urplötzlich, in betrunkenem Zustand, das Gebrüll der beiden riss uns aus dem Schlaf –, mussten wir wieder umziehen. Genau wie unsere Mutter strampelten wir uns ab, dass es gut lief, weit über jedes vertretbare Maß hinaus. Unser Vater war weg, und unsere Mutter konnte nicht aufhören, verliebt sein zu wollen. «Ich schwöre, das ist das letzte Mal», sagte sie, wenn sie stocknüchtern war, und einen Monat später kam sie mit einem weiteren Versager nach Hause. Die wurden anscheinend immer jünger und gammeliger, was Angel für ein schlechtes Zeichen hielt. Meiner Mutter schien das nicht aufzufallen. Am Anfang war immer alles neu. Sie verlor an Gewicht, küsste uns zu oft und gab Versprechen, die sie nicht halten konnte.
Der Letzte war ein Matrose namens Wes gewesen, der Hummer mit nach Hause brachte, meine Mutter «Care» nannte und uns zum Fahrradfahren nach Block Island mitnahm, bis er eines Nachts ihr Telefon zertrümmerte, als sie seinetwegen die Polizei verständigen wollte. Weder er noch sie waren verletzt, deshalb brachten die Polizisten keinen von beiden vor Gericht. «Ihr Cops seid nutzlos», sagte meine Mutter. «Ja», entgegnete einer von ihnen, «deshalb sind wir um ein Uhr früh ja auch hergekommen, denn wir haben nichts Besseres zu tun.» Wir wohnten im oberen Stockwerk eines Zweifamilienhauses, und am nächsten Morgen, als Wes zum Fischen draußen im Sund war, schleppten wir drei alles, was wir tragen konnten, die Treppe runter und stopften es in den Wagen meiner Mutter.
Das Haus bei der Line & Twine stand zum Verkauf, aber 2009 wollte es niemand haben. Meine Großmutter hatte bei den Besitzern, Winterflüchtlingen, die lange vor dem Bankenkrach nach Florida gezogen waren, in der Buchhaltung gearbeitet. Wie die meisten Häuser an der River Road stand es schon jahrelang leer. Auf den Schindeln wuchs Moos und in den Dachrinnen Unkraut.
Meine Großmutter kam vorbei, um uns beim Putzen der Küche zu helfen. Sie brachte ihre Gummihandschuhe mit. «Nicht gerade das Taj Mahal», sagte sie.
«Es ist schon in Ordnung», sagte meine Mutter, als würden wir nicht lange dort wohnen. «Angel Lynn. Zieh nicht so ein Gesicht.»
«Ich hab doch gar nichts gesagt», erwiderte sie mit finsterem Blick.
«Das ist auch nicht nötig.»
Ich sagte nichts. Ich sagte fast nie etwas, aus Angst, alles noch schlimmer zu machen. Ich beobachtete die beiden wie eine Punktrichterin und vermerkte im Stillen alle Kränkungen und Beleidigungen, jeden vergeblichen Versuch, nett zu sein. Ich war dreizehn und hatte wie alle Kinder einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich wollte, dass alle glücklich waren, unserem wirklichen Leben zum Trotz.
In dem Zweifamilienhaus hatten Angel und ich uns ein Zimmer geteilt. Hier hatten wir beide ein eigenes und konnten die Tür hinter uns zumachen. Wenn ich im Bett lag, fehlte es mir, dass sie sich, noch lange nachdem ich aufgehört hatte zu lesen, mit ihren Freunden Nachrichten schrieb, das Leuchten auf ihrem konzentrierten Gesicht hatte etwas Beruhigendes wie ein Nachtlicht. Insgeheim wünschte ich mir, dass ich mich, sobald ich auf die Highschool käme, in sie verwandeln und ihre Stärken erben würde, nicht nur ihr Aussehen und ihre Bestimmtheit, sondern auch das Selbstvertrauen, das sie so anziehend machte, das Wissen, dass, egal, was passierte, sie immer begehrt sein würde. Jetzt, ohne sie, im Dunkeln, die Straße still, hinter der Line & Twine der über das Wehr plätschernde Fluss, kam mir dieser Traum noch unerreichbarer vor.
Unser Vater hatte uns nicht gänzlich verlassen. Er kam noch immer vorbei, um etwa die Klingel zu reparieren oder den verstopften Abfluss der Dusche mit einer Spirale freizubekommen, was wegen unserer langen Haare ein ständiges Problem war. Wir waren jedes zweite Wochenende bei ihm, und dann nahm er uns mit zum Brandungsangeln und ließ uns am Strand seinen Pick-up fahren. Die Sommergäste waren verschwunden, die Villen, um deren Gärten er sich kümmerte, für den Rest des Jahres verriegelt, die spitzen Eisentore zugekettet. Die Muschelbuden und Del’s-Lemonade-Stände hatten geschlossen, und am Ende fuhren wir zum Mittagessen in die Stadt zu One Fish Two Fish, einem Schnellimbiss in einem früheren Burger King, wo wir immer gegessen hatten, als wir noch klein waren. Dort gab es noch die ursprünglichen gelborangen Resopaltische, an den Kanten ramponiert und schmutzig, jedes verstreute Salzkorn deutlich zu sehen. Wir hatten einander nicht viel zu sagen, als befürchteten wir, Geheimnisse preiszugeben, die sich gegen uns verwenden ließen. Meistens sprachen wir über die Schule und Angels Job bei CVS. Er hatte eine Wohnung in Pawcatuck, über einem chinesischen Restaurant, sodass es überall nach verbranntem Speiseöl stank. Um das Schlafsofa von Bob’s auszuziehen, das er extra für uns gekauft hatte, musste er die schwere Seemannskiste wegschieben, die er als Couchtisch benutzte, und jedes Mal waren da dieselben ausgebleichten Arielle-Bettlaken, obwohl wir aus dem Meerjungfrau-Alter längst raus waren. Sonntags schliefen wir lange, während meine Mutter und Großmutter in der Kirche waren, und er machte uns Waffeln, ein weiteres Überbleibsel aus unserer Kindheit, und danach lieferte er uns wieder zu Hause ab. In unserer Einfahrt gab er jeder von uns einen Zwanziger, bevor er uns aussteigen ließ, als handelte es sich um ein Trinkgeld. Für unsere Mutter hatte er manchmal einen Scheck und manchmal auch nicht, je nachdem, wie die Geschäfte liefen. Sie stritten sich bitterlich wegen des Geldes, was uns alle verlegen machte, und es war ein gutes Wochenende, wenn er die gesamte Summe parat hatte. Ich blieb immer auf der Veranda, um ihm noch mal zuzuwinken, während unsere Mutter und Angel schon ins Haus gingen.
«Wie war’s?», fragte unsere Mutter. «Was habt ihr alles gemacht?»
«Nichts», sagten wir. «Das Übliche.»
Sie zeigte kein wirkliches Interesse, und wir suchten bereits nach Hinweisen darauf, wie sie das Wochenende verbracht hatte, schnupperten nach dem Geruch von Gras oder Körperspray, kontrollierten die Aschenbecher auf Zigarettenstummel, die Wertstofftonne auf zusätzliche Bierflaschen.
Eines Sonntags fand Angel unterm Nachttisch unserer Mutter den Zipfel einer Kondomverpackung. Sie zeigte ihn mir auf der geöffneten Hand, als wäre er ein Beweisstück.
«Na und?» Ich tat so, als würde mir der Gedanke keine Angst machen, dass ein weiterer Fremder von unserem Zuhause Besitz ergriff.
«Also fickt sie irgendwen.»
«Was du nicht sagst.»
«Wahrscheinlich war sie stockbesoffen. Wahrscheinlich kannte sie den Kerl nicht mal. Das ekelt mich richtig an. Sie ist so eine Schlampe.»
Ich wollte unsere Mutter verteidigen. Sie war einsam und wusste nicht, was sie anderes tun sollte. «Wenigstens ist er nicht mehr hier.»
«Wart’s nur ab», sagte Angel, und sie hatte recht.
Am nächsten Freitag kündigte unsere Mutter an, dass Russ kommen und sie abholen werde. Er war Feuerwehrmann, besaß aber auch eine Landschaftsgärtnerei. Wir erwarteten, dass er einen Pick-up fuhr wie unser Vater, doch der Wagen, der vor dem Haus hielt, war ein mickriger silberner Honda wie der von unserer Großmutter. Russ war kleiner als unsere Mutter und kahlköpfig, er hatte eine dicke Bifokalbrille, einen graumelierten Bart und einen Bauch, der sich über seinen Gürtel wölbte. Statt Röhrenjeans und Motorradstiefeln trug er eine waldgrüne Cordhose und braune Halbschuhe. An seinem Finger prangte ein klobiger Jahrgangsring, und er schüttelte uns schlaff die Hand, wie Reverend Ochs nach dem Gottesdienst. Unsere Mutter betonte, dass sie essen gehen und sich danach einen Film im Stonington Regal ansehen würden, als hätten sie sich nicht in einer Bar kennengelernt.
«Schräg», sagte Angel, als wir die beiden davonfahren sahen.
«Ja.»
«Er sieht aus wie Papa Schlumpf.»
«Das ist fies», sagte ich.
«O Carol, ich will meinen Schlumpf in deinen Schlumpf stecken. Ich schlumpfe dich richtig schlumpfig durch.»
Ich schlug ihr auf die Schulter, und wir lachten und sprangen uns an wie zwei Sportkameradinnen.
«O mein Gott», sagte sie. «Was, wenn er der Auserwählte ist?»
«Hör auf.»
«Eigentlich ist es traurig. Als hätte sie kapituliert.»
«So schlimm ist er nun auch nicht», sagte ich, denn ich dachte, sie meinte es immer noch witzig, aber als ich sie ansah, wischte sie sich die Tränen weg.
«Ange, na komm schon.»
Sie kehrte mir den Rücken zu, damit ich es nicht sehen konnte, und griff nach einem Papiertaschentuch, um sich zu schnäuzen. Sie konnte es nicht ausstehen zu weinen, da sie glaubte, sie würde sich eine Blöße geben, doch sie brach ständig in Tränen aus. «Das ist so abgefuckt. Sie macht alles bloß noch schlimmer. Man macht einen Fehler, man bringt ihn in Ordnung, man begeht ihn nicht wieder, verstehst du?»
«Ja», sagte ich, aber ich war zu ängstlich, um zuzugeben, dass ich nicht mehr wusste, worüber wir redeten. Vermutlich über ihren Freund Myles, denn normalerweise wäre Angel bei ihm, wären die beiden eingesponnen in ihre eigene kleine Welt. Als ich schließlich verstand, was sie gemeint hatte, war es zu spät.
Das Mädchen, bei deren Tod meine Schwester die Finger im Spiel hatte, hieß Birdy Alves. In den Nachrichten wurde sie Beatriz genannt, doch in der Schule nannten alle sie Birdy. Sie spielte Fußball und Softball und arbeitete im D’Angelo in der Granite Street. Sie war zierlich, hatte große Augen und ein herzförmiges Gesicht. Wie Angel war sie beliebt, aber sie kam aus Hopkinton und gehörte einer anderen Clique an.
Um Halloween herum verschwand Birdy Alves. Wochenlang suchte der ganze Bundesstaat nach ihr. Jeden Abend sahen wir ihr Gesicht in den Nachrichten aus Providence. «Sollten Sie irgendwelche Informationen haben», hieß es da, «rufen Sie bitte die Polizei in Hopkinton an.»
Ich liebte meine Schwester. Ich wollte nicht glauben, dass sie mich anlügen würde. Auch jetzt will ich noch glauben, dass sie in jener Nacht, in der unsere Mutter mit dem Feuerwehrmann Russ ausging, versuchte, die Wahrheit zu sagen, dass sie mich davor warnen wollte, so zu werden wie sie. Vielleicht war es so. Noch war nichts passiert. Später würde die Polizei alles mit einem Datum verknüpfen, doch vorerst waren wir zwei Mädchen, die nirgends hinkonnten, an einem Freitagabend allein im Haus. Wir machten Popcorn, kuschelten uns bei ausgeschaltetem Licht auf dem Sofa unter eine Decke und sahen uns Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel an, einen der Lieblingsfilme meiner Mutter, hatten die Füße bei der anderen auf dem Schoß und reichten die Schüssel hin und her. Sie war Julia Roberts, ich Lili Taylor. Es spielte keine Rolle, dass sie die Hälfte der Zeit mit ihrem Telefon beschäftigt war. Wir mussten nicht sprechen. Ich wollte ihr auf diese Weise bloß nahe sein, wollte, dass wir beide an denselben Stellen lachten. Sie war die Einzige, die wusste, was wir beide durchgemacht hatten, und ich mochte es, mir vorzustellen, dass wir unzertrennlich waren, dass uns nicht nur Blutsbande zusammenhielten. Wir waren nicht glücklich in jenem Herbst, in jenem verrottenden überschuldeten Haus, mit allem, was wir bereits verloren hatten, und allem, was uns noch bevorstand, aber während ich warm und geborgen unter der Decke meiner Großmutter lag, Popcorn aß und verstohlene Blicke auf meine witzige, schöne Schwester warf, auf deren Gesicht das Licht spielte, wünschte ich mir, wir könnten dort für immer bleiben.
1
Am Samstag muss Birdy ihre normale Schicht arbeiten, zehn bis sechs, zumindest hat sie das allen gesagt. Als sie es ausspricht, klingt es wie ein Alibi, die Zeitangabe zu präzise, obwohl das unnötig ist. Alle kennen ihren Dienstplan.
Letzte Nacht konnte sie nicht schlafen, und das Licht im Bad ist zu grell. Im Spiegel sieht der rote Spitzen-BH, den sie sich für heute aufgespart hat, billig aus, als würde sie sich zu sehr bemühen. Sie knöpft ihre hässliche Uniform zu, bindet sich das Haar zurück, senkt das Kinn, versucht, ihrem Blick auszuweichen. Ihre Augen sind blutunterlaufen und wässrig, so will sie nicht für ihn aussehen, doch jetzt steckt sie in der Falle, ist außerstande wegzuschauen.
Was ist sie bloß für ein Mensch? Zeigt diese Frage nicht schon, dass sie ein Gewissen hat? Sie kann es nicht beantworten und lässt es auf sich beruhen. Sie wird sowieso nicht aufhören, also was soll’s? Alles geht schief. Es ist kalt und soll später regnen, ihre Tagträume, Hand in Hand mit ihm am Strand zu gehen, in den Dünen eine Decke auszubreiten und sich zu ihm zu legen, um die Wolken vorbeiziehen zu sehen, sind zerplatzt. Hinter ihr auf der Badematte räkelt sich ihre Cocker-Spaniel-Hündin Ofelia, beobachtet, wie sie sich die Zähne putzt und die Hände eincremt, steht, noch bevor sie fertig ist, auf und trottet zur Tür, wedelt mit ihrem Stummelschwanz, als könnte Birdy sie mitnehmen.
«Weg da. Ich krieg die Tür nicht auf, wenn du mir im Weg rumstehst.» Sie weiß, dass sie gemein ist, aber das macht sie nur noch ungeduldiger. Ofelia kennt doch ihre Arbeitskluft.
In ihrem Zimmer steckt sie ihr Kosmetiktäschchen in die Handtasche und sieht, dass sie noch einen einzigen Streifen Kaugummi übrig hat.
Das Ganze ist eine schlechte Idee. Sie hat sich immer für ehrlich gehalten, nicht für perfekt, aber für im Grunde ihres Herzens gut, und die Leichtigkeit, mit der sie sich in diese neue, rücksichtslose Birdy verwandelt hat, ist verwirrend, als hätte jemand anders die Kontrolle über sie übernommen. Es ist eine Art Besessenheit, eine Kraft größer als sie selbst, die sie über sich hinauswachsen lässt und zugleich hilflos macht. Es lohnt sich nicht, Hector deswegen zu verlieren, doch hier steht sie und ist sich schon selbst abhandengekommen. Manchmal interessiert sie das gar nicht. Manchmal würde sie am liebsten im Nichts verschwinden. Dieses Verlangen macht ihr Angst, genau wie ihr Verlangen nach Myles, das rätselhaft und zugleich überwältigend ist.
Unten näht ihre Mutter im Wintergarten Babykleidung für Birdys neugeborene Nichte Luz und singt, wie früher ihre Großmutter, einen alten Fado vor sich hin. Mein Freund, ich verlass dich nur ungern. Die Nähmaschine rattert, bleibt stehen, rattert wieder. Wenn sie sich bloß rausschleichen könnte, ohne ihrer Mutter gegenüberzutreten, denkt sie, aber die Treppe, die Tür, das ganze Haus knarrt. Ofelia, das miese Stück, läuft vor ihr her und verrät sie. Vor jeder einzelnen Stufe muss Birdy überlegen, als hätte sie vergessen, wie man eine Treppe runtergeht.
Die Nähmaschine rattert, während sie ihre bauschige Winterjacke anzieht. Sie könnte gehen, einfach einen Fluchtversuch unternehmen, doch sie steht mit ihren Schlüsseln in der Hand da und wartet, bis die Nadel zum Stillstand kommt.
«Ich gehe», ruft sie.
Mit einem Scharren steht ihre Mutter vom Stuhl auf, kommt auf ihren schlimmen Knien herübergewankt, um sie zu verabschieden, und als sie das Esszimmer durchquert, klirren im Geschirrschrank die Wassergläser. Ihre Mutter ist der klügste Mensch, den sie kennt, eingespielt auf die Stimmungen der ganzen Familie. Sie wusste, dass Josefina mit Luz schwanger war, noch bevor Josefina es wusste. Auch jetzt ist sich Birdy sicher, dass sie Bescheid weiß, umarmt sie zu fest und nimmt demonstrativ ihren blöden Sonnenschild vom Haken. Alles, was sie tut, ist verlogen.
«Zum Abendessen gibt’s Hackfleischbällchen. Ich dachte, ich verarbeite das Hamburgerfleisch, bevor es schlecht wird.»
«Gute Idee.»
«Kannst du auf dem Heimweg ein Stück Parmesan besorgen?»
«Klar», sagt sie, obwohl sie weiß, dass sie nicht daran denken wird. Sie müsste sich von ihrem Telefon daran erinnern lassen.
Draußen ist der Himmel heller, als sie erwartet hat, und das Licht versucht, durch die Wolken zu brechen. Im Auto empfindet sie es als Erleichterung, die Sonnenbrille aufzusetzen, als könnte sie sich dahinter verstecken, aber da ist sie noch, im Spiegel, augenlos, außerirdisch. Sie könnte eine Attentäterin aus der Zukunft sein, die kaltblütig ihren Auftrag ausführt, doch sie kann ihre Gedanken nicht stoppen. Im Radio reißt der DJ einen Witz über den Regen, quatscht in den Anfang von Rihannas «Umbrella» rein, und sie schaltet es aus. Als Myles ihr eine Textnachricht schickte, in der er fragte, was sie am Samstag mache, warf sie die Hände in die Luft und tanzte durchs Zimmer, als hätte sie etwas gewonnen. Jetzt muss sie sich bewusst machen, dass die Leute so was ständig tun. Sie ist nichts Besonderes.
Sie fährt, als wäre sie unterwegs zur Arbeit, durch Ashaway, wo Hector schon im Liquor Depot zugange ist. Hier darf man nur vierzig fahren, es wird geblitzt, um den Strandverkehr von der I-95 abzugreifen. Sie will nicht angehalten werden und drosselt das Tempo, als sie am Parkplatz vorbeifährt, in der Hoffnung, dass Hector sie sieht, als Beweis ihrer Unschuld. Sie blickt sich nach seinem Charger mit den teuren Felgen um – sicher geparkt auf der anderen Seite, wo niemand den Lack zerkratzen kann. Als sie noch nicht lange zusammen waren, kam er immer mittags vorbei und nannte ihr seine Bestellung, bis sie ihm irgendwann sagte, das möge sie nicht.
«Was? Ich finde, in deiner Uniform siehst du hübsch aus.»
«Ich sehe nicht hübsch aus, also lass es bleiben, okay? Das meine ich ernst.»
«Okay», sagte er enttäuscht, als wäre sie eine Spaßverderberin. In letzter Zeit gibt Hector ihr das Gefühl, knauserig zu sein, als würde sie ihn wegstoßen, wenn er sie an sich drücken will. Er sagt, er liebt sie. Er will sie irgendwann heiraten, ein Haus voll Kinder haben wie Kelvim und Josefina. Ständig will er irgendwas haben, das sie ihm gar nicht geben will. Wie soll sie erklären, dass sie kaum noch an ihn denkt? Er hört sowieso nie zu. Myles bittet sie, Geschichten von sich zu erzählen, und achtet auf jedes Wort.
Hinter dem Postamt des Ortes wechselt das Tempolimit, jetzt wieder fünfundsechzig, und der ölschwarze Fluss blitzt zwischen den Bäumen hervor, schäumt über niedrige Wehre. Sie ist schon tausendmal an der langen Fabrik und dem Granitwerk mit den ungeschliffenen Grabsteinen vorbeigefahren, warum fallen sie ihr dann heute auf? Es liegt nicht nur an ihrer Stimmung, es ist eine schauerliche Jahreszeit. Das Laub verfärbt sich, bald ist Halloween. Auf der Arbeit haben sie schon dekoriert, das vordere Fenster mit Spinnennetzen aus hauchdünner Baumwolle behängt. Sie stellt sich vor, dort zu sein, sich auf den Mittagsandrang vorzubereiten, die Türen verschlossen, ihre größte Sorge, dass Sandra die Schneidemaschine blockiert.
Sie hat Mr. Futterman erzählt, sie müsse zu einer Hochzeit, um eine Cousine zu schminken. Sie wusste, er würde nichts dagegen haben. Sie nimmt sich sonst nie an Samstagen frei, und die Tagschicht lässt sich problemlos besetzen.
Normalerweise würde sie auf der 3 nach Westerly reinfahren. Jetzt blickt sie in den Rückspiegel, bevor sie den Blinker setzt, um auf die Umgehungsstraße einzubiegen, als würde irgendwer sie verfolgen – nur ein Roto-Rooter-Lieferwagen, der an ihr vorbeirauscht, als sie abbremst und die Auffahrt nimmt. Die Umgehungsstraße ist in beiden Richtungen einspurig, geteilt durch eine Betonschutzwand. Auch außerhalb der Saison herrscht dort dichter Verkehr. Sie fädelt sich hinter einem Pick-up ein, als plötzlich die ersten Regentropfen die Windschutzscheibe sprenkeln.
«Länger warten ging nicht, was?» Sie setzt die Sonnenbrille ab, klappt sie mit einer Hand zusammen und steckt sie mit dem Telefon in den Becherhalter. Erst sind es nur ein paar Tropfen, doch dann wird der Regen stärker und prasselt auf die Scheibe, und kaum ist sie an der Ampel an der Post Road, hat sie die Scheibenwischer auf die höchste Stufe eingestellt.
Der Tag ist verdorben, sie haben alle Vorzeichen gegen sich. Noch kann sie das Ganze beenden, kann sich über den Parkplatz des Stop & Shop schlängeln und zurückfahren, bei Elena vorbeischauen und alles beichten, bevor sie irgendwas Dummes tut, sie können gemeinsam abhängen und über ihre Mission Impossible lachen. Chica, was denkst du dir bloß dabei? Ich meine, Myles Parrish, der ist cool – tut mir leid, Hector –, aber was zum Teufel denkst du dir dabei?
Keine Ahnung, denkt Birdy, aber das ist gelogen. Jeder kann sehen, wie ihr Plan ausgehen wird. Sie will bloß nicht die Verantwortung dafür übernehmen, als hätte sie keine andere Wahl.
Die Ampel springt um, und sie fährt geradeaus, an der Einfahrt zum CVS und dem Stop & Shop vorbei. Neben ihr verläuft anderthalb Kilometer lang der Zaun des Flugplatzes, wo die Maschinen abheben, die die Werbebanner für Foxwoods, Narragansett und die Wilcox Tavern hinter sich her ziehen. Im Sommer hat sie hier mit allen möglichen Freunden im Stau gestanden und kennt seitdem jede Toilette. Ursprünglich hatte sie vor, sich im 99 Restaurant umzuziehen, befürchtete aber, jemand könnte sie sehen. Es ist sicherer, es ein Stück weiter hinten zu tun, an dem Park mit den Tennisplätzen, wo sie die Tür verriegeln kann.
Bei dem Regen ist sie dort der einzige Mensch. Auf dem Betonboden sind schmutzige Fußabdrücke, und sie kann ihre Winterjacke nirgends aufhängen. Sie stülpt sie über den Türgriff und sichert den Kragen mit den Riemen ihrer Handtasche. Die Luft ist feuchtkalt, und als sie ihre Uniformjacke auszieht, überläuft sie ein Schauder, und sie bekommt eine Gänsehaut. Sie streift das Top über, das sie mitgebracht hat – ein eng anliegendes, geripptes rotes Velours-Oberteil, das ihm gefällt –, und zupft vor dem Spiegel an den Schultern herum, bis es richtig sitzt. Die Neonbeleuchtung ist matt, und sie beugt sich über das Waschbecken, um den Eyeliner aufzufrischen und Lipgloss aufzutragen, tritt dann einen Schritt zurück, um alles zu beurteilen. In dieser Woche hat sie jede ihrer Entscheidungen im Nachhinein in Zweifel gezogen, und sie ist erleichtert zu sehen, dass das unnötig war. Sie überlegt, ein Selfie zu machen – vorher und nachher –, rollt aber nur ihre Uniformjacke zusammen und stopft sie in die Handtasche, zieht ihre Winterjacke an und bricht aus Angst, zu spät zu kommen, auf.
Zurück im Wagen, lässt sie ihren letzten Streifen Kaugummi knallen, und beim Kauen füllt sich ihr Mund mit süßlichem Saft. Es ist nicht mehr weit. Die Straße ist ihr so vertraut, und dennoch sieht alles fremd aus – riesige Felsen und welker Rhododendron auf beiden Seiten, kaputte Hummerfallen als Briefkästen. Eine ausrangierte Boje liegt rostend in einem Vorgarten, die Unterseite verbeult wie ein alter Topf. Sie erklimmt den letzten Hügel, und plötzlich ist in der Ferne, als dunkle Linie, das Meer zu sehen. Weit draußen ein Sonnenstrahl, der durch eine Wolkenlücke fällt, das Wasser bronzen färbt und auf ein winziges Fischerboot trifft. Als sie sich der Ampel an der Shore Road nähert, springt die im richtigen Moment auf Grün, und sie braust durch. Nachdem es sie so viel gekostet hat herzukommen, kommt ihr das zu einfach vor.
Auf dem letzten Kilometer ist das Land vollkommen flach, von verfallenen Steinmauern begrenzte Wiesen, Teiche und sumpfige Böden, umgeben von zottigem Schilf. Die pastellfarbenen Motels und grauverschindelten Ferienhäuser sind verriegelt, die Einfahrten mit Seilen abgesperrt. KEINE WENDESTELLE, verkündet ein Schild, das an einem weißgetünchten Betonblock befestigt ist, als könnte sie immer noch umkehren. Die Gehsteige sind verlassen, nur ein paar aufgedunsene Möwen hocken mit windzerzaustem Gefieder auf Pfählen. Weiter vorn, wo die Straße auf die Atlantic Avenue trifft, überquert ein Polizei-Geländewagen die Kreuzung, und sie erschrickt. Am Stoppschild wartet sie etwas länger und biegt dann in die andere Richtung, vorbei an einer nostalgischen vierseitigen Uhr, die eine falsche Zeit anzeigt, und plötzlich erstreckt sich vor ihr, hinter den geschlossenen Baseball-Schlagtunneln und der Gokartbahn, ihr Fahrtziel, der große Asphaltparkplatz für den öffentlichen Strand.
Der Parkplatz ist wie eine Rennbahn geformt, ein riesiges Oval mit dem Eingang an der Zielgeraden. Am Governor’s Bay Day, wenn der Eintritt frei ist, haben sie und ihre Freunde manchmal stundenlang gewartet, um die Kassenhäuschen zu passieren, sind im Schneckentempo die Leitplanke entlanggeschlichen, um dann kurz vorher abgewiesen zu werden und am Ende noch draufzuzahlen, weil sie bei irgendwem im Garten parken mussten. Heute gibt es keine Warteschlange. Als sie dem Oval der Straße folgt, ist sie überrascht, Menschen zu sehen, doch ein paar Unentwegte sind immer da. In der nächstgelegenen Ecke, direkt hinter der letzten klapprigen Strandbar, drängen sich zwei Wohnmobile an die Dünen, dann kommt lange nichts als Pfützen, Scharen von landeinwärts gedrifteten Möwen, die alle in dieselbe Richtung blicken. Durch die Lücken in den Dünen kann sie die sich brechenden, gischtsprühenden Wellen sehen. Weiter hinten auf dem Parkplatz, auf dieser Seite der Umkleidekabinen, stehen mehrere Wagen. Auch aus der Ferne erkennt sie, dass es größtenteils Pick-ups sind – außerdem würde er allein warten, nicht in der Gesellschaft anderer Leute.
Er ist nicht gekommen, denkt Birdy. Irgendwie hat seine Freundin es rausgefunden – die Freundin, deren Namen sie nicht ausstehen kann, bei dem sie zusammenzuckt, wenn sie ihn im Fernsehen oder, noch schlimmer, in der Kirche hört, die Freundin, die sie sich gegen ihren Willen jedes Wochenende mit ihm vorstellt, im Kino oder auf Partys, auf Sofas rumknutschend, Ohrringe tragend, die er ihr geschenkt hat. Es interessiert sie nicht, wo die beiden hinfahren oder was sie machen, als würde sein Leben, losgelöst von ihr, keine Rolle spielen. Wenn sie an diese Freundin denkt, überkommt sie eine rettende Leere. Selbst jetzt macht sie in dem Bestreben, sie auszulöschen, ein verkniffenes Gesicht. Sie will sie nicht ausstechen, Birdy wünscht sich vielmehr, sie hätte nie existiert. Der Gedanke, dass sie Myles drei Jahre lang für sich hatte, ist lähmend, ein Fehler, den er, so redet sie sich ein, nur aus Nettigkeit nicht behebt. Sie hat gehofft, der heutige Tag werde ein großer Schritt für sie beide sein, also warum hat sie dann Bauchschmerzen, als sie an den Kassenhäuschen einbiegt und seinen Eclipse allein auf der anderen Seite der Umkleidekabinen stehen sieht?
Ist sie zu spät dran? Wie lange hat er schon auf sie gewartet?
Bei ihm zu sein ist alles, was sie gewollt hat, doch plötzlich kommt es ihr kriminell vor, wie eine Drogenübergabe. Während sie die freien Parklücken überquert, macht sie sich an ihrem Telefon zu schaffen, drückt den Knopf zum Ausschalten, und das Display wird schließlich schwarz. Sie spuckt ihr Kaugummi in ein Papiertaschentuch und stopft das Knäuel in den Aschenbecher, um alles Beweismaterial zu beseitigen.
Als sie neben ihm hält, steigt er aus, spannt einen Regenschirm auf und kommt um den Wagen herum, um sie vor dem Regen zu schützen, wie in dem Song. Er hält ihr die Hand hin, als wollte er sie zum Tanzen auffordern, und sie ergreift sie und tritt in den Wind und die Kälte hinaus, während das Meer hinter den Dünen tost, und noch bevor sie etwas sagen kann, küsst er sie, sein Mund warm, sein Körper fest an sie gedrückt, und sie vergisst alles andere. Sie sind den Blicken ausgesetzt, ihre Wagen, ihre Nummernschilder. Irgendwo beobachtet jemand sie auf Überwachungskameras, doch es ist ihr egal.
«Du hast mir gefehlt», sagt er.
«Du hast mir gefehlt», sagt sie und küsst ihn wieder, gierig, als hätte der erste Kuss nicht gereicht.
«Komm.» Er hält ihr die Tür auf, und sie steigt ein, die Wärme und der Duft seines Kirsch-Vanille-Lufterfrischers umhüllen sie. Sie beobachtet, wie er um die Motorhaube herumgeht, greift dann, als wären sie schon seit Jahren ein Ehepaar, über den Fahrersitz und öffnet ihm die Tür.
Wieder küssen sie sich – über die Handbremse hinweg, ihre Körper verdreht, sich einander entgegenbeugend. Seine Hände sind kalt, und ihre Jacke ist im Weg. Sie will sie ausziehen, doch das ist schwierig, es ist zu eng, und ohne etwas sagen zu müssen, da beide finden, dass es unmöglich ist, lösen sie sich voneinander und entspannen sich, nehmen den anderen strahlend in sich auf, erstaunt, dass sie wirklich hier sind, dass sie sich nach all den beschwerlichen Stunden, in denen sie getrennt waren, wiedergefunden haben. Irgendwie ist es witzig, wie einfach alles ist, wenn sie zusammen sind. Der Rest der Welt verschwindet, und alles ist wieder, wie es sein soll. Er schnallt sich an und wartet, bis sie seinem Beispiel gefolgt ist, wendet den Wagen und braust zur Ausfahrt.
«Wohin fahren wir?», fragt sie schäkernd.
Er lächelt sie an, als hätte sie genau das Richtige gesagt. «Wirst du schon sehen.»
Es herrscht viel Betrieb, trotz des Regens. Die Samstage sind immer extrem, und bei diesem Wetter haben die Leute erst recht nichts anderes zu tun, als einkaufen zu gehen. Sie kommen klatschnass herein, die Haare strähnig, von den gelben Regenmänteln und Schirmen tropft es auf den Teppichboden. Normalerweise würde das Angel nicht stören. Sie mag Regen, und ihr gefällt die Dunkelheit draußen, während es drinnen warm und trocken ist. Und wenn viel los ist, geht der Tag schneller vorbei. Sie und Shayna müssen dann keine Regale aufräumen oder den Parkplatz kontrollieren, wo vorbeifahrende Freunde sie sehen könnten. Sie sitzen hinter der Kasse, albern herum und singen zur Hintergrundmusik, wenn sie gut ist, andernfalls ziehen sie drüber her. Beyoncés «Single Ladies» läuft in Dauerschleife, und Shayna hat versucht, ihr die Moves aus dem Musikvideo beizubringen. Angel steht eher auf Paramore und Fall Out Boy, doch der Refrain ist unwiderstehlich. If you liked it, then you shoulda put a ring on it.
Das Problem ist, dass alle Leute Gutscheine benutzen, um sich mit Süßigkeiten für Halloween einzudecken, und einer der Preise auf dem wöchentlichen Prospekt ist falsch. Den ganzen Nachmittag haben sie sich mit ihr wegen der kleinen Snickers-Riegel rumgestritten, haben ihr den Werbeprospekt vor die Nase gehalten, als würde sie sie belügen. Es ist so, wie Shayna sagt: Du darfst nie vergessen, dass der Kunde dein Feind ist.
«Der Druckfehler tut uns leid», sollen sie auf Anordnung von Mr. Fenton den Kunden sagen.
«Tut mir leid, dass Sie so geizig sind», würde Angel ihnen am liebsten entgegenhalten, nur um sie zum Schweigen zu bringen. Es geht um weniger als einen Dollar, und mit dem Gutschein kriegen sie ohnehin schon einen Dollar Rabatt. Was wollen die eigentlich?
«Ich will mit dem Geschäftsführer sprechen», sagen sie, als wäre Angel unter ihrer Würde, und dann muss sie ihn nach vorn rufen, wo er ihnen genau dasselbe erzählt, nur dass sie mit ihm nicht wie mit einem kleinen Kind sprechen, weil er ja einen Penis hat.
«Am Regal steht doch der richtige Preis», beklagt sich Shayna.
«Wir müssen die Prospekte verschwinden lassen», sagt Angel so laut, dass Mr. Fenton es hören kann. «Das wäre hilfreich.»
«Zu spät. Die sind schon am Dienstag rausgegangen.»
«Ich meine die an der Tür. Niemand bringt sie von zu Hause mit.» Was nicht ganz stimmt. Sie hat ein paar zusammengefaltete Broschüren gesehen, auf denen der Snickers-Riegel mit dickem Filzstift umkringelt war, als wäre er eine Art Schatz. Das sind dieselben Leute, die bei einer Rabattaktion die Dove-Duschgel-Regale leerräumen. Wahrscheinlich haben sie davon die Schränke voll, ja eine ganze Garage.
Mr. Fenton kann nicht mal die Prospekte wegräumen, ohne dass er sich bei jemandem rückversichert, doch es ist Wochenende, und während er hinten ist, kommt eine weitere Kundin im Alter ihrer Mutter aus dem Regen herein und steuert auf den Gang mit den Halloweenartikeln zu.
«Geliebte Süßigkeiten», sagt Shayna.
«Das ist doch dumm», sagt Angel, überquert den verschmutzten Teppichboden, schnappt sich den ganzen Stapel und schiebt ihn unter den Tresen.
«Ich glaube, das merkt er.»
«Ist mir egal.»
«Wie wär’s, wenn ich die Seite rausschneide?»
«Nein», sagt Angel. «Der Druckfehler ist nicht deine Schuld.»
Natürlich kauft die Frau drei Tüten Snickers. Angel informiert sie über den richtigen Preis, bevor sie sich die Mühe macht, alles einzuscannen.
«Hier steht aber was anderes.» Aus der Nähe betrachtet, ist sie älter als ihre Mutter und kleiner, ihre Haare mit Henna, die Augenbrauen schwarz gefärbt. Ihre Brille baumelt an einer Perlenkette, wie bei einer Bibliothekarin.
«Ich weiß, es ist ein Druckfehler. Tut uns wirklich leid. Wollen Sie sie trotzdem kaufen?»
«Der einzige Grund, warum ich im Regen den ganzen Weg hergefahren bin, sind diese Dinger, und jetzt soll der Preis nicht gelten, mit dem Sie geworben haben?»
«Es ist ein Druckfehler. Tut uns wirklich leid.»
«Und was ist mit den anderen Preisen? Stimmen die auch nicht?»
«Soweit wir wissen, ist es bloß dieser.»
«Tja, das passt ja.»
«In der Zeitung gibt’s einen Gutschein dafür, mit einem Dollar Rabatt.»
«Das hilft mir jetzt auch nicht, oder?»
Der Scheitel der Frau gibt ihre grauen Haarwurzeln preis. Angel ist etwa dreißig Zentimeter größer als sie, sie ist stark vom Krafttraining beim Volleyball und vom täglichen Plattdrücken der Pappkartons. Trotz des Tresens zwischen ihnen könnte sie problemlos die Hand ausstrecken und die Brillenkette ergreifen, die Frau zu sich heranziehen und ihr dabei die ganze Zeit in die Augen blicken. Vielleicht würde sie dann ihren Ton ändern.
Angel lächelt. «Mal sehen, ob ich einen für Sie dahabe.»
Der mit einem Reißverschluss verschlossene Bankbeutel unter der Kasse ist voll davon, und sie zupft einen heraus und scannt den Strichcode – piep, piep, piep. «In Ordnung? Das macht dann sechs siebenundzwanzig. Haben Sie eine Kundenkarte?»
Die Frau zögert, als wäre das Ganze ein Trick, und holt dann ihre Karte aus dem Portemonnaie. Wie leicht sich die Leute doch beschwichtigen lassen. «Sie müssen noch den Preis ändern.»
«Wir arbeiten dran», sagt Angel, steckt den Kassenbeleg in die Tüte und hält sie ihr an den Griffen hin. «Danke. Auf Wiedersehen.»
«Ich hab gesehen, was du gemacht hast», sagt Shayna, als sie wieder allein sind.
«Ich weiß, einen pro Kunde. War kurz davor auszurasten.»
«Ich war mir sicher, dass du gleich in die Luft gehst.»
«Das ist es nicht wert.»
Das Ladentelefon klingelt, und bevor Angel reagieren kann, tippt Shayna sich mit dem Finger an die Nase und schüttelt den Kopf.
Es ist Mr. Fenton, und Angel denkt, dass sie jetzt Probleme kriegt. In seinem Büro kann er sie beide auf den Überwachungskameras sehen. Es ist einer ihrer Running Gags, dass er sie anschaut wie einen Pornofilm. Wenn sie eine Paywall einrichten würden, könnten sie eine Stange Geld verdienen.
«Bitte gehen Sie die Prospekte durch, und nehmen Sie die Seite raus. Wenn die Leute extra danach fragen, dann geben Sie’s ihnen für den Preis.»
«Den falschen Preis», sagt Angel.
«Genau.»
«Okay», sagt sie, als wäre es verrückt, und erzählt es Shayna.
«Wie ich gesagt hab», sagt Shayna.
«Mein Gott, entscheide dich mal, okay?»
Sie blättern alles durch, nehmen die Seite heraus, falten die Prospekte wieder zusammen und legen sie auf den Stapel neben der Tür zurück. Das Ganze dauert ungefähr fünf Minuten, warum nervt es Angel dann?