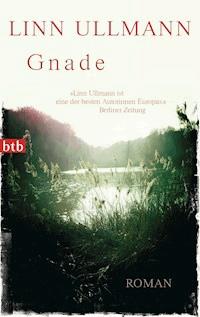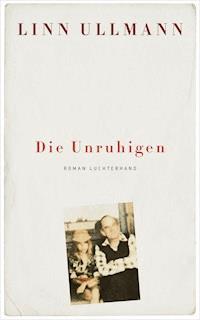8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Jede Familie hat ihre Geheimnisse …
… aber manchmal entwickelt das Verschweigen eine zerstörerische Kraft.
In einer norwegischen Küstenstadt findet in einer nebligen Julinacht eine große Party statt. Jenny Brodal wird 75, und ihre Tochter Siri hat gegen den Willen ihrer Mutter ein Fest organisiert. Die weiße Holzvilla auf einer Anhöhe leuchtet in die Nacht, während die Gäste eintreffen und Jenny in ihrem Zimmer sitzt und nach zwanzigjähriger Abstinenz wieder zu trinken beginnt …
Wie jedes Jahr verbringen Siri, die in Oslo und an der Küste ein Restaurant führt, und ihr Mann Jon den Sommer hier, nur haben sie diesmal ein Kindermädchen für ihre beiden Töchter engagiert, weil Jon keine Zeit hat, sich um Liv und Alma zu kümmern: Er ist Schriftsteller und muss endlich sein überfälliges neues Buch abschließen. Mille, das Kindermädchen, ist 19 Jahre alt und hat vor, in diesem Sommer eine andere zu werden. Doch dann verschwindet Mille spurlos in dieser Nacht. Jeder aus der Familie hatte eine eigene Beziehung zu Mille, die er vor den anderen verbirgt. Ihr rätselhaftes Verschwinden rührt aber auch andere, tiefe Gefühle auf, nie vergessene Verletzungen, nie gelebte Sehnsüchte, Ängste und Unsicherheiten. Behutsam dringt Linn Ullmann in die Geschichte ihrer Figuren vor, trägt Schicht um Schicht der Fassade ab, bis wir ihnen so nahe kommen, dass wir verstehen, warum sie lügen und Alpträume haben, warum sie feige sind oder gemein. Sie bringt sie uns so nahe, dass wir uns selbst in ihnen erkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Ähnliche
Linn Ullmann
Das Verschwiegene
Roman
Aus dem Norwegischen vonIna Kronenberger
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Det dyrebare bei Forlaget Oktober AS, Oslo.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert.
Die Veröffentlichung dieser Übersetzung wurde von NORLA gefördert.
Copyright © der Originalausgabe 2011 Linn Ullmann
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-10890-8V002www.luchterhand-literaturverlag.de
Dein Schwinden selbst aber bleibt.
Gunnar Ekelöf
Für Niels
Jenny Brodal hatte seit über zwanzig Jahren keinen Tropfen mehr angerührt. Sie öffnete eine Flasche Rotwein und schenkte sich ein großes Glas ein. Sie hatte davon geträumt, wie die Wärme in den Magen hinunterfließen würde, vom Kribbeln in den Fingerspitzen. Sie wurde enttäuscht, nahm jedoch einen weiteren Schluck, ja, sie leerte das Glas und schüttelte sich. Sie hatte niemals nie gesagt! Eins nach dem anderen hatte sie gemacht, eins nach dem anderen, und niemals, niemals nie gesagt. Sie saß auf der Bettkante, geschminkt und herausgeputzt, wenn man von den dicken grauen Wollsocken absah, die Irma gestrickt hatte. Sie fror an den Füßen, was mit dem Blutdruck zusammenhing. Geschwollen waren sie auch. Ihr graute davor, sie in schmale hochhackige Sandalen zwängen zu müssen. Nektarinfarbene. Aus den sechziger Jahren. Jenny schenkte sich noch ein Glas ein. Sie wollte, dass der Wein bis in die Füße vordrang. Sie hatte niemals nie gesagt. Eins nach dem anderen, hatte sie gesagt. Sie versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, warum sie sich gegen dieses Fest, diese Feier gesträubt hatte. Sie erhob sich und drehte sich vor dem Spiegel an der Wand. Über dem Busen saß das schwarze Kleid perfekt. Bald würde sie die Wollsocken aus- und die Sandalen anziehen.
Heute war der fünfzehnte Juli 2008, und Jenny wurde fünfundsiebzig. Mailund, das große weiße Haus, in dem sie nach dem Krieg aufgewachsen war, nachdem die Eltern mit ihr die abgebrannte Stadt Molde verlassen hatten, war voller Blumen. Sie hatte fast ihr ganzes Leben darin verbracht, in guten wie in schlechten Zeiten, und jetzt waren siebenundvierzig sommerlich gekleidete Gäste auf dem Weg hierher, um sie zu feiern.
I Der Schatz
Mille oder das, was von ihr noch übrig war, wurde von Simen und zwei Kameraden gefunden, die im Wald einen Schatz ausgraben wollten. Zunächst war ihnen nicht klar, was sie gefunden hatten. Ihnen war nur klar, dass es nicht der Schatz war. Es war das Gegenteil von einem Schatz. Später, als sie der Polizei und ihren Eltern erklären sollten, warum sie im Wald gewesen waren, fiel Simen die Antwort schwer. Warum hatten sie in dieser Lichtung gegraben? Unter diesem Baum? Und wonach hatten sie eigentlich gesucht?
Vor zwei Jahren hatten alle, Erwachsene wie Kinder, nach Mille gesucht. Alle, die im Sommer in dem kleinen Küstenstädtchen Urlaub machten, alle, die dort das ganze Jahr über wohnten, die Polizei, Milles Eltern, alle, die in der Zeitung über sie schrieben oder im Fernsehen über sie berichteten, hatten nach Mille gesucht. Im Wasser und an Land, in Gräben und in Gräbern, in den Sandhaufen von Tangen und in der Nähe der unzugänglichen Klippen nördlich des Zentrums, in den Ruinen hinter der stillgelegten Schule und in dem unbewohnten, baufälligen Haus am Ende des Brageveien, wo das Gras bis zu den Fenstern stand und kein Kind spielen durfte. Milles Eltern hatten jeden Meter im Zentrum abgesucht, sie waren von Kapitänshaus zu Kapitänshaus gezogen, von Geschäft zu Geschäft und hatten ein Foto von Mille vorgezeigt, sie hatten Plakate aufgehängt: an der Tür des Konsums, an der Tür der Kneipe Bellini, an der Tür des Buchladens, der früher für seine ungewöhnlich gute Auswahl an fremdsprachiger Belletristik bei Bücherliebhabern in ganz Norwegen bekannt gewesen war (zu Zeiten, als Jenny Brodal noch hinter dem Tresen stand), an der Tür zur Pizzeria Palermo und an der Tür der stillgelegten Bäckerei, die in den Sommermonaten das neu eröffnete Fischrestaurant Gloucester MA beherbergte, das alle nur die alte Bäckerei nannten, weil Gloucester so schwer auszusprechen war. Die alte Bäckerei stand dort, wo die Straße nach Mailund abging, die lange Straße, die sich zwischen den Klippen, dem Wald und all den Holzhäusern hindurchschlängelte, wovon eines hässlicher als das andere war.
Alle hatten nach Mille gesucht, sogar der Junge, den sie KB nannten und der später verhaftet und des Mordes an ihr bezichtigt wurde, dabei war sie zwei Jahre lang unter dem Baum im Wald vergraben gewesen, ohne dass jemand sie fand, von Erde und Gras und Moos und Zweigen und Steinen bedeckt, und nun war sie selbst fast zu Erde geworden, wenn man vom Schädel und den Gebeinen, den Knochenresten und Zähnen, den dünnen Armbändern und den langen dunklen Haaren absah, die nicht mehr lang und dunkel waren, sondern dünn und welk, als hätte man Mille mit Wurzeln und allem Drum und Dran aus der Grube gezogen.
In jenem Sommer, in dem Mille verschwand, glaubte Simen, sie überall zu sehen. Sie war das Gesicht im Schaufenster, der Kopf in den Wellen, das lange, dunkle Haar einer fremden Frau, das vom Wind hochgewirbelt wurde, und sie war Mamas rotes Kleid. Alle redeten über sie, alle fragten sich, wohin sie verschwunden war. Einst hatte Mille existiert, einst hatte sie Simen angeschaut und gelacht. Einst hatte sie Mille geheißen, doch dann war sie im Nebel verschwunden. Die Spaten waren real. Die Fahrräder waren real. Die Grube, in der sie lag, war real. Nur Mille war nicht real. Mille war ein Schleier aus Nacht und Frost, der hin und wieder durch ihn hindurchglitt und ihm die Freude nahm.
Simen hatte sie nicht vergessen. Er dachte an sie, wenn er nicht schlafen konnte oder der Herbst näher kam und die Luft nach Schießpulver und nassem, welkem Gras roch, doch jetzt hatte er schon lange nicht mehr an sie gedacht.
Simen war der Jüngste von den dreien. Die beiden anderen hießen Gunnar und Ole Kristian. An einem Samstag Ende Oktober 2010 verbrachten die Kameraden ihr letztes Wochenende zusammen. Die Ferienhäuser sollten winterfest gemacht werden, und das kleine Küstenstädtchen, ein paar Stunden südlich von Oslo gelegen, würde sich bald in seine eigene Dunkelheit hüllen. Es war Nachmittag, die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, und die Jungen beschlossen, den Schatz zu heben, den sie Monate zuvor vergraben hatten. Gunnar und Ole Kristian sahen keinen Sinn darin, ihn für alle Ewigkeit in der Erde ruhen zu lassen. Simen war anderer Meinung. Darin bestand doch gerade der Sinn, meinte er, das machte den Schatz doch aus, dass er allen außer ihnen verborgen blieb, der Schatz war unter der Erde tausendmal wertvoller als darüber. Er konnte nicht erklären, warum, er wusste nur, dass es so war. Doch weder Gunnar noch Ole Kristian verstanden, was Simen sagen wollte. Wenn sie ehrlich waren, fanden sie Simens Betrachtungen über die Erde völlig hirnrissig, beide wollten einfach den Inhalt des Schatzes zurückhaben, ihren Beitrag zum Schatz, ihnen war der Schatz als Schatz vollkommen egal, und schließlich sagte Simen, das sei für ihn in Ordnung, es sei ihm egal; warum zogen sie nicht sofort los und gruben den ganzen Mist wieder aus.
Die Geschichte von Simen und dem Schatz begann ein paar Monate zuvor, im August, als Gunnar, der Älteste der drei Jungen, vorschlug, sie sollten ihr Blut vermischen. Der Sommer näherte sich dem Ende, der Abend war warm und rot, und alles blühte besonders üppig, wie immer, wenn es bald vorbei war. Es würde nicht mehr lange dauern, dann müssten sie Abschied nehmen und nach Hause zurückkehren, dorthin, wo sie den Rest des Jahres verbringen würden, in den Herbst, in die Schule, in den Fußballverein und zu den anderen Kameraden.
Gunnar hatte sich einen Ruck gegeben und gesagt: »Das Vermischen von Blut ist ein Symbol ewiger Freundschaft.«
Die beiden anderen wanden sich, die Vorstellung, sich die Handfläche mit der Scherbe einer kaputten Limonadenflasche aufzuritzen, war wenig verlockend, es würde unglaublich wehtun, so etwas wollte man sich selbst nicht antun, nicht einmal aus Gründen ewiger Freundschaft, und auch wenn man hauptsächlich Fußball spielte, wo die Beine zum Einsatz kamen, brauchte man doch auch die Hände, brauchte sie für verschiedene Dinge, ohne blutige Kratzer und Wunden, aber wie sollte man Gunnar das erklären, ohne als feige und kindisch zu gelten und ohne all das Gute kaputtzumachen.
Sie saßen vor ihrer Geheimhütte im Wald, die sie im letzten Jahr gebaut hatten. Sie hatten ein Lagerfeuer gemacht und Würstchen gegrillt, Chips gegessen und Cola getrunken, sie waren Liverpool-Fans, alle drei, die Unterhaltung lief also wie von selbst, sie hatten auch gesungen, denn hier konnte niemand sie hören, man brauchte sich vor niemandem zu blamieren, Walk on, walk on, with hope in your heart, und Simen dachte, wenn man dieses Lied singt, hat man das Gefühl, dass das Leben wirklich begonnen hat. Doch dann hatte Gunnar angefangen, und das war typisch Gunnar, davon zu reden, dass sie noch lange keine echten Freunde waren, nur weil sie jeden Sommer miteinander verbrachten. Echte Freunde, die miteinander durch dick und dünn gingen. Gunnar kannte einen Typen, der jahrelang zu Liverpool gehalten hatte, und dann hatte er plötzlich angefangen, zu Manchester United zu halten, nur weil sein neuer Nachbar zu Manchester United hielt. Und was macht man mit so einem Kerl? Ist das ein echter Freund? Und auf einmal schlug Gunnar den Bogen zu Blut und Schmerz und echter Freundschaft und anderen Dingen, über die er in diesem Sommer offensichtlich viel nachgedacht hatte und die in den Vorschlag mündeten, Blutsbrüder zu werden. Er hatte alles vorbereitet, sich für die ganze Prozedur gewappnet, und auch das war typisch Gunnar. Die Glasscherben waren fein säuberlich in Alufolie verpackt, die Flasche hatte er zu Hause im Garten zerbrochen, dann hatte er die Scherben mit Spüli gereinigt, es sei nämlich so, sagte Gunnar, wenn man sich mit schmutzigen Glasscherben in die Hand schnitt, konnte man eine Blutvergiftung bekommen und sterben, und er legte das verbeulte Päckchen zwischen sie und wickelte das Alupapier vorsichtig auseinander, als befänden sich Diamanten in dem Päckchen oder Skorpione. In dem Moment kam Ole Kristian, der von ihnen der Gewiefteste war, auf die Idee, stattdessen einen Schatz zu vergraben – als Symbol für ewige und echte und richtige Freundschaft. Sommers wie winters. Durch dick und dünn. Und alle drei mussten einen Gegenstand beisteuern, und dieser Gegenstand musste wertvoll sein. Ein Schatz anstelle von vermischtem Blut. Das war die Abmachung.
Im Gartenschuppen von Ole Kristians Eltern stand eine alte hellblaue Blechkanne mit Deckel, die seine Mutter vor Jahren gebraucht gekauft hatte. Die Kanne war zerbeult, übersät mit sonnengebleichten, handgemalten Bildern von Kühen und Mägden, und auf einer Seite der Kanne stand auf Englisch: MILK – nature’s most nearly perfect food. Ole Kristians Vater war fast den ganzen Tag über sauer gewesen, weil die Mutter für so etwas Bescheuertes wie eine alte Milchkanne nahezu vierhundert Kronen ausgegeben hatte. Daraufhin war Ole Kristians Mutter doppelt so sauer gewesen und hatte gesagt, wenn Ole Kristians Vater die Terrasse vor der Schlafzimmertür bauen würde (wie er es vor einer Ewigkeit versprochen hatte), würde sie diese mit Kisten und Krügen, mit Kletterrosen, Kissen und Decken schmücken. Es sollte ihre kleine italienische Veranda werden, hatte sie gesagt. Die Blechkanne war Teil ihres Plans und sollte, wenn die Terrasse fertig war, mit Wiesenblumen gefüllt werden. Aber die Terrasse wurde nicht fertig, nicht in diesem Jahr und auch nicht im Jahr darauf, und jetzt stand die Kanne ganz hinten im Schuppen, halb vergessen hinter einem kaputten Rasenmäher. Die Kanne könnte ihnen als Schatzkiste dienen, sagte Ole Kristian.
(Der Sinn eines vergrabenen Schatzes bestand darin, dass man ihn nie wieder ausgrub. Nie. Man wusste, dass es ihn gab. Man wusste, wo er sich befand. Man wusste, wie wertvoll er war und wie viel man geopfert hatte, als man beschlossen hatte, ihn zu vergraben und nie mehr anzuschauen. Und man konnte keinem je davon erzählen.)
Aber Ole Kristian musste etwas finden, was er in die Blechkanne hineinlegen wollte, meinte Simen – und dem stimmte Gunnar zu. Hatte Ole Kristian nicht gerade zweihundertfünfzig Kronen von seiner Großmutter bekommen? Davon sollte er wenigstens zweihundert opfern. Das Geld (wenn es Scheine waren), konnte man in eine Plastiktüte packen, darin würde es sich nicht auflösen. Ole Kristian wollte das Geld nicht hergeben, auch wenn der Schatz seine Idee gewesen war und er es war, der gesagt hatte, alle müssten etwas beisteuern, was einen gewissen Wert hatte, man müsse gewissermaßen etwas opfern. Aber Simen und Gunnar waren beide der Meinung, es reiche nicht aus, die Blechkanne zu seinem Beitrag zu erklären. Das sei kein Opfer! Die Blechkanne sei nicht Bestandteil des Schatzes, die Blechkanne sei lediglich die Hülle für den eigentlichen Schatz. Nur, dass sie keine Kiste war, sondern eine Kanne. Wenn man der Wahrheit ins Auge sah (und das hier war sozusagen die Stunde der Wahrheit, wie Gunnar bemerkte), hatte Ole Kristian nichts anderes von Wert als das Geld seiner Großmutter.
Es sollte wehtun.
Was Gunnars Beitrag anbetraf, gab es keinen Zweifel. Hier waren sich Simen und Ole Kristian völlig einig. Gunnar musste das Autogrammheft vom FC Liverpool opfern.
Vor wenigen Monaten war Gunnar mit seinem großen Bruder, der zweiundzwanzig war, in Liverpool gewesen. Sie hatten ein ganzes Wochenende dort verbracht, im Hotel gewohnt und sich ein Fußballspiel der Premier League zwischen Liverpool und Tottenham angeschaut. (Gunnars großer Bruder war kein richtiger großer Bruder, auch wenn Gunnar ständig »mein großer Bruder hier, mein großer Bruder da« sagte, er war ein großer Halbbruder, der Sohn von Gunnars Vater, und Gunnar sah ihn eigentlich nicht sehr oft.) In dem Autogrammheft hatten unter anderem Steven Gerrard und Fernando Torres, Xabi Alonso und Jamie Carragher Autogramme gegeben, und ganz hinten im Heft klebte ein Foto von Gunnar zusammen mit seinem großen Bruder vor dem Anfield Stadion, beide mit Liverpool-Schal um den Hals. Neben dem großen Bruder mit seinen eins neunzig, mit den langen, braunen Haaren und den breiten Schultern sah Gunnar wie eine Schnake aus, und unter dem Bild stand mit blauem Kugelschreiber: Für den coolsten kleinen Bruder der Welt von Morten.
Simen wusste, dass Gunnar das Autogrammheft lieber nicht in die Kanne legen wollte. Die zweihundert Kronen von Ole Kristians Großmutter waren eine Sache. Etwas völlig anderes war Gunnars Autogrammheft vom FC Liverpool, das tat richtig weh. Es kam recht häufig vor, dass Ole Kristian Geld von seiner Großmutter erhielt, aber es kam nicht sehr oft vor, dass Gunnars großer Bruder (auch wenn er kein richtiger großer Bruder war) mit Gunnar nach Liverpool fuhr, und es kam schon gar nicht oft vor, dass man von Steven Gerrard, Fernando Torres, Xabi Alonso und Jamie Carragher Autogramme bekam. Und Gunnar, der von den dreien am schmächtigsten war, fing fast an zu heulen, als er versprach, sich von seinem Autogrammheft zu trennen.
Nachdem dies geklärt war, flüsterte Simen: »Ich weiß, was ich in die Kanne legen werde.«
Er war der Einzige, der noch übrig war. Draußen vor der Geheimhütte waren jetzt Wolken aufgezogen, und Simen wollte Gunnar und Ole Kristian zeigen, dass auch er bereit war, ein Opfer zu bringen.
Simens Mutter besaß eine Kette mit einem Anhänger, einem kleinen Kreuz aus Diamanten. Sie hatte es vor zweieinhalb Jahren von Simens Vater zu Weihnachten bekommen. Simen selbst war beim Kauf im Juweliergeschäft dabei gewesen, und er war fast ohnmächtig geworden, als er mitbekam, wie viele tausend Kronen es kostete. Die Idee dahinter war, dass das Kreuz auch zu einem kleinen Teil von ihm kommen und Mama sich mächtig freuen sollte. Aber er wusste nicht, ob die Rechnung aufgegangen war, so viele tausend Kronen auszugeben, damit Mama sich freute. Mama war nach Weihnachten dieselbe wie vorher. So viele Tausender für so einen kleinen Anhänger. Simen hatte schon überlegt, Papa zu fragen, ob es die Sache wert gewesen sei. Aber er ließ es bleiben. Und jetzt hatte er eine neue Idee.
Jeden Abend, wenn Mama zu Bett ging, nahm sie die Kette mit dem Anhänger ab und legte sie in eine blaue Schale im Bad. Er brauchte bloß zu warten, bis alle schliefen – es war kinderleicht. Niemand würde ihn verdächtigen. Simen war keiner von denen, die Sachen stahlen. Mama würde traurig sein, sie würde das ganze Haus auf den Kopf stellen, um den Anhänger zu finden, aber niemals würde sie ihn verdächtigen.
Gunnar und Ole Kristian sahen sich zuerst gegenseitig an, dann Simen.
»Wie viel hat er genau gekostet?«, fragte Ole Kristian.
»Viele Tausender. Siebzehn vielleicht.«
»Das kann nicht sein«, sagte Ole Kristian.
»Wenn es echte Diamanten sind«, sagte Gunnar, »kann es schon sein.«
Ole Kristian dachte nach.
»Okay«, sagte er und sah Simen mit durchdringendem Blick an, »dann steuerst du den Anhänger bei!«
Am nächsten Abend hatten sie den ganzen Wald abgesucht, waren unter leuchtenden Baumkronen über kleine, verschlungene Waldwege um die Wette geradelt, um die perfekte Stelle für die Kanne zu finden. Auch an dem grünen Waldsee kamen sie vorbei, in dem vor vielen, vielen Jahren zwei kleine Kinder ertrunken waren. Alma, das Nachbarmädchen von Mailund, hatte Simen von den Ertrunkenen im Wald erzählt. Alma war ein paar Jahre älter als Simen und hatte hin und wieder Geld von seiner Mutter erhalten, damit sie ein paar Stunden auf ihn aufpasste. Die Zeiten waren jetzt vorbei. Heute passte er auf sich selbst auf. Das war früher gewesen. Als er noch klein war. Fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Jetzt war er elf. Wenn Simen erwachsen wäre und Kinder hätte, würde er niemals, niemals im Leben Geld dafür bezahlen, dass jemand wie Alma auf sie aufpasste. Alma würde er seine Kinder ohnehin nicht überlassen, nicht einmal, wenn es kostenlos wäre. Sie war komisch und dunkeläugig und erzählte Geschichten, manche wahr, manche erlogen, und man konnte sich nie sicher sein, um welche Art Geschichte es sich gerade handelte. Die Geschichte von den Kindern, die in dem grünen See ertrunken waren, schien zu stimmen. Der Junge war ertrunken, während das Mädchen dabeistand und zusah, daraufhin war die Mutter der Kinder so außer sich gewesen, dass sie auch das Mädchen ertränkt hatte.
»Sie hat ihren Sohn bestimmt mehr geliebt als ihre Tochter«, sagte Alma.
Alma und Simen hatten im Gras gesessen und auf das sommerlich warme Wasser geschaut, beide hatten ein Stück Apfelkuchen und einen Plastikbecher mit rotem Saft in der Hand gehabt. Almas Mutter hatte ihnen ein Picknick mitgegeben, aber Alma mochte keinen roten Saft und goss ihn in den See. Almas Mutter, die Siri hieß, strich ihm gern über den Kopf und sagte: Hallo, Simen, wie geht’s dir denn heute?
Alma sagte: »Der kleine Junge ist ins Wasser gefallen und ertrunken, während seine Schwester dabeistand und zusah, und als das Mädchen ohne den kleinen Bruder nach Hause kam, war die Mutter so außer sich, dass sie nicht mehr ein noch aus wusste. Sie weinte und weinte und weinte, und niemand konnte sich im Haus aufhalten, weil sie so viel weinte. Das Mädchen hielt sich die Ohren zu und weinte auch. Aber die Mutter interessierte das nicht. Oder es interessierte sie vielleicht, aber sie hörte es nicht. Und dann eines Abends wurde die Mutter ganz still. Auch das Mädchen wurde ganz still.«
»Was passierte dann«, fragte Simen, »wurde die Mutter wieder fröhlich und hörte auf zu weinen?«
Alma dachte nach.
»Nein, das nicht«, sagte sie, »die Mutter nahm das Mädchen mit in das große Doppelbett und las und sang ihm vor und kitzelte es im Nacken und zerzauste ihm die Haare und sagte: Ich hab dich so lieb, kleine … kleine …«
Alma suchte nach Worten.
»… kleine Singdrossel«, schlug Simen vor, denn so nannte ihn seine Mutter oft.
»Kleine Singdrossel, ja. Ich hab dich so lieb, kleine Singdrossel, sagte die Mutter zu dem Mädchen. Und dann stand sie auf und ging in die Küche und kochte einen großen Becher mit heißer Schokolade, das Lieblingsgetränk des Mädchens.«
Alma drehte sich zu Simen. Er war damals acht, als sie an dem grünen Waldsee saßen und Apfelkuchen aßen.
»Das macht deine Mutter, nicht wahr? Deine Mutter nennt dich kleine Singdrossel«, sagte Alma.
Simen antwortete nicht.
»Warum nennt sie dich kleine Singdrossel?«
»Weiß ich doch nicht«, sagte Simen und bereute es, Alma davon erzählt zu haben. Eigentlich wollte er Alma überhaupt nichts erzählen, schon gar nicht so etwas. Und mehr wollte er dazu nicht sagen. Er wollte nicht sagen, weil Mama jeden Abend, bevor sie mir einen Kuss gibt, mir eine gute Nacht wünscht und aus dem Zimmer geht, mir ins Ohr flüstert: Was soll ich dir vorsingen, bevor ich gehe? Und dann flüstere ich zurück: Ich will, dass du mir die kleine Singdrossel vorsingst. Alle Strophen! Und das machen wir jeden Abend seit vielen Jahren, und darum nennt Mama mich kleine Singdrossel.
Alma sah wieder über das Wasser und fuhr mit ihrer Geschichte fort.
»Und nachdem die Mutter die Schokolade gekocht hatte, tat sie ein Schlafmittel hinein. Es war farblos. Geschmacksneutral. So etwas gibt es, weißt du – Schlafmittel, die man nicht schmeckt, wenn man sie trinkt! Man kann nie wissen. Es kann jederzeit passieren. Auch dir. Deine Mutter kann Schlafmittel in deinen Kakao tun, ohne dass du etwas merkst.«
»Hör auf«, sagte Simen.
»Hör selbst auf«, sagte Alma, »ich erzähle dir nur, was passieren kann. Das ist die bittere Realität des Lebens.«
»Hör trotzdem auf«, wiederholte Simen.
»Und als das Mädchen die Schokolade getrunken hatte«, fuhr Alma fort, »schlief es im Bett der Mutter ein. Es fiel in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und die Mutter hielt ihr Ohr an den Mund des Mädchens und lauschte seinem Atem, und als sie sicher war, dass es nicht aufwachen würde, hob sie es aus dem Bett und trug es in den Wald zu dem See und warf es hinein.«
»Das glaub ich dir nicht«, sagte Simen.
»Weil du so klein bist«, sagte Alma, »und weil du nicht weißt, was Mütter tun, wenn sie nicht aufhören können zu weinen – und die Mutter des Mädchens konnte nicht aufhören zu weinen.«
Es war Jahre her, seit Alma auf Simen aufgepasst und ihm die Geschichte von dem Jungen und dem Mädchen, die in dem See ertrunken waren, erzählt hatte, und auch wenn er die Geschichte nicht zu hundert Prozent geglaubt hatte, badete er hier nicht gern. Er badete lieber im Meer. Er wollte nicht in dem grünen Wasser schwimmen und sich vorstellen, dass ihn der Junge und das Mädchen, in Seerosen verwandelt, packen und nach unten ziehen könnten.
Und Simen radelte an dem See vorbei, an dem er als kleines Kind mit Alma gesessen hatte, und dachte: Ich kenne diesen Wald in- und auswendig.
Der Schatz lag in der hellblauen Milchkanne und war an Ole Kristians Fahrradlenker befestigt. Der Inhalt des Schatzes: zweihundert Kronen in Scheinen, ein Diamantkreuz im Wert von siebzehntausend Kronen und ein Autogrammheft vom FC Liverpool. Einer der Spaten ragte aus Gunnars Rucksack heraus. Simen hatte sich eine Fahrradtasche geliehen und den anderen Spaten darin verstaut. Drei Jungen, dünn wie Bleistiftstriche, rasten in das Dunkelgrün, um das perfekte Versteck zu finden.
Der Wald öffnete und schloss sich, nahm sie auf und legte sich um sie, und plötzlich bremste Simen scharf und rief: »Dort! Unter diesem Baum!« Sie waren zu einer Lichtung im Wald gekommen, und am Rande der Lichtung lagen ein paar Steine, die aussahen, als bildeten sie den Buchstaben S – wie in Schatz oder Simen oder Bill Shankly –, und mitten auf der Lichtung stand ein Baum und streckte seine Äste zum Himmel, als bejubelte er jedes einzelne Tor, das Liverpool seit 1892 geschossen hatte.
Aber im Herbst sah alles anders aus. Nichts stimmte. Es regnete und war dunkel und kalt, und man brauchte Mütze und Schal und einen dicken Pullover und eine Taschenlampe, und der Wald war schroff und dicht und still, und es gab keine hellen Lichtungen, in denen Steine ein S bildeten und Bäume jubelten.
Aber sie fanden eine Lichtung, und sie fanden einen Baum, der dem Baum vom letzten Sommer ähnelte.
Ole Kristian war ganz sicher, dass das hier die richtige Stelle war, er erkenne sie wieder, sagte er. Simen betrachtete den Baum, der die nahezu nackten Äste in den Nachthimmel streckte. Im Leben nicht! Dieser Baum rief überhaupt keine Erinnerungen wach. Dieser Baum erinnerte an einen steinalten Mann, der dem Himmel mit Fäusten drohte und so zornig war, dass er sterben wollte. Das lag nicht nur daran, dass er seine Blätter verloren hatte. Dieser Baum war am Ende.
Aber er sagte kein Wort zu den anderen. Sie waren seit Ewigkeiten in die falsche Richtung geradelt. Er war sich nahezu sicher, dass sie in die falsche Richtung geradelt waren und das hier nicht die richtige Stelle war. Doch wenn er sich irrte und Ole Kristian recht hatte und der Schatz tatsächlich unter diesem Baum lag, stellte sich die Frage, ob er das Diamantkreuz wieder in die blaue Schale im Bad legen sollte oder ob er es vielleicht lieber behalten und einen Kumpel bitten sollte, es mit ihm zu verkaufen. Mit siebzehntausend Kronen kam man weit. Er sah seine Mutter vor dem Ferienhaus, sie trug ein rotes Kleid und hatte lange dunkle Haare und dunkle Augen, und sie lächelte ihn an wie immer, wenn sie so tat, als hätte sie sich nicht mit Papa gestritten.
Sie rammten die Spaten in die Erde.
»Zum Glück hat es noch keinen Frost gegeben«, sagte Ole Kristian, »dann wäre es nicht mehr möglich …«
»Das ist garantiert die richtige Stelle«, sagte Gunnar, »man sieht ja, dass hier jemand gegraben hat.«
»Der Sinn des Ganzen war ja aber, dass wir ihn nicht mehr ausbuddeln«, warf Simen ein.
»Für wen soll das der Sinn gewesen sein, verdammt noch mal?«, fragte Ole Kristian.
»Der Schatz war doch deine Idee«, sagte Simen.
»Könnt ihr vielleicht mal die Klappe halten und graben«, sagte Gunnar.
Die Jungen gruben schweigend weiter. Es war mittlerweile stockfinster geworden, und sie wechselten sich beim Graben und beim Halten der Taschenlampe ab.
Keiner von ihnen begriff, dass Mille vor ihnen lag, als sie atemlos und erschöpft den Strahl der Taschenlampe auf sie richteten. Das Grab erinnerte an ein Vogelnest, ein großes unterirdisches Vogelnest aus Zweigen und Knochen und Haut und Stroh und Gras und Stoff – und zuerst dachte Simen, der den kompletten Inhalt des Grabes noch nicht erfasst hatte, dass es sich bei dem, was er sah, genau darum handelte, die Überreste eines Riesenvogels, des einzigen seiner Art, schwarz und rauschend, vor der Welt verborgen, mächtig und allein mit seinen dunklen schweren Flügeln, hin und her, hin und her, durch unterirdische Tunnel, Gänge und Säle. Ein großer, stolzer, einsamer Nachtvogel, der am Ende abstürzte und nur wenige Spuren seiner Existenz hinterließ – und er wurde aus diesen Gedanken erst herausgerissen, als Gunnar, der die Taschenlampe hielt, einen Schrei ausstieß.
»Igitt, das ist eine Leiche.«
Gunnar war grün im Gesicht, und das lag nicht allein am gespenstischen Licht der Taschenlampe.
Ole Kristian sagte: »Seht mal, die Haare, an dem Schädel wachsen Haare, das ist kein Gras, das sind Haare.«
Dann musste er sich übergeben.
Milles Verschwinden lag jetzt zwei Jahre zurück. Simen war damals neun gewesen, und schon zu der Zeit waren er und sein Fahrrad eins, so sah er sich zumindest in jenem Sommer, als einen Jungen auf Rädern, als ein Fahrrad mit Körper, Herz und Zunge, und hätte er gedurft, hätte er das Fahrrad mit ins Bett genommen, wenn er am Abend widerstrebend schlafen ging. Von frühmorgens an sauste, schlitterte und rutschte er über die schmalen Kieswege bei der weißen Kirche oder ließ vorne bei den Holzstegen neben dem Fähranleger an der langen Mole das Fahrrad hochsteigen, und dann glänzte der Fahrradlenker in der Sonne, und ihm stieg der beißende Geruch von Garnelenschalen und Fischabfällen in die Nase, von den beiden Fischern, die unbeirrt dort ausharrten.
Am Abend, an dem sie verschwand, dem fünfzehnten Juli 2008, hatte es leicht geregnet, der Nebel hatte ihn eingehüllt, und die Straßen waren schwarz und feucht gewesen, als könnten sie sich jederzeit auftun und ihn verschlucken. Simen hatte von seinen Eltern die Erlaubnis, allein draußen Rad zu fahren – solange er in der Nähe des Ferienhauses blieb. Er fror, wollte aber nicht nach Hause. Seine Mutter und sein Vater stritten sich und konnten nicht aufhören, auch wenn er schrie: IHR SOLLT EUCH NICHT MEHR STREITEN!
An der höchsten Stelle der Straße, die Svingen hieß – die Kurve – (die nach Ansicht von Simens Vater jedoch Svingene – die Kurven – heißen müsste, es sind schließlich hundert Kurven, Simen, nicht nur eine!) und sich vom Zentrum aus wie ein gewelltes Band den Berg hinaufwand, stand die große weiße Holzvilla der Buchhändlerin Jenny Brodal. Jenny lebte mit einer Frau zusammen, die Irma hieß, und die beiden gingen jeden Abend spazieren. Jenny war klein und zierlich und marschierte die lange Straße zum Zentrum hinunter. Irma war groß und breit und lag meistens ein paar Schritte hinter ihr. Simen begegnete den beiden Frauen oft, wenn er draußen mit dem Fahrrad unterwegs war. Irma sagte nie etwas, aber Jenny grüßte immer.
»Guten Tag, Simen«, sagte sie stets.
»Hallo«, sagte Simen und wusste nicht, ob er anhalten und richtig grüßen oder weiterradeln sollte – aber beide wären ohnehin schon weit weg, bis er sich entschieden hätte.
Irma war die Frau, deren Jenny sich erbarmt hatte. Simen wusste nicht, was erbarmen bedeutete, den Ausdruck hatte seine Mutter benutzt, als er fragte, was das für eine Frau sei, die zusammen mit Jenny Brodal in Mailund wohne.
In Wahrheit mied Simen Irma, so gut er konnte. Am schlimmsten war es, wenn Irma abends allein draußen herumlief. Simen erinnerte sich daran, wie er einmal auf der Straße auf sie zufuhr und sie seinen Lenker packte und ihn anfauchte. Es kamen zwar keine Flammen aus ihrem Mund, aber es hätte ihn nicht gewundert, wenn es so gewesen wäre. Sie war irgendwie voller Licht, das fiel ihm auf, weil es draußen so dunkel war. Ja, sie leuchtete, als hätte sie gerade einen Feuerschlucker verschluckt.
Er hatte keine Ahnung, warum sie das tat. Warum sie ihn anfauchte. Er hatte nichts Böses getan. Er hatte ihr nicht den Weg versperrt. Sie hatte ihn festgehalten.
Seine Mutter sagte, Irma habe vielleicht nur versucht, mit ihm zu scherzen, und sich dabei etwas ungeschickt angestellt. Irma sei nicht verkehrt, sagte die Mutter, und Simen solle seine Phantasie zügeln, solle sich nicht Geschichten über Menschen ausdenken, die er nicht kenne. Simen müsse einsehen, dass Irma ganz bestimmt ein guter, freundlicher Mensch war und dass sie Jenny Brodal liebte, die Irma aus allen erdenklichen unangenehmen Situationen befreit hatte (und die sich außerdem ihrer erbarmt hatte), aber weil Irma so groß war und nicht wie eine normale Frau aussah, war man versucht, ihr negative Eigenschaften anzudichten. Das alles sagte Simens Mutter, und das tat sie, weil sie stets an das Gute im Menschen glaubte. Aber in diesem Fall irrte seine Mutter. Die Hünin Irma hatte seinen Lenker gepackt und Simen angefaucht, und sie hatte im Dunkeln geleuchtet. Da war sich Simen ganz sicher.
Doch an jenem Abend im Juli begegnete er weder Jenny noch Irma auf der Straße. Zum Glück. Er wusste, warum. Jenny hatte Geburtstag, und ihr großer Garten war voller Menschen, schon von weitem hörte er die Stimmen und das Gelächter. Es war ein großes Fest, was Simen angesichts von Jennys Alter ein wenig merkwürdig fand. Sie war bestimmt über siebzig, vielleicht sogar über achtzig. Er war sich nicht sicher. Aber alt war sie. Bald würde sie sterben. Daran führte kein Weg vorbei. Man konnte sich nicht entziehen. Und Jenny war auch keine Frau, die sich den Dingen entzog. Sie marschierte zwar – aber dem Tod konnte man auch marschierend nicht entkommen. Der Tod hatte alle Macht. Mama würde sterben, Papa würde sterben. Und eines Tages würde auch Simen sterben. Darüber hatte er mit Mama gesprochen – sie gab ihm richtige Antworten. Papa wich eher aus. Warum sollte man ein großes Fest feiern, wenn man bald starb? Was gab es da zu feiern?
Simen fuhr die lange Straße hinauf, um im Gebüsch zu spionieren. Nebel lag über ihm und unter ihm, vor ihm und hinter ihm, und die Stimmen aus Jennys Garten schienen daraus zu entspringen. Der Nebel erschuf die Stimmen. Der Nebel erschuf das Gelächter. Der Nebel erschuf die Straße, die sich zum Haus hochwand, und all die hundert Kurven, und der Nebel erschuf die Menschen auf dem Fest, und nur Simen und sein Fahrrad waren real. Sie waren Fleisch und Blut und Knochen und Räder und Stahl und Kette. Simen und sein Fahrrad waren eins. Zumindest bis das Rad einen Stein rammte und Simen über den Lenker flog. Sein Schrei wurde erstickt, als er auf dem Boden landete. Eine Weile rührte er sich nicht, dann begann es wehzutun. Die Schürfwunden an Handflächen und Knien. Der Kies in den Wunden. Das Blut. Er krabbelte zum Straßenrand, lehnte sich an einen Baumstamm und weinte. Doch wie laut er auch weinte, Mama und Papa würden ihn nicht hören. Ihr Haus lag weit unten in der Straße, und die Stimmen der Geburtstagsfeier hier oben übertönten alles, und er war ganz allein, und es tat überall weh, vor allem an den Knien, das Fahrrad war ganz sicher hinüber, und er hatte sich die Hände aufgerissen bei dem Versuch, sich beim Fallen abzustützen. Den Kopf zu schützen. Das sollte man tun, wenn man vom Fahrrad fiel. Eigentlich sollte man einen Fahrradhelm tragen, und Mama wurde bestimmt wütend, weil er keinen aufhatte, und er würde künftig am Abend nicht mehr allein Rad fahren dürfen. Das Fahrrad lag immer noch mitten auf der Straße. Seltsam verdreht. Simen begann noch lauter zu weinen. In dem Moment kam sie. Das Mädchen in dem roten Kleid mit den langen dunklen Haaren. Sie hatte ein Tuch um die Schultern und eine Blume im Haar. Sie war das allerschönste Mädchen, das Simen je gesehen hatte – und der Nebel schien ihr nichts anhaben zu können. Als wiche er vor dem, was schöner war als er, zurück. Simen weinte weiter, auch wenn etwas in ihm sagte: Wenn sich dir so etwas Schönes wie dieses Mädchen nähert, solltest du nicht im Graben sitzen und wie ein kleines Kind heulen. Andererseits: Hätte er nicht im Graben gesessen und geweint, wäre das Mädchen niemals stehen geblieben, wäre niemals vor ihm in die Hocke gegangen, hätte nicht den Arm um ihn gelegt und geflüstert: Bist du vom Fahrrad gefallen? Hast du dir wehgetan? Darf ich mal sehen? Sie hätte ihm niemals auf die Beine geholfen, ihn gefragt, wie er heißt, und das rote Tuch genommen, um ihm den Schmutz und die Tränen aus dem Gesicht zu wischen. Sie hätte sich niemals über das Fahrrad gebeugt und den Schaden begutachtet. (Es ist nicht kaputt, sagte sie und stellte es wieder auf, siehst du, Simen, es ist nicht kaputt.) Und sie hätte ihn niemals den weiten Weg von Jennys Haus zu seinem eigenen, dem zweiten auf der linken Seite, begleitet – eine Hand in seiner, die andere auf dem Lenker. Ich heiße Mille, sagte sie, als sie am Ziel ankamen.
Sie lehnte sein Fahrrad an den Zaun, sah ihn an und lächelte. Dann beugte sie sich über ihn und küsste ihn auf den Kopf.
Ich heiße Mille, und du heißt Simen, und jetzt musst du nicht mehr weinen.
Dann drehte sie sich um und ging.
II Charles Olson hatte keinen Hund
Jon Dreyer hatte sie alle zum Narren gehalten. Es war der Sommer des Jahres 2008, und er versuchte zu schreiben. Stattdessen betrachtete er Mille.
Das Zimmer, in dem er saß, befand sich im Dachgeschoss von Jenny Brodals baufälliger weißer Holzvilla Mailund, in der die Familie ihre Sommer verbrachte. Es war klein und hell und staubig mit Blick auf die Blumenwiesen und den Wald. Die Frau, mit der er zusammenlebte, die mit dem schiefen Rücken (ein kleiner Knick in der Taille nur), hatte in der alten Bäckerei ein Restaurant eröffnet, nicht sehr groß, mit Platz für zwanzig Gäste. Siri hieß sie. Vierzig Jahre. Tochter der Buchhändlerin Jenny Brodal und des Schweden Bo Anders Wallin, ehemals Inhaber der Steinhauerei Wallin AG in Slite auf Gotland, seit langem verstorben. Die Kinder von Siri und Jon: Alma, zwölf, und Liv, fünf.
Siri hatte das Restaurant Gloucester MA genannt, nach dem Fischerstädtchen in Massachusetts, in dem sie und Jon und Alma ein paar Monate verbracht hatten, als Jon den ersten Band seiner Trilogie zu Ende schrieb. Er hatte von einem entfernten und freundlichen amerikanischen Verwandten das Angebot erhalten, dessen großes Haus in Gloucester zu mieten. Die Miete war rein symbolischer Natur gewesen. Dort sollten sie gut drei Monate wohnen, von Juni bis September. Der Verwandte war froh, dass jemand das Haus hütete, während er sich selbst auf einer längeren Reise in Südamerika befand. Das ist ein Zeichen, dachte Jon damals, daran konnte er sich gut erinnern. Dass er das Buch in derselben Stadt zu Ende schreiben durfte, die der Dichter Charles Olson mit seinem Werk unsterblich gemacht hatte.
Es war im Sommer 1999, vier Jahre vor Livs Geburt. Alma war damals drei. Siri wollte, dass sie zusammen nach Gloucester fuhren, und erklärte sich bereit, ihr Restaurant in Oslo dem mehr als kompetenten Geschäftsführer Kajsa Tinnberg und dem Küchenchef Pål Pepper Olsen zu überlassen – ein junger und begabter Koch, der Horror, wenn man in der Küche mit ihm zusammenarbeiten musste (sensibler Perfektionist, beliebt und manisch, seinen Spitznamen Pepper hatte er nach einem fast manisch zu nennenden Manöver mit der Pfeffermühle erhalten), aber mit großem Respekt für Tinnberg.
Ach, wie er damals schreiben konnte.
Jetzt, neun Jahre später, saß Jon am dritten Band, Band eins und zwei waren sehr gut gelaufen, erschienen 2000 und 2002, aber Band drei wollte ihm nicht gelingen, das Buch sollte seit Jahren fertig sein, aber ihm war ständig etwas dazwischengekommen, es hatte nicht geklappt, die Tage vergingen, und er brachte nichts zustande. Vielleicht war er depressiv.
Er besah sich seine Notizen zu Herman R. und schrieb: Die Geschichte eines Mannes, der eine Geschichte erzählen wollte. Weiter kam er nicht. Genau das versuchte er hinzukriegen: Wie schreibt man die Geschichte eines Lebens, was macht ein Leben aus, worin besteht das gelebte Leben, woraus bestehen wir, und wie beschreiben wir es? Auf einen gelben Post-it-Zettel an der Wand hatte er ein Zitat aus einem Charles-Olson-Gedicht gekritzelt:
Ein Amerikaner
ist eine Kombination von Zufällen
War das die Antwort? War das alles?
Er hatte Siri etwas von Charles Olson vorgelesen, als sie in Gloucester waren. Aber sie sagte, Charles Olson gehöre dem Universum der Gottlosen an, einem der vielen Universen, zu denen sie keinen Zugang fand. Die Steinhauerei des Vaters war auch so eines. Es war der Sommer, in dem sie keinen Schlaf fand, nur wenn er ihre Hand hielt und ihr Geschichten erzählte, konnte sie einschlafen. Sie lagen nebeneinander in der Dunkelheit, und er erzählte. Er wollte ihr etwas von der Ruhe zurückgeben, die sie unterwegs eingebüßt hatte; in der Nacht, in der Dunkelheit, inmitten der großen Stille zwischen ihnen wollte er ihr etwas geben, das sowohl ihm als auch ihr gehören konnte. Seine Stimme fand eine Tonlage, die sie nie zuvor gehabt hatte, und er lag neben ihr und nahm sich die Zeit, sich an alles zu erinnern, woran er sich nicht mehr zu erinnern glaubte, an die Einrichtung von Großmutters Wohnung, die anderen Hausbewohner in Frogner, die bunten Kleider der Mutter, im Detail beschrieben, jedes Gesicht auf den Klassenfotos, er schilderte ihr den Schulweg Meter für Meter und jedes einzelne Stück, das man in seiner Kindheit im Lebensmittelladen an der Ecke kaufen konnte, er erzählte und erzählte, Nacht für Nacht, mit derselben monotonen Stimme, von Büchern, die er vor langer Zeit gelesen hatte, von Geschichten, die ihm sein Vater erzählt hatte, als sie in jenem Sommer, in dem er zwölf wurde, in die Berge gingen, von den beiden Wellensittichen, die er in seinem Zimmer im Käfig hielt und die sich so heftig stritten, dass, solange sie lebten, buchstäblich die Federn flogen, er hielt Siris Hand und sagte, er glaube trotzdem, dass die beiden Vögel sich geliebt hatten, dennoch und allem zum Trotz, und er kam auf seine Reisen zu sprechen, detaillierte Schilderungen von Zugreisen kreuz und quer durch Europa, und von dort zu ihren gemeinsamen Reisen, er lag in der Dunkelheit und erinnerte sich an die seltsamsten Dinge, Brocken zur Geschichte der Fischerei in Gloucester, die er während ihres Aufenthaltes dort bereits gelesen hatte, von all jenen, die zu den großen Fischgründen hinausgefahren und im Nebel verschwunden waren; ihre Hände froren am Ruder fest, und der Nebel verschluckte sie ganz, mehrere Tausend Jungen, Männer, Söhne, Väter verschwanden, und ständig kamen neue hinzu, sie kamen aus Schweden, Norwegen und Dänemark, sie kamen aus Sizilien, sie kamen von den Kapverdischen Inseln und den Azoren, sie kamen aus Neufundland, sie kamen, um zu verschwinden, sie kamen, um festzufrieren, sie kamen, um sich im Nebel aufzulösen, und er lag neben ihr und hörte nicht auf zu reden, und manchmal schnarchte sie, und manchmal wimmerte sie, und manchmal gab sie vor zu schlafen, er konnte sich nie sicher sein, aber es war auch nicht so wichtig, er lag neben ihr, ergriffen von seinen Geschichten, ergriffen von Siris Nähe und Wärme, und er streichelte ihre Hand, bis er sich selbst in den Schlaf geredet hatte.
Und wenn Jon aufhörte zu erzählen, weil er vielleicht mitten in einem Wort eingeschlafen war, machte Siri weiter. Vielleicht hörte er zu, vielleicht auch nicht. Sie erzählte von Träumen, die sie als Kind gehabt hatte, von heutigen Träumen, von der endlosen Treppe im Haus ihrer Mutter in Mailund, die nie dieselbe Anzahl Stufen hatte, meistens aber neunundzwanzig, eine Stufe pro Buchstabe im norwegischen Alphabet, wobei sie manchmal mehr und manchmal weniger hatte. Sie erzählte von Filmen, die sie gesehen, von Büchern, die sie gelesen hatte, Büchern, die Jon nicht lesen wollte, vielleicht weil sie von Frauen geschrieben waren, Orlando zum Beispiel, Virginia Woolfs kokette Biographie über ihre Geliebte Vita Sackville-West, und glaubst du, es ist so, Jon, flüsterte sie, du als Autor, dass man schreibt, um ein anderer zu werden, und wenn man ein anderer wird, will man dann sich selbst entkommen, oder bedeutet es womöglich mehr? Kann es nicht auch die Notwendigkeit bedeuten, aus sich heraus- und in einen anderen hineinzutreten, den Platz eines anderen einzunehmen, mitzufühlen, mitzuleben, mitzuatmen: Wenn ich zum Beispiel in eine Glasscherbe trete, kannst du dann spüren, wie es schmerzt, kannst du den Schmerz in deinem Fuß spüren und so beschreiben, dass alle Leser ihn ebenfalls spüren, und als sie keine Antwort erhielt, erzählte sie von Orlando, einer Figur, die sowohl Mann als auch Frau war und mehrere Jahrhunderte lebte, und sie erzählte von ihrer Kindheit und ihrem Vater, der, statt laut vorzulesen, Teile großer literarischer Klassiker nacherzählte, genau wie sie jetzt, Erzählungen, die weder Siri noch Syver begreifen konnten, Siri war sechs, und ihr kleiner Bruder Syver war vier, doch das hielt den Vater nicht davon ab, den Kindern von Karenin, Anna Kareninas Ehemann, zu erzählen, der so griesgrämig und streng war, dass alle Angst vor ihm hatten, dabei war er eigentlich nur sehr traurig. Und genau das begriff sie. Siri weiß noch, dass sie wirklich verstand, wie es sein musste, Karenin zu sein, ein kalter Fisch der russischen Aristokratie, obwohl sie erst sechs war. Und sie erzählte Jon von Syvers Tod im Wald, davon, wie ihre Mutter zu trinken begann und niemals torkelte, sich im Haus nicht fortzubewegen, sondern ruckartig zu versetzen schien, plötzlich stand sie im Wohnzimmer in der Ecke, dann saß sie auf der Bettkante, plötzlich hing sie über Töpfen und Kasserollen in der viel zu großen Küche, dann stand sie vor dem Spiegel, und ich versuchte, sie zu berühren, aber sie entglitt meinen Händen und verschwand in den Töpfen, verschwand im Spiegel. Und sie erzählte von ihrem Vater, der sich nach Slite absetzte und Sofia heiratete, von der Steinmetzfirma Steinhauerei Wallin AG, deren Spezialität gotländischer Kalkstein war, und von seinem Besuch in Mailund, als er ihr Geburtstagsgeschenk vergessen hatte und, um das Versäumnis wiedergutzumachen, seinen Staubmantel durchtrennte, ihr schenkte und ihn Unsichtbarkeitsmantel nannte, und wie sie versuchte, Alma den Mantel zu geben, weißt du noch, Jon, und Alma wollte ihn nicht haben, Alma schrie NEIN, NEIN, NEIN, DEN WILL ICH NICHT HABEN, und das war bestimmt eine gesunde Reaktion, meinst du nicht, um Alma mache ich mir keine Sorgen, sagte Siri, und sie erzählte weiter, wie sie hochschwanger war und ihr Vater tot im Bett lag, ein Tuch ums Gesicht gebunden wie eine Haube, damit sich nicht der Mund öffnete und für alle Ewigkeit offen stand, nachdem die Totenstarre eingesetzt hatte. Der Vater war mit ihr zum Leuchtturm Fårö gefahren, bei einem der wenigen Male, die sie ihn als Kind in Slite besucht hatte. Sie war gern in Slite gewesen, mochte die Zementfabrik, die gewissermaßen über der ganzen Stadt schwebte, mochte die kleinen müden Gassen im Zentrum und den weißen Staub, der sich auf alle und alles legte, aber Fårö war anders, Fårö war kahl und kalt, und sie erinnerte sich, dass sie dort nicht mehr hinwollte, und sie hatte sich vorher nicht besonders viele Gedanken über den Ausflug mit ihrem Vater gemacht, bis sie und Jon und die kleine Alma am Good Harbor Beach in Gloucester standen, mehr als zwanzig Jahre später und Tausende Meilen entfernt, und die beiden wunderschönen Silhouetten der Leuchttürme sahen, die Zwillingslichter auf Thacher Island.
Sie hatten sich auf die Bücher zur Geschichte Gloucesters und seiner Fischerei gestürzt, beide – dieser Hunger danach, neue Orte zu erobern, als müsse man sie unbedingt in- und auswendig kennen, sie zu etwas Heimeligem, etwas Vertrautem machen (sie las, während Jon schrieb und Alma schlief, Alma war noch so klein, dass sie jeden Tag einen Mittagsschlaf machte) –, und sie erzählte ihm von damals, 1635, als das Schiff Watch and Wait mit dreiundzwanzig Menschen an Bord, zehn davon Kinder, auf seinem Weg von Ipswich nach Marblehead, wo sie eine Kirche bauen wollten, um Cape Ann segeln musste. Das Schiff wurde von einem kräftigen Sturm überrascht, und als in den Windböen die Segel rissen, ankerten sie für die Nacht. Am frühen Morgen, sagte sie, sei der Wind so stark geworden, dass das Schiff an den Felsen zerschellte, sich in Holzsplitter auflöste und alle ins Meer gespült wurden. Lediglich der Engländer Anthony Thacher und seine Gattin Elizabeth schafften es, sich an Land zu retten und zu überleben. Alle anderen waren verschollen. Ihre vier Kinder waren verschollen. Und die Geschichte dieser beiden, die überlebt, aber alles verloren hatten, war so traurig, dass die Behörden in Massachusetts ihnen die Insel, vor der das Schiff gestrandet war, schenkten. Ja, hier waren sie: Anthony und Elizabeth, Elizabeth und Anthony, neu in dem neuen Land, gute Menschen, gottesfürchtige Menschen, denn sie wollten eigentlich nach Marblehead, um eine Kirche zu bauen, und jetzt hatten sie alles verloren, vier Kinder, in den Wellen verschwunden. Und die Insel – auf die sie sich gerettet hatten, die sie geschenkt bekommen hatten und gar nicht haben wollten – wurde Thacher’s Woe genannt, Thachers Wehklage. Doch erst im Dezember 1771, erzählte Siri, und jetzt schlief er bestimmt, dachte sie, jetzt war er ganz sicher eingeschlafen, brannten die beiden Leuchttürme, die Zwillingstürme, um vor dem gefährlichen Riff südöstlich der Insel zu warnen. Und da Thacher Island zu Cape Ann gehörte, wurden die Leuchttürme Anns Augen genannt, als könnten sie uns sehen, sagte sie, über uns wachen, als würden wir uns in ihnen auflösen und wieder zum Leben erweckt werden.
»Du leuchtest viel mehr«, flüsterte Jon und schmiegte sich an sie. »Dein Licht leuchtet.«
An einem Tag dort in Gloucester, weit weg von zu Hause, fragte er sie, ob sie mit ihm zusammen nach Charles Olsons Grab suchen wolle. Jon erinnerte sich, wie er und sie, die kleine Alma zwischen ihnen, über den großen und nicht gerade gut gepflegten, ja mehr oder weniger zugewachsenen Friedhof an der Essex Avenue liefen und Charles Olsons Grab suchten. Sie fanden es nicht. Und nach ein paar Stunden gaben sie auf und fuhren stattdessen nach Essex, stöberten in Antiquitätenläden herum, und Siri kaufte Alma einen kleinen blauen Puppenwagen, der in Gloucester blieb, als sie nach Norwegen zurückkehrten.
Jon hatte große Pläne für den abschließenden Band seiner Trilogie, er musste nur hineinfinden. Jetzt saß er in seinem Arbeitszimmer auf dem Dachboden von Mailund und war ganz sicher, dass der Roman sich in der Geschichte eines Mannes versteckte, der eine Geschichte erzählen wollte, eines Mannes wie zum Beispiel Herman R., und wenn es Jon nur gelänge, den Code zu knacken, stünde ihm die Tür zu seinen eigenen Geschichten weit offen.
Er sah seine Notizen durch.
Als Herman R. zwölf Jahre alt war und als Gefangener im Konzentrationslager Buchenwald in Deutschland saß, sah er eines Tages auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns ein kleines Mädchen. Hungrig und voller Angst fragte er das Mädchen, ob es ihm etwas zu essen geben könne. Es nahm einen Apfel und warf ihn über den Zaun.
Am nächsten Tag trafen sie sich wieder, jeder auf seiner Seite des Stacheldrahtzauns, sie sagten nichts, aber das Mädchen warf erneut einen Apfel über den Zaun. So trafen sie sich sieben Monate lang. Mal warf sie Äpfel über den Zaun, mal Brot. Dann wurde Herman in ein neues Lager verlegt, das Mädchen und der Junge wurden getrennt, aber Herman und seine drei Brüder überlebten den Krieg.
Fünfzehn Jahre später zog Herman R. nach New York, und dort begegnete er einer jungen Jüdin aus Polen. Die Frau hieß Roma. Roma erzählte, dass sie als Kind während des Krieges mit ihrer Familie in Deutschland gelebt habe, wo sie sich für Christen ausgaben. Sie habe in der Nähe eines Konzentrationslagers gewohnt, erzählte sie, und einem kleinen Jungen auf der anderen Seite des Zauns Äpfel zugeworfen.
Herman hatte das Mädchen gefunden, das ihn damals vor fünfzehn Jahren am Leben erhalten hatte, das Mädchen mit den Äpfeln, und er hielt sofort um ihre Hand an, und seither waren sie verheiratet.
Jon hatte vor vielen Jahren den Dachboden im Haus seiner Schwiegermutter in Mailund bezogen. Hier saß er und schrieb. Hier sollte der dritte Band entstehen, das glaubte er zumindest jetzt. Heute. Der Dachboden war voller LPs, Bücher, Notizhefte, dort gab es ein Puppenhaus, Puppenmöbel und Miniaturpuppen. Die Puppensachen hatten einmal Siri gehört. Der alte Ola, ihr Nachbar, hatte sie für sie geschnitzt, nachdem ihr kleiner Bruder Syver gestorben war.
Bevor Jon den Dachboden als Arbeitszimmer nutzte, hatte er als Speicher gedient. Jenny hatte fast alle Spielsachen von Siri weggeworfen, als sie erwachsen und ausgezogen war, hatte es aber nicht übers Herz gebracht, die Puppensachen zu entsorgen.
Jon starrte auf den Bildschirm. Er hatte das Wort Herz getippt. Doch er hatte seine Zweifel, ob es eine Frage des Herzens war, dass Jenny die Puppensachen nicht weggeworfen hatte. Falls Jenny ein Herz hatte, war es klein und schwarz, es war in einen Schrein eingeschlossen und in einem Waldsee versenkt worden.
Was war mit Irma? Wie konnte man Irma erklären? Wer war Irma für Jenny? Groß und kräftig und breit, größer und breiter als Jon, und aus der Entfernung sah sie eher aus wie ein Mann, nicht wie eine Frau, doch aus der Nähe war sie überraschend schön, nicht ihr Körper, sondern ihr Gesicht, sie hatte lange blonde, gelockte Haare, volle Lippen und strahlte etwas Erhabenes aus, etwas Edles, fast Ätherisches – wie der Erzengel Uriel in Leonardos Gemälde Die Madonna in der Felsengrotte.
Irma lebte mit Jenny in Mailund und bewohnte die Kellerwohnung. Sie bezahlte keine Miete, legte jedoch bei vielen Dingen Hand an, was einer relativ unpraktischen Frau wie Jenny sehr gelegen kam. Irma hatte die unschöne Angewohnheit des Tabakkauens, was aber besser war als Rauchen. Jenny vertrug keinen Rauch. Ein paar Bedingungen hatte Jenny bei Irmas Einzug nämlich gestellt. Nicht rauchen. Nicht mit den Türen schlagen. Pünktlichkeit. Und nun kam sie ständig mit herrenlosen Tieren an – Katzen, Hunde, Meerschweinchen –, aber das war in Ordnung, solange die Tiere in der Kellerwohnung blieben!
Irma liebt Tiere mehr als Menschen, sagte Siri. Jenny selbst liebte Irma am meisten – falls sie überhaupt in der Lage war, einen Menschen zu lieben. Es hieß, dass Jenny Irma vor einem Mann gerettet hatte, der sie schlug. Jon konnte sich kaum vorstellen, dass es einen Menschen gab, der auf jemanden von Irmas Statur losgehen konnte – vielleicht war es aber gerade ihre Größe, die sie so verletzlich machte? Irma hatte bereits kapituliert, sagten die Leute auch, sie hatte sich zum Sterben hingelegt, als Jenny die Hand ausstreckte und sagte: Zieh zu mir.
Und Jenny und Irma standen womöglich für eine ganz besondere Form von Liebe, auch wenn Jon es für ausgeschlossen hielt, dass seine Schwiegermutter einen Menschen lieben konnte. Der Gedanke, warum sie sich vielleicht liebten und wie es möglicherweise zu dieser Liebe gekommen war, die Absprache zwischen den beiden (denn Jenny und Irma hatten ganz eindeutig eine Absprache, wer sie füreinander waren), wie sie ihr Leben ersannen, erinnerte Jon wiederum an die Geschichte von Herman R., und er ging seine Notizen noch einmal durch.
Wie erzählt man die Geschichte eines Lebens? So könnte ein möglicher Einstieg aussehen:
Eines Tages, vor etwas mehr als zehn Jahren, beschloss ein unbekannter, nahezu siebzigjähriger Mann, eine Liebesgeschichte zu schreiben. Bald ist Valentinstag, und eine Lokalzeitung hat aus diesem Anlass einen Schreibwettbewerb für die beste Erzählung ausgeschrieben. Die Erzählung soll von einem Mädchen handeln, das einen Apfel wirft. Herman sieht das Bild vor sich. Er hat es ein Leben lang in sich getragen. Es ist nie geschehen, es konnte nicht geschehen, er wäre auf der Stelle erschossen worden, wenn er sich dem stromführenden Stacheldrahtzaun genähert hätte, und doch geschieht es, indem er sich hinsetzt und die Geschichte aufschreibt. Mag sein, dass er aufblickt, mag sein, dass sein Blick auf Roma fällt, die Frau, die er geheiratet hat und die jetzt eine alte Frau ist. Er will eine Geschichte über ihre Kindheit schreiben, als sie in tiefster Finsternis lebten. Er in Buchenwald, sie versteckt zwischen Christen. Doch die Geschichte kann nicht nur dunkel sein. Sie muss einen Lichtblick haben. Sie muss einen Hoffnungsschimmer enthalten. (Kriegen wir das nicht ständig zu hören?) Und hat er nicht immerzu dieses Bild von dem Mädchen mit den Äpfeln in sich getragen? Er weiß nicht, woher es kommt, aber er betrachtet Roma, die beiläufige Geste, wenn sie sich durch die Haare streicht, eine Geste, die sie sich bestimmt als junges Mädchen angewöhnt hat und die ihr ein ganzes Leben lang gefolgt ist bis ins hohe Alter, er starrt sie an und erlebt, wie sie sich vor ihm offenbart und zugleich auflöst. Alle Barrieren, alle Vorbehalte, die Zeit und die Sorgen, alles, was Herman zu Herman macht und Roma zu Roma, wird weggerissen, und dort, auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns, im Dämmerlicht, sieht er das Mädchen mit den Äpfeln. Er hat es immer gewusst, sich immer danach gesehnt, jetzt braucht er es nur noch zu Papier zu bringen.
Herman gewinnt den Wettbewerb der Lokalzeitung, er hat eine Geschichte über die Hoffnung geschrieben, und er besteht darauf, dass sie wahr ist (Jon besteht immer darauf, dass seine Geschichten nicht wahr sind, auch sind sie keineswegs voller Hoffnung), und die Geschichte von dem Mädchen mit den Äpfeln beginnt ein Eigenleben, sie setzt sich durch, wird zur eigentlichen Geschichte von Herman und Roma. Die beiden treten in Talkshows auf und erzählen immer wieder ihre Geschichte, Herman erhält einen Verlagsvertrag, Pläne für eine Verfilmung werden erörtert.
Auf einer zerschlissenen Decke auf dem zerschlissenen orangefarbenen Sofa lag Jons Hund und hatte Appetit auf Herz, Nieren und Leber, Trockenfutter kam für ihn nicht in Frage, lieber hungerte er, als Trockenfutter zu fressen, darum hatte er auch den Namen Leopold erhalten. Er war ein großer schwarzer Labrador mit einem weißen Fleck auf der Brust und grimmigem Blick. Leopold, auch Leo genannt, wusste, dass Jon das Buch nicht zu Ende bekäme, was ihn bekümmerte. Der Grund für den Kummer war – schließlich war er ein Hund und nicht einmal ein besonders reflektierter –, dass Jon keine langen Spaziergänge mehr mit ihm unternahm. Ehe das Buch nicht fertig war, konnte man von Jon nichts anderes erwarten – außer, dass er das Buch nicht schrieb. Alles war in eine Warteposition versetzt.