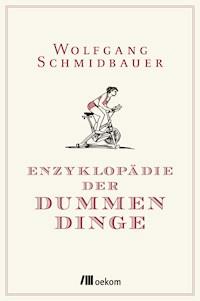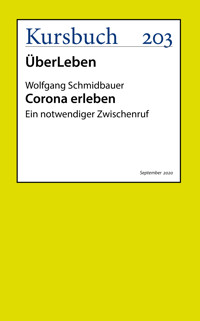Vorwort
Zu den prägendsten Erfahrungen meines Lebens gehören die Glücksgefühle, die von einem frühen Hineinstolpern in eine archaische Umgebung ausgelöst wurden. 25-jährig, frisch verlobt und mit einem Diplom in Psychologie ausgerüstet, hatte ich für den Gegenwert von einigen Tausend Mark ein verlassenes Steinhaus in der Toskana erstanden: solide Mauern und ein reparaturbedürftiges Dach, mit schönster Aussicht, ohne Autostraße, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Meine Frau und ich retteten dieses Haus vor dem Verfall und lebten dort einige Jahre, ehe unsere älteste Tochter eingeschult wurde. Ich hatte schon während des Studiums als Medizinjournalist gearbeitet und schrieb jetzt jeden Tag drei verkäufliche Seiten. Das reichte gut zu einem Leben mit Kerzenlicht, Kaminfeuer und Wasser aus der Quelle.
Wenn ich am Feuer saß, über die Felder ging, die an einen Schäfer verpachtet waren, wenn ich nachts in die Dunkelheit trat und die Milchstraße über mir sah oder im Juni die Lichtspuren der Leuchtkäfer, deren Flackern das Auge nicht anders deuten kann als einen springenden Funken, wenn der Mond durch die Äste schimmerte oder ein Gewitter über den Bergen von Pistoja ganz ohne Donner leuchtete, überfiel mich dieses Glücksgefühl: »Das ist schön, fast zu schön, um wahr zu sein, und doch ist es wahr – ich habe es nicht verdient, es ist mir in den Schoß gefallen.«
In dieser Stimmung lag der Keim eines meiner ersten Bücher: Homo consumens, eine psychologische Analyse der Konsumgesellschaft und ihrer Fähigkeit, Homo sapiens in eine Karikatur seiner selbst zu verwandeln. Die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich letztlich doch in großen Städten verbracht, schließlich waren sie in der Zeit vor Internet und Handynetz die einzige Möglichkeit, am Fortschritt teilzunehmen (und sei es in der Form von Kritik).
Nach meiner Rückkehr in die Großstadt war ich Psychoanalytiker geworden. Mein Lieblingstext Sigmund Freuds wurde Das Unbehagen in der Kultur. Im Lauf der Jahre wuchs in mir die Idee heran, das in manchen Punkten nicht mehr zeitgemäße Modell Freuds zu ergänzen. Freud hatte die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, Trägerin der Zivilisation seiner Zeit, in den Rang von Kultur schlechthin gehoben. Er nutzte die Forschung über die biologische und kulturelle Evolution zum Menschen nicht, und er kannte die schriftlosen Kulturen nicht gut genug, denen unser Fortschrittsgedanke undenkbar ist und die doch unseren sozialen Bedürfnissen sehr viel besser gerecht werden als das Projekt der Konsumgesellschaft.
Eltern begegnen der kindlichen Autoerotik heute weniger aggressiv und verbietend als zu Freuds Zeiten. So wird nicht mehr die Unterdrückung der kreatürlichen Bedürfnisse zur Quelle des Unbehagens. Unser Lebensglück wird vielmehr bedroht durch die manipulative Ausbeutung unserer Wünsche nach Geltung, verbunden mit der Angst, sich nicht in den Forderungen einer überkomplexen Gesellschaft zurechtzufinden. Diese Angst liest das Kind aus den Blicken der Eltern oder entwickelt sie im Scheitern seiner Anpassung an die Ansprüche einer ebenso reichen wie missgünstigen Kultur.
Die scheiternde Beziehung zwischen Fortschritt und Glück wird im Folgenden an vielen Beispielen und Szenen erläutert. Ich hoffe, dass sie Mut machen, unkonventionelle Wege einzuschlagen, und vor der Versuchung schützen, natürliche Lebensgrundlagen für Rohstoffe zu halten, die wir bedenkenlos in die Fundamente »fortschrittlicher« Projekte kippen können.
Die menschlichen Glücksmöglichkeiten sind sehr flüchtig, sehr persönlich; sie kommen von innen und klingen hohl, wenn sie von außen verordnet werden. Sie wurzeln im Kontrast zwischen Erregung und Beruhigung, zwischen trüben und frohen Stimmungen. Wer sie in feste Formen gießen will, kann das Glück nicht sicher haben, muss eher fürchten, im Festhalten Unglück zu zementieren. Brauchbar für das Glück ist stets die Haltung, anderen und auch sich selbst mit Empathie und Gelassenheit zu begegnen. Diese Haltung speist sich aus der Gewissheit, dass unsere Glücksmöglichkeiten schwinden, wenn wir das Glück erzwingen möchten oder jenen glauben, die behaupten, solches für uns zu leisten.
München, November 2021
Wolfgang Schmidbauer
Einführung
In diesem Buch geht es um einen Widerspruch: Obwohl immer mehr Menschen in wachsendem Wohlstand und steigender Sicherheit vor Krankheit und Gewalt auf dem Planeten leben, steigt jedes Jahr die Zahl derer, die an Depressionen und Ängsten leiden. Das ist statistisch gut beobachtbar und über klinische Diagnosen hinaus in Umfragen, in dem wachsenden Verbrauch von Psychopharmaka und in den Wartelisten psychotherapeutischer Praxen dokumentiert. Ist das nur ein ungünstiger Zufall? Oder könnte es sein, dass es der Fortschritt selbst ist – vielleicht genauer: ein allzu gieriger Umgang mit ihm – der uns in Gefahr bringt, unglücklich zu sein?
Mir kommt dabei eine Fabel von Fuchs und Wolf in den Sinn: Der Fuchs bringt den Wolf auf die Idee, zusammen in den Keller eines Metzgers einzusteigen. Dort angekommen, machen sich die beiden über Würste und Schinken her. Der Wolf schlingt nach Herzenslust, der Fuchs aber unterbricht gelegentlich das Festmahl und quetscht sich durch das Fenstergitter, durch das sie eingedrungen sind. »Was tust du?«, will der Wolf wissen. »Ich sehe nach, ob jemand kommt«, sagt der Fuchs. Irgendwann im Laufe des Gelages stößt der Wolf ein Fass um. Der Lärm weckt den Metzger, er kommt mit einem Knüppel. Der Fuchs kriecht schnell durch das Fenster und entkommt, der Wolf jedoch bleibt stecken und wird verdroschen.
Die Entfernung von der Natur im Sinn einer besseren Kontrolle über die Unberechenbarkeit von Jagdbeute und Sammelertrag ist untrennbar mit der Menschwerdung verbunden: Tierhaltung und Landwirtschaft, Medizin, Infrastruktur und Technik erleichtern den menschlichen Zugriff auf Güter ungemein. Aber wie gehen wir mit dieser Naturentfernung und ihren Früchten um? Haben wir gleichzeitig auch eine bessere Kontrolle über uns selbst entwickelt, die uns erlaubt, die Angebote der fortschrittlichen Welt zu handhaben? Sind wir in der Geschichte der gierige Wolf, der bedenkenlos die Segnungen des Metzgerhandwerks konsumiert, oder der schlaue Fuchs, der die Verführung kontrolliert und sich damit selbst schützt – wie Odysseus, der sich an einen Schiffsmast binden lässt, weil er den verführerischen Gesang der Sirenen hören will, aber um seine zerstörerische Wirkung weiß?
Unsere Möglichkeiten, die Natur zu vertreiben, haben sich in den letzten Jahrhunderten multipliziert. Den wenigsten Menschen ist aber durchweg wohl mit dieser Entfernung. An Wochenenden und im Urlaub entfliehen sie dem städtischen Leben, in das die Industrialisierung immer mehr Menschen gezwungen hat. Als das während der Coronapandemie nicht möglich war, wurden Katzen und Hunde en masse gekauft; Grün wucherte auf Balkonen. Wir sehnen uns nach Wohnorten, in denen Natur und Technik sich versöhnen. Davon können wir gegenwärtig jedoch nur träumen. Dem Fetisch des »stärker und schneller« folgend haben wir unsere Städte autofreundlich statt lebensfreundlich gebaut – daran kann auch die vermeintlich umweltschonende Elektromobilität nichts ändern, zumindest nicht, wenn sie in immer leistungsstärkeren SUVs daherkommt und die Straßen weiterhin verstopft.
Natürlich lässt uns die Naturentfernung nicht kalt – schon das Wort »natürlich« zeigt, dass unser Denken geprägt ist von einer Art Unwohlsein, wenn etwas eben »unnatürlich« ist (es gibt im Deutschen sogar die Steigerung »widernatürlich«, deren Einsatz meist pure Ideologie ist, wenn es beispielsweise um den Kampf gegen so natürliche Neigungen wie Selbstbefriedigung oder Homoerotik geht).
Keiner der frühen Zweifler am Fortschritt konnte voraussehen, womit wir uns heute plagen. Rousseau argumentierte brillant, am Anfang des menschlichen Elends stehe das Eigentum:
Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen ›Dies gehört mir‹ und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ›Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört.‹1
Rousseau konnte nicht ahnen, dass im 21. Jahrhundert nicht nur eingezäunt, sondern auch verbrannt und vergiftet wird. Viele der Schäden durch den Fortschritt lassen sich nicht mehr rückgängig machen, weil sie nicht wie ausreißbare Zäune auf dem Land stehen. Gifte wie DDT, Quecksilber und Weichmacher für Kunststoffe treiben massenhaft in den Weltmeeren. Sie reichern sich am Ende von Nahrungsketten zu gefährlichen Potenzen an – und können nicht mehr aus diesen Kreisläufen entfernt werden. Das ist kein mythischer Sündenfall, es ist ein realer.
Inzwischen hat das Klimaproblem die Umweltvergiftung an Dringlichkeit überholt. Beiden gemeinsam ist der Schritt in Abhängigkeiten, die wie zementiert wirken. Der Autoverkehr etwa ruiniert die Lebensqualität in den Städten und macht sich zugleich unentbehrlich, weil sich dieser Ruin in einem Auto besser ertragen lässt und man mit ihm am Wochenende »in die Natur« entfliehen kann.
Der zweite Sündenfall war die Hingabe an den Zwang, Profit zu erwirtschaften, koste es, was es wolle. Wenn die Beteiligten von toxischen Entscheidungen sofort vergiftet siechen würden, wäre es nie so weit gekommen. Aber nachdem viele Folgen der kapitalistischen Industrie zwar bösartig sind, aber erst später oder weit entfernt von den Konsumenten und Entscheiderinnen eintreten, wachsen die Gefahren.
Nie haben so viele Menschen in so viel Sicherheit und Wohlstand auf dieser Erde gelebt wie gegenwärtig – und nie hatten gerade die Bürger der reichsten Länder so viele und so gut begründete Ängste vor der Zukunft. Jeder Schritt der kulturellen Evolution ist auch ein Schritt vom Hunger zur Angst, jeder Gewinn an Macht über das Leben weckt die Angst vor dem Verlust dieser Sicherheit. Angst macht rücksichtslos und kalt, daher können wir an vielen Orten beobachten, wie kaltes Denken frühere, der Empathie nähere Strukturen überwältigt.2
Je komplexer die Welt wird, desto mehr wächst auch die Anziehungskraft von Lügen, in denen die gegenwärtig sichtbaren, bösartigen Folgen der Entwicklung weggewünscht und wegversprochen werden. Der Ängstliche glaubt nur allzu gerne, dass Gefahren nicht existieren, solange sie ihn noch nicht unmittelbar betreffen, vor allem, wenn eine charismatische Figur ihn darin unterstützt. Neben das Charisma des Ehrlichen, der sich redlich bemüht, den Zustand der ihm Anvertrauten zu bessern, tritt das Charisma des Betrügers. Er vermittelt eine ganz andere Botschaft, die ihm kurzfristig hohe Aufmerksamkeit garantiert: »Ich werde euch zwar nichts von dem Guten geben, das ihr euch wünscht, aber ich kann euch erklären, wen ihr dafür hassen sollt, weil ihr es nicht bekommt!«
In der modernen, individualisierten Konsumgesellschaft hat die Angst ein neues Trägermedium entdeckt: den Neid. Rousseau hat das schon erkannt: Wir gehen zwar nicht mehr hungrig ins Bett, aber wir können nicht schlafen, weil andere erfolgreicher sind, mehr und bessere Dinge haben – schlimmer noch, weil sie bessere Beziehungen haben (oder wir das wenigstens glauben). Missgunst weckt Angst, Angst festigt Missgunst; wo es bestimmt genug gäbe, um allen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, werden die einen in Elend gezwungen, weil die anderen fürchten, alles zu verlieren, wenn sie ein wenig abgeben.
Die immense Macht der Angst wird in einer Rhetorik deutlich, die in vielen Ländern Europas einen Untergang durch arme Eindringlinge befürchtet und mit Slogans wie »das Boot ist voll«3 abwehrt, ohne einen Gedanken daran zu verlieren, dass die Geburtenrate in den meisten europäischen Ländern so gering ist, dass sie auf Zuwanderung angewiesen sind.
Gegenwärtig bräuchten die Spitzenreiter der kulturellen Evolution sechs Planeten von der Größe der Erde, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren. So ist der Gedanke des »zurück« unvermeidbar geworden. Er sollte aber nicht in primitive Nostalgie führen. Das Bild des »edlen Wilden«, der gerne teilt und die Natur nicht zerstört, ist oft mit kritischen Argumenten in Scherben geschlagen worden – und hat sich ebenso oft wieder zusammengefügt. Freud suchte nach einem Kompromiss: Die Kultur ist unvermeidlich, aber muss sie so beschaffen sein, dass die Menschen neurotisch werden und der normengetreue Bürger eine unglückliche Person ist?
Die Fortschritte zu Wohlstand und Sicherheit haben nicht dazu geführt, dass sich die Menschen besser fühlen. Nach Umfragen nehmen Lebensängste zu und die materiell irrige Aussage, dass früher alles besser war, wird von Mehrheiten bejaht. Die Gründe dafür sind komplex. Sie hängen mit einer durchaus realistischen Notwendigkeit zur kulturellen Transformation zusammen, fort von der Verschwendungsgesellschaft, spiegeln aber auch eine einfühlbare Angstdynamik. Wir fürchten uns nicht vor der Vergangenheit – sie ist ja bezwungen, hurra, wir leben noch! – wohl aber vor der Zukunft. So würden manche Menschen gerne aus der Gegenwart in eine idealisierte Wiedergeburt der Vergangenheit flüchten, in eine von anderen Menschengruppen oder Glaubensformen befreite Größe und Macht.
Kapitel 1
Die Regulierung des Lebens
Seit jeher erleben Menschen die Natur als Mutter und Feindin zugleich. Wer in Mitteleuropa einen Garten anlegt, kann sich jeden Tag mit diesem Dilemma beschäftigen. Es grünt, blüht, trägt Frucht, aber der Gärtner muss beständig mähen und jäten. Tut er das nicht, ist sein Garten nach zehn Jahren von Wald bedeckt. Wenn er alljährlich schweißbedeckt seinen Heckenschnitt auf den Kompost wirft, mag er sich an den Mythos vom goldenen Zeitalter erinnern, in dem nach Hesiod die Menschen von süßen Eicheln lebten, Teil der Natur, mütterlich von ihr ernährt, nicht geschwächt von einem unaufhörlichen Kampf.
Hesiod und die Erzähler der biblischen Paradiesgeschichte verbindet der Gedanke, dass es ein Verlust war, Ackerbau und Tierzucht zu erfinden, eine Sünde, Folge verderblicher Verführung. Der Mensch überschreitet dabei eine Grenze. Er will Gott spielen. Er gestaltet die Welt, erfindet Neues, statt zu lassen, was ist, und vom Überfluss zu nehmen. Dieser Gedanke verbindet Freuds Unbehagen in der Kultur mit den Büchern Mose und anderen Mythen, die eine Ambivalenz der Evolution zeichnen.
Der Gestaltungswille, der sich in der neolithischen Revolution zeigt, diente vor allem der Einhegung einer großen Gegnerin: der Angst. Sie macht es uns unbequem in unserer Haut und führt zu einer Sehnsucht nach Größe und Macht, mit denen wir uns sicherer fühlen. Angst hat schon immer Sicherheitsbedürfnisse geweckt, aber die Möglichkeiten, diese Sicherheiten zu erzeugen, waren während der biologischen Evolution minimal und auch in der kulturellen Evolution lange Zeit sehr gering.
Doch irgendwann gelangen die entscheidenden Schritte. Ackerbau und Viehzucht sind wohl die ersten, die wir gut fassen können, obwohl auch ein verbesserter Speer oder ein gefiederter Pfeil dem altsteinzeitlichen Jäger größere Sicherheit schenkten – und damit die Angst verkleinerten, sich am Abend hungrig schlafen legen zu müssen. Und schon bei diesen ersten Errungenschaften wird auch der Schatten der Fortschritte sichtbar: Fernwaffen etwa steigern die Versuchung, sich Mord als etwas vorzustellen, das ohne eigene Gefahr, ohne Konsequenzen möglich ist. Der Täter hält das Leid des Opfers von sich fern – ein Schritt, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn er erst einmal getan wurde.
Seither hat der Mensch seine Möglichkeiten rapide verbessert, das eigene Leben und das Leben um ihn herum zu kontrollieren. Aber was anfangs geeignet schien, Ängste abzuwehren, uns etwa die Sicherheit des Hirten gegenüber dem Jäger, der Gärtnerin gegenüber der Sammlerin zu spenden, ist spätestens seit dem Exzess der Konsumgesellschaft zur mächtigsten Angstquelle von allen geworden. Der Fortschritt hat eine manische Qualität gewonnen – es soll alles für alle in immer besserer Qualität geben.
Manie und Melancholie, Überschwang und Depression sind schon geraume Zeit als psychologische Gegensatzpaare bekannt; wo ihre Extreme destruktiv werden, spricht man von einer zyklothymen, bipolaren oder manisch-depressiven Störung. Wer mit solchen Kranken therapeutisch arbeitet, wird bald entdecken, dass sie in depressiven Perioden hoch motiviert sind, Hilfe anzunehmen, in ihrer gehemmten und bedrückten Stimmung aber wenig verändern können, während sie in den manischen Phasen sehr aktiv und innovationsfreudig sind, aber wenig motiviert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dann verwandelt sich der anfangs bewunderte Helfer schnell in einen Langweiler, den man nicht mehr sehen mag.
Manisch-depressive Erkrankungen sind wohl nur in einer vom Eigentum geprägten Kultur möglich. Nur dort stehen Manikern genug materielle Mittel zur Verfügung, um ihre Manie voll auszuleben. Seit den Anfängen der Psychiatrie ist die Verschwendung ihres Vermögens der zentrale Anlass, Maniker in geschlossenen Stationen unterzubringen. Grenzüberschreitungen sind sozusagen das Ding der Manie, wobei es sich, wie bei allen Psychosen, stets um eine Interaktion zwischen seelischer Störung und sozialem Angebot handelt.
Die manische Illusion weckt den Glauben an totales Gelingen; die kollabierende Größenfantasie droht das Ich zu vernichten. Ebenso verhält es sich mit dem Fortschritt: Kollektiv wollen wir mit ihm immer höher, schneller, weiter. Doch die Konsequenzen unseres blinden Verschwendens der Natur lassen sich nicht länger verdrängen; die Illusion unendlichen, konsequenzenlosen Wachstums bröckelt. Die gegenwärtige Angst in der Kultur reagiert auf nichts Geringeres als den Untergang des menschlichen Lebens durch die drohende Zerstörung des Planeten. So wurde der angstbezwingende Fortschritt ironischerweise zur Angstquelle.
Es überrascht daher nicht, dass einige derzeit einen Blick zurückwerfen: Die ökologische Überlegenheit der steinzeitlichen Kulturen hat neues Interesse an ihnen geweckt. Schließlich haben die Angehörigen dieser Kulturen viele Jahrtausende den Planeten erobert, ohne einen einzigen seiner lebenswichtigen Kreisläufe zu gefährden. Sie blieben ihr Leben lang gleich weit vom Komfort einer funktionierenden Stadt wie von der Hölle eines Bombenkrieges oder den Bedrohungen der Klimakrise entfernt. Lässt sich aus diesem Blick zurück etwas mitnehmen für unser zukünftiges Zusammenleben und das Glück?
Die Forschung über die Jäger- und Sammler-Kulturen macht deutlich, dass es keine »Wilden« in dem Sinn gibt, den der Blick der westlichen Zivilisation entwirft.4 Die Primitiven kennen die Sprache und sie haben Regeln des Zusammenlebens, wenngleich sehr wenige Sanktionen, um diese durchzusetzen. Sie verteidigen sich energisch, wenn es gar nicht anders geht, gehen aber einem Kampf lieber aus dem Weg und lösen Konflikte durch Distanzierung: Wer Streit hat, schließt sich einfach einer anderen Gruppe an. Diese Kulturen zeigen nicht nur deutlich weniger Regulierungsdrang, was die nichtmenschliche Welt angeht; auch die elementaren Momente des menschlichen Lebens werden bei ihnen weniger kontrolliert.
Die Regulierung von Geburt und Tod
Die gesellschaftliche Regulierung von Geburt und Tod ist in der Altsteinzeit den Bedürfnissen der Beteiligten überlassen. Frauen, Männer und Kinder sorgen füreinander, aber auch hier gibt es wenig Sanktionen, wenn ein Mann nicht von einem Jagdzug zurückkommt, weil er sich einer anderen Gruppe angeschlossen hat, oder eine Frau mit einem anderen Mann weiterzieht. Kinder zu bekommen, ist selbstverständlich; ein respektvoller Umgang mit ihnen wurde oft beschrieben. Es gibt aber ebenso keine Strafen, wenn sich eine Mutter gegen ein Kind entscheidet. Das Neugeborene wird sterben, wenn nicht eine andere Frau ihre Aufgabe übernimmt. Entweder ist in der Gruppe, in die das Kind hineingeboren wird, die Wärme da, es anzunehmen und zu beschützen – oder es gibt nach kurzer Zeit das Kind nicht mehr.
Wo der Staat die Fruchtbarkeit der Menschen reguliert, kann diese Wärme verloren gehen. Die traditionelle Gesetzgebung war patriarchalisch und militarisiert. Die Unterbrechung einer Schwangerschaft wurde mit strengen Strafen verboten; das seelische Elend unerwünschter Kinder war dem Gesetzgeber egal. Kinder überleben auch in einer kalten Umgebung, und das System war auf die Produktion möglichst vieler Soldaten zugeschnitten.
Die liberale Wende stellte später nicht mehr den Soldaten, sondern die Konsumentin und den Konsumenten ins Zentrum, daher öffneten sich die Strukturen nach und nach den Frauen und der Sexualität. Schwangerschaften dürfen heute unterbrochen werden, Homosexualität und Transsexualität sind erlaubt. Diese Öffnung ist höchst erfreulich – aber das Problem der Kälte bleibt, es nimmt vielleicht sogar zu, denn statt empathischer Aufklärung wird etwa bei der Abtreibung eine schnelle, »harmlose« Dienstleistung angeboten und vernünftige Aufklärung darüber bisher vom Gesetzgeber tabuisiert. Das verführt zu einer Art Flucht nach vorne, einer Entscheidung, die ohne Einfühlung in ihre existenzielle Dimension vollzogen wird. In der therapeutischen Praxis klagen manche Frauen, die früher eine Abtreibung hatten und jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch, über ihre unbedachte Entscheidung damals. »Ich habe es einfach so gemacht, damit ich es hinter mir habe. Und jetzt weine ich jedes Mal, wenn ich daran denke.«
Wer aus solchen Gedanken lesen möchte, die drakonischen Verbote einer Abtreibung seien eine »bessere« Lösung, denkt am Wesentlichen vorbei. Es geht darum, eine Entwicklung zu unterstützen, nicht sie zu unterdrücken. Das ganze Elend von Debatten über die Regulierung des Lebens steckt in der ebenso dummen wie verbreiteten Auffassung, dass jeder, der gegen ein strafbewehrtes Verbot der Interruptio ist, Abtreibungen »befürwortet«. Wer über das menschliche Glück im Kontext technischer Lösungen nachdenken will, sitzt immer zwischen zwei Stühlen, denn er ist weder dafür noch dagegen und wird deshalb zum Feind der Fanatiker auf beiden Seiten.
Aber nicht nur der menschliche Lebensbeginn, auch das Lebensende wird durch den Fortschritt zunehmend reguliert. Der Tod ist nicht mehr frei, er kann kein Freund der Schwerkranken mehr sein, denen der Weg zurück in ein lebenswertes Leben abgeschnitten ist. Wir haben ihn eingesperrt, er wird von Juristen, Theologen und Medizinern bewacht. Sterbende werden an Orte gebracht, deren Inspiration es ist, Leben zu retten und den Tod zu vertreiben.
Diese Gefangenschaft des Todes schmälert unsere Chancen auf Glück und ein friedvolles Hinnehmen schwerer Situationen. Der mehrfach Beeinträchtigte, von unheilbarem Schmerz Geplagte, dem der Tod als Erlösung vorschwebt, soll über dieses glückliche Bild nicht sprechen. Er stößt auf Kritik, Furcht, Ablehnung, Verschlossenheit. Hier zeigt sich vielleicht am deutlichsten, wie der technische Ausbau eines glücksgesicherten Lebens in sein Gegenteil umschlägt: Wir dürfen nur noch Angst haben vor dem Tod. Ich werde darauf abermals zu sprechen kommen, wenn es später um die Coronapandemie geht.
Die bei Weitem längste Periode unserer Entwicklung haben wir auf der Erde gelebt, ohne uns um das Richtige und das Falsche zu kümmern. Wenn in der paläolithischen Kultur Stammesangehörige nicht mehr für sich selbst sorgen können, werden sie in guten Zeiten, wenn es genug Beute, Früchte, Nüsse oder Knollen gibt, durchgefüttert. In schlechten Zeiten bleibt nichts für sie übrig. Wenn jemand erkrankt, wird ein Schamane gerufen, dem die Geister sagen, ob und wie die Krankheit geheilt werden kann oder nicht. Die Heilung »macht« nicht der Schamane, sie ist ein Gruppenprozess. Wer viele Freunde hat, lebt länger als der Menschenfeind.
Die vielleicht drastischste Regulierung des Lebens ist seine vorsätzliche Beendigung, das Töten. In den archaischen Kulturen gibt es keine Unterscheidung zwischen geplantem Mord und Totschlag und ebenso wenig festgelegte Strafen dafür. Wir wissen nicht viel darüber, aber immerhin so viel, um nicht zu glauben, dass die Primitiven besonders mordlustig sind – und schon gar nicht, wie Diderot unterstellt, dass der Sohn den Vater erschlägt und die Mutter »heiratet«. Sie organisieren keine Kriege; es wird nichts erobert und besetzt, es gibt keine Sanktionen, wenn dem Jäger eine Fährte interessanter erscheint als der Zug gegen eine feindliche Gruppe, zu dem er mit anderen aufgebrochen ist. Es macht keinen Sinn, weite Wege zu gehen, um anderen Jägern die Beute wegzunehmen, denn sie haben womöglich gerade gar keine.
Wenn Jägerkulturen Plünderung und Sklaverei nicht kennen, bedeutet das nicht, dass sie bessere Menschen hervorbringen. Sie sind auch keine Fahnenträger gewaltfreier Kommunikation. Es ist schlicht ihre Lebensform, die es ihnen erspart, das Böse zu kennen, das in jedem Zugewinn an Macht steckt.
Nicht von Anfang an ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Er hat sich selbst dazu verführt, indem er dafür sorgte, dass sich Raub und Versklavung lohnen. Keine andere Macht als die unsere hat uns aus dem Paradies vertrieben, bestrebt, es zu verbessern.
Vorratswirtschaft ist ambivalent: Sie ermöglicht bis dato undenkbare Entwicklungen und Sicherheiten und bringt zugleich Gefahren mit sich, die umso deutlicher werden, je bequemer es sich Menschen im Überfluss machen. Soziale Organisationen wie die Stadt, große Bauwerke, Literatur und systematische Forschung sind nur dort möglich, wo Menschen ihre Tätigkeit nicht immer wieder unterbrechen müssen, um Nahrung aufzutreiben.
Zugleich verlagern sich Konflikte in einer Vorratswirtschaft unweigerlich auf die Verhältnisse zwischen Menschen. Progression und Regression gehorchen nicht mehr dem zyklischen Muster von Hunger, der mobil macht, und Sättigung, die Ruhe bringt. Manche Menschen leisten viel, andere leben auf deren Kosten. Als Adam grub und Eva spann – wo war denn da der Edelmann? Nun, er drohte beiden mit Schaden an Leib und Leben, wenn sie ihm nicht gaben, was er brauchte, um sie vor seinesgleichen zu schützen.
Der Spruch von Adam und Eva gehört in die Zeit der Bauernkriege des 16. Jahrhunderts. Die Aufständischen scheiterten damals an der besseren Organisation der Feudalherren. Ständische, traditionell orientierte Gesellschaften konnten seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Freisetzungsbewegungen, die Hegel und Marx durchleuchtet haben, nicht mehr unterdrücken. Weder Bäuerin noch Bürger erkämpften jedoch in diesem Aufstand ihre Freiheit – sie mochten es für kurze Zeit glauben, aber die neugewonnene Freiheit reichte nur so weit, wie sie dem Kapital nützte, das alle Strukturen auflöst und dem Gebot der eigenen Maximierung unterwirft.
Hier beginnt die eigentliche Verwirrung des Menschen durch die Moderne: Sie hat angeboten, ihn von den bedrückenden Einschränkungen der Traditionen zu befreien, die in der neolithischen Welt nach der Vertreibung aus dem kargen Paradies der Altsteinzeit den ortsfesten Bauern, den arbeitswilligen Leibeigenen, den pflichtbewussten Handwerker schufen und einer winzigen Oberschicht eine Ahnung von Selbstverwirklichung spendeten. Seither kann jeder werden, wohin ihn seine Fähigkeiten tragen.
Aber diese schöne neue Welt ist nicht mehr die Wildnis, in der einst Jäger und Sammler überlebten. Es ist eine von Menschen und ihren Erfindungen gemachte Welt, kompliziert, widersprüchlich, unberechenbar. Sie verändert sich schnell, über Nacht kann etwas nicht mehr sein, was gestern noch da war. In der Jäger-Welt wecken persönliche und kollektive Katastrophen keine Schuldgefühle, wie sie moderne Katastrophen an sich haben. »Ich habe meinen Job verloren, weil mein Mentor sein Vorstandsamt verloren hat – wieso habe ich das nicht früher bedacht?« »Die Häuser meiner Nachbarn wurden von einer Flutwelle fortgerissen – wieso haben wir nichts gegen die klimatischen Veränderungen getan?«
Je größer soziale Gebilde werden, und je mehr Individuen leisten müssen, um einen sicheren Ort in ihnen zu finden, desto größer wird die emotionale Fallhöhe von Sicherheit zu Angst. Schein-Sicherheiten wachsen, deren Bruch heftige Traumatisierungen auslöst und an dem Sinn des sozialen Gebildes zweifeln lässt. Im buddhistischen Gründungsmythos erzählt man sich, dass ein Fürst seinen Sohn vor allem Wissen um das Leid des Lebens bewahren wollte und dafür die ultimative Schein-Sicherheit schuf: Ein Leben komplett ohne Leid. Als der Prinz eines Tages unausweichlich doch mit Krankheit und Tod in Kontakt kam, entfaltete diese Begegnung, weil er so völlig unvorbereitet war, die Wucht, ihn komplett aus seinem luxuriösen Leben zu reißen. Sie macht ihn zum ruhelosen Wanderer, Asketen und Wahrheitssucher.
Die Regulierung des Lebens hin zur Abschirmung aller negativen Seiten mithilfe des Fortschritts – Norbert Elias spricht von einer normativen Pazifizierung der »besseren« Schichten der Gesellschaft – mag auf den ersten Blick beruhigend wirken, überlagert aber im Angesicht der Realitäten des Lebens zunehmend Glücksmöglichkeiten mit Angst.
Die Regulierung des Verhältnisses zum eigenen Körper
Eine weitere Seite des Lebens, die in den fortschrittlichen Gesellschaften massiv reguliert wird, ist das Verhältnis zwischen Selbst und Körper. Die Regulierung dieser Beziehung beginnt bereits im frühen Alter und führt oft zu einer elementaren Störung: dem Scheitern der Autoerotik. Die Freude an den Lustquellen des eigenen Körpers wird spontan entdeckt und im kindlichen Spiel gepflegt, solange Vorbilder oder Eingriffe der Erziehenden diese Entwicklung nicht ablenken oder blockieren. In Kulturen, die eine perfektionistische Auffassung von Sexualität dominiert, wird dieses Spiel entwertet und die primäre Vielfalt der Erotik kanalisiert.
Freud beschrieb, dass der Menschen Seele Schaden leidet, wenn ihnen zu viel Triebverzicht abverlangt wird (jedoch hatte auch er den abschätzigen Blick auf die kindliche Erkundung der Autoerotik nicht ganz überwunden – er sprach vom »polymorph-perversen Erleben des Kindes«). Das Gelingen der Selbstbefriedigung baut eine fürsorgliche Beziehung zum eigenen Körper auf, der als Lustquelle folgerichtig geschätzt und geschützt wird. Wo diese Beziehung fehlt und der Mangel an Autoerotik zu innerer Leere führt, finden die Angebote psychoaktiver Drogen und narzisstischer Fantasien einer grundlegenden Veränderung des Körpers durch Operationen, Anorexie oder sexuelle Transformation ihren Nährboden.
In der viktorianischen Gesellschaft wurden die sexuellen Wünsche in ein Korsett gezwängt. Ihnen mehr Raum zu geben, war ein Schritt zu mehr Freiheit. In der Konsumgesellschaft lösen sich asketische Ideale auf, was jedoch nicht bedeutet, dass das Verhältnis zum Körper heute liebevoll gepflegt wird. Während die Autoerotik in den soldatisch geprägten Gesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts offen aggressiv bekämpft wurde, scheinen die gegenwärtigen Störungen vor allem in der Angst der Bezugspersonen zu wurzeln, ihr Kind entwickle sich nicht »richtig« oder sei nicht »normal«. Freudlosigkeit der Eltern dringt in die kindliche Psyche und erschwert eine lustvolle Selbstfindung.
In unserer Kultur verbindet sich zunehmend narzisstisch besetzter Hedonismus mit technischen Machbarkeitsillusionen und verschleiert Störungen in der Entwicklung eines autoerotisch positiv besetzten Körperselbst – statt Körper vor gefährlichen, schmerzhaften Eingriffen zu bewahren, werden ebendiese Eingriffe oft als schnelle Lösungen für ungeliebte Körper eingesetzt.
Hier sei eine kleine Nebenbemerkung zur Gegenüberstellung »natürlicher« Entwicklung und »technischer« Lösungen erlaubt: Der Gedanke, dass »Natur« eine steuernde Rolle im menschlichen Erleben spielen sollte, wird nicht selten mit faschistischen und rassistischen Ideologien in Verbindung gebracht. Er ist in der Tat aufgegriffen und missbraucht worden, um eine an der bürgerlichen Emanzipation bereits gescheiterte patriarchale Position quasi als »natürliche Rolle« von Mann und vor allem Frau neu zu beleben. Das geschah insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert, prägt aber eine »Soziobiologie« oder auch »Humanethologie« genannte Pseudowissenschaft bis heute.5
Die Einstellung zur Autoerotik ist hier ein brauchbarer Signalgeber, ob differenziert über die Anforderungen der »Natur« an die menschliche Psyche nachgedacht oder eine Ideologie des Natürlichen als Machtinstrument missbraucht wird. Das Menschenbild des Faschismus und Nationalsozialismus wurzelt in einer heroischen, jeder Autoerotik feindlichen Auffassung des Körpers, die sich bis zur Feier des Todes steigern kann.6