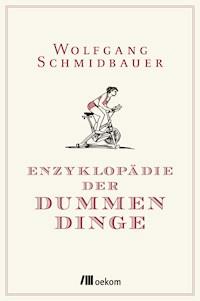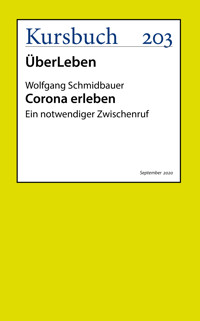Vorwort
In den frühen Sechzigerjahren finanzierte ich mein Psychologiestudium als Werkstudent und begann Artikel für ein medizinisches Magazin zu schreiben. Mein Chef, Ildar Idris, reiste oft nach Amerika und brachte von dort Rahel Carsons Buch Silent Spring mit, eine flammende Kritik an dem Missbrauch der Insektizide in der landwirtschaftlichen Produktion. Erst wird das Gift mit dem Flugzeug ausgebracht, dann sterben die Vögel. Das Gift wird ins Meer geschwemmt. Am Ende enthält die Muttermilch von Eskimofrauen so viele schädliche Chemikalien, dass sie als Nahrungsmittel nicht zugelassen würde.
Ich verliebte mich kurz nach einer Rezension von Carsons Buch in eine Dolmetscherin und bezog wenig später zusammen mit ihr ein Steinhaus über dem Mugello nördlich von Florenz. Eine traumhaft schöne Landschaft und darin ein verlassenes Gehöft, das für ein paar tausend Mark zu haben war. So begann ein Aussteigerleben1, finanziert durch den Medizinjournalismus, in einem Haus ohne Elektrizität, ohne fließendes Wasser, mit einer für Ochsenkarren, aber nicht für Automobile geeigneten Zufahrt.
Experimentierfreudig und sparsam unterwarfen wir uns diesem Haus, statt es den Ansprüchen des zivilisierten Wohnens in Mitteleuropa anzupassen. Wir flickten das Dach, säuberten die alte Wasserstelle unter dem Haus und entdeckten, dass ein Leben ohne Komfort nicht nur möglich, sondern auf einer emotionalen Ebene geradezu luxuriös ist – kein Autolärm, Holz aus dem Wald, Wärme aus dem offenen Kamin, Wasser von der Quelle, Licht von einer Petroleumlampe. Keine teuren Geräte, keine Zeitfresser.
Wenn heute mein Computer streikt und ich die Expertin brauche, denke ich an die mechanische Schreibmaschine von damals, die sich nach dem Abnehmen der Verkleidung meinem Verständnis ihrer elementaren Funktionen bereitwillig öffnete: Farbband einlegen, Typen ausrichten, ein paar Tropfen Öl, alles ist wieder gut. Wir gingen zu Fuß zu dem VW-Käfer und fuhren zweimal pro Woche zum Einkaufen. An Fremdenergie verbrauchten wir 1969 im Monat tausend Lire (damals ungefähr sechs Mark) für Kerosin und Propangas.
Umweltgifte waren eines der Themen, über die mir Bücher zur Rezension und Artikel für Magazintexte zugeschickt wurden. Ich hatte Psychologie studiert, mich in die Naturwissenschaften und in die Medizin passabel eingearbeitet, schrieb an einer Promotion, beschäftigte mich mit antiautoritärer Erziehung, mit Psychohygiene, mit einem Leben, das sich auf die wichtigen Dinge konzentriert und nicht von der Jagd nach Luxus und Gewinnmaximierung vergiftet ist. Warum also nicht den Verschwendern ins Gewissen reden, auch die Motive der Verführten und Gleichgültigen bloßstellen, nicht nur die der profitgeilen Verführer in der chemischen Industrie? Würde nicht so viel Überflüssiges gekauft, das uns abhängig, aber nicht glücklich macht, dann stünde es besser um die Welt! Was waren die Motive, die eine vernünftige (»sapiens«) Lebensform in eine destruktive verwandeln? Ist es die schon in der frühen Kindheit beginnende orale Frustration durch den Ersatz der Mutterbrust durch die Flasche, sind es die analen Fixierungen, die nur den rasierten, desodorierten, parfümierten und geschminkten Körper attraktiv erscheinen lassen, sind es die Leistungsfixierung und die in ihr wurzelnde Freudlosigkeit, wenn Kinder nicht einfach sein können, was sie sind, sondern »gut« sein müssen, gut nach den Vorstellungen der Eltern? Durch Leistungsdenken verkümmert, zentriert sich das Ich von Homo consumens neu um das Sich-leisten.
Homo consumens. Der Kult des Überflusses war der Titel des ersten konsumkritischen Buches, das 1972 erschien; es wurde viel rezensiert, viel getadelt (auch Jesus wäre mit dem Auto gefahren, hätte er eines gehabt, schrieb ein Rezensent in der ZEIT). Die Schlussprognose – Homo consumens sei wie der Dinosaurier zum Aussterben verurteilt; es hänge von uns ab, ob Homo sapiens ihn überlebt – ist inzwischen Allgemeingut; Harald Welzer hat sie jüngst als die Alternative zwischen design and disaster beschrieben: Entweder entwerfen und bauen wir eine zukunftsfähige Kultur, oder wir werden von der Katastrophe überrollt.
Das Buch über Homo consumens hat seit 1984 als Taschenbuch seinen lateinischen Titel eingebüßt und unter dem Titel Weniger ist manchmal mehr noch eine Reihe von Auflagen erlebt. 2010 hat meine Tochter Lea ein E-Book herausgebracht, in dem beide Titel kombiniert wurden: Homo consumens. Weniger ist mehr.
Mir schien der Text später zu moralisierend und zu pathetisch. Als ich ihn schrieb, war ich kaum dreißig Jahre alt und hatte keine klinische Erfahrung als Psychotherapeut. Die Leser urteilten freundlicher. Da es einer der ersten psychologischen Texte zur Ökologie war, wurde ich später gelegentlich von Verlagen angefragt, ob ich nicht eine neue Fassung schreiben wolle. Ich las dann einige Seiten wieder – und gab auf. Erst in den letzten Jahren, angeregt durch verschiedene Tagungen – zuletzt durch eine zum Gedenken an Small is beautiful –, kam ich zu dem einzig realistischen Plan: Ich musste das Ganze von Grund auf neu fassen, einen Ansatz finden, der meinem gegenwärtigen Verständnis entsprach.
Raubbau an der Seele greift den Gegensatz von Homo sapiens und Homo consumens jetzt wieder auf, an einem aktuellen gesellschaftlichen Problem: der wachsenden Gefährdung von Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit durch Depressionen und ihre Vorstufen, wie Burn-out, Mobbing und Stalking. Bedrohlich ist nicht allein das depressive Leid, sondern auch dessen Behandlung durch chemische Stoffe, die in vielen Fällen mehr schaden als nützen. Vor allem verschleiern antidepressive Medikamente den Hintergrund der depressiven Symptomatik, den kulturellen Prozess, der ihre Voraussetzungen herstellt.
Die Depression entsteht nicht aus mikrobiologischen Mangelzuständen an den Verbindungen der Nervenzellen. Was sich da nachweisen lässt, ist nicht Ursache, sondern Folge eines unbewussten Geschehens, in dem Gesellschaft und Individuum einander ergänzen. Die Depression folgt dem Zusammenbruch von seelischen Strukturen, die sich als unerfüllbare Erwartungen oder als manische Abwehr beschreiben lassen. Sie hängen eng mit den Verleugnungsstrategien und Verwöhnungsbedürfnissen des Homo consumens zusammen.
EinleitungZur Ökologie der Depression
Die kannibalische Dynamik der Konsumgesellschaft spiegelt sich in der individuellen Psyche. Wie die hoch entwickelten Gesellschaften bis zu sechsmal mehr Energie und Rohstoffe verbrauchen, als sich auf dem Planeten regenerieren können, so wächst auch in den Konsumgesellschaften die seelische Erschöpfung und nimmt bedrohliche Formen an. Die Depression wird zur häufigsten Ursache der Unfähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. In armen Ländern sind Entspannung, Lebensfreude und Bereitschaft zum Lachen leichter zu finden als in den reichen. Dort dominieren Ängste.
Ein Verständnis der Depression wird durch falsche Alternativen behindert, jener zwischen nature or nurture (»Erbe oder Umwelt«) ebenso wie jener zwischen »Schuld oder Schicksal«, »Krankheit oder Verantwortung«. Anlagen werden durch die Umwelt entwickelt und verwirklicht. Es ist gleich absurd zu behaupten, Intelligenz oder eine Psychose sei »angeboren«, wie sie seien »anerzogen«. Falsche Alternativen sind ein Ausdruck unbewusster Ängste: Wir suchen fanatisch nach Sicherheit in einem unübersichtlichen Feld. Wer in Panik handelt, sieht nur Schwarz oder Weiß und stürzt sich bedenkenlos ins Licht.
Vereinfachungen machen Entscheidungen leichter und helfen, Störendes zu entsorgen. Dann liegt dieses Störende in einer Schublade, auf der »Krankheit« steht und für deren Inhalt das Medizinsystem zuständig ist. In diesem Sinn ist Depression – ebenso wie Alkoholismus – eine »Krankheit«. Vernachlässigt wird, dass es Erscheinungen gibt, deren Bedeutung wir durch den Krankheitsbegriff begrenzen, ja abwehren.
Wer die Anlage zur Chorea Huntington in sich trägt, wird irgendwann schwer krank, egal, in welchen Umständen er aufwächst und lebt. Aber niemand kann Alkoholiker in einer Kultur werden, in der kein Alkohol produziert wird.
Bei der Depression ist es etwas komplizierter. Sicher ist, dass frühkindliche Erfahrungen und soziale Einflüsse eine wichtige Rolle in diesem Geschehen spielen. Sie sind aber nicht so leicht dingfest zu machen wie eine Droge oder ein Virus.
Kein Kundiger wird in der Behandlung eines an Chorea Huntington Erkrankten an dessen Verantwortungsgefühl und Entscheidungskraft appellieren, aber in der Behandlung von Alkoholikern und Depressiven wird dies ständig getan. Komplexe Störungen wie Sucht und Depression existieren an einem Ort, der dem Limbo des Mittelalters entspricht. Es sollte jene Seelen aufnehmen, die weder in den Himmel noch in die Hölle gehörten. Jetzt will die Gesellschaft sie an die Medizin loswerden. Wenn die Ärzte ihre Arbeit ernst nehmen, versuchen sie durchaus, diese Störungen zurückzuexpedieren.
Woher kommen Depressionen? Der wichtigste schädliche Einfluss in der Konsumgesellschaft ist die Angst der Eltern, dass aus dem Kind »nichts werden« könnte. Sie prägt das Kind stärker, als die Eltern es bemerken und beabsichtigen. Seine Verinnerlichung von Angst und Unruhe führt dazu, dass die entsprechenden seelischen (und nervösen) Strukturen überaktiv werden. Insbesondere Eltern, die ihre eigenen Traumatisierungen gerade noch kompensieren können, wollen dann »das Beste« für ihre Kinder – und setzen sie unter einen Druck, der deren seelische Entwicklung belastet.
Die Überschätzung von Leistung und Anpassung als Grundlage des Selbstgefühls in unseren Gesellschaften ist den Depressionsgefährdeten nicht bewusst. Sie finden diese Position völlig »normal«. In der Konsumwelt ist die Orientierung an einer täglich erlebten Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und an einem handwerklichen Streben nach guter Arbeit zurückgetreten. Sie wird durch einen unpersönlichen, nicht mehr auf Handwerkliches gerichteten Perfektionismus ersetzt – ein angesehener Beruf, viel Geld verdienen, attraktiv sein, attraktive Partner finden. Solange das Streben nach Perfektion handwerklich geordnet bleibt, schadet es nicht. Sobald es sich aber auf Gefühle, Beziehungen, Charaktereigenschaften oder soziale Anerkennung richtet, wird es zum Verhängnis. Denn die perfekte Liebe gibt es so wenig wie den perfekten Chef oder die perfekten Eltern.
»Da, wo du nicht bist, ist das Glück!«
»Ich kann nicht spazieren gehen. Der Englische Garten ist voller glücklicher Paare!« Dieser Satz einer depressiven Patientin zeigt die Hartnäckigkeit, mit der ein Lebensgefühl den Menschen in die Moderne begleitet, das historisch mit Begriffen wie »Melancholie« oder auch »romantischer Isolation« verknüpft wird. Gegenwärtig wird es eher als Versagen der Versorgung unserer Synapsen der medizinisch-pharmakologischen Verwertung zugerüstet.
Die letzte Zeile des 1821 veröffentlichten Gedichts von Georg Philipp Schmidt von Lübeck wird oft zitiert, um die romantische Weltsicht zu beleuchten. Sie ist vor allem in der Vertonung durch Franz Schubert unter dem Titel Der Wanderer bekannt geworden und steht in den geläufigen Deutungen für die Unvereinbarkeit des romantischen Ichs mit der Alltagswirklichkeit (Ich bin ein Fremdling überall), der Sehnsucht nach einem Land, in dem Träume Wirklichkeit werden.
Depressive denken während der Arbeit mit Kummer daran, dass sie bei schönstem Wetter am Schreibtisch sitzen und sich mit fremdbestimmten Aufgaben quälen müssen. Wenn sie endlich das tun, wovon sie während der Arbeit geträumt haben, etwa auf einer Parkbank zu sitzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen – dann quälen sie sich mit Selbstvorwürfen, dass sie jetzt faulenzen, statt zu arbeiten.
Das melancholische Lebensgefühl, in dem aus dem Unbewussten auftauchende Stimmungen und Gedanken den unbefangenen Genuss der Gegenwart erschweren, ist in der antiken Medizin mit einem Übermaß schwarzer Galle verbunden worden. In der von der Pharmaindustrie geprägten Psychiatrie der Gegenwart hat vielfach ein genetisch bedingter Mangel an Serotonin diese Rolle übernommen. Beide Erklärungen entlasten das Ich von einem Rätsel: »Ich bin gesund, habe eine liebende Frau und wohlgeratene Kinder, einen sicheren Beruf – und bin dennoch unglücklich, kann mich nicht freuen, denke an Selbstmord.«
Kulturwissenschaftliche und psychologische Aspekte zur Depression haben es gegenwärtig schwer, sich zu behaupten. Das ist im Grunde nicht verwunderlich. Wer selbst depressiv ist oder Depressionen erforscht, steht wie in der alten Allegorie über Tugend und Laster an einem Scheideweg. Die eine Straße ist breit und bequem, die andere steil, unübersichtlich und mühevoll. Die neurobiologischen Hypothesen entlasten die Kranken ebenso wie ihre Ärzte und fördern den Umsatz einer mächtigen Industrie. Freilich reduzieren sie auch die Möglichkeiten, die Inszenierung des Kummers und seine Wurzeln in Familie, Biografie und Gesellschaft freizulegen.
In der Allegorie führt der breite, bequeme Weg in die Hölle, der steile und schwierige ins Paradies. Seit wir nicht mehr an solche Jenseitswelten glauben, scheint weniger denn je gegen breite und bequeme Wege zu sprechen. Aber das hat Menschen noch nie daran gehindert, klettern zu gehen, statt mit der Seilbahn zu fahren. In diesem Sinn wird hier versucht, das Geheimnis der Depression zu entschlüsseln.
Ich beginne mit einer Geschichte, die den Einbruch einer Depression in das Leben einer Siebenjährigen beleuchtet. Sie hatte die Mutter um Erlaubnis gebeten, einen Jahrmarkt zu besuchen, der in ihrem Heimatort veranstaltet wurde. Dort sah sie am Geschäft eines Schaustellers zum ersten Mal in ihrem Leben eine mechanische Orgel in vollem Betrieb. Der Eindruck war überwältigend. Eine wunderbare, den ganzen Körper durchdringende, rhythmische Musik griff nach ihr und wie eine Geisterhand in sie hinein. Dazu kam noch das Schauspiel von silbern glänzenden Figuren, die im Takt des Schmetterns der Pfeifen auf kleine Trommeln und Tamburine schlugen. Die Siebenjährige war begeistert, sie versank in den Anblick, ließ sich mitreißen, von Entzücken erfüllt.
Dann stieg eine Spannung in ihr auf, der Genuss trübte sich, sie wäre am liebsten weggelaufen und konnte es doch nicht. Allmählich nahmen ihre Trauer und Furcht Gestalt an: Sie stand hier allein, sie genoss dieses atemberaubende Schauspiel allein und egoistisch. Sie hatte nicht an ihre Mutter gedacht, die zu Hause war und dieses Schöne nicht genießen konnte. Jetzt wusste das Mädchen genau, was zu tun war: zur Mama laufen, sie herbeiholen, damit auch sie dieses Schöne genießen, den Rausch der Töne und Bewegungen mit ihr teilen konnte.
Gedacht, getan. Die Mutter stand in der Küche und war beschäftigt. Erst begriff sie nicht, was ihre Tochter wollte. Die Kleine war so eifrig, fordernd und fast den Tränen nahe, wenn die Mutter nicht gleich mitkommen würde, um auch zu sehen, was da so schön war, dass es unbedingt gesehen werden musste, Figuren, die Musik machten, bitte, bitte, komm doch mit, es dauert nicht lange!
Endlich trocknete die Mutter die Hände an der Schürze ab, hängte sie an den Haken und ging mit. Dann stand sie neben der Tochter und sah die Jahrmarktsorgel, die sie schon ein Dutzend Male gesehen hatte. Was sollte das Besonderes sein? Da war nichts Besonderes, ein Musikautomat, nichts weiter! Schritt für Schritt, während das Kind den Mangel an Begeisterung bei der Mutter sah, verschwand auch die eigene Begeisterung. Die Orgel war nicht mehr schön, die Musik klang blechern und gewöhnlich, konnte es sein, dass es immer dieselbe Melodie war? »Was soll das schon sein? Für dieses Gedudel hast du mich von meiner Arbeit weggeholt! Das nächste Mal überleg dir das vorher!«
Das Kind verstand jetzt selbst nicht mehr, warum es die Mutter hatte dabeihaben wollen. Es hatte die Freude an der Orgel und an dem ganzen Jahrmarkt verloren, ging mit der Mutter nach Hause, fühlte sich erschöpft und müde.
Die Mutter hatte sich ihr Leben anders vorgestellt. Ihr Ehemann war Beamter, Richter, eine gute Partie, sie musste froh sein, dass sie ihn bekommen hatte, er war gut zu ihr, aber – und durfte sie das überhaupt denken? – er war langweilig, pedantisch, erzählte nie etwas von seiner Arbeit, erzählte eigentlich überhaupt nie etwas, lebte so dahin, wollte das Kompott zum Nachtisch angewärmt, er hatte einen empfindlichen Magen.
Sie versorgte die Kinder, das war nun einmal ihre Pflicht. Sie war streng zu ihnen, schlug sie manchmal. Wenn schon sie ihre Pflicht tun musste – dann konnte sie auch den Kindern keine Nachlässigkeiten durchgehen lassen. Der Vater mischte sich selten ein. Erziehung war Frauensache.
Während man sich in das Ende der Szene leicht einfühlen kann, gleicht ihr Anfang durchaus dem Rätsel, welches das Einsetzen der Depression bei Erwachsenen umgibt. Was hindert die Siebenjährige, den von ihr soeben entdeckten Genuss alleine auszukosten, bis er sich erschöpft und beginnt, die kleine Zuschauerin zu langweilen? Warum hat sie plötzlich keine Freude mehr, sondern Angst, die sie dazu zwingt, die Fantasie zu entwickeln, sie müsse die Mutter dazu bringen, sich ebenso zu freuen wie sie?
Die Analyse der Kindheitserinnerung ergibt, dass das kleine Mädchen eine angespannte Beziehung zur Mutter hat. Es beneidet die Mutter um ihre Privilegien und ihre Macht, um den Platz an der Seite des Vaters. Es nährt in sich Gefühle, von der Mutter gegenüber dem Bruder benachteiligt zu sein. Zu den elementaren Qualitäten des menschlichen Erlebens gehört es nun, dass wir bedeutungsvolle Personen, von denen wir uns abhängig fühlen, durch die Brille der eigenen Affekte sehen.
Wer sehr bedürftig ist und sich die Liebe, die ihm mangelt, am liebsten mit Gewalt holen würde, fühlt sich von einem Vampir bedroht, der ihm das Blut aussaugt. Und wer neidisch ist, fühlt sich vom Neid bedroht, wenn er etwas genießt und nichts abgibt.
In dem Glücksmoment hat das Mädchen die Mutter vergessen. Es hat sich entspannt und in der Begegnung mit dem schönen Erlebnis treiben lassen. Dann meldet sich mit einem Schlag die Angst. Das Kind erschrickt vor sich selbst, vor seiner Sorglosigkeit, seiner Nachlässigkeit. Für einen viel zu langen Moment hat es nicht an die Mutter gedacht und sich seiner Autonomie erfreut. Die Mutter war ganz überflüssig, alle Pflichten, welche die Mutter ihm auferlegte, waren vergessen – lebte die Mutter noch, oder war sie vielleicht sogar schon verschwunden, war verstorben, war einfach weg? Das Kind erschrak, wie jemand erschrecken mag, der sich nach dem Tod eines nahestehenden Menschen zu dauernder Trauer verpflichtet fühlt und plötzlich bemerkt, dass er gedankenlos seinen Tee und sein Sandwich genossen hat.
Die Angst, die solcher Genuss auslöst, hängt mit der Fantasie zusammen, dass die Mutter mich ebenso beneidet, wie ich sie beneide, dass sie mir die Freude nicht gönnt und ich schleunigst dafür sorgen muss, dass sie diese Freude mit mir teilen kann, sonst muss ich ihre Rache fürchten. Der von Neid und Aggression geprägte Teil der unbewussten Fantasie dringt nicht an die Oberfläche, wohl aber die elementare Lösung: der Zwang, die jetzt mit Angst besetzte Freude zu teilen, dadurch den Neid zu überwinden und die Unterstützung der Mutter zu gewinnen, auf die zu hoffen das Mädchen trotz aller Enttäuschungen nicht aufgegeben hat.
Viel von unserem im Alltagsverhalten verwurzelten Streben nach Ordnung, Stille und Sauberkeit hängt mit Strukturen zusammen, die einmal gegen die unbekümmerte Haltung des Kindes errichtet wurden. Wer ein schräg hängendes Bild gerade rückt, weil es ihn »stört«, wer nur in einer aufgeräumten Küche seine Mahlzeit genießen kann, wer sich für ein ungemachtes Bett oder auf dem Boden liegende Wäsche entschuldigt, verrät in diesen leisen Irritationen die einst mächtige Angst des Kindes vor dem Urteil der Mutter. Er hat damals Sicherheit gefunden, indem er sich mit dieser Mutter – die er durchaus als bedrohlich erlebte – identifizierte.
Obwohl diese Optimierungsgeste auf den ersten Blick nichts mit der Depression zu tun hat, haben beide doch eine ähnliche Wurzel in einer Leistungshaltung, die während des Wandels von der bürgerlichen Kultur zur globalisierten Konsumgesellschaft universelle Konstante geworden ist. Der Glaube an die Optimierung hat den gleichen Hintergrund wie die manische Abwehr, deren Zusammenbruch die Depression auslöst.
Von einer manischen Abwehr sprechen wir, wenn Grenzen geleugnet, Eindrücke verdrängt werden, welche einer primären Fantasie von Glück und Gelingen widersprechen. Ich bin das Lieblingskind meiner Eltern, meine Freunde werden mich nie hintergehen, mein Partner ist absolut treu, meine Kinder werden mir ihr Leben lang dankbar sein. Eine solche Abwehr ist in den gegenwärtigen sozialen Strukturen weit weniger auffällig als ihr Fehlen.
Der unverwundbare Held ist ein Symbol der Größenfantasie, die sich als zentraler Inhalt der manischen Abwehr fassen lässt. Eigentlich müsste im Leben alles klappen, alles gelingen. In der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit mäßigt sich unter günstigen Bedingungen die primäre Größenfantasie. Humor und Distanz werden möglich. Dann gelingt es dem Individuum, Niederlagen zu verarbeiten, ohne zu verzweifeln.
Je rigoroser und kritikresistenter die manische Abwehr aufgebaut wird, desto schwieriger wird es, ihr Scheitern zu ertragen. Es liegt ja eine innere Logik darin, dass am meisten an einer Größenfantasie kleben bleibt, wer wenig Anerkennung und Einfühlung erfährt. Im Alltag werden Größenfantasie und manische Abwehr (welche die Grandiosität stützen und verteidigen soll) als »Stolz« und als »Alles oder nichts« fassbar. »Ich reite keinen Esel; lieber bleibe ich sitzen!«, sagt der Stolze. »Besser schlecht geritten als sitzen geblieben«, sagt der Reisende, der seine Größenvorstellung mäßigen kann.
In der Konsumgesellschaft konserviert ein kulturelles Versprechen spezifische Formen der Größenfantasie und schützt sie durch eine besondere Form der manischen Abwehr vor einer an sich hilfreichen Distanz. Wir sollen glauben, dass das Leben durch Leistung kontrollierbar wird. Wer genug leistet, kann sich Sicherheit und Glück kaufen. Aber was ist genug? In den archaischen Kulturen des Hungers ist dieser Zustand einfach zu finden. Wer satt ist, kann aufhören, nach Essbarem zu suchen. In den Zivilisationen aber dominiert der Wunsch nach Sicherheit und in ihm die Angst. Dieses Bedürfnis ist unersättlich.
Schon früh und mit großem Druck wird dem Kind vermittelt, dass es, wenn es etwas werden will, gute Leistungen in der Schule und gute Beziehungen zu Gleichaltrigen haben muss. Unbewusst fließt ein, dass der gute Zustand (»ich bin nicht wertlos, ich bin wertvoll«) zwangsläufig eintreten wird, wenn die Leistung erbracht ist.
Die Mutter hat Angst vor ihren Verpflichtungen, zu erziehen und dafür zu sorgen, dass aus dem Kind das sozial Erwünschte wird. Und das Kind hat Angst vor dieser Mutter. Sie soll das Kind entlang der spezifischen kulturellen Anforderungen prägen. Seither sind unsere frühen Beziehungen neben Liebe und Fürsorge auch von Fremdheitsgefühlen, Ängsten und Aggressionen bestimmt. Diese Affekte färben die Identifizierungen und Introjekte, aus denen sich die inneren Strukturen der Psyche aufbauen. Der Unterschied zwischen den Kulturen des Hungers und den Kulturen der Angst liegt vor allem darin, dass die Menschheit es in der Beherrschung der Natur so weit gebracht hat, dass fast alle Gefahren nur noch von unseren Mitmenschen her kommen.
In der Situation des Kindes vor der Jahrmarktsorgel wird die Angst vor dem Neid der Mutter fassbar. Das Kind erlebt die Situation nicht naiv und erfreut sich an ihren Reizen; es will etwas richtig machen, es will gut sein. Die Orientierung an der im eigenen Inneren wachsenden Lust oder Unlust wird durch eine komplizierte Struktur ersetzt, in der die Fantasie über die Reaktionen der ambivalent erlebten Mutter das Verhalten prägt. In dem Bestreben, die Mutter herbeizuholen und in ihrer Freude die eigene Freude zu steigern, wird ein Stück der Größenvorstellung deutlich, die Mutter in die eigenen Glücks- und Erlösungsvorstellungen einzubeziehen.
Das Ich der Depressiven erlebt weder Angst noch Neid und Wut, nur Erschöpfung, Freudlosigkeit und Unlust. Die Aggression richtet sich, wo sie wahrnehmbar ist, nicht gegen Nahestehende, sondern in Gestalt von Schuldgefühlen und der Überzeugung, alles falsch gemacht zu haben, gegen das eigene Ich. Die Größenfantasie ist im Negativ fassbar, ist es doch ebenso schwierig, im Leben alles falsch zu machen wie alles richtig.
Der Zustand nach dem Zusammenbruch der manischen Abwehr ist höchst quälend, weil er sich in allen ernsteren Fällen sozusagen verknotet: Angst vor der Depression, verstärkte Angst angesichts der nicht weichen wollenden Depression, Gefühle zu versagen, nichts zu taugen, nichts wert zu sein, die sich aus der depressiven Hemmung der Initiative ergeben und diese vertiefen.
Dazu kommt der Druck durch eine fordernde Umwelt, die auf ehrgeizige, tüchtige, allseitig funktionierende Individuen zugeschnitten ist. Wo auch immer, wie auch immer wir leben wollen: Überall ist das Aufwändige, Undurchschaubare und psychisch Belastende leichter zu haben – im Wohnen, im Essen und Trinken, in der Mobilität, in der Berufsarbeit. Seelische Ressourcen gehorchen den Gesetzen der Ökologie: Sie regenerieren sich, wenn wir sie mäßig ausbeuten. Wenn aber die Grenze zum Raubbau überschritten wird, kippt das System, schon minimale Belastungen überfordern es. Jahrelang hat der Sachbearbeiter täglich hundert und mehr Vorgänge erledigt – jetzt schafft er es nicht mehr, einen Brief zu öffnen, den er im Kasten findet.
Die Antwort der Konsumgesellschaft auf solche Kippphänomene ist vorhersehbar: Man dringt nicht etwa zur Wurzel des Übels vor und ändert dort etwas, sodass die Regeneration wieder eine Chance hat. Sondern man vermarktet mit hohem Aufwand und komplizierter Rhetorik ein Mittel gegen die Folgen.
1Die fatale Attraktion der Antidepressiva
Von der Pharmaindustrie unabhängige Forscher sind sich weitgehend einig, dass die Wirkung antidepressiver Medikamente 1. nicht auf dem von den Herstellern behaupteten Mechanismus der »Erschöpfung« des Botenstoffs Serotonin im Gehirn beruht und 2. bei der weit überwiegenden Zahl behandelter Patienten die Wirkung des geläufigen Placebo aus Milchzucker nicht übersteigt.
Wie lässt sich dann der wachsende Umsatz solcher Medikamente verstehen?
Eine Analyse dessen, was hier geschieht, ist zugleich eine Analyse der verwickelten Beziehungen zwischen Arzt und Patient in der Konsumgesellschaft, der Werbung in einem von starken emotionalen Bedürfnissen bestimmten Feld und dem strategischen Vorgehen der beteiligten Industrie. Und sie ermöglicht tiefe Einblicke in seelische Zurichtungen, welche der 1972 versuchten Unterscheidung eines Homo consumens vom Homo sapiens neue Aspekte hinzufügen.
Wenn wir die Vorgeschichte einer Depression verstehen, verstehen wir auch die seelischen Vorteile einer Zuschreibung von »organischen« Ursachen. Zu dieser Vorgeschichte gehört ein soziales Milieu, das parallel zur Entwicklung der modernen Gesellschaft mehr und mehr von abstrakten pädagogischen Forderungen geprägt wird.
In einer Jägerkultur muss niemand dem Kind mit viel Nachdruck beibringen, nicht zu naschen. Alle essen alles, essen, was sie finden können, Verzicht wird von der Natur auferlegt, nicht von den Eltern. Die Kinder werden nicht geschlagen, nicht bestraft, wenn sie nicht still sitzen. Das Leben in einer solchen Kultur ist hart, aber dieser Härte sind alle unterworfen, sie wird nicht geschaffen, um das Verhalten der Kinder entlang von Erwartungen zu kanalisieren, die für das Kind unverständlich sind.
Heute werden die Erwachsenen von den Kindern grundsätzlich ambivalent erlebt. Vor allem sind das gerade jene Erwachsenen, die dem Kind am nächsten stehen, zu denen die intensivste Beziehung besteht, die am meisten als Rollenmodell verinnerlicht werden. Manche Eltern drohen mit Liebesentzug, ja Strafe, wenn das Kind nicht lernt, abstrakte Normen – etwa still zu sitzen, sich Schriftzeichen zu merken, mit Zahlen umzugehen – zu erfüllen. Andere bemühen sich, keinen Druck auf das Kind auszuüben. Dennoch kann auch hier das Kind die Ängste der Eltern unbewusst aufnehmen, es könnte versagen.
Die Depression wird in ihrem lebensgeschichtlichen Kontext verständlich, wenn wir die Dreifaltigkeit von Angst, Aggression und Anpassung betrachten. Das Kind reagiert spontan mit Wut auf die Zwänge, seine Wünsche zu kanalisieren, auf die Ausführung von Impulsen zu verzichten, sich den Forderungen nach Anpassung zu unterwerfen. Aber es muss lernen, diese Wut zu unterdrücken, sie nicht mehr zu spüren, »lieb und brav« zu sein, um die brüchigen Elternbilder zu stützen. Es bemerkt die Ängste der Eltern und lernt, sich so zu verhalten, dass die Eltern weniger Angst haben und es ihnen gut geht, denn das bedeutet auch für das Kind ein höheres Maß an Sicherheit.
Die Schritte von der Orientierung am Hunger zur Orientierung an der Angst erfordern viele Entscheidungen, in denen komplexe Zusammenhänge langfristig angegangen und Interessenkonflikte bewältigt werden sollen. Nach dem Verlust der Orientierung am Hunger müssen erheblich mehr Gefühle von Schuld und Scham verarbeitet werden; insgesamt wachsen die Forderungen, schnelle Emotionen zu stoppen, sie durch gründliche Überlegung zu klären und zum Teil dauerhaft zu unterdrücken.
In einer auch an ökologischen und evolutionstheoretischen Gesichtspunkten orientierten Sichtweise dreht sich die Betrachtung der Depression sozusagen um. Unsere Psyche ist zunächst von den Lebensformen der Altsteinzeit strukturiert, einem intakten Wechselspiel von Anspannung und Entspannung. Dieses Wechselspiel ist in der Konsumgesellschaft nicht mehr auf einigermaßen harmonische Weise möglich. Um ein dauerhaftes Funktionieren in dieser Gesellschaft zu gewährleisten, muss eine manische Abwehr aufgebaut werden, eine präventive Abwehr von Unlust, Angst und Aggression. Sie kann besser oder schlechter funktionieren. Sie kann auch zusammenbrechen; das Ergebnis ist je nach der Intensität des Zusammenbruchs eine mehr oder weniger heftige/lang dauernde Depression.
Der »normale« Mensch kann die Normen in der modernen Gesellschaft nur dadurch erfüllen, dass er seine Belastbarkeit überschätzt. Diese Überschätzung ist der Kern einer manischen Abwehr. Großstadtkinder würden über ein Eskimokind lachen, das Lärm und Reizüberflutung einer Metropole unerträglich findet. Aber die Abwehr, die sie aufbauen mussten, fordert ihren Preis.
Die zahlreichen Ansprüche an unsere Belastbarkeit haben ebenso zahlreiche Formen des Versagens an den Leistungsforderungen hervorgerufen – von der Sucht bis zu den Zwängen, den Angststörungen und der Depression. Die psychischen Störungen haben in der modernen Welt nicht dazu geführt, die Überschätzung dessen zu revidieren, was »Normale« ertragen müssen. Im Gegenteil, es entstand ein riesiges Angebot von Dienstleistungen und Waren um den Gedanken herum, die manische Abwehr zu ignorieren und nicht bei ihr anzusetzen, sondern ihre zwangsläufigen Zusammenbrüche zu vermarkten.
Ein emeritierter Ordinarius kommt wegen einer Depression in Behandlung. Die Sorgen und Ängste des Siebzigjährigen kreisen um seinen Sohn. Er hat dem nicht mehr jungen Mann, der ihm schon während der Schulzeit viele Sorgen machte, Marihuana rauchte und sich mit den Lehrern anlegte, zwei abgebrochene und ein abgeschlossenes Studium bezahlt. Gegenwärtig arbeitet der 45-Jährige an einer Dissertation und schreibt Artikel für eine alternative Filmzeitschrift, mit denen er kaum Geld verdient. Der Vater finanziert ihm eine Wohnung und unterstützt ihn in unregelmäßigen Abständen. Er beklagt die Unfähigkeit des Sohns, mit Geld umzugehen und sich notfalls rechtzeitig zu melden, um die hohen Zinsen für den Dispokredit zu vermeiden. Der Sohn kommt erst, wenn sein Kreditrahmen überzogen ist, weil er sich schämt, dass er nicht genug verdient, wird aber wütend und unzugänglich, wenn der Vater versucht, mit ihm Wege zu diskutieren, mit seinen Qualifikationen eine Arbeit zu finden, die ihn von den väterlichen Zuwendungen unabhängig macht. Er lasse sich keine Deppenarbeit aufzwingen! »Ich kann ihn nicht im Stich lassen«, sagt der Vater. »Als er noch klein war, habe ich mich nicht genug um ihn gekümmert.« Die Eltern sind geschieden, Mutter und Sohn haben nach einem Streit den Kontakt abgebrochen.2
Während der Professor seine Karriere festigen und darin seinen Realitätssinn bewahren konnte, hat er sich als Vater folgenschwer überschätzt. Er hat in der Begegnung mit seinem Sohn alle Signale ignoriert, aus denen er hätte schließen können, dass seine spezielle Form der Fürsorge nicht angemessen aufgenommen wurde.
Der junge Mann hat keinen Weg in eine erwachsene Rolle und in wirtschaftliche Unabhängigkeit gefunden, sondern sich bisher immer so verhalten, wie es die Verzerrung der Realität durch die väterliche Abwehr erforderte. Da der Vater die Möglichkeit eines Scheiterns der akademischen Karriere des Sohns nicht zulassen konnte, hat er dessen wiederholt auftretende Depressionen geleugnet und den Sohn darin unterstützt, sie durch mehrere Studienwechsel manisch zu verarbeiten.
Das Leben des Sohnes ist von einer Mischung aus Scham- und Schuldgefühlen sowie Resignation geprägt, die durch eine auf den Vater gerichtete Entwertung erträglich gehalten wird. Er kann immer wieder die Überzeugung aufbauen, dass der Vater an seiner Unreife schuld ist und bisher das Falsche von ihm verlangt und für ihn getan hat. In diesem Zustand ist er für den Vater ebenso unzugänglich wie im Cannabisrausch, dessen Vorzüge er gegenüber dem Alkoholkonsum des Vaters ins Feld führt.