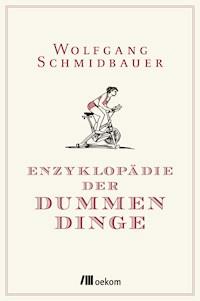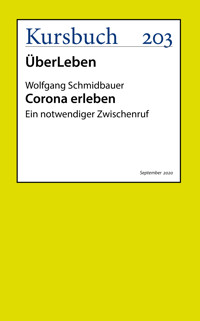9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wie gehen andere Kulturen mit psychischen Krankheiten um? Was unternahmen schriftlose Gesellschaften angesichts seelischer Leiden? Wie hat sich aus diesen magischen Wurzeln die heutige Vielfalt therapeutischer Ansätze entwickelt? Wolfgang Schmidbauer erzählt die faszinierende Geschichte der Psychotherapie von den Anfängen der Menschheit bis heute. Er beleuchtet die zahlreichen und oft widersprüchlichen Aspekte der Rolle des Helfers und Heilers zwischen einfühlendem Künstler und striktem Wissenschaftler, zwischen spirituellem Führer und modernem Dienstleister. Er zeigt auf, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Schulen und Richtungen der Psychotherapie liegen und welches Potenzial in ihrer Fortentwicklung steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Ähnliche
Vollständig überarbeitete Neuausgabe des 1998 im Nymphenburger Verlag erschienenen Titels »Vom Umgang mit der Seele. Therapie zwischen Magie und Wissenschaft«
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2012 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
eBook-Produktion: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger & Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7766-8152-9
Inhalt
Vorwort
1. Evolution und Psychotherapie
Die seelische Bedeutung der Magie
Literatur
2. Archaische Psychotherapie
Der Medizinmann als Psychotherapeut
Der Tabu-Tod
Krieg im Geisterreich
Schamanistische Methoden
Bildhafte und abstrakte Kuren
Wie man Schamane wird
Die Schamanenkrankheit
Die Aktualität des Schamanismus
Literatur
3. Riten, Mythen, Priesterärzte
Vom Sinn der Ekstase
Ekstatische Kulte der Gegenwart
Saturnalien und verwandte Feste
Die Austreibung und Übertragung von Leiden
Sündenbock-Riten
Literatur
4. Die Psychotherapie der Antike
Mesopotamien
Ägypten
Altpersische Psychotherapie
Die Hebräer
Indien
Griechenland
Die Geburt einer rationalen Kosmologie und Psychologie
Medizin ohne Psychotherapie
Psychologen der Antike
Platon und Aristoteles
Etrusker und Römer
Epikureer, Stoiker: Entspannung durch Einsicht
Literatur
5. Das Mittelalter: Heilung für Besessene?
Mittelalter – Finsternis und Licht
Zur Psychodynamik der Besessenheit
Die Hexenverfolgung
Ostgriechen, Nestorianer, Araber
Ansätze zu einer realistischen Psychologie
Literatur
6. Von der Magie zur Beobachtung
Was ist Hysterie?
Die Bürger und die »armen Irren«
Monstren und Tiere …
Befreit wozu?
Die Geburt der »Psychiatrie«
Theatralische Therapie
Literatur
7. Magnetismus, Hypnose, Suggestion
Somnambule und Medien
Der Streit um die Erinnerung: aktuelle Aspekte
Satanskulte und multiple Persönlichkeiten
Geistiges Heilen und christliche Wissenschaft
Suggestion und Persuasion
Literatur
8. Die Psychoanalyse
Das Unbehagen im Fortschritt
Freuds Werdegang
Freud bei Charcot
Von der Katharsis zur Analyse
Verwundbare Kindheit
Die Bedeutung der Träume
Übertragung und Gegenübertragung
Freuds Originalität
Literatur
9. Die psychoanalytische Bewegung
Carl Gustav Jung (1875–1961)
Otto Rank (1884–1939)
Die Neo-Psychoanalyse
Die NS-Psychotherapie in Deutschland
Sándor Ferenczi (1873–1933)
Georg Groddeck und die Psychosomatik
Literatur
10. Psychochirurgie und Psychopharmakologie
Insulin- und Elektroschock
Chirurgische Eingriffe
Pharmaka für die Psyche
»Wahrheitsdrogen« und »bewusstseinserweiternde« Stoffe
Literatur
11. Veränderungen, Neuerungen, Erweiterungen
Westliche und östliche Psychotherapie
Gruppentherapie
Familienforschung und Familientherapie
Verhaltenstherapie
Ein gemeinsamer Nenner?
Literatur
12. Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
Das deutsche Psychotherapeuten-Gesetz
Der Bedarf an Psychotherapie
Ist die Gesellschaft »therapeutisiert«?
Literatur
Lesetipps
Vorwort
Eine Geschichte der seelischen Krankheit und ihrer Heilung ist immer auch Kulturgeschichte. Jede seelische Regelwidrigkeit trägt den Stempel der Sozietät, die Normen schafft und auf den verschiedensten Wegen versucht, ihre Mitglieder zu bewegen, sich mit diesen abzufinden. Die Psychotherapie hat eine sehr lange Vergangenheit, während ihre eigentliche Geschichte als Wissenschaft erst begann, als sich in der Renaissance der Mensch als Schöpfer seiner eigenen Individualität identifizierte.
Anders als in traditionellen Kulturen, in denen sich die persönliche Entwicklung an ständischen Normen orientiert und der Sohn des Bauern mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls Bauer wird, wird in den städtischen, vom Bürgertum geprägten Gesellschaften jeder Einzelne seines Glückes Schmied. Große religiöse Veränderungen wie Reformation und Gegenreformation haben in Europa diesen Wandel formuliert – weg von einer traditionellen Hierarchie, in der das fromme Volk glaubt, was die Bischöfe sagen, hin zu einer Gemeinschaft der Gläubigen, von denen jeder sich im persönlichen Bibelstudium orientiert und der Prediger von seiner Gemeinde gewählt wird.
Die berufliche Rolle des Psychotherapeuten unterscheidet ihn von allen anderen modernen Berufen, die sich in Gesellschaften mit weit fortgeschrittener Industrialisierung und Individualisierung ausdifferenziert haben. Sie führt zurück zu den altsteinzeitlichen Kulturen. Hier gibt es oft nur einen erkennbaren »Beruf«, den des Schamanen, der Dichter, Sänger, Theaterspieler, Medizinmann und Psychotherapeut in Personalunion ist. Schamanen lernen ihr Handwerk ausschließlich in persönlicher Unterweisung und oft nur durch eine eigene Leidenserfahrung, die »Schamanenkrankheit«.
Wenn wir die prägende Phase in der Entwicklung der modernen Psychotherapie mit der psychoanalytischen Bewegung von Sigmund Freud beginnen lassen, erkennen wir als ihr Kennzeichen die professionelle Rolle einer Person, die nicht Mediziner, nicht Lehrer oder Priester ist, sondern etwas Eigenes. Und es mutet merkwürdig an, dass sich die Zugehörigkeit zu dieser Profession jetzt doch wieder an eine persönliche Unterweisung in einer Lehranalyse knüpft, in der eigene seelische Belastungen erforscht werden sollen. Die frühen psychotherapeutischen »Bewegungen« haben sich in einer Weise organisiert, die durchaus Gemeinsamkeiten mit Stammeskulturen aufwies: Es gab eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Mythen, welche zugleich Grenzen der eigenen »Schule« gegenüber anderen schufen.
Daher bin ich überzeugt, dass es sinnvoll ist, eine Geschichte der Psychotherapie nicht in einer Zeit beginnen zu lassen, in der sich dieser Beruf in Abgrenzung zur theologisch fundierten Seelsorge und zur an der Zellularpathologie orientierten Medizin entwickelte. Wir sollten vielmehr viel weiter zurückschauen und dadurch auch das Verständnis in die Zeitlosigkeit von magischen und esoterischen Modellen vertiefen, die bis heute in der Welt der Psychotherapie eine große Rolle spielen. Gegenwärtig gibt es neben den psychologischen Psychotherapeuten, die sich in Kammern organisieren, ihre Arbeit systematisch reflektieren und in wissenschaftlichen Methoden geschult sind, eine wirtschaftlich mindestens ebenso bedeutsame Gruppe von neuen Schamanen.
Ausgangspunkt des Buches ist die Evolution des Bewusstseins und die Untersuchung des magischen Denkens als der ersten und bis heute viel verbreiteten »Methode« der Psychotherapie. Meist sprechen wir heute nicht von magischem, sondern von positivem Denken und unterwerfen so die ursprüngliche Vielfalt der Magie einem technischen Zweck. Aufgabe der archaischen, zum guten Teil auch der modernen Psychotherapie war und ist es, die mit dem Evolutionsschritt zum reflektierenden Bewusstsein verbundenen Gefahren zu überwinden.
Schließlich noch einige Worte zum besonderen Charakter einer allgemeinverständlichen Darstellung. Der Wissenschaftler ist oft versucht, solche Aufgaben gering zu schätzen. Er schreckt vor der ungeheuren Vereinfachung zurück, die eine Geschichte der Psychotherapie auf 300 Seiten in einer für den interessierten Laien verständlichen Sprache notgedrungen bedeuten muss. Er fürchtet, dass er hier keinem Kenner etwas Neues sagen wird, und bequemt sich vielleicht, einen arg verdünnten Aufguss seines Wissens zu bereiten.
Ich habe versucht, hier einen anderen Weg zu gehen. Mir scheint, dass der Zwang, seine Gedanken so auszudrücken, dass sie jeder verstehen kann, höchst heilsam ist und mehr zu einer Vertiefung der Probleme anregt, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Das Streben nach Vereinfachung und Klarheit ist das Ziel der Wissenschaft selbst, die ja stets danach strebt, aus der Fülle einzelner Vorgänge und Beobachtungen das Allgemeine, Gesetzmäßige abzuleiten.
Ich habe das Buch seit dem ersten Erscheinen mehrmals überarbeitet und ergänzt, zuletzt 2012. Das Ziel des Textes ist das gleiche geblieben: den Leser durch eine umfassende geschichtliche Darstellung in einem unübersichtlichen und von oft sehr voreiligen Überzeugungen durchtränkten Gebiet zu orientieren.
Wolfgang Schmidbauer
München, Juli 2012
1. Evolution und Psychotherapie
Der Mensch, Psyche wie Körper, hat sich aus tierischen Vorstufen entwickelt. Die Zwischenformen sind ausgestorben; sie müssen aus fossilen Funden mühsam rekonstruiert werden. Bereits vor zehn bis 20 Millionen Jahren hat sich die Evolution des Menschen von jener seiner nächsten Verwandten unter den Primaten abgespalten. Wie unterscheidet sich der Mensch von ihnen?
Man kann eine lange Reihe von Antworten auf diese Frage finden. Die Spanier, welche um 1500 in Amerika landeten, waren etwa überzeugt, dass der Glaube an einen allmächtigen Gott den Menschen über das Tier erhebt. Folgerichtig erklärten sie die Indianer zu Tieren und nahmen sich das Recht, sie als Sklaven auszubeuten oder abzuschlachten. »Soll es nicht länger erlaubt sein, Lasttiere zur Arbeit zu benutzen«, fragten die spanischen Siedler erstaunt, als Fray Bartolomeo de Las Casas die Zwangsarbeit abschaffen wollte. Es sei besser für die Indianer, als Sklaven in Gefangenschaft denn als Tiere in Freiheit zu leben, behauptete Anfang des 16. Jahrhunderts eine Kommission spanischer Theologen: »Einerseits fliehen sie die Spanier und lehnen es ab, ohne Belohnung zu arbeiten; andrerseits sind sie so pervers, dass sie manchmal ihren gesamten Besitz verschenken. Außerdem sträuben sie sich dagegen, jene ihrer Kameraden zu verstoßen, denen die Spanier die Ohren abgeschnitten haben.«
Zur selben Zeit berichtet ein spanischer Reisender, Fernando Gonzalez de Oviedo, dass die Indianer in Puerto Rico Weiße zu fangen und zu ertränken pflegen. Die Leichen beobachten sie wochenlang, um zu sehen, ob die Toten verwesen oder nicht. Denn die Indios hielten die Spanier für Götter und wollten herausbekommen, ob sie nicht in Wahrheit Menschen seien. Die »Primitiven« riefen also, wie wir mit Claude Lévi-Strauss festhalten können, die Naturwissenschaft zu Hilfe, während die »Zivilisierten« sozialwissenschaftlich klassifizierten, d. h. für sie nützliche Vorurteile theologisch verbrämten.
Dieser Exkurs zeigt uns zweierlei: dass die Antwort auf eine Frage nach dem Wesen des Menschen nicht so einfach ist, wie man meinen möchte, und dass der Hochmut des Zivilisierten gegenüber der geistigen Welt der sogenannten Primitiven unbegründet ist. Wir verwenden den Ausdruck Primitive hier nur, um eine schriftlose Kultur zu kennzeichnen, völlig ohne den wertenden Beigeschmack, den das Wort gerne annimmt. Wir werden sehen, dass eine Geringschätzung der Naturvölker (auch dies ein unscharfer Ausdruck, denn sie sind ebenso stark von Kultur geprägt wie wir, nur sind ihre Gesellschaften anders aufgebaut) gerade in einer Geschichte der Psychotherapie fehl am Platze ist.
Kehren wir zu der ersten Frage zurück: Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Die Antworten der modernen Kulturanthropologie auf diese Frage lauten: Werkzeugherstellung (im Unterschied zum Werkzeuggebrauch, den man auch bei Schimpansen, Seeottern und Darwinfinken findet), Sprache, Kultur, reflektierendes Bewusstsein. Die Tatsache, dass wir heute in Autos fahren, Städte bauen und Astronauten auf ihrem Mondflug verfolgen, fällt diesen Merkmalen gegenüber nicht ins Gewicht. Denn es gibt Menschen, die nichts davon kennen, die hinter Windschirmen oder unter lose zusammengesteckten Blätterhütten leben, nackt Antilopen hetzen oder Melonen, Beeren und Nüsse sammeln. Doch auch auf dieser archaischen Stufe technischer Beherrschung der Umwelt finden wir Werkzeugherstellung, Sprache, Kultur, Religion, Heiratsregeln (Inzestverbote), reflektierendes Bewusstsein, kurzum Menschen, die als Individuen ebenso weit von den Tieren entfernt sind wie wir, mag sich ihre Kultur auch noch so sehr von der unsrigen unterscheiden.
Ein Buschmannkind (die Lebensform seiner Eltern haben wir eben beschrieben), das heute, seiner Familie entrissen, mit Kindern in einer Großstadt aufwachsen würde, träte nach wenigen Jahren mit der gleichen Selbstverständlichkeit auf die Rolltreppen der Untergrundbahn, würde in Supermärkten einkaufen und sich von einer Lehrerin Kenntnisse beibringen lassen, die seinen leiblichen Eltern nicht im Traum einfallen würden. Wir wollen hoffen, dass das kleine Buschmannkind (Experimente solcher Art sind schon früh gemacht worden) nicht unter den Vorurteilen leiden muss, mit denen viele Menschen einander plagen, und uns fragen, was diese doch überraschende Anpassungsfähigkeit eines auf altsteinzeitlichem Niveau lebenden Jägers und Sammlers an unsere Zivilisation ermöglicht. Die Antwort darauf gibt uns die Evolutionstheorie, welche heute, nachdem die Erkenntnisse von Charles Darwin erweitert und modifiziert wurden (vor allem durch die experimentelle Mutationsforschung), von den meisten Biologen und Verhaltensforschern akzeptiert wird (Namen s. Ploog 1965). Die beiden großen Baumeister der Natur, Mutation und Selektion (Auslese), müssen dafür verantwortlich sein, dass es heute einen psychisch und (in geringerem Maße) physisch weitgehend identischen Menschentypus gibt. Im Gegensatz zur »Rassenpsychologie«, wie sie im »Dritten Reich« geübt wurde, sind sich die modernen Anthropologen weitgehend einig, dass seelische Unterschiede zwischen einzelnen Menschen verschiedener Kulturen fast ausschließlich auf Lernen beruhen, also nicht angeboren sind wie etwa die Kräuselung der Haare oder die Hautfarbe. Als Beweis dafür kann man Studien anführen, die im Prinzip ähnlich aufgebaut sind wie unser Gedankenexperiment mit dem Buschmannkind. Man hat gefunden, dass die psychischen Merkmale der Schwarzen in amerikanischen Städten der Nordstaaten, um nur ein Beispiel zu nennen, denen der Weißen vergleichbarer sozialer Schichten weit ähnlicher sind als denen afrikanischer Schwarzer.
Mutation und Selektion bildeten den heutigen Menschen in dem typischen Rhythmus biologischer Veränderung. Die Mutation veränderte, die Selektion sorgte dafür, dass nur Veränderungen weitergegeben wurden, die für das Überleben günstig waren. Die Filter der Selektion sind für den Menschen in einer so langen Zeitspanne seiner Entwicklungsgeschichte gleich geblieben, sodass die relativ kurzfristigen Änderungen seit der Jungsteinzeit, als der Ackerbau entdeckt wurde und in den fruchtbaren Flusstälern die ersten Städte entstanden, den biologischen Typus von Homo sapiens nicht mehr verändern konnten. Wir werden bald sehen, wie wichtig dieser evolutionstheoretische Gesichtspunkt für eine Geschichte der Psychotherapie sein kann. Denn das Leben des Menschen als Jäger und Sammler in der Altsteinzeit, welches mindestens 99 Prozent seiner Entwicklungsgeschichte ausmacht, muss nicht nur die psychische Gleichförmigkeit der verschiedenen Rassen erzwungen, sondern die Seele des Menschen selbst entscheidend geprägt haben. Die selektiven Einflüsse, denen der Mensch damals unterworfen war, formten die genetische Struktur und damit auch die Grundzüge seiner Psyche. Betrachten wir sie näher, indem wir uns vor allem auf Befunde stützen, zu denen die ethnografische Feldforschung an bis heute erhaltenen Resten von Jägern und Sammlern gekommen ist.
Der primitive Jäger und Sammler überlebt vor allem dank einer fundierten Kenntnis über die natürlichen Nahrungsquellen seiner Umwelt, sowohl was das Verhalten der Tiere als auch das Wissen um essbare Pflanzen angeht. Erst in zweiter Linie nützt ihm seine oft rudimentäre Technologie (Speere, Bogen und Pfeil, Pfeilgifte, Grabstöcke). Auf Intelligenz stand also durchweg eine größere Selektionsprämie als auf handwerkliches Können.Spätestens seit der Evolution von Homo erectus (Pithecanthropus von Java, Sinanthropus von Peking) war der Mensch ein Großwildjäger. Großwildjagd ist einem biologisch relativ schlecht bewaffneten Wesen, wie er eines ist, nur in Gruppen möglich. Damals mag sich eine hohe Selektionsprämie für Kommunikation zwischen einzelnen Jägern herausgebildet haben. Sippen von Homo erectus, die sich gut miteinander verständigen konnten, erbeuteten mehr und bevölkerten größere Areale.Mit der Entwicklung der Sprache intensivierte sich das Gruppenleben. Die Sexualität wurde, über ihre Fortpflanzungsfunktion hinaus, zu einem sehr wichtigen gruppenbindenden Mittel (vgl. Wolfgang Wickler 1969).Seit der Mensch in Gruppen biologisch erfolgreicher war, erhielt eine spezifische, mit der Intelligenz eng verknüpfte Fähigkeit besonders hohe Selektionsprämien: die soziale und kulturelle Anpassungsfähigkeit an das Gruppenleben, das Lernen.So funktioniert die menschliche Anpassung ab einem bestimmten (aber kaum bestimmbaren) Zeitpunkt der Evolution grundsätzlich anders als die zoologische. Nicht mehr die Struktur des einzelnen Organismus passt sich an die jeweils gegebene Umwelt an, sondern die Struktur der Gruppe, der primitiven Kultur. Ihre Anpassung schlägt sich in Normen und sozialen Spielregeln nieder. Diese Normen werden dann an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben. So erklärt sich die große Variabilität gesellschaftlicher Normen schon auf steinzeitlichem Niveau: die Pflicht des Eskimos zu fleißigem Jagen ebenso wie die Trägheit des Pygmäen oder Buschmannes, der in der Regel nicht mehr als drei Stunden pro Tag arbeitet (was man wohl als das evolutionstheoretisch »natürliche« Maß akzeptieren muss), der kriegerische Ehrgeiz des Prärieindianers und die friedliche Haltung des Mbuti-Pygmäen, der alle aufkommenden Konflikte einfach dadurch löst, dass die Kontrahenten zu anderen Gruppen überwechseln.Bei aller Verschiedenheit der kulturellen Formen, die aus diesem Prozess hervorgehen, lassen sich einige Folgen festhalten, die alle Individuen betreffen. Die Sprache als wichtigster Träger sozialer Normen und kultureller Traditionen musste weiter ausgebaut werden. Alle biologischen Residuen, welche die kulturelle Anpassungsfähigkeit durch Lernen beeinträchtigten, wirkten sich negativ aus und verkümmerten. Der Mensch verlor seine Instinkte bis auf wenige bruchstückhafte und immer durch Lernen überformbare Reste. Die kulturelle Adaptation erwies sich als erheblich wirksamer, sie arbeitete rascher und flexibler, sie gestattete dem Menschen, einen Bereich der Erde zu besiedeln, der größer ist als der jedes anderen Tieres.Soziale Verbote, welche eine Kultur lebensfähig machen, traten an die Stelle der Instinkte (z. B. das Inzestverbot, da ein vollzogener Inzest die Weitergabe kultureller Verhaltensvorschriften behindert und den gesellschaftlichen Austausch unterbindet).Einsichtiges, reflektierendes Denken, das die Folgen des eigenen Verhaltens in einem inneren Probehandeln (Sigmund Freud) vorher abschätzt und das Individuum sich danach richten lässt, wurde besonders selektionsgünstig, da es die Möglichkeiten einer reibungslosen, dabei aber im Gegensatz zu tierischen Sozietäten, die durch sehr starre Instinkte zusammengehalten werden, variablen Adaptation an die jeweiligen kulturellen Formen begünstigte.Die seelische Bedeutung der Magie
Wir haben hier ein durchaus rationales Bild der psychischen Evolution skizziert. Es mag in manchen Partien verzeichnet sein, hilft aber, sich zu orientieren. Wie kommt es nun, dass so viele Berichte über die Primitiven geradezu überquellen von der Beschreibung unvernünftiger Handlungen, sonderbarer, logisch und kausal nicht zu begründender Überzeugungen, die man in der Regel »magisch« nennt? Warum darf etwa die Frau eines Huzul in den Karpaten nicht spinnen, wenn ihr Mann jagt? Weil sich sonst das Wild ebenso dreht wie die Spindel und der Jäger vorbeischießt, wird sie uns antworten. Warum muss jeder Besucher, der in das Haus eines ostindischen Jägers kommt, geradezu eintreten und darf nicht an der Tür zögern? Weil sonst das Tier, ehe es in die Falle geht, ebenfalls zögert. Warum darf ein Krieger auf Madagaskar keine Nieren essen? Weil das Wort für Nieren dasselbe ist wie jenes für Schuss; ein Schuss könnte ihn treffen, wenn er sich nicht vorsähe. Warum darf die Frau des ostafrikanischen Elefantenjägers ihren Mann nicht betrügen? Weil ihn sonst der Elefant tötet oder schwer verwundet. Warum hat der Jäger von den Aleuten keinen einzigen Seeotter gefangen? Weil seine Frau untreu oder seine Schwester unkeusch war. Warum darf niemand den Strandplatz betreten, von dem aus ein Kanu auf den Kei-Inseln bei Neuguinea in See sticht? Weil sonst die Reisenden Schiffbruch erleiden. Was kann die Frau eines See-Dajak tun, um ihn sicher auf dem Weg zu einem kriegerischen Überfall zu wissen? Sie muss früh erwachen, denn dann wird auch ihr Mann nicht verschlafen; sie darf ihr Haar nicht einfetten, denn täte sie es, könnte er ausgleiten, sie darf tagsüber nicht schlafen oder dösen, denn sonst wird auch die Aufmerksamkeit ihres Mannes nachlassen. Jeden Morgen muss sie Reiskörner auf der Veranda des Hauses verstreuen, denn dann werden die Männer flink und beweglich sein. Innen im Haus muss peinlichste Ordnung herrschen, denn wenn die Frauen über irgendeinen herumliegenden Gegenstand stolpern, werden auch die Männer stolpern und dem Feind in die Hände fallen. Schließlich soll von jeder Speise ein wenig beiseitegelegt werden, denn geschieht es, werden auch die Männer nie Hunger leiden. Was soll eine Huichol-Indianerin tun, damit sie ebenso schöne Muster weben kann, wie sie auf dem Rücken der Schlange gezeichnet sind? Sie bittet ihren Mann, eine Schlange zu fangen, indem er sie hinter dem Kopf mit einem gegabelten Stock festhält; dann streicht sie mit der Hand den Rücken der Schlange entlang und führt dieselbe Hand über ihre Stirn und ihre Augen. Dadurch wird sie fähig sein, ebenso schöne Muster zu weben, wie sie die Schlange trägt.
Die Liste solcher magischen Praktiken ließe sich noch sehr lange fortsetzen. James Frazer hat einige dicke Bände mit ihrer Beschreibung gefüllt. Der britische Anthropologe fasste die Magie im psychologischen Kontext seiner Epoche als verfehlte Anwendungen der Assoziationsgesetze auf. Diese sagen aus, auf welche Weise sich Vorstellungen verknüpfen. Schon Aristoteles hat einige dieser Gesetze beschrieben: Nähe in Raum oder Zeit, Ähnlichkeit, Kontrast. Eine sehr einfache Methode, solche Assoziationen nachzuweisen, besteht darin, jemanden zu bitten, das erste Wort zu sagen, das ihm auf ein »Reizwort« einfällt: Tal-Berg, Zeit-Uhr, Liebe-Triebe, Topf-Deckel. Frazer erklärt die »homöopathische« Magie durch eine falsche Anwendung des Gesetzes der Ähnlichkeit (wenn ich die Haare meines Feindes verbrenne, mache ich, dass er bald verbrennen wird), die »kontagiöse« (ansteckende) Magie durch eine falsche Anwendung des Assoziationsgesetzes der Berührung (Kontiguität, räumliche bzw. zeitliche Nähe). Die kontagiöse Magie bezieht sich auf so verbreitete Formen des Aberglaubens wie das Bannen eines Beutetiers, indem man einen Nagel oder einen Holzpflock in seine Fährte schlägt (ein Brauch, der bis ins 19. Jahrhundert in Deutschland üblich war und auch bei den steinzeitlichen Jägern in Australien beobachtet wurde).
Viele werden das Sprichwort kennen: Er schlägt den Rock und nicht den Dieb; wenige aber wissen, dass es sich auch hier um kontagiöse Magie handelt, die im vergangenen Jahrhundert in Norddeutschland noch geläufig war. Wer einen Dieb nicht festhalten konnte, suchte sich seines Rocks zu bemächtigen. Dann wurde das Kleidungsstück heftig verprügelt, denn man glaubte, auf diese Weise würde auch der Dieb die Schläge spüren und erkranken. Frazer zitiert aus dem Jahr 1830 den Fall eines Honigdiebs, der ertappt wurde und seinen Mantel zurücklassen musste. Der Imker malträtierte den Mantel, und als der Dieb davon erfuhr, erschrak er, legte sich ins Bett und starb nach kurzer Zeit.
Warum kann uns die Interpretation der Magie als primitive Naturerklärung und falsche Anwendung der Assoziationsgesetze nicht genügen? Zunächst ist zu bedenken, dass die Primitiven keineswegs, wie viele frühere Anthropologen (die selbst nie Feldforschung betrieben hatten) glaubten, durchweg ein »prälogisches«, gestaltloses, gefühlsdurchtränktes Denken aufweisen, sondern auf vielen Gebieten, die mit ihrem Lebensunterhalt zu tun haben, genauso logisch und scharfsinnig denken wie wir. Paul Parin veranschaulicht das durch eine Anekdote, welche die falschen Erwartungen des europäischen Forschers bloßstellt: Während seiner Forschungen bei den Dogon lernte er einen Mann kennen, der einen verkrüppelten Zehennagel an seinem linken Fuß darauf zurückführte, er sei von einem feindlichen Zauberer verhext worden. Der Europäer zeigt daraufhin auf den ebenfalls verunstalteten Zeh des anderen Fußes und fragt: »Wer hat dich da verhext?« Niemand, antwortet der Dogon; es sei Schmutz unter den Nagel geraten, dieser habe sich entzündet, ob denn der Weiße solche Erkrankungen nicht kenne?
Wenn das menschliche Denken ein so unzuverlässiges und realitätsfernes Instrument wäre, wie es etwa Lucien Levy-Bruhls Lehre von der participation mystique aussagt, dann hätte es sich in dem unerbittlichen Zweischritt von Mutation und Selektion nicht herausgebildet. Denken, Einsicht, welche die Folgen der eigenen Handlungen vorwegnimmt, Sprache und reflektierendes Bewusstsein haben ihren guten evolutionären Sinn. Sollte ihn die Magie nicht auch haben? Ist sie es nicht, die nach Frazers Worten wie ein mächtiger unterirdischer Strom immer noch das gesamte Denken des Menschen durchzieht (und wir werden sehen, wie recht Frazer mit dieser Annahme hat), sinnvoll innerhalb jener spezifischen Form der menschlichen Evolution, die wir als kulturelle beschrieben haben? Muss Magie wirklich auf eine »Urdummheit« (Theodor Preuss), auf ein Unvermögen, logisch zu denken (Lucien Levy-Bruhl), zurückgeführt werden? Finden wir nicht in der Magie einen ersten Ausdruck psychotherapeutischer Vorgänge in einem sehr weiten Sinn?
Wenn die psychotherapeutische Funktion der Magie den meisten Betrachtern bisher entgangen ist, wenn es nicht gelingen wollte, sie evolutionstheoretisch einzuordnen, dann hat das viele Gründe. Die lange Zeit herrschende Geringschätzung des geistigen Lebens der Primitiven, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zum Zeitpunkt der Zerstörung oder Veränderung fast aller primitiven Gesellschaften, überwunden wurde, mag dazu beigetragen haben. Dann schwang in der wissenschaftlichen Betrachtung der Magie noch bis in die jüngste Zeit (selbst bei Jensen, siehe ➝ Seite, noch nicht überwunden) jener Zorn der Aufklärung gegen den Aberglauben, gegen alles Unvernünftige, Unbegründbare mit. Wenn man sie erklären musste, tat man es negativ: als »falsche« Anwendung der Assoziationsgesetze, als primitive Vorstufe der Wissenschaft, als rohes, kümmerliches Sichabzappeln des menschlichen Geistes vor Problemen, die erst ein fortgeschrittenes Zeitalter in den Griff bekommen habe.
Wir haben gesehen, dass die menschliche Fähigkeit zur Einsicht, zur Vorwegnahme der Zukunft und zur Vergegenwärtigung der Vergangenheit sich als wertvolles Hilfsmittel erwies, sobald es galt, sich an das Gruppenleben anzupassen, kulturelle Traditionen weiterzugeben, Beutetiere zu überlisten. Doch jeder biologische Fortschritt birgt auch ein Risiko. Der Mensch hat etwa seine ihm eigentümliche Fortbewegungsart, die ihm die werkzeugschaffenden Hände frei machte und seinen Kopf hoch über die Gräser der Savanne erhob, durch eine erhöhte Anfälligkeit für eine ganze Reihe von Krankheiten erkauft: Krampfadern der Beine etwa, da das Blut größere Höhenunterschiede überwinden muss als beim Vierfüßler, endlose Rückenprobleme durch die gesteigerte Belastung oder die große Verwundbarkeit der weiblichen Geschlechtsorgane durch Dehnungen der Bänder, welche die Gebärmutter festhalten.
Im psychischen Bereich gilt ein ähnliches Gesetz. Mit den Vorzügen seiner hohen Intelligenz und der Fähigkeit, sich Vergangenheit und Zukunft zu vergegenwärtigen, löste sich der Mensch auch von der Ruhe und Sicherheit des Tieres, das keine Neurose kennt und keine Magie (solange es nicht in das Laboratorium eines Psychologen gerät).[1] Nietzsche hat in seiner Studie Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben diesen Bruch des Menschen mit seiner Umwelt, diesen Beginn von Sorge und Angst beschrieben. Und wie die Klappen in seinen Venen dem Menschen dazu verhelfen, dass sich trotz des aufrechten Ganges das Blut nicht in den unteren Gliedmaßen staut, so war es die Magie, welche den vom aufflackernden Licht des Bewusstseins geworfenen Schatten durchdrang und ordnete. Sie trug auf diese Weise, unabhängig von ihrem Missbrauch in der übelwollenden Zauberkunst, viel zu jener geistigen Unabhängigkeit bei, auf die wir heute so stolz sind. Vielleicht wären die ersten Menschen, die ein reflektierendes Bewusstsein kennenlernten, von den Schattenseiten dieser revolutionären Mutation gelähmt worden, hätten sie nicht die Magie entdeckt. Ihr danken wir es vielleicht, dass unser Bewusstsein, kaum geboren, nicht wieder erlosch, weil es ein zu kühner Entwurf der Baumeister des Lebens war.
Jetzt sind auch die magischen Praktiken, die Sympathie- und Analogiezauber leichter zu verstehen, die wir beschrieben haben. Die Frau des Jägers, die sich wegen ihres Wissens um die Gefahr Sorgen um ihren Mann macht, erhält ein Leitseil, an das sie sich halten kann, bindende Vorschriften, welche ihr Ruhe geben. Wenn sie von ihr erfüllt werden, wird schon nichts passieren. Der Jäger selbst, der die scharfen Sinne und die List der Beutetiere fürchten gelernt hat, der anders als Löwe oder Schakal bewusst plant und sich über Misserfolge grämt, gewinnt in der Magie ein Mittel, seine psychischen Kräfte zusammenzuhalten, sich Selbstvertrauen zu verschaffen und mit jener Zuversicht auszuziehen, welche die Mutter des Erfolges ist. Nur konsequent ist es, wenn der moderne Jäger, dessen weitreichende Waffen ihm hohe Sicherheit geben, weniger Jagdzauber benötigt und sich getrost auf den Weg macht, obschon seine Frau in den Tag hineinschläft. Doch halt: Sehen wir ihn nicht vorsichtig einer schwarzen Katze aus dem Weg gehen?
Die den Einzelnen beruhigende, das Selbstvertrauen erhöhende und Nachteile der Reflexion ausgleichende Funktion der Magie wird durch ihre Bedeutung für die Gemeinschaft vielleicht noch übertroffen. Es ist den Konstrukteuren der Evolution sicher nicht leichtgefallen, ein Wesen wie den Menschen zu schaffen, das ein hohes Maß geistiger Freiheit und Selbstständigkeit aufweist und doch nicht Einzelgänger ist, sondern fest in Gruppen zusammenhält. Gerade unter den gruppenbindenden Faktoren spielt die Magie (ebenso wie Mythos und Religion) eine wichtige Rolle, da sie eine Reihe sozialer Vorschriften viel besser festlegen und begründen kann als andere Argumente, andrerseits aber auch der ganzen Gruppe Sorgen abnimmt, sie von Übeln erlöst und Emotionen reinigend (»kathartisch«) entäußern hilft. Wie der gesetzestreue Bürger heute nicht immer aus ethischer Überzeugung handelt, sondern aus Angst vor polizeilicher Verfolgung, so auch der Primitive, dessen Gruppe durch die fernwirkende Magie eine viel sicherere Strafe für Vergehen gegen die Gemeinschaft hat als selbst Interpol. Der Verbrecher mag ungestraft entrinnen, doch seine Verfolger werden einen Knochen auswählen, ihn sorgfältig bemalen, seine magische Kraft durch wiederholte Zaubersprüche steigern und ihn endlich dem Verbrecher nachwerfen. Damit nicht genug: Durch Rauchsignale wird dieses Urteil bekannt gegeben; erfährt es der Betroffene, so stirbt er in wenigen Tagen. Wir haben nun die psychische Funktion der Magie kennengelernt und werden bald sehen, dass es möglich ist, in vielen religiösen Riten ähnliche psychotherapeutische Aspekte festzustellen. Das führt uns aber zu einigen grundlegenden Fragen, vor allem zu der Frage, wo man in einer Geschichte der Seelenheilkunde die Grenzen ihres Gegenstandes ziehen soll. Der Begriff »Psychotherapie«[2] taucht zum ersten Mal im Jahr 1872 in Daniel Hack Tukes Werk Bemerkungen über den Einfluss des Geistes auf den Körper. Studien zur Klärung der Wirkung der Einbildungskraft auf, und zwar im 16. Kapitel (»Psychotherapeutics«). Tuke ging es damals vorwiegend um den sogenannten tierischen Magnetismus.
1889 definiert van Eeden jede Heilmethode als Psychotherapie, »wenn sie sich psychischer Mittel bedient, um die Krankheit durch Intervention psychischer Funktionen zu bekämpfen«, eine Definition, die man noch heute akzeptieren kann. Wir wollen hier grundsätzlich alle Maßnahmen untersuchen, die geeignet waren oder als geeignet galten, seelischen und psychosomatischen Leiden vorzubeugen oder sie zu bessern. Über die Seelenheilkunde im engeren Sinn hinaus behandeln wir also auch die Psychohygiene. Seelischer Gesunderhaltung diente zweifellos die Magie: Sie wirkte als Schiene oder fester Verband um jene Bruchstelle, welche den Beginn der Reflexion kennzeichnet. Vielen Menschen ist dieser feste Verband noch heute unentbehrlich; andere können auf ihn verzichten, teilweise oder ganz. Diese Frage nach den Grenzen der Psychotherapie wird allerdings dadurch kompliziert, dass die Religion eine Reihe magischer Funktionen übernehmen kann. Erst die Weltreligionen haben sich teilweise von magischen Elementen gereinigt, während die Religionen der Primitiven völlig von ihnen durchdrungen sind. Jedenfalls geht es nicht an, die Magie als »Anwendungsstadium« und ehrfurchtslose Manipulation von der echten Verehrung des Göttlichen zu trennen.
Literatur
Bitter, W. (Hrsg.), Magie und Wunder in der Heilkunde, Stuttgart 1959
Campbell, D. G., Human evolution, Chicago 1966
Duerr, H. P., Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation,Frankfurt 1978
Frazer, J. G., The golden bough, London 1913
Heberer, G. (Hrsg.), Die Evolution der Organismen, Stuttgart 1967/70
Lee, R. B. und I. DeVore (Hrsg.), Man the hunter, Chicago 1968
Lévi-Strauss, C., Les structures élémentaires de la parente, Paris 1949
Ders., Traurige Tropen, Köln 1960
Lorenz, K., Über tierisches und menschliches Verhalten, München 1965
Narr, K. J., Urgeschichte der Kultur, Stuttgart 1961
Ploog, D., »Verhaltensforschung und Psychiatrie«, in: Psychiatrie der Gegenwart,Berlin 1965
Schmidbauer, W., »Schamanismus und Psychotherapie«, in: Psychologische Rundschau 20, 1969, S. 29
Washburn, Sh. L. (Hrsg.), Social life of early man, Chicago 1968
Wettley, A., »Ansatz zu einer Geschichte der Psychotherapie«, in: F. Krafft, K. Goldammer, A. Wettley, Alte Probleme – neue Ansätze, Wiesbaden 1965
Wickler, W., Sind wir Sünder? Naturgesetze der Ehe, München 1969
Anmerkungen
[1] Dort können sogenannte experimentelle Neurosen etwa dadurch erzeugt werden, dass man eine Ratte beim Durchschreiten einer Klappe mit dem Signal »Kreis« durch Futter belohnt, beim Signal »Oval« durch einen elektrischen Schlag bestraft. Das Tier lernt, das Oval zu meiden. Wenn der Versuchsleiter dieses Oval immer kreisähnlicher macht, erkranken die Ratten an verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten.
[2] Allerdings verwendet ihn schon im 9. Jahrhundert der arabische Arzt Rhazes im Rahmen einer Anekdote (vgl. ➝ Seite).
2. Archaische Psychotherapie
Der außerordentliche Einfluss des Medizinmannes oder Schamanen in primitiven Gesellschaften ist lange Zeit nur negativ gesehen worden. Er galt als Quacksalber, Hexenmeister oder Giftmischer. In alten Reisebeschreibungen und mehr noch in Romanen (etwa von Karl May), aus denen viele ihr völkerkundliches Wissen schöpfen, erscheint er meist als komische Figur, ja oft sogar als der böse Geist des Stammes. Diese Abneigung gegen den Medizinmann, das mangelnde Verständnis und die Geringschätzung seiner Heilmethoden haben ihre Ursache zuerst einmal darin, dass er der natürliche Feind der Missionare war, die ihn als den Träger der religiösen Traditionen des Stammes nach Kräften verteufelten.
Adrian Boshier fasst seine Beobachtungen in Südafrika zusammen: »Die traditionelle Form der Religion bei den Bantu Südafrikas ist die Ahnenverehrung; das Wohlergehen des Volkes hängt unmittelbar vom Verkehr mit seinen Vorfahren in der Geisterwelt ab. Der Begriff Medizinmann (witch doctor) bezeichnet den Priester, Propheten, Arzt, Pflanzenkenner, Seelentröster, Wahrsager und Historiker des Stammes. Er ist der Vermittler zwischen den Stammesmitgliedern und deren Ahnen; er spielt eine entscheidende Rolle innerhalb der Gemeinschaft. Es ist der Medizinmann, zu dem man mit seinem Kummer geht, gleichgültig, ob es sich um ein körperliches oder seelisches Leiden, eine Missernte, eine verlorene Kuh oder um ausbleibenden Regen handelt.« (Boshier, zit. n. H. P. Duerr 1981, S. 16)
Die wissenschaftliche Feldforschung ist ein Kind des letzten Jahrhunderts; vorher waren die Anthropologen weitgehend auf die oft tendenziösen Berichte ebendieser Missionare angewiesen. (Es gab immer Ausnahmen; einige sehr angesehene Völkerkundler waren Missionare.) Aber auch nüchterne Beobachter mit rein wissenschaftlichen Zielen, ethnologische Feldforscher, konnten mit den sonderbaren therapeutischen Methoden der Schamanen nicht viel anfangen. Erst mit der Entwicklung der psychosomatischen Medizin und klinischen Psychologie ist deutlicher geworden, dass die unverständlichen Heilverfahren des Medizinmannes weit mehr als primitiver Hokuspokus sind.
Dass seine Heilverfahren wirken, hat man schon früh beobachtet; warum sie es tun, welche psychotherapeutischen Methoden der Schamane verwendet, blieb im Dunkeln.
Betrachten wir einen von Adolf Allwohn mitgeteilten Bericht über eine magische Kur: »›Wenn der Mann nicht sofort operiert wird, muss er sterben! Er hat eitrige Blinddarmentzündung. Ich habe mein Besteck bei mir und werde ihn sogleich operieren.‹ So sagte ein mir befreundeter Arzt … Ich fragte ihn (den Erkrankten, einen Afrikaner in Tanganjika) also, ob er sich operieren lassen wollte. Mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen weigerte sich der Schwarze und verlangte nach dem Medizinmann … Der Patient hatte eine Temperatur von 40,1 °C, im Munde gemessen, und krümmte sich vor Schmerzen. Der Medizinmann, dem ich die Symptome der Erkrankung mitgeteilt hatte, verrieb einige Blätter, die er mit Bast um den Leib gebunden hatte, in seiner rechten Hand, legte diese dem Kranken auf den Nabel und sagte: ›Deine Schmerzen werden jetzt weggehen. Auch das Fieber wird heruntergehen.‹ … Schon nach genau einer Stunde war das Fieber auf 39 °C gesunken und nach drei Stunden auf 38,6 °C. Der Medizinmann ließ seine Hand nicht vom Bauche des Patienten, wiederholte aber immer wieder: ›Die Schmerzen lassen nach, das Fieber geht herunter.‹ Genau 12 Stunden später war der Kranke fieberfrei und ging drei Tage später wieder seiner Arbeit nach.«
Wir haben hier ein geradezu klassisches Modell suggestiver Einwirkung vor uns. Der Kranke glaubt fest, dass der Medizinmann ihm helfen kann; dieser kündigt ihm mit der ganzen Autorität seines Amtes an, dass Schmerzen und Fieber verschwinden werden. Es scheint schwer vorstellbar, dass man auf rein psychischem Weg eine körperliche Krankheit wie die Vereiterung des Blinddarmwurmfortsatzes beseitigen kann. Wahrscheinlich gelingt es auch nicht in allen Fällen, vor allem dann nicht mehr, wenn der Appendix schon durchlöchert ist. Doch zahlreiche Studien psychosomatisch orientierter Ärzte in unserer Zeit haben gezeigt, dass die Widerstandskraft gegen Entzündungen durch seelische Faktoren stark beeinflusst wird. Ein Beispiel ist die sogenannte Examens-Angina: Aus völliger Gesundheit heraus erkranken Studenten unmittelbar vor einer Prüfung an eitriger Angina mit hohem Fieber.
Erhöhte Widerstandskraft gegen Infektionen wird nicht nur während und nach einer geglückten Psychotherapie oft beobachtet, sie lässt sich auch statistisch beweisen. Annemarie Dührssen in Berlin hat gezeigt, dass psychoanalytisch behandelte Neurotiker später erheblich weniger Krankenhaustage pro Jahr beanspruchten als »normale«, nicht behandelte Versicherte. Dass psychische Ausgeglichenheit und auch das Gefühl, gebraucht zu werden, Infektionen verhindern können, zeigt noch eine weitere Statistik. Man hat festgestellt, dass in den nasskalten Monaten November und Dezember Arbeiter und Angestellte erheblich öfter als gewöhnlich einige Tage Krankheitsurlaub benötigen, weil sie sich erkältet haben. Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme: Die Angestellten der Post bekommen »ihre« Grippe nicht in der für sie besonders arbeitsreichen Vorweihnachtszeit, sondern erst einen oder zwei Monate später. (Zur psychosomatischen Medizin siehe ➝ Seite.)
Der Medizinmann als Psychotherapeut
Ein Afrikaner, der regelmäßig die 42 Kilometer zur nächsten Poststation gehen muss, wird von einem Büffel angefallen. Er kann sich nur mit Mühe retten, indem er sich in einer Grube versteckt, und macht Augenblicke der Todesangst durch. Seither leidet er an heftigen Ängsten. Nachts schreit er plötzlich auf, sodass alle erwachen und die Hunde anfangen zu bellen; er läuft dann ruhelos umher. Schlafmittel bleiben wirkungslos, sodass der weiße Arbeitgeber den Medizinmann ruft. Dieser hört den Kranken an und fragt dann, ob Büffelhörner im Haus seien. Er lässt sich eines geben und sägt zusammen mit dem Kranken ein Stück von den Spitzen der Hörner ab, zerstampft sie vor seinen Augen in einem Mörser und gibt sie ihm mit einer Tasse Tee zu trinken. Dabei nimmt er ihn an den Händen, blickt ihn an und sagt: »Die Hörner des Büffels können dir nun nichts mehr tun. Du wirst das Leben aus den Hornspitzen trinken und jede Furcht vor Büffeln wird dann verschwinden!« Der Postgänger trinkt; nach einer Woche meldet er sich, um seinen Dienst wieder aufzunehmen. Ob er keine Angst mehr habe? »Nein, Herr, ein Büffel kann mir nichts mehr tun!«
Ähnliche Neurosen wie die Büffelangst des hier geheilten Afrikaners findet der Psychotherapeut heute noch oft genug, z. B. nach Verkehrsunfällen, in deren Nachwirkung die Betroffenen nicht mehr allein eine Straße zu überqueren wagen, weil sie Angstanfälle (die zu den unangenehmsten Zuständen gehören, die es gibt) erleiden. Die Ursachen solcher Phobien sind heute ziemlich klar herausgearbeitet worden. Das Rezept des Medizinmanns gehorcht dem Gesetz der homöopathischen Magie: Similia similibus, Ähnliches wird durch Ähnliches beeinflusst. Wer sich die Spitzen eines Büffelhorns einverleibt, wird den Büffel nicht mehr fürchten. Ganz ähnlich heilte Moses die Kinder Israels in der Wüste von Schlangenbissen: Er ließ eine bronzene Schlange aufrichten.
Der Tabu-Tod
Nichts belegt die Macht der Magie des Medizinmannes und ihre Bedeutung als gruppenbindendes Element deutlicher als der sogenannte Tabu-Tod. Tabu ist ein polynesisches Wort, das – ähnlich dem lateinischen sacer – den Doppelsinn von heilig und verflucht hat. Die Speise eines Häuptlings etwa ist für gewöhnliche Polynesier tabu. Wer versehentlich von ihr kostet, muss je nach dem Grad seines Glaubens und der sozialen Angst, welche ihm die Gemeinschaft vorschreibt, mit einer ernstlichen Magenverstimmung rechnen oder sogar sterben. Der Tod durch Magie, durch den Zauber eines Medizinmannes, gehorcht ganz ähnlichen psychologischen und physiologischen Gesetzen. Der Eingeborene, der sich verhext weiß oder glaubt (das ist, weniger in der Überzeugung des Magiers als in der Praxis, ein äußerst wichtiger Umstand, der zeigt, dass es sich um einen autosuggestiven Tod handelt, nicht um paranormale Vorgänge), kauert sich, von Angst geschüttelt, in einen Winkel und stirbt in wenigen Tagen, ja manchmal in Stunden.
Claude Lévi-Strauss hat auf die vielfältigen sozialen Verflechtungen hingewiesen, welche den Effekt der Magie steigern. Der Verhexte ist aufgrund der feierlichsten Traditionen seiner Gruppe überzeugt, dass er verloren ist. Freunde und Verwandte ziehen sich von ihm zurück. In jeder Geste legt die Gemeinschaft dem Opfer nahe, dass er einerseits bereits tot, andrerseits aber eine Gefahr für seine Umwelt ist. Endlich setzt der Körper des Opfers der Auflösung dessen sozialer Persönlichkeit keinen Widerstand mehr entgegen. Durch Sonderfütterung und den Einsatz der eisernen Lunge ist es einmal geglückt, einen australischen Eingeborenen in dieser Situation zu retten: Er musste sich überzeugen, dass die Magie des weißen Mannes stärker war als die des Schamanen.
Im Tabu-Tod zeigt sich, dass die seelisch-stützende Funktion der Magie in ihr Gegenteil umschlagen kann, dass sich der mit hohen Selektionsprämien belohnte Schritt zu einem Symbolsystem von Worten und Vorstellungen, das zwischen den Menschen und die Realität geschaltet wird, auch als tödlich erweisen kann. Der Mensch kann als einziges Wesen seinen Tod vorwegnehmen, indem er ihn sich vorstellt, und er kann auf diese Weise sterben. Medizinisch lässt sich der Tabu-Tod heute am besten durch die Stresstheorie Hans Selyes interpretieren, die auch in der modernen psychosomatischen Medizin eine große Rolle spielt.
Schon Walter B. Cannon (der selbst eine Studie über den »Voodoo-Death« schrieb) hat gezeigt, dass Angst und Wut körperlich einer intensiven Erregung des sympathischen Nervensystems entsprechen. Seelisch besonders belastend wirkt diese »Alarmreaktion«, wenn sich keine sofortige körperliche Aktion an sie anschließt. Der Alarm im Körper hat den evolutionären Sinn, ein Maximum an körperlicher Spannkraft für Notfälle bereitzustellen. Nur haben die Konstrukteure der Evolution nicht an den Notfall Tabu-Tod »gedacht«; sie richteten sich nach äußeren Gefahren, die handgreifliche Aktion verlangten: Flucht oder Angriff. Seelischen Gefahren kann der Mensch nicht entrinnen; er muss sie zu kontrollieren suchen, so gut es eben gehen will. Der Angestellte, der eine ernstliche und, wie er meint, ungerechte Verwarnung einstecken muss, kann nicht mit geballten Fäusten auf seinen Vorgesetzten losgehen, wie es seiner körperlich-seelischen Alarmreaktion entspräche. Er muss seine Erregung hinunterschlucken und wird vielleicht hohen Blutdruck oder eine Magen-Darm-Störung (etwa ein peptisches Ulkus) entwickeln. Die Alarmreaktion macht die erste Phase des allgemeinen Anpassungssyndroms im Sinne Selyes aus. Die Hormondepots in der Nebennierenrinde werden entleert, das Blut eingedickt, der Blutzuckerspiegel steigt, ebenso der Wachheitsgrad des Gehirns. Wenn aber diese Alarmreaktion nicht durch anstrengende körperliche Aktion (Kampf, Flucht) ausgenützt wird, kann sich auch keine körperliche und seelische Entspannung anschließen.
So folgt der Alarmreaktion die Erschöpfung. Da der Kranke Essen und Trinken verweigert, kann es sehr rasch zu nicht wieder gutzumachenden Schäden infolge der Verminderung des Blutvolumens kommen. Medizinisch würde man von einem Tod im »Schock« sprechen; Kreislauf und Atmung versagen. Im letzten Krieg sind mehrmals solche Todesfälle beobachtet worden, vor allem unter Zivilisten, die während eines Bombardements in einem Luftschutzkeller ausharrten und als plötzlich das Licht erlosch und das Krachen der Trümmer betäubend laut wurde, fürchten mussten, verschüttet zu werden. Allerdings muss sich eine rein äußerliche Gefahr bis zum Exzess steigern, wenn sie zum psychogenen Tod führen soll. Auch der Tabu-Tod ist ein sehr seltenes Ereignis. Vielfach findet der Verhexte ja einen anderen Zauberer, dessen weiße Magie die schwarze ausgleicht, der er zum Opfer zu fallen droht.
Krieg im Geisterreich
In weiten Teilen Asiens und Amerikas wird den Schamanen die Fähigkeit zugeschrieben, ihren Körper zu verlassen und mithilfe eines Schutzgeistes in das Geisterreich zu gelangen. Da die Krankheiten, die sie heilen müssen, durch ungünstige Einflüsse aus diesem Geisterreich verursacht werden, wird auf diese Weise die suggestive Bekämpfung der Symptome, wie sie uns die afrikanischen Medizinmänner gezeigt haben, sozusagen eine kausal-auflösende Therapie. Es mag auf den ersten Blick leichtfertig scheinen, dem schamanistischen Heilverfahren einen solchen Rang einzuräumen, den fortschrittsgläubige Psychiatriehistoriker (z. B. Zilboorg) einzig und allein der Psychoanalyse zubilligen wollen, die ja auch, im Gegensatz zu suggestiv-zudeckenden Verfahren, kausal-auflösend ist. Aber es ist nützlich, eine Geschichtsauffassung zurückzustellen, welche die Vergangenheit allein an der Gegenwart misst.
Während die suggestiv-zudeckende Behandlung dem Kranken versichert, sein Leiden bestehe nicht mehr oder es werde bald verschwinden (»Der Schmerz vergeht; das Fieber vergeht …«), sucht die kausal-auflösende zu erklären, wodurch die Störung zustande kam und warum sie auf dem (vom Schamanen oder vom Psychoanalytiker) beschrittenen Weg geheilt werden kann. Der eine drückt sich in einer magisch-mythischen Sprache aus, der andere in einer wissenschaftlichen, die freilich zahlreiche mythische Elemente enthält. Suggestion ist auf den inneren Bereich eines Individuums bezogene Magie und Magie nichts anderes als über den Einzelnen hinaus wirkende Suggestion. Auch das aufdeckende Verfahren entfaltet suggestive Macht, doch hat diese eine andere Gestalt.
Wer jemals ein kleines Kind beobachtet hat, hat auch gesehen, dass die Neugier ein wesentliches Motiv seines Verhaltens ist. Es gibt auch im Tierreich »Neugierwesen«; Ratten beispielsweise erforschen ein Labyrinth, selbst wenn kein Futter am Ausgang auf sie wartet. Auch ihnen muss, wie dem Menschen, die Selektion lange Zeit Prämien für das reine Wissen um die Umwelt verliehen haben. Im Notfall wird die neugierige Ratte rascher und sicherer zum Futter finden, wird der neugierige Jäger und Sammler, der weitere Streifzüge unternahm, ein Bündel essbarer Wurzeln mehr zu seiner Familie bringen.
Die Neugier als Wunsch nach Orientierung und ihr Gegenstück, die Angst vor dem Nichtgewussten, vor der Desorientierung sind es sicher auch, welche eine kausal-auflösende Psychotherapie eher und nachdrücklicher befriedigt als die suggestiv-zudeckende. Sicher liegt ein guter Teil des Erfolges der Psychoanalyse darin begründet, dass sie geeigneter ist, menschliche Neugier zu befriedigen, als andere Methoden. Und wenn Freud selbst sie nur für jüngere Menschen angezeigt hielt, so hat das, außer den von ihm genannten Gründen (größere Flexibilität der Persönlichkeit, weniger eingeschliffene Reaktionsweisen), auch den Grund, dass jüngere Menschen in der Regel neugieriger sind als ältere.
Das Wesen der schamanischen Kur mit der Reise der Schamanenseele ins Geisterreich und dem Kampf gegen die mythisch personifizierten Krankheitszeichen verdeutlicht ein von den schwedischen Ethnografen Nils Holmer und Henry Wassen publiziertes Dokument, das in seiner Art sicher einzigartig ist. Es enthält den vollständigen, 535 Verse langen Gesang eines Schamanen der Cuña-Indianer, der Hilfe bei einer schweren Geburt bringen soll. Aus ihm wird die subtile psychologische Technik dieser Therapie deutlich, in der sich suggestive und auflösende Elemente legieren.
Der Gesang beginnt damit, dass die Kranke der Hebamme gesteht: »Wahrlich, ich bin bekleidet mit dem warmen Gewand der Krankheit«, und die Hebamme antwortet: »Wahrlich, du bist mit dem warmen Gewand der Krankheit bekleidet, so habe auch ich dich verstanden.« Der Schamane setzt also ganz am Anfang ein. Er schildert der Gebärenden eindringlich und mit den minutiösen Wiederholungen, die wir in der Hypnotherapie kennen, ihre Situation, von der die Behandlung ausgeht:
»Die Hebamme geht in der Hütte umher,
Die Hebamme sucht Perlen,
Die Hebamme geht umher,
Die Hebamme setzt einen Fuß vor den andern,
Die Hebamme berührt mit dem einen Fuß den Boden,
Die Hebamme setzt den andern Fuß vor,
Die Hebamme öffnet die Tür ihrer Hütte, die Tür ihrer Hütte knarrt,
Die Hebamme tritt heraus …«
Die Kranke soll also noch einmal ganz genau und von Anfang an erleben, was sich in ihrer Umwelt abspielte. Dann, unmerklich, geht der Schamane dazu über, Vorgänge in ihren inneren Organen zu schildern. Von ihnen wechselt er wieder zu dem Geschehen im Geisterreich, zu den Taten der Schutzgeister, zu ihrer magischen Bedeutung. Diese Geister sind zum großen Teil, wie Wassen und Holmer (und nach ihnen auch Lévi-Strauss) zeigen konnten, nichts anderes als symbolisch dargestellte körperliche Vorgänge.
Der Hauptteil des Gedichtes zeigt ein immer rascheres Wechselspiel zwischen mythischen und körperlichen Vorgängen, zwischen eindringlicher Schilderung des Schmerzerlebens und Beschreibung des Geisterkampfes mit den Krankheitsdämonen.
Nach dem Glauben der Cuña hat jeder Körperteil seine eigene purba (Lebenskraft). Die schwierige Geburt wird durchaus »psychosomatisch« dadurch erklärt, dass die purbas der einzelnen Organe durch die Lebenskraft des Uterus gefesselt werden. Das ist sicher keine Interpretation, die ein heutiger Pathologe akzeptieren würde. Doch sie umschreibt sehr gut, wie sich der Schmerz subjektiv für die Betroffene bemerkbar macht. Phänomenologisch orientierte Psychologen wie Philipp Lersch haben beschrieben, wie dabei das gesamte Erleben um den »Pfahl im Fleisch« kreist. Schon viel früher hat Wilhelm Busch veranschaulicht, wie – um es in der Cuña-Terminologie auszudrücken – die purba des kranken Zahnes alle anderen purbas gefangen nimmt (Balduin Bählamm):
»Das Zahnweh, subjektiv genommen,
Ist ohne Zweifel unwillkommen;
Doch hat’s die gute Eigenschaft,
Daß sich dabei die Lebenskraft,
Die man nach außen oft verschwendet,
Auf einen Punkt nach innen wendet,
Und hier energisch konzentriert.
Kaum wird der erste Stich verspürt …
Und aus ist’s mit der Weltgeschichte,
Vergessen sind die Kursberichte.
Denn einzig in der engen Höhle
Des Backenzahnes weilt die Seele …«
Aufgabe des Schamanen ist es, die gefangenen Lebenskräfte wieder zu befreien und die innere Ordnung im Kosmos der einzelnen purbas ebenso wiederherzustellen wie analog zu ihr die im gestörten Ablauf der Geburt. Die Schutzgeister bluten wie die Kranke, ihre Schmerzen steigern sich ins Ungeheure; endlich dringen sie, noch einmal langwierig beschrieben als Geister des Windes, der Gewässer und Wälder, der alkoholischen Getränke und des »silbernen Dampfers des weißen Mannes« (der Mythos ist ein lebendiger Glaube), in den »Weg Muus«, den Geburtskanal, ein. Es ist leicht vorzustellen, dass die Kranke nach der langen, suggestiven Vorbereitung sie wirklich eindringen spürt, dass sie fühlt, wie sie den Weg Muus »erhellen«: »Die nelegan (Schutzgeister) pflanzen ein gutes Licht in die Kranke, die nelegan öffnen leuchtende Augen in der Kranken.«
Jetzt dringen die Schutzgeister zusammen mit der Seele des Schamanen in das Haus Muus, in den von fantastischen Ungeheuern bevölkerten Uterus. Da ist Onkel Alligator Tiikwalele, der seine ungeheuren Flossen bewegt, die alles ausfüllen, zurückschieben, mitziehen. Da ist Nele Kikirpanalele, der Tintenfisch, der seine schleimigen Fangarme ausstreckt und wieder zusammenzieht, Bilder krampfartiger Schmerzen, wie sie deutlicher nicht gezeichnet werden können. Kaum sind die im Uterus gefangenen Lebensgeister befreit, da erfolgt schon der Abstieg. Nicht weniger mühsam und gefahrenreich ist er als der Aufstieg, soll er doch die Geburt selbst herbeiführen. Noch einmal zählt der Schamane seine Schutzgeister auf, mustert seine Truppe und ihre mit magischer Kraft geladenen Waffen: Perlen, verschiedene Knochen, Flöten, silberne Halsbänder. Um sie zu verstärken, werden die »Wege-Öffner« geholt, sinnreich genug sind es die »Herren der Wühltiere«, wie etwa das Gürteltier. So sorgfältig wie die Situation des Beginns wird auch jene des Ausgangs in allen Details geschildert (geradezu wie das »Zurücknehmen« einer Hypnose). Alle purbas sind an ihre Plätze zurückgekehrt, der Sturm in der physischen Welt hat sich gelegt wie jener in der psychischen bzw. mythischen, eine Ordnung ist wiederhergestellt, für alle Teile verbindlich und von keinem mehr bedroht. Psychologisch ist es nur von geringer Bedeutung, dass die psychosomatische Theorie des Cuña-Schamanen keiner Realität im naturwissenschaftlichen Sinn entspricht. Die Kranke orientiert sich an ihr ebenso wie ihr Arzt und die Gesellschaft, in der beide leben. Schutzgeister, die Schamanenseele, purbas und nelegan, Störenfriede, magische Tiere und Pflanzengeister, ja selbst ein Ausschnitt aus einer fremden, technischen Zivilisation (der Geist des »silbernen Dampfers des weißen Mannes«) sind Mitspieler in einem Weltbild, das auf seine Art alle Leiden und Freuden des Menschenlebens erklärt.
Wir verstehen jetzt vielleicht besser, warum Überzeugungen wie die Magie und der Schamanismus lange Zeit Selektionsprämien erhalten haben. Sie halten die Gruppe zusammen, sie helfen ihr, das Geschenk des Bewusstseins weise zu verwalten. Wir werden noch sehen, dass aus ebendiesen Zusammenhängen der Beruf des Schamanen – in vielen archaischen Kulturen der einzige unterscheidbare Beruf, den es gibt – seine eminente Bedeutung schöpft.
Die schwierige Geburt bedeutet eine Störung in dem geschlossenen System von Überzeugungen, die das Weltbild der Cuña ausmachen. Mithilfe der mythischen Interpretation weist ihr der Schamane einen Platz in diesem Weltbild zu. Die Schmerzen werden dadurch nicht nur erträglicher, sondern die Kranke folgt dieser bildhaft-mythischen Schilderung auch dann noch, wenn sie ihr den Weg aus dem Leiden heraus zeigt und wird gesund – vielleicht.
Der Schamane erlaubt seiner Patientin, »zu sagen, was sie leidet«, indem er es ihr selbst vorsagt. Dadurch wird es der Kranken möglich, eine Erfahrung zu ordnen und zu verstehen, die sonst unverständlich und chaotisch bliebe. Analog wird der körperliche Vorgang der Geburt verwandelt und geordnet. Wir müssen uns hier nur an die von Grantley Dick Read in seiner Lehre von der natürlichen, schmerzlosen (besser: schmerzarmen) Geburt zugrunde gelegten Vorstellungen erinnern. Read glaubt, dass der biblische Fluch »In Schmerzen sollst du deine Kinder gebären« zusammen mit den zahlreichen anderen, ähnlich negativ geprägten Erwartungen die Geburt viel schmerzhafter macht, als sie sein müsste. Der Fluch wirkt wie eine Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Die Schwangere hat Angst, Angst führt zu Vasokonstriktion (die Blutgefäße ziehen sich zusammen), die herabgesetzte Durchblutung löst Schmerzen aus oder steigert sie; der Schmerz verstärkt wiederum die Angst. Wird der psychophysische Teufelskreis durch die Suggestionen des Geburtshelfers durchbrochen, dann läuft das Geburtsgeschehen nicht nur schmerzärmer, sondern auch glatter ab.
Wie nach einem Wort Bert Brechts die einfachen Leute alles andere sind als einfach, so sind auch die psychologischen Methoden, mit denen die sogenannten Primitiven ihre Kranken heilen, alles andere als primitiv. Man macht es sich zu einfach, wenn man die Psychotherapie des Schamanen schlechterdings »suggestiv« nennt und sie in eine Reihe mit Coués Formel »Es geht mir von Tag zu Tag immer besser und besser« stellt. Wir dürfen nicht unsere gewohnten Denkkategorien auf die Struktur der primitiven Sozietät projizieren und alles übersehen, was nicht hineinpasst. In der Welt des Schamanen und seiner Patienten existierte der Gegensatz zwischen zudeckender und auflösender, suggestiver und analytischer, symptomatischer und kausaler Psychotherapie nicht. Die Suggestion des Schamanen wirkt zugleich kausal-auflösend und analytisch, da die Ursache der Krankheit erkannt, die Orientierungslosigkeit des Patienten beseitigt und das Leiden selbst in einem dramatischen Geisterkampf besiegt wird, den der Kranke in allen Phasen durch die geniale Darstellung des Schamanen miterlebt.
Claude Lévi-Strauss stellt deshalb das schamanistische Heilverfahren in die Mitte zwischen organische Medizin und Psychoanalyse.[3] Ein Kranker, dessen Störungen man mit Mikroben, Allergien oder Viren erklärt, wird durch diese Erklärung allein nicht gesund, bemerkt der französische Ethnologe. Erklärt man sein Leiden aber als Kampf mythischer Ungeheuer, so gesundet er. »Man wird uns Widersprüche vorwerfen, wenn wir dieses Phänomen dadurch erklären, daß Mikroben wirklich existieren, Ungeheuer hingegen nicht«, erläutert Lévi-Strauss. »Und gleichwohl ist die Beziehung zwischen Mikrobe und Krankheit dem Denken des Patienten äußerlich: es ist eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, während die Beziehung zwischen Ungeheuer und Krankheit für dasselbe bewußte und unbewußte Denken eine innere ist: es ist die Beziehung zwischen Symbol und symbolisiertem Gegenstand.«
Einen wichtigen Gesichtspunkt in der Betrachtung schamanistischer Heilkunst liefert die von dem in Ungarn geborenen, später in London tätigen Analytiker Michael Balint begründete Unterscheidung zwischen einer subjektiven oder autogenen und einer objektiven oder »iatrogenen« (durch ärztliche Einwirkung entstandenen) Krankheit. Der Patient empfindet sein Wohlbefinden schmerzlich gestört: die subjektive Krankheit. Der heutige Arzt sucht nach einem messbaren körperlichen Befund, wobei ihm eine lange Reihe von Laboratoriumsverfahren biochemische Tests, Elektrokardiogramm usw. hilft. Der Widerspruch zwischen subjektivem Befinden und objektivem Befund ist eines der größten Probleme in der modernen, naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin, welche die seelischen Faktoren in einem Krankheitsbild gewöhnlich vernachlässigt. Zahlreiche Statistiken haben erwiesen, dass rund jeder zweite Patient, der in die Praxis eines Internisten kommt, tatsächlich an seelisch (mit)bedingten Störungen leidet. Im Denken und in der Ausbildung fast aller Internisten nimmt aber die Psychologie keineswegs 50 Prozent ein, sondern bestenfalls 5 Prozent. Während der moderne Arzt geschult ist, den objektiven Befund zu erkennen und therapeutisch zu ändern, wobei er das Risiko läuft, dass der Kranke selbst sich menschlich vernachlässigt und missverstanden fühlt, konzentriert sich der Schamane auf das subjektive Befinden, die »autogene Krankheit«, und versucht, es mit seinen Mitteln zu verändern. Es wäre eine fesselnde Frage zu vergleichen, wie weit man auf beiden Wegen kommen kann. Keineswegs lässt sich von vorneherein entscheiden, dass der Schamane in jedem Punkt unterlegen sein muss.
Schamanistische Methoden
Nach dieser Analyse des Cuña-Heilgesanges fällt es nicht mehr schwer, auch andere schamanistische Techniken zu verstehen. Sie schließen sich gegenseitig nicht aus und können durch Behandlung mit heilenden Kräutern oder durch physikalisch-chirurgische Maßnahmen ergänzt werden (Aderlass, Trepanation). Wo sich schamanistische Kulturen in der Zivilisation erhalten haben, »im Bauch des Wals«, wie mir ein Navajo-Indianer 1977 sagte, ergänzen sich heute beide Methoden: Der Kranke wird z. B. von einem modernen Chirurgen in einem Hospital operiert und nach seiner Entlassung von dem medicine man (persönlich wurden mir solche Praktiken von einem Zuni und einem Navajo berichtet) mithilfe von Gesängen, Sandbildern oder beidem in den Zusammenhang der Lebewesen neu integriert. Während der naturwissenschaftlich gebildete Arzt vielleicht dazu neigt, den Schamanen als Quacksalber abzuwerten, ist dieser durchaus in der Lage, die Mittel der Naturwissenschaft zu respektieren. Nun zu den Verfahren:
Der Schamane manipuliert das erkrankte Organ direkt, indem er, meist nach einem vorbereitenden Ritus, der den Kranken einstimmt und seine Glaubensbereitschaft verstärkt, die Krankheit etwa »heraussaugt«. Vielfach wird sie dann im psychologisch wirksamsten Moment sichtbar gemacht, etwa als Kaktusdom, als Schlangenzahn, als Glassplitter, Feder, blutiger Wurm oder Tierkralle, manchmal auch nur als Speichel oder Lufthauch (Australien, Alaska, Süd- und Mittelamerika). Während dieses Ritus werden oft auch Erläuterungen der Krankheitsursache abgegeben. Der Schamane nennt den fremden Zauberer oder übelwollenden Verwandten, der den Giftstachel oder die Tierkralle in den Leib des Opfers praktiziert hat. Zu großer Aufmerksamkeit in den Medien hat diese Praktik durch einen esoterischen Tourismus zu philippinischen Heilern geführt, von denen immer wieder berichtet wurde, wie sie mit bloßen Händen in den Eingeweiden eines Kranken wühlten und schließlich durch die unverletzte Bauchdecke hindurch das kranke Organ vorführten. Die Debatte über »Realität« und »Betrug« dieser Heiler signalisiert hier die großen Schwierigkeiten einer Verständigung über kulturelle Barrieren hinweg.Der Kranke wird in einem dramatisch dargestellten Eingreifen des Schamanen in die Geisterwelt geheilt, entweder in seiner eigenen Hütte oder in der des Schamanen, manchmal auch unter freiem Himmel. Diesen Kampf erleben alle Angehörigen und der Kranke selbst mit. Er gibt ebenso wie die erste Methode Gelegenheit, Verfehlungen des Kranken oder seiner Angehörigen gegen die Gemeinschaft und ihre Verbote anzuprangern. Beispiel: Der Schamane holt eine Dingo-Pfote aus dem schmerzenden Magen eines australischen Jägers, der zu hartnäckig und zur Unzeit Dingos gejagt hat. So belehrt er ihn über seine Verfehlung und kuriert diese mit seinen magischen Mitteln. In der exakten Wirklichkeitserfassung unserem Weltbild unterlegen, fesselt den ökologisch geschulten Betrachter die schamanistische Idee des Gesamtzusammenhangs aller Lebewesen und der magischen Strafe, die den trifft, der allzu ausbeuterisch vorgeht. Europäische Fischer, Wal- oder Robbenjäger müssen durch strenge Gesetze davon abgehalten werden, die eigenen wirtschaftlichen Grundlagen in einer ruinösen Konkurrenz um kurzfristige Chancen zu zerstören.Wesentlich für die schamanistischen Kuren ist immer der kosmische Bezug. Es gibt kaum eine Heilung ohne Kosmos im ursprünglichen Sinn: Ordnung, Harmonie der Dinge. Der Schamane verfügt über bestimmte Tiere, Pflanzen, Kunstgegenstände, Musikinstrumente, die Eigenleben gewinnen und in der Heilung mitwirken. Besonders anschaulich ist das bei der »Kunsttherapie« der Navajos: Der Kranke wird auf eine komplizierte Sandmalerei gelegt, die der Schamane ausgeführt hat und in einem Heilgesang deutet. Dieser kosmische Bezug, die Verbindung mit einem anschaulichen und gleichzeitig metaphysischen System, hat sich vor allem in den esoterischen Gruppen (wie der Anthroposophie), im Sternenglauben und in der Homöopathie erhalten.
Bildhafte und abstrakte Kuren
In den wenigen Kulturen, die bis in die Zeit ihrer wissenschaftlichen Erforschung Bruchstücke einer altsteinzeitlichen Identität erhalten haben, sind alle Erwachsenen in der einen oder anderen Form in ein Bezugssystem eingebunden, das die Forscher schamanistisch nennen, nach jener späteren Entwicklung, in der nur besonders begabte Individuen die Laufbahn eines Schamanen oder Medizinmannes einschlagen.
Dieser urtümliche Heiler, der noch Arzt, Priester, Dichter und Lehrer in einem ist, verdankt seine Macht den Tier- und Pflanzengeistern, unter Umständen auch Steinen oder Bergen, nach der Begegnung mit den Europäern auch Dampfern oder Flugzeugen, eindrucksvollen Gegenständen jedenfalls, die zu ihm gehören, aus deren Anrufung er seine Macht schöpft, ähnlich wie der Katholik aus der Litanei, in der möglichst mächtige Heilige benannt sind.
Diese Helfer trägt der Schamane mit sich, oft in der Gestalt einer Medizinkette, in der etwa Vogelschädel, Schlangenwirbel, Pflanzensamen, Holz-, Stein- und Glasperlen zusammengefügt sind. Da alles, was ein Mensch sieht, ihm auch etwas bedeuten kann, sind die Bedeutungen von natürlichen Materialien so vielfältig wie die Natur selbst. Manche Zusammenhänge leuchten uns ein, etwa die Faszination durch die Muschelperle, die wie ein Wunder aus dem Fleisch der Auster leuchtet, oder die Anziehungskraft der strahlenden Farben von Mineralien, die mit den Farben unserer Organe harmonieren: Vor allem das Rot der Koralle, des roten Jaspis und des durchscheinenden Karneols haben die Menschen schon sehr lange fasziniert, wie wir aus den Funden solcher Perlen ableiten können, die schon seit Jahrtausenden getragen werden. Ähnliches gilt für den grünen Türkis, den himmelsfarbigen Lapislazuli, den goldgelben Bernstein. Auch die Zähne und Krallen großer Raubtiere bringen eine Botschaft: Wer sie trägt, hat entweder selbst solche Tiere erlegt, ist Freundin oder Freund eines solchen Jägers.
Reine Wissenschaft, angewandte Wissenschaft, Technik, Design, Kunst, Kunstgewerbe – in solchen Schubladen ordnen wir unsere Welt. Je stärker wir uns von diesen Einteilungen bestimmen lassen, desto weniger begreifen wir Lebensformen, die vor solchen Intellektualisierungen bestanden und unter ihnen fortbestehen bis heute. In unseren technischen Zeiten hört es sich wie eine neue Botschaft an, dass Mineralien und fossile Harze wie Bernstein und Kopal nicht »nur schön«, »nur Schmuck« sind, sondern »Kräfte« haben. Eine entzauberte, kraftlose Ästhetik wird sozusagen durch Magie wieder gestärkt. In Wahrheit ist alles, was uns schöner macht, auch etwas, was unsere seelische Kraft erhöht und uns vor Selbstzweifeln oder Ängsten schützt. Zaubersprüche sind keine Abrakadabras, die verwegene Forscher auf einem altägyptischen Papyros lesen (vgl. Duerr 1978, 1981). Zaubersprüche sind Dichtungen, die uns fesseln, sind die Argumente eines Werbetexters, die uns anregen – behexen? –, überflüssige Dinge zu kaufen, sind die Reden von Politikern, die Deutungen von Psychotherapeuten. In ihnen finden wir ebenso viel Magie in unserem Alltag wie in weihrauchduftenden Esoterikbuchhandlungen oder an Messeständen, an denen uns Kraftkristalle verkauft werden.
Die Naturwissenschaften haben das Gebiet der Schamanen erobert und besetzt. Vom magischen Standpunkt aus könnte man sagen: Ihre Magie ist die stärkere, denn wer Explosivwaffen und Antibiotika erfindet, hat auch so viel geistige Kraft, dass er alles, was sich seinem Anspruch nicht unterordnet, mit einem Bann belegen kann: unwissenschaftlich, unbewiesen, Einbildung, Placebo-Effekt. Dieses Regiment ist kaum toleranter als die theologische Herrschaft, der sie nachfolgte und die sie ergänzt. In dieser ist die Magie des Teufels und der Mensch soll sich Gott – das heißt: den Priestern – unterwerfen und sich nicht anmaßen, mit Zaubersprüchen, Kräutersalben oder Heilsteinen dem Teufel zu dienen.
Aber ihre gewaltige und gewalttätige Überlegenheit hat die neuen wissenschaftlichen Herrscher auch leichtsinnig gemacht. Sie beherrschen das offene Gelände und den Tag; ihre Machtzentren sind gut bewacht, und wer sich zu ihnen Zugang verschaffen will, muss viele Jahre in Organisationen verbringen, in denen alle Magie als Dummheit gilt. Aber das oft undifferenzierte Vorgehen der Wissenschaftspolizei und ihre Bereitschaft, auf Verdacht hin zu verhaften und abzuschieben (Feyerabend 1981, 1983), haben ihr auch Feinde gemacht und dazu geführt, dass in der Dunkelheit und in verborgenen Winkeln weit mehr Aberglaube und magisches Denken gedeihen, als es die Hierarchen der Wissenschaft vermuten.
Ein Beispiel für diese geringen Differenzierungsanstrengungen der Wissenschaft: Ein Pharmakologe, der die Wirksamkeit eines neuen Mittels beweisen will, erwirbt sich wissenschaftliche Glaubwürdigkeit dadurch, dass er den Placebo-Effekt durch den doppelten Blindversuch ausschließt. Weder Arzt noch Patient wissen, ob sie eine wirksame Substanz oder einen nach pharmakologischem Wissen unwirksamen Stoff, beispielsweise Milchzucker, erhalten. Wer auf diese Weise den Placebo-Effekt zu eliminieren glaubt, erwirbt sich Verdienst, Anerkennung und Karriere.