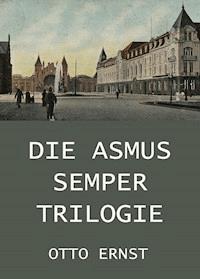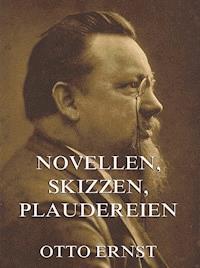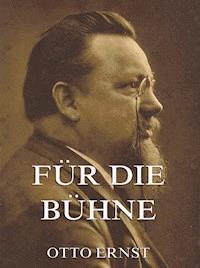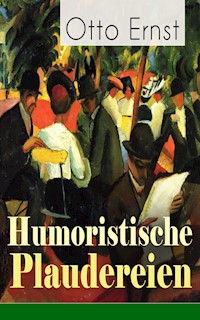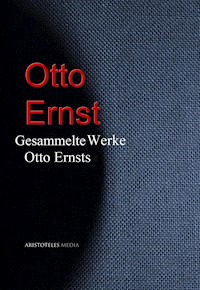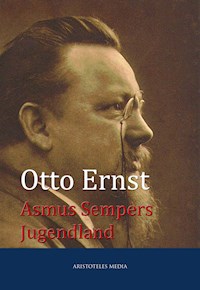Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Diese Ausgabe von "Humoristische Plaudereien" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Otto Ernst (1862-1926) war ein deutscher Dichter und Schriftsteller. Inhalt: Vom grüngoldnen Baum: Das vierbeinige Geschenk Von zweierlei Ruhm Die späte Hochzeitsreise Meine Damen! Die Marienbader Kur Ein frohes Farbenspiel: Von Schiffahrt, Angst, Courage und dergl. Der große Sonntag Flieh, auf, hinaus ins weite Land Von den Frauen. Eine verwegene Plauderei Wenn Kinder spielen Die Hosentaschen des Erasmus Asmodi oder Der hinkende Teufel im Theater Vom Essen und Trinken. Bekenntnisse einer schönen Seele Ernsthafte Predigt vom Commersieren Das Wintersonnenmärchen Humoristische Plaudereien über groß und kleine Kinder: Die Gemeinschaft der Brüder vom geruhigen Leben Was war uns Friedrich Schiller? Heimkehr in die Stadt Der Pudding Ein Tag aus dem Leben Appelschnuts Appelschnut und die Philosophie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die schönsten Geschichten der Jahrhundertwende: Humoristische Plaudereien
Inhaltsverzeichnis
Vom grüngoldnen Baum
Das vierbeinige Geschenk.
Auch ein Tagebuch.
Sie besitzt bereits einen ganzen Tierpark, unsere Jüngste, Tiere von Holz, Stein, Leder, Papiermaché und Metall, kurz von allem möglichen Material und in jeder erdenklichen Herstellungsart; endlich aber läßt sich der Drang nach dem Lebendigen nicht mehr zurückhalten, und zur nächsten Weihnacht will sie einen wirklichen Hund haben.
Roswitha, welch ein Begehren!
Ich habe die Hunde gern, soweit sie vier Beine haben, und soweit sie vier Beine haben, scheinen sie diese Zuneigung auch zu erwidern; diese Tiere haben wie die kleinen Kinder einen Instinkt für das Wohlwollen – aber einen Hund als Hausgenossen –? Mein Weib und ich erheben die ernstlichsten Sauberkeits- und Gesundheitsbedenken.
Wir erschöpfen unsere Phantasie in der Ausmalung kolossaler Unannehmlichkeiten und Gefahren, die ein Hund mit sich bringen kann; Roswitha sieht auch alles ein, wie es sich für ein pietätvolles Kind geziemt, und wenn wir sie dann fragen, was sie sich also statt eines Hundes wünsche, dann sagt sie: »'n Hund.«
Wir versuchen es anders herum: wir breiten vor ihrer Phantasie die wunderbarsten Dinge aus: Ganze Puppenhäuser mit Wasserleitung und Zentralheizung, prachtvolle Parks mit Springbrunnen und lustwandelnden Paaren, die man aus einer einzigen Schachtel hervorzaubern kann, vollständige Eisenbahnen mit sämtlichen modernen Verkehrserschwerungen, kurz: alles, was ein kindlich Herz erfreuen kann, und artig und folgsam erklärt Roswitha denn auch endlich: Ja, das alles möchte sie gern haben, und außerdem natürlich einen Hund.
Er ist da. Der Hundeseelenverkäufer hat den Judaslohn eingesteckt und ist gegangen. Es ist ein Dackel; er steht da und sieht sich ratlos im Kreise um wie ein Untersekundaner in der ersten Tanzstunde. Roswitha ist nicht zugegen. Wir lassen sie unter irgendeinem gleichgültigen Vorwande rufen. Sie kommt, und nun ereignet sich ein Wunder. Das Tier springt mit einem jauchzenden Belllaut an ihr hinauf und will ihr das Gesicht belecken. Roswitha ist hochbeglückt und fragt: »Wo kommt der her? Wem gehört der?«
»Der gehört dir.«
Das Weitere ist nicht zu beschreiben. Es gibt eine Freude, bei der dem Zuschauer die Tränen ins Auge treten. Menschenfreude ist so ergreifend wie Menschenleid.
Es ist kein Zweifel mehr, Roswitha und Männe sind durch Schicksalsschluß von Ewigkeit her für einander prädestiniert. Er spielt auch gern mit den andern Kindern; er zeichnet mich aus, indem er, wenn er unter meinem Schreibtisch liegt und schläft, sich mit schmeichelhafter Vertraulichkeit auf meine Füße bettet, deren animalische Wärme ihm sehr brauchbar scheint; er schätzt meine Frau noch höher; denn sie, nur sie, reicht ihm regelmäßig das Futter, und wenn er seine Schüssel leer geleckt hat – »nicht jedes Mädchen hält so rein« – so schenkt sie ihm einen prachtvollen Knochen; wenn die lieblichsten Düfte der Küche in ihren Kleidern hängen, so folgt er ihr, wohin sie will, und auch sonst gehorcht er ihr nicht selten (für einen Dackel eine enorme Leistung) – und doch: wenn diese Frau zum Schein die Hand gegen Roswithen erhebt, als wolle sie sie schlagen, so blafft er sie wütend an und schnappt nach ihrer Hand. Der edle Grundsatz: »Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe,« gilt bei den Hunden nicht. Ich möchte wissen, wer auf die törichte Idee gekommen ist, das Wort »Hund« als Schimpfwort zu gebrauchen. Ich wills gewiß nicht wieder tun.
Sobald das Dienstmädchen am Morgen seine Kammer geöffnet hat, rast er – zeigt mir einen Menschen, der mit so krummen Beinen so rasend laufen kann – rast er die Treppe zu Roswithens Schlafzimmer hinauf. Ich weiß nicht, wie ich dies Rennen bezeichnen soll – etwa wie wir ein Zündholz anreißen: rrt! – ist er oben und winselt vor ihrer Tür. Wenn ihm das Mädchen die Tür geöffnet hat, läuft er an Roswithens Bett und schaut hinein, und wenn sie schläft, legt er sich still auf den Bettvorleger nieder und wartet. Sowie sie erwacht und sich leise regt, springt er an ihrem Bett empor, reißt den Mund auf bis an die Ohren und lacht.
Bei der Toilette und beim Frühstück weicht er nicht von ihrer Seite, und wenn sie zur Schule fährt, begleitet er sie zum Bahnhof. Wenn er die Mittel hätte, würde er ihr jeden Morgen ein Veilchenbouquet in den Wagen reichen. Anfangs wollte er mitfahren; aber bald hat er eingesehen, daß das nicht möglich ist, und hat resigniert. So ein Dackel kann resignieren wie ein Philosoph. Nur daß er dem Zuge wehmütig nachschaut, bis er den Bahnhof verlassen hat. Roswitha winkt mit dem Taschentuch und will bemerkt haben, daß er mit den Ohrlappen zurückwinkt. Dann steht er noch einen Augenblick versunken da, das Haupt auf die Seite geneigt und mit einem Blick – einem Blick! – ich muß immer an den Primgeiger einer Zigeunerkapelle denken, der mit geneigtem Ohr die schwermütig-schmelzenden Töne seiner Geige einsaugt. Dann tappt er heimwärts. Das Leben hat vorläufig keinen Sinn und Zweck mehr als den, verschlafen zu werden. Zu jeder ihm passenden Zeit kratzt er an meine Tür, ob ich dichte oder nicht, und ich oder jemand anders macht ihm auf: denn ich habe die Weisung gegeben:
»Dieser Ritter wird künftig ungemeldet vorgelassen.«
Er geht geradeswegs unter meinen Schreibtisch, legt sich mit melancholischer Unverschämtheit quer über meine Füße und schläft. Schläft und schnarcht wie ein aktiver Kammerpräsident. Stunde auf Stunde. Wenn er gar zu heftig zu meinen Versen schnarcht, versetz ich ihm aus verletzter Autoreneitelkeit einen Stoß und rufe: »Männe. Mäßige dich.« Dann hört das Schnarchen für eine Minute auf, um dann mit neuer Kraft zu beginnen. Wer so schlafen könnte! Wer die Zeit dazu hätte! Die Türklingel mag läuten und die Haustür mag gehen, so oft sie will – er schläft und schnarcht. Verrückt, so etwas »ein Hundeleben« zu nennen!
Aber Männe könnte wie der Mann des Seidl-Löweschen Liedes singen:
Ich trage, wo ich gehe, Stets eine Uhr bei mir –
Gegen zwei Uhr wird sein Schlaf unruhig. Von Zeit zu Zeit zucken seine Ohren – es wetterleuchtet in seinen Zügen, wie ein ordentlicher Romanschreiber sagen würde – plötzlich hebt er den Kopf, rast – rrt! – nach der Tür, kratzt und winselt: »aufmachen, aufmachen.« – rrt! an die nächste, ebenfalls geschlossene Tür und heult: »aufmachen, schneller, schneller.« – rrt! an die Haustür und bellt: »diese ekelhaften Türen!« saust wie ein abgeschossener Dackel durch den Garten und in die Arme seiner vergötterten Herrin. Er hat sie gehört, gespürt, geahnt, mit zweitem Gesicht gesehen, bevor wir nur das Geringste hörten. Wie sie sich begrüßen, wie sie miteinander durch den Garten tollen – ja, das ist Liebe! Er lacht Tränen vor Wonne, und sein Schwanz, das Perpendikel seines Herzens, macht zehn Schwingungen in der Sekunde. Wenn sie ihre Schularbeiten macht, wenn sie mit ihren Puppen spielt – er liegt selig blinzelnd zu ihren Füßen. Wehe, wenn ein anderer das Zimmer betritt! »Wer wagt es, in den Dunstkreis meiner Herrin zu treten!« fährt er grollend auf und beruhigt sich nur langsam, wenn es ein Mitglied oder ein Freund des Hauses ist. Er erlaubt uns, mit Roswithen familiär zu verkehren, läßt aber durchblicken, daß ihm diese Vertraulichkeiten im Grunde seines Herzens nicht gerade angenehm sind.
Einmal aber kam sie nicht nach Hause, weil sie gleich von der Schule zu ihrer Freundin auf Logierbesuch gegangen war. Um zwei Uhr lief er an die Haustür, horchte und witterte und dachte: »Nanu?!« Er setzte sich nieder und wartete bis drei, bis vier, bis fünf. Er aß nicht, kauerte sich zusammen und verfiel in einen unruhigen Halbschlummer. Er fuhr empor, sobald er draußen etwas hörte – und sank traurig wieder in sich zusammen. Um sieben Uhr saß er noch auf dem Vorplatze, und das Antlitz noch, das bleiche nach dem Fenster sah.
Dann begriff er: sie kommt nicht, und suchte, ohne gegessen zu haben, mehr kriechend als gehend, sein Lager auf.
In der Nacht begann er zu heulen, daß wir erwachten und nicht wieder einschlafen konnten. Ich stieg im tiefsten Negligé die Treppen hinunter und machte ihm beruhigende Vorstellungen, schüttelte ihm sein Lager zurecht und lud ihn ein, wieder Platz zu nehmen und wohl zu ruhen. Nach solchen Exkursionen empfindet man die Bettwärme besonders wohltuend. Ich hatte kaum drei Minuten gelegen, als Männe wieder zu heulen begann wie ein besserer Schloßhund. Diesmal entfuhr ich schneller dem Bett, eilte die Treppe hinunter und wurde in meinen Worten sehr unangenehm, in meiner Stimme äußerst drohend. Ich sah nach dem Futter und dem Wassernapf – es war alles in Ordnung, stellte ihm das Ultimatum: jetzt Ruhe oder Prügel. und flüchtete klappernd wieder in mein Bett.
»Na, jetzt scheint er sich ja –«
»Zu beruhigen,« wollte meine Frau sagen, kam aber nicht dazu, weil der Herr Dackel wieder das Wort genommen hatte.
»Vielleicht will er hinaus,« meinte meine Frau. Ich zog mich also an, ging hinunter, schloß die beiden Haustüren auf und sagte: »Hinaus.«
Rrrrt! war er draußen.
Ich schloß wieder zu, ging nach oben, entkleidete mich und schlüpfte tief aufatmend und zufrieden ins Bett. Da heulte und bellte er draußen, und schlimmer als zuvor.
»Jetzt weckt er auch die Nachbarn auf,« sagte meine Frau.
Ich zog mich abermals an, diesmal aber lag in der Art, wie ich die Hosen heraufzog, entschlossener Ingrimm. Ich nahm einen gehörigen Stock zur Hand, ging hinunter, schloß wieder zweimal auf, rief den Hund mit wohlwollend gefärbter Stimme ins Haus – rrt, lag er wieder in seinem Korb – und schloß wie ein bedächtiger Henkersknecht wieder zu. Dann ging ich zu dem Hunde und hob den Stock – aber das Tier sah mich mit einem Paar Augen an – nie hab' ich in menschlichen Augen eine so ergreifende Angst und Traurigkeit gesehen. Aus der Tiefe seines dunkleren Daseins herauf fürchtet sich ein Tier vielleicht noch mehr, als ein Mensch sich fürchten kann. Ich warf den Stock hin, redete dem Tiere wieder begütigend zu und ging wieder nach oben. Wir mußten uns endlich entschließen, auch trotz Hundegeheuls einzuschlafen, und wenn man muß und will, kann man auch das.
Als Roswitha nächsten Tages heimkehrte, ließ Männe eine Art Bellheulen hören, das man nicht näher bezeichnen kann; es schien ein wirres Produkt von Bellen, Weinen, Jauchzen, Heulen, Schluchzen und Hurrarufen, und in seiner Begeisterung rannte er so heftig gegen sie an, daß sie sich wider Willen »bums« auf den Rasen setzte. Diese Gelegenheit benutzte Männe wider alles Verbot, ihr immer abwechselnd Hals und Gesicht zu belecken. Sein Schwanz machte diesmal fünfzehn Schwingungen in der Sekunde.
Inzwischen ist es Frühling, ist es Sommer geworden, und Männe zieht Feld und Garten dem Aufenthalt zu meinen Füßen bei weitem vor. Wenn Kinder im Garten sind, vor allem, wenn Roswitha dabei ist, bevorzugt er den Garten vor allen andern Plätzen. (Auch ein Beweis für Männes feinen Instinkt, daß ihm die Kinder lieber sind als die Erwachsenen.) Er erlaubt dann gütigst, daß man ihn spazieren fahre. Die Kinder setzen ihn in den Blockwagen, bedecken ihn bis an den Hals mit Birken, Erlen und Weidenkätzchen, so daß nur der interessante Kopf hervorschaut; zwei ziehen und eines geht hinterher und hält den Sonnenschirm über ihn. Er aber blickt um sich mit dem lässigen Behagen eines Elegants, der mit dem chicksten Gespann der Welt durch das Boulogner Wäldchen fährt.
Wenn keine Kinder da sind, bin ich ihm gut genug, ja, wenn ich Miene mache, nach den Stiefeln zu greifen, macht er die halsbrechendsten Versuche, mich zu küssen. Ich brauche von dem Worte »ausgehen« nur die erste Silbe zu sprechen, so steht er schon wonneheulend an der Haustür. Es ist der Forscherdrang, der ihn hinaustreibt. Denn unterwegs gibt es keinen Garten und kein Gehöft, keine Tür und keine Pforte, durch die er nicht eindränge, um eine gründliche Lokalinspektion vorzunehmen, so daß ich mir schon gedacht habe, er sei im Stillen mit der Abfassung eines Adreßbuches für Hunde beschäftigt. Man kann nie wissen, was in so einem Dackel steckt und was er vorhat.
Wenn weder die Kinder noch ich zu seiner Unterhaltung verfügbar sind, liegt er auf dem Rasen in der hellsten und heißesten Sonne. Es ist nicht zu sagen, was solch ein Tier an Sonne in sich aufnehmen und an Faulheit hervorbringen kann. Dackel sind der schlagendste Beweis gegen die Theorie, daß Wärme sich in Bewegung umsetze. Männe nun gar hat die Faulheit zur Genialität entwickelt. Der trägste Maurersmann ist eine Biene im Vergleich zu ihm, und wenn Otto der Faule ein Denkmal erhalten hat, so verdient Männe eine ganze Siegesallee. Halbe Tage lang liegt er, den Kopf auf die Vorderpfoten gestreckt, in der Sonne und schlürft das Dasein in sich ein als ein Schlemmer, der die ewige Seligkeit durch einen Strohhalm einsaugt.
Nur zuweilen steht ihm der Sinn nach anderem Pläsier. Dann kommt niemand, auch der harmloseste Spaziergänger nicht, an unserm Garten vorbei, ohne daß ihn Männe ohne allen Grund und Zweck auf die heftigste Weise angebellt und angeschnauzt hätte. Er bleibt wohlweislich hinter dem Gitter; aber er schnauzt wie toll: »Was haben Sie hier zu suchen! Scheren Sie sich augenblicklich fort, oder –!« Ich denke mir, daß er in einem früheren Dasein Polizeibeamter in Deutschland gewesen ist, und daß es sich nur um gelegentliche Rückfälle, um eine Art Atavismus handelt.
Wenn er auch dieses Vergnügens müde ist und sich gar nichts anderes mehr bietet, trottet Männe nach dem Hintergarten und holt aus einem Versteck den ewigen Knochen hervor. Es ist ein vollkommen abgenagter, steinharter, gebleichter Knochen, von dem auch nicht das Geringste mehr herunterzubeißen ist; aber was will man dazu sagen? Man kann daran nagen und kauen. So hat der Mensch die Erinnerung . . . .
In Alexander Dumas wundervollem Lügenroman »Der Graf von Monte Christo« gibt es einen alten Mann namens Noirtier, der so schwer vom Schlage gerührt ist, daß er weder sprechen noch ein Glied rühren kann; aber Augen hat er, Augen, in denen sich sein ganzer Lebensrest konzentriert. Mit alleiniger Hilfe dieser Augen unterhält er sich, macht er Testamente, entlarvt er Giftmischerinnen, führt er Liebende zusammen – ich erinnere mich nicht, ob er auch Klavier spielt; aber Dumas würde auch das auf sich nehmen – kurz: macht der alte Herr Sachen, bei denen im Vollbesitz ihrer Kräfte befindliche Menschen in Schweiß geraten würden. An die Augen des Noirtier muß ich jedesmal denken, wenn ich in Männes Augen schaue. Auch er macht und sagt mit den Augen alles. Es gibt nichts Klügeres und dabei Unergründlicheres als Dackelaugen, nichts Ausdrucksvolleres, Wechselvolleres als ein Dackelgesicht; denn der Dackel ist derjenige unter den Hunden, der ein wirkliches Gesicht hat. Manchmal, wenn ich ganz allein bin und keinen andern Gesellschafter habe als ihn, spreche ich stundenlang mit ihm die tiefsten Dinge über moderne Literatur und Kritik. Das Resultat dieser Dialoge gedenke ich einmal als »Unterhaltungen mit einem Hunde« herauszugeben. Wie köstlich sind auch seine Antworten, wenn er sich in meiner Abwesenheit eine Wurst vom Frühstückstisch geholt hat.
»Ach bitte, verehrter Männe, komm doch mal her!«
Seine ganze Reaktion besteht darin, daß seine Ohren leise zucken.
»Männe!«
Er hebt langsam den Kopf von den Pfoten.
»Hörst du nicht, Männe?«
Er erhebt sich langsam und streckt sich in den Vorderbeinen.
»Hierher, Männe!«
Er wiederholt dieselbe Freiübung in den Hinterbeinen.
»Na?!«
Jetzt läßt er sich langsam herbei.
»Wo ist die Wurst geblieben?«
»Wie meinen?« versetzt er, indem er mit sanftem Augenaufschlag den Kopf auf die Seite legt.
»Wo die Wurst geblieben ist, will ich wissen.«
»Sie verzeihen, ich höre auf diesem Ohr nicht gut,« erklärt er und neigt den Kopf auf die andere Seite.
»Wer hat die Wurst hier weggenommen?«
»Gestatten Sie eine Frage: Was ist Wurst?« erwidert er.
Ich ziehe ihn an seinem Halsband an den Tisch, stelle ihn auf einen Stuhl und deute auf den Teller, um ihm seine Schandtat durch die Sinne in Erinnerung zu bringen.
»Ich danke,« bemerkt er, »ich habe keinen Appetit.«
»Pfui, Männe,« ruf' ich, indem ich ihn schüttele, »du stiehlst Würste? Schäm' dich, du Lump!«
Er blickt mich voll an mit den Augen des Herrn Noirtier und versetzt: »Auf diesen Ton einzugehen verbieten mir Erziehung und Selbstachtung.«
Kurz, es ist ihm nicht beizukommen. Er stellt sich konsequent auf den Standpunkt: »Solange man unschuldig tut, kann man noch Dumme finden, die's glauben«, und erinnert mich dann immer an den bekannten biederen, krummbeinigen Bürgersmann, der es faustdick hinter den Ohren hat und die allgemeine Achtung seiner Mitbürger genießt.
Nun wird mir vielleicht der eine oder andere meiner Leser einwenden, ich übertriebe und schätzte die Intelligenz meines Dackels denn doch gar zu hoch ein. Solchen Opponenten will ich noch ganz was anderes sagen. Die Menschen haben jahrtausendelang die Erde für das Zentrum des Weltgebäudes gehalten und sind furchtbar damit hineingefallen. Dann hat es noch lange Zeit Leute genug gegeben, die da hofften, daß wenigstens der Mensch das Zentrum der Welt sei. Ihre Blamage hat nicht auf sich warten lassen. Daß er Gipfel und Zentrum der organischen Erdenwelt sei, das glaubt der Mensch noch heute. Wie aber, wenn er eines Tages auch von diesem selbstgezimmerten Throne verjagt würde und in irgend einem Tier eine weit intelligentere und ehrenwertere Gattung erkennen müßte? »Oho!« hör' ich einige rufen. Bitte: ich stand vor einiger Zeit vor dem Ladenfenster eines großen Bankiers, allwo man Münzen in Silber und Gold und unzählige Banknoten und Wertpapiere aus aller Herren Ländern, alles in allem ein beträchtliches Vermögen ausgestellt sah. Da kam ein riesiger Hund daher, und was tat dieser Hund? Er warf einen kurzen Blick in das Schaufenster und nahm dann diesen Schätzen gegenüber eine Stellung ein, wie sie die Hunde an Ecken, Bäumen, Laternenpfählen u. dgl. nicht selten einnehmen. Kann ein zynischer Philosoph eine größere Überlegenheit beweisen? Ja, noch mehr; dieselbe Stellung sah ich bald darauf einen Hund vor einem Bücherladen einnehmen, und zwar genau an der Stelle, wo das Buch eines meiner literarischen Gegner – ich will den Namen nicht nennen – ausgelegt war. Wo findet man bei Menschen ein so sicheres Urteil? Nun ja, wendet vielleicht ein Mann von großer Vernunft ein: der Hund weiß eben nicht, welchen Wert eine Obligation der Österreichisch-ungarischen Staatsbahn repräsentiert; man halte ihm aber eine Wurst hin, und man wird sehen, wo seine Überlegenheit bleibt. Das ist ja eine sehr vernünftige und ernsthafte Bemerkung; indessen: ich habe Hunde nach einer Wurst springen, schnappen und lungern sehen, und habe Politiker, Künstler und Gelehrte nach einem Orden springen, schnappen und lungern sehen, und ich muß euch sagen: ich habe stets die Bewegungen des Hundes anmutiger und würdiger gefunden. Und dann, wie gesagt, wenn ich Männe soeben eine Gothaer Zervelatwurst geschenkt habe und im nächsten Augenblick auf Roswitha losfahre, als wollte ich ihr ein Leids tun, so schnappt er nach mir mit wütendem Gebell. Bringt mir ein Analogon aus der Menschenwelt.
Nein, ich laß es mir nicht nehmen: der Hund, wenigstens der Dackel, besitzt Qualitäten, die ihn sogar zu hohen Stellungen in unserem Staatswesen berechtigen. Männe zum Beispiel liebt es in Winterszeiten, sich, wenn er nicht über meine Füße verfügen kann, möglichst unmittelbar vor den glühenden Ofen zu legen. Da ich das für ungesund halte, so pflege ich es nicht zu dulden.
»Na –?« ruf ich dann in ziemlich energischem Tone, worauf er leise mit den Ohren zuckt und über die Pfoten hinweg nach mir hinschielt. (Vergleiche die Darstellung von vordem.)
»Na, Männe?!« ruf ich lauter, worauf er langsam den Kopf hebt, ganz wie oben und wie immer.
Ich muß also erst zu ihm herantreten und mit nicht mißzuverstehender Gebärde rufen:
»Gehst du jetzt augenblicklich fort?!«
Dann erhebt er sich, dreht sich einmal langsam um sich selbst und legt sich wieder nieder. Er glaubt damit bei mir die Täuschung zu erzielen, daß er vom Ofen weggerückt wäre.
»Männe, wenn du jetzt nicht sofort –!!«
Da erhebt er sich abermals, dreht sich einmal auf der Stelle, legt sich wieder hin und spricht zu mir mit den Augen eines Engels:
»Sie sehen, ich tue alles, was Sie von mir wünschen.«
Da frage ich: man verwendet die Hunde jetzt auf allen Gebieten, bei wissenschaftlichen Forschungen, bei der Polizei, in der Armee – warum nicht in der Diplomatie?!
Um aber vollends ernst zu reden: Wenn ich gesehen habe, wie Tiere von Menschen gequält, geschunden und mit Mühsal überladen wurden, wenn ich den Blick gesehen habe, mit dem ein Pferd die Roheit seines Herrn erträgt, ohne zu vergelten, wie es doch wohl könnte, dann ist mir mehr als einmal der Gedanke gekommen: sie befolgen die Philosophie, die die Menschen von den Kanzeln predigen: Liebet eure Feinde und widerstrebet nicht dem Übel; denn ihm widerstreben, heißt es vermehren. Und dann ist mir noch immer vor meiner Gottähnlichkeit bange geworden.
In Summa: ich lerne Roswithens Sympathien täglich mehr verstehen, und jetzt find' ich auch, daß Männe schön ist, schön wie Engel voll Walhallas Wonne, und weiß auch, woher er die krummen Beine hat. Er wäre sonst zu schön gewesen, darum krümmte ihm der Neid der Olympischen die Beine. Zwar finde ich, daß er bei der guten Kost etwas in die Breite geht, daß er einer Nudelwalze ähnlich wird wie ein zu gut gepflegter erster Held und Liebhaber; aber Roswithens Liebe ist blind. Sie hat mir auch ganz heimlich, damit es Männe nicht höre, ins Ohr geflüstert, was sie ihm zur bevorstehenden Weihnacht verehren will. Sie will ihm ein Halsband sticken, ihm eine Wurst und ein Tannenbäumchen schenken. Das Bäumchen hat sie schon leise herbeigeschafft, als er schlief, und wenn sie an dem Halsband stickt und Männe zur Tür hereinkommt, verbirgt sie es schnell unter dem Tisch. Auch hat sie mir bereits anvertraut, was sie sich zur wiederum nahenden Weihnacht wünscht: ein Lamm, eine Ziege, zwei Kaninchen, einen Laubfrosch, einen Kanarienvogel und noch einen Dackel. »Weiß du warum, Pappi? Denn kriegen sie fürleicht Junge, un denn kriegen wir immer mehr Dackel.«
Von zweierlei Ruhm.
Manche Leute erweisen mir die Ehre, mich für berühmt zu halten. Und ich glaube sogar, daß ich es bin. Ich sage das ganz ungeniert, weil der Ruhm, um den es sich hier handelt, eigentlich gar kein Ruhm ist. Wirklicher Ruhm – wenigstens Dichterruhm – kann eigentlich erst nach dem Tode entstehen. Darin irren unsere Kritikaster (wenn sie es auch bestreiten werden): leisten kann ein Dichter schon bei Lebzeiten etwas; sogar Faust und Hamlet wurden vor dem Tode ihrer Verfasser geschrieben; aber berühmt, richtig berühmt kann ein Dichter erst nach seinem Hingang werden. Der Graf Zeppelin ist bei lebendigem Leibe berühmt geworden; denn der Wert eines brauchbaren Luftschiffes leuchtet ohne weiteres ein; Kunstwerke aber sind imaginäre Größen. »Herrlich,« sagt der eine, »scheußlich« der andere, und beweisen kann keiner von beiden, daß er recht habe. Erst wenn ein Kunstwerk nicht nur zu den Zeitgenossen, wenn es auch zum nachlebenden Geschlecht, ja zu mehreren Geschlechtern mit warmen Lippen gesprochen hat, erst wenn die Zeit, die alle vorlauten Meinungen belächelt, ihr anerkennendes Urteil gesprochen hat, erst dann beginnt den Grabstein des Künstlers jenes magische Licht zu umwittern, das wir mit andächtigem Schauer den »Ruhm« nennen.
Die andere Sorte von Ruhm darf uns mit geringerer Andacht erfüllen. Es ist nämlich die durch unser ausgedehntes Zeitungs- und Verkehrswesen ins Ungewöhnliche gesteigerte Bekanntheit des Namens. Ich wiederhole: des Namens. Die Namen Max Klinger und Wilhelm Raabe sind gewiß in weite Volkskreise gedrungen, und wenn man sie nennt, werden weiteste Volkskreise rufen: »Ah – Max Klinger. Alle Achtung. – Ooh – Wilhelm Raabe – das wollt' ich meinen!« Aber bei näherem Nachforschen wird man bald bemerken, daß große Massen dieser Kreise nicht genau wissen, ob Klinger und Raabe berühmte Parlamentarier oder berühmte Chemiker sind, oder ob sie gemeinsam eine berühmte Korsettfabrik betreiben. Nur, daß sie »berühmt« sind, das weiß man.
Ich wollte vor kurzem einen Freund besuchen, der in einem großen Bankhause beschäftigt ist. Ich wandte mich an einen Kollegen meines Freundes und sagte:
»Würden Sie die Güte haben, Herrn X. zu sagen, daß ich da bin? Mein Name ist Otto Ernst.«
»Ah,« rief er ehrfurchtsvoll, »der Komponist!?«
»Ganz richtig,« sagte ich, »der Komponist der Salome.«
»Aaah!« machte er mit tiefer Verbeugung, »darf ich bitten, Platz zu nehmen; ich werde Herrn X. sofort verständigen.«
Diese Art von Ruhm meinte ich mit der zweiten Sorte. Sie bekundet sich u. a. durch die mehr oder weniger stündlich einlaufenden Autogrammgesuche. Wenn man in einer Autographensammlung unter keinen Umständen fehlen darf, dann ist man unrettbar berühmt. Ich bin in keiner Hinsicht Sammler; aber ich kann es verstehen, daß jemand die Schriftzüge eines Menschen besitzen möchte, dessen Werke ihm lieb geworden sind; denn ein gewisses Charakteristikum des Menschen liegt wohl auch in seiner Schrift. Wenn ich merke, daß einer sich wirklich mit meinen Arbeiten befaßt hat, pflege ich deshalb seinen Wunsch nach einem Autogramm wohl zu erfüllen. Aber die Anrede »Hochverehrter Meister!« und die allgemeine Versicherung, daß man meine »sämtlichen Werke mit größter Begeisterung gelesen habe«, überzeugt mich nicht, besonders dann nicht, wenn der Briefschreiber mich konsequent »Herr Otto Erich« nennt. Die Autographensammlerei hat sich nämlich zu einem kompletten Blödsinn, zu einer förmlichen Landplage entwickelt, und 80 Prozent der Sammler denkt gar nicht daran, jemals einen Blick auf das Werk derer zu werfen, »deren Schriftzüge ihnen die kostbarste Bereicherung ihres Albums« sein würden. Die lieben kleinen Mädchen sind natürlich hier wie in all dergleichen Dingen die Geriebenen. Sie appellieren an die Eitelkeit des Mannes im Künstler; er soll ihnen glauben, daß sein Bild immer über ihrem Schreibtisch, über ihrem Bett hänge, daß ein Autogramm von ihm »der sehnlichste Wunsch ihres Lebens« sei und sie »unendlich selig« machen würde usw. usw. Man sieht förmlich die armen Wesen sich in schlaflosen Nächten auf den tränendurchnäßten Kissen wälzen und den Tag ihrer Geburt verfluchen, weil sie noch immer das Autogramm nicht haben. Es gibt allerdings auch andere. So schrieb eine – ohne jegliche Anrede –
»Da ich eine eifrige Autographensammlerin bin, so bitte ich höflichst um Ihre Schriftzüge.
Erna . . . .«
Es fehlt nur noch der Zusatz: »widrigenfalls unverzüglich zur Pfändung geschritten werden wird.«
Sehr viel Freude hatte ich auch an dem Brief einer kleinen Engländerin. Sie schrieb:
»Im Anschluß, der von Ihnen so entzuckenden geschriebenen Schriftstucken kann ich es nicht unterlassen, einige Zeilen an Sie hochgeehrter Herr zu richten. Schon lange war es mein sehnlichster Wunsch (siehe da!) ein Autogramm von ihnen zu besitzen« usw. usw.
Als ich meine Schreibweise von einer solchen Kennerin unserer Sprache anerkannt sah, kam ich mir ungemein berühmt vor.
Was diesen Bittgesuchen noch eine besondere Pikanterie verleiht, ist, daß sie häufig mit Strafporto belastet sind. Eine Zugabe, die auch viele der täglich einlaufenden, zur Beurteilung eingesandten Dramen, Romane und Gedichte auszeichnet.
Die Begleitbriefe dieser Sendungen fangen so gut wie ausnahmslos folgendermaßen an:
»Sie werden sich fragen, wie ich, ein Ihnen völlig Unbekannter, dazu komme, Ihnen, der Sie gewiß mit ähnlichen Anliegen überschwemmt werden, beschwerlich zu fallen (ach nein, ich frage mich schon gar nicht mehr; ich kenne meine Antwort) und Ihre gewiß kostbare Zeit (er schickt aber doch!) für die wohlwollende Prüfung des beifolgenden Dramas in Anspruch zu nehmen. Ich würde es auch nicht wagen, wenn ich mir nicht sagen dürfte, daß hier ein Fall vorliegt –«
Der Fall liegt nämlich immer vor. Ich kann aber ohne Übertreibung versichern, daß ich, wenn ich alle diese »Ausnahmefälle« lesen und gewissenhaft prüfen wollte, auf jede eigene Produktion verzichten müßte. »Nu, wenn schon –« werden manche der Einsender denken; aber so denke ich eben nicht. Man tut ja, was man kann; obwohl Gustav Falke recht hatte, als er mich vor kurzem fragte:
»Hast du denn deine Erstlinge an Berühmtheiten zur Prüfung geschickt?«
»Nein,« sagte ich.
»Na also; ich auch nicht,« sagte Falke.
Aber gleichwohl, man tut, was man kann, wenn einem die »Berühmtheit« nicht gar zu sauer gemacht wird. Das kommt aber vor. Einer z. B. verlangte dieser Tage achterlei von mir: Ich sollte
sein Stück lesen,
dessen Mängel beseitigen,
es bei einer Bühne anbringen,
einen Verleger besorgen,
die Höhe der mutmaßlichen Tantièmen angeben,
mich bei gewissen Zeitungen für ihn verwenden usw. usw.
Vorschuß verlangte er von mir nicht. Aber auch das gibt es. Zu einem meiner Freunde kam ein Mann und sagte:
»Ich habe eine glänzende Schwankidee; die könnten wir gemeinsam bearbeiten. Der Erfolg ist sicher.« (Ist immer sicher.) »Solch ein Schwank bringt erfahrungsgemäß 60 000 M. ein. Strecken Sie mir meine 30 000 M. vor.«
»Wieso?« sagte mein Freund, »strecken Sie mir meine 30 000 M. vor.« Aber so sicher schien dem Männe der Erfolg nicht. Er hatte wohl auch nicht so viel bei sich.
Einige dieser Herren Kollegen bestimmen gleich die Zeit, innerhalb deren die Prüfungsarbeit zu leisten ist.
»Soeben meine Komödie beendet,« heißt es in einem solchen Schreiben mit kühner Partizipialkonstruktion, »richte ich an Sie die ergebenste Bitte, ob Sie gewillt wären, mit mir dieses Stück einmal an Abenden nächster Woche durchzugehen.« Und um sein Vorgehen zu rechtfertigen, schreibt derselbe Herr:
»Hat Schiller, Deutschlands Lieblingsdichter, nicht immer seine Werke nach der Beendigung erst seinem Freunde, dem geistvollen Goethe zur Durchsicht gegeben? – ja, und Letzterer nahm diese Ehre auch mit großem Danke an.« (Die Folgerung ergibt sich von selbst.) »Gleiches taten noch ferner viele andere Dichterfürsten.«
»Wer kann da widerstehen?« hat er sich gedacht. Am hübschesten hab ich in diesem Briefe immer den »geistvollen Goethe« gefunden. Es ist so, als wenn man sagte: »Der strebsame Beethoven« oder »der anstellige Bismarck«.
Die resolutesten Herrschaften dieser Art schreiben einfach: »Ich werde mir erlauben, am nächsten Sonntag zu Ihnen zu kommen und Ihnen das Stück vorzulesen.« Darauf pflege ich freilich zu antworten: »Sie werden nicht, mein Herr oder meine Gnädige.« Ich halte das für qualifizierte Erpressung. Einmal habe ich das durchlebt. Es war ein armes Weib, dem ich nichts Angenehmes sagen konnte und nichts Unangenehmes sagen mochte. Die Martern des Guatimozin sind ein Sonnenbad gegen solche Qualen. Seitdem bringt mich ein Besucher dieser Art nicht mehr zum Sitzen.
Ganz etwas anderes ist es, wenn, wie vor einigen Jahren, ein Mann zu mir kommt und erklärt: »Ich bin ein Dichter, wie er in hundert Jahren nur einmal vorkommt. Mit Dichterlingen wie Hauptmann und Sudermann bitte ich mich nicht zu verwechseln. Mein Stück steht auf gleicher Höhe mit dem »Hamlet«, nur, daß es weit dramatischer ist.« Eine solche Unterstützung vereinfacht die Arbeit bedeutend; man stimmt einfach zu.
Und ebenso klar lagen die Verhältnisse bei einem jungen Mädchen, das mir schrieb:
»Hiermit erlaube ich mir, Ihnen sechs meiner von mir verfaßten Gedichte zu übermitteln; ich schrieb dieselben ohne jegliches Vorstudium und brauchte für jedes Gedicht zirka zehn Minuten . . . . Wenn ich mich der Schriftstellerei vollständig widme, werde ich nur humoristische Skizzen schreiben, da ich auf dem humoristischen Gebiet zu Hause bin.«
Das ist sie ohne Zweifel, und das hab' ich ihr auch geschrieben.
Die feste Überzeugtheit ist auch ein durchgehendes Merkmal derer, die nicht mit fertigen Schöpfungen, sondern mit »brillanten Stoffen« an den »Berühmten« herantreten. »Das ist wirklich passiert!« – mit diesem Satze glauben sie jeden Einwand beseitigt.
»Das ist Wort für Wort Tatsache!« erklärte mir solch ein Mann. »Sie glauben gar nicht, wie gemein sich die Verwandten meiner Frau gegen sie benommen haben.«
»Das kann ich mir denken,« sagte ich höflich.
»Nein, das können Sie sich gar nicht denken.«
»Dscha – wenn Sie meinen –«
»Ja, und nun wollten wir gern 'n Roman daraus gemacht haben. Meine Frau könnte das ja auch machen; aber sie hat keine Zeit zu so was.«
»Und nun meinten Sie, daß ich . . .«
»Ja.«
»Na – schreiben Sie einmal alles auf, was Sie erfahren haben, recht klar und wohl geordnet« (in diesem Augenblick bemerkt man regelmäßig auf dem Gesicht des Besuchers eine deutliche Enttäuschung) »und dann schicken Sie's mir durch die Post; dann werde ich Ihnen ebenfalls durch die Post meine Meinung schreiben.« Dies ist die einfachste Methode.
Oder ich schicke sie, in dem christlichen Gefühl, daß man auch seinen Kollegen ein Vergnügen gönnen soll, zu einem andern. »Gehen Sie mal nach Blankenese, da wohnt Gustav Frenssen, der macht es Ihnen sofort, oder, wenn der nicht will, gehen Sie zu Liliencron, der tut's sicher. Grüßen Sie die Herren von mir.«
Sehr nett war auch der Mann, der mit der ungemein dramatischen Idee »Grün Tuch« zu mir kam.
»Im ersten Akt,« rief er begeistert, »ist es das grüne Tuch des Försters. Im zweiten das grüne Tuch des Bureautisches. Im dritten das grüne Tuch von Monte Carlo. Im vierten« – hier wurde er schmelzend – »das grüne Tuch der Natur – Frühling. – verstehen Sie?«
»Vollkommen. Und –?«
»Das wird kolossalen Erfolg haben, Sie werden sehen. Wollen Sie das bearbeiten? – Ich würde Ihnen natürlich einen Teil der Einnahmen abgeben!«
Immerhin war dieser grüne Stoff noch reichlicher bemessen als der »Stoff« eines Jünglings, der mir schrieb:
»Ein talentvoller junger Mann, dem es seine Eltern an Ausbildung nicht haben fehlen lassen, der aber besonderer Umstände halber trotzdem das väterliche Geschäft erlernt, glaubt auf Grund seiner Fähigkeiten zu etwas Höherem geboren zu sein, wird aber durch seine Eltern jedesmal abgehalten und gezwungen, sein Geschäft weiter zu verrichten. Die Lösung dieser Frage bleibt ja nun dem Bearbeiter dieses Werkes (nämlich mir) überlassen, und ist der Phantasie weitester Spielraum gelassen.«
Unverkennbar. Diese Sublieferanten haben aber mitunter noch eine Kehrseite. Nehmen wir an – nicht dieser junge Mann; ich kenne ihn nicht und will ihm nicht unrecht tun – aber irgend einer wäre mit derselben Idee zu Schillern gekommen und Schiller hätte dann seine Jungfrau von Orleans geschrieben, so hätte Schiller ganz wohl erleben können, daß jener ihn öffentlich des Plagiats oder doch der unlauteren Benutzung seiner Ideen bezichtigt hätte. Man hat Beispiele.
Natürlich sind alle solche Petenten »begeisterte Verehrer und Bewunderer« unserer sämtlichen Werke. Und es ist nett, wenn man dann gelegentlich merkt, daß sie einen mit Tolstoi oder mit der Verfasserin der »Berliner Range« verwechseln. Das Hübscheste leistete aber doch der Ungar, der mich übersetzen wollte. Er schrieb mir:
»Ich bin einer Ihrer Schwärmer und möchte gern Ihr reizendes Stück »In Behandlung« übersetzen.«
Nun ist »In Behandlung« wirklich ein reizendes Stück; aber es ist von Max Dreyer. Ich schrieb denn auch zurück, daß ich gegen die Übersetzung nicht das Geringste einzuwenden hätte.
Und da wir einmal bei der österreichisch-ungarischen Monarchie sind, so will ich noch erzählen, was sich – sagen wir: in Graz ereignete. Es war nicht Graz; aber sagen wir eben deswegen »in Graz«. Ich hatte eine Vorlesung gehalten, und nach der Vorlesung kam ein stürmischer Student zu mir, ein jugendlicher Idealist. und bat mich, ich möchte doch mit ihm zur Frau v. G. kommen, sie sei sehr geistreich und eine große Verehrerin von mir; sie lasse mich zum Souper bitten; es kämen noch sechs oder sieben andere Herrschaften, die alle darauf brennten, mich persönlich kennen zu lernen. Ich hatte meine Erfahrungen, sträubte mich heftig und erklärte, daß ich viel lieber mit ihm und seinen Kommilitonen einem zwangloseren Vergnügen obliegen würde; aber ich merkte bald, daß ein Preis auf meinen Kopf gesetzt war und daß er sich anheischig gemacht hatte, mich tot oder lebendig einzuliefern. Ich wurde schwach und ließ mich hinschleifen. Es waren auch wirklich eine ganze Anzahl Damen und Herren da, die mich sämtlich, einer nach dem andern, fragten, ob ich schon einmal in Graz gewesen sei. Natürlich mit Abwechslung in der Form, aber mit merkwürdiger Übereinstimmung des Grundgedankens:
»Sind Sie zum erstenmal in Graz?« oder
»Waren Sie schon mal in Graz?« oder
»Sie sind wohl nicht zum erstenmal in Graz?« usw.
Ein bizarrer Geist fragte mich, in welchem Hotel ich abgestiegen sei. Nun hab' ich gar nichts gegen solche Fragen als Gesprächseinleitung; aber die ganze Unterhaltung bestand aus solchen Einleitungen. Es fiel mir auch auf, daß die Dame des Hauses mich als »Herr Otto« vorstellte – so vertraut waren wir doch noch gar nicht – aber ich dachte mir: sie hat sich versprochen. Das Essen in diesem reichen Haufe war deprimierend, niederschmetternd und überzeugte mich davon, daß die gnädige Frau mich nur sehr oberflächlich kennen müsse. Der stürmische Student tat, was ich selbstverständlich niemals tue: er brachte das Gespräch auf meine Schriften, und ich bemerkte deutlich, daß die gnädige Frau an meiner Seite unruhig wurde. Aus Mitleid mit ihr suchte ich dem Gespräch eine andere Wendung zu geben; aber der Student war hartnäckig; er faßte immer wieder nach. Da sah ich es plötzlich hell aufleuchten im Antlitz der Dame, ein erlösender Gedanke mußte ihr gekommen sein.
»Sie sind doch gewiß aus einer Waldgegend, nicht wahr?« sprach sie zu mir mit begeistertem Lächeln.
Ich blickte unwillkürlich an mir hinunter, ob ich etwas Waldmenschliches an mir hätte. »Warum meinen Sie das, gnädige Frau?«
»Nun, Ihr neuestes Stück spielt doch mitten im Walde, nicht wahr? Ich konnte leider nicht zur Premiere kommen –«
»Im Walde?« wiederholte ich staunend.
»Theo!« rief sie jetzt ihren Gatten an, der bereits vor Verlegenheit schlotterte und die Augen verdrehte, »du erzähltest mir doch von dem Förster und dem Gutsherrn, die im Streit miteinander liegen, und der Förster schießt dann den Sohn des andern tot . . .«
Die ganze Gesellschaft saß »kalt durchgraut«, und Theo starrte sein Weib an wie Belsazar die Wand mit der Flammenschrift. Die Bejammernswürdige meinte den »Erbförster«. Meine Verehrerin hielt mich für dessen Verfasser, der allerdings auch Otto heißt.
Ich glaube, daß ich nun deutlich genug jene mumpiziöse Art des Ruhmes gekennzeichnet habe, die mit dem Menschen, seinem Werk und seinem Verdienst nicht das Geringste zu tun hat, die nichts ist als eine Resonanz in hohlen Köpfen und offenen Mäulern, und die deshalb allerdings vortrefflich in unsere Zeit paßt. Und ich hoffe, nicht den Verdacht erweckt zu haben, als wollte ich Erhabenheit über die Anerkennung der Mitlebenden posieren. Die Dichter, die uns versichern, daß es ihnen vollkommen gleichgültig sei, ob ihre Bücher gekauft und gelesen würden, bewundere ich aus innerstem Herzen; aber ich glaube ihnen nicht. Ich las noch in diesen Tagen wieder die herrlichen Briefe Th. Fontanes an seine Familie. Der feine, bescheidene, adlige Mann freute sich von Herzen jedes ehrlichen Lobes, und erhielt mit bittersten, kräftigsten Worten nicht zurück, wo Unverstand und Bosheit es ihm versagten.
Der Tagesruhm – das hab' ich zu sagen vergessen – zerfällt eben auch wieder in zwei Unterabteilungen. Als ein zeitgenössischer Dichter nach der Première seines Stückes die Räume eines deutschen Hoftheaters verließ, fiel ihm ein junges, fremdes und obendrein hübsches Mädchen um den Hals und drückte ihm einen kräftigen Kuß auf die Lippen. Solch eine Trophäe würde ich bis ans Lebensende bewahren und keinem andern gönnen. Den »Ruhm« aber, den ich in dieser Plauderei beschrieben habe, würde ich an etwaige Reflektanten mit Vergnügen abgeben. Ohne Entgelt. Bei Abnahme des ganzen Postens liefere ich frei ins Haus.
Die späte Hochzeitsreise.
Als sie sieben Jahre verheiratet waren, machten sie ihre Hochzeitsreise. Es ging nicht eher. Sie hatten nämlich geheiratet, als er ein Einkommen von 1500 Mk. jährlich hatte. Das kann man Frechheit nennen; man kann es aber auch Liebe nennen. Zwar erhielt er nach etwa einem Jahr ein Schriftstellerhonorar, für das sie hätten reisen können, wenn nicht ein Kind gekommen wäre und sofort die Hand auf dieses Geld gelegt hätte. Im nächsten Jahre aber gelang es ihm, als Vorleser bei einem alten Herrn einen hübschen Nebenverdienst zu erwerben, der gerade für das zweite Kind reichte. Da fiel ihm im dritten Jahre ein Preis für eine wissenschaftliche Arbeit zu, für den sie sicher eine Reise gemacht hätten, wenn das diesjährige Kind das Geisteskind nicht aufgewogen hätte. Die nächsten zwei Jahre brachten keinen Nebenverdienst und nur ein Kind.
Als er dann aber zum zweiten Male einen Preis errang und als sein Gehalt um zweihundert Mark erhöht wurde, und als ihre Ehe schon zwei Jahre lang unfruchtbar gewesen war, da beschlossen sie, für dreihundert Mark eine Reise nach Thüringen zu machen.
»Deutschland ist das Herz Europas«, das hatte er als kleiner Junge in der Schule gehört. Es klang etwas anmaßend; aber ein Deutscher mocht' es immerhin glauben. Thüringen mußte nach allem, was er davon gehört und in Bildern gesehen hatte, das deutscheste Land der Deutschen, mußte das Herz des Herzens sein. Und dort zog es die beiden hin.
Siebenundfünfzig Abende hindurch arbeitete er an den Plänen, und bei allem mußte er denken: Was wird sie für Augen machen, wenn sie das sieht. Hätte er alle Genüsse dieser Gedankenreise bezahlen müssen – ein langes Leben voll Arbeit hätte nicht gereicht, die Zinsen dieser Schuld zu erzwingen. In den letzten Tagen ging er wirklich daran, die Kosten zu berechnen. Da fand sich, daß, wenn er sehr sparsam zu Werke gehe, etwa ein Zehntel seiner Pläne verwirklicht werden könne.
Und in den letzten Tagen wurde sein tapferes Weibchen feige. Der Junge habe so heiße Wangen und das Jüngste habe in der letzten Nacht einmal gehustet. Ihr Herz konnte sich nicht von den Kindern lösen. Er stellte ihr vor, wie sehr sie einer Erholung bedürfe – das verschlug gar nichts. Da spielte er mit roten Backen und glänzenden Augen den vollständig Angespannten, Übermüdeten, Niedergebrochenen. »Es gibt für eine Familie keine bessere Kapitalsanlage als die sorgfältigste Pflege des Ernährers,« machte er ihr klar. Das sah sie ein. Der Abschied von den Kindern, die unter der Obhut ihrer Schwester blieben, war nichtsdestoweniger noch eine Katastrophe und erschien ihr wie bethlehemitischer Kindermord.
Aber in der Eisenbahn wurde sie völlig anderen Sinnes. Es ist etwas Eigenes um die Eisenbahn. Sie hat etwas Fortreißendes, Unerbittliches, Unwiderrufliches. Aussteigen während der Fahrt ist bei Schnellzügen nicht anzuraten, und so findet man sich schnell in das Unabänderliche. Auch sie erfaßte nun der ganze, springende Jubel des Losgebundenseins, der den Reisebeginn zu einer so unvergleichlichen Freude macht, und die beiden benahmen sich wie ausgerissene Schulkinder. Zwei Minuten lang saßen sie rechts, drei Minuten lang links; fünf Minuten lang fuhren sie vorwärts, vier Minuten lang rückwärts; bald saß sie auf seinem Schoß, bald er auf ihrem, bis sie ihn aufstöhnend fortstieß: »Uff, geh' weg, du dicker Mensch.« – Dann lachten sie, dann küßten sie sich, dann tanzten sie, dann küßten sie sich wieder, kurz: es war ein großes Glück, daß sie das Abteil ganz für sich allein hatten.
Als der Zug zum ersten Male hielt, öffnete ein Mann die Tür und machte Miene einzusteigen. Das Gesicht der jungen Frau zeigte grenzenlose Überraschung, wie wenn jemand ungerufen bei einer Königin eingetreten wäre; seine Augen aber schleuderten Blicke, die auch der eingefleischteste Optimist nicht als Einladung auffassen konnte. Über das Gesicht des Fremden huschte ein lächelndes Verstehen: Aha – Hochzeitsreisende. Er schloß die Tür und suchte sich einen andern Platz.
»Das ist ein guter Mensch!« sprach sie mit frommer Rührung.
»Ein vornehmer Charakter,« bestätigte er.
Aber als sie weiterfuhren, kamen sie in eine Gegend mit gemeinen Charakteren, die einstiegen und lange sitzen blieben. Wann werden wir endlich Kupees für Hochzeitsreisende haben!
Auf dem Bahnhof einer großen Station nahmen sie das Mittagsmahl ein. Suppe, Fisch, Braten und Pudding für eine Mark fünfundsiebzig. Er betastete das dicke Portemonnaie in seiner Tasche und bestellte ½ Flasche Mosel.
»Hast du dir das jemals träumen lassen, daß wir noch einmal wie die Fürsten dinieren würden?« flüsterte er ihr ins Ohr.
»Nein.« sagte sie mit langsamem Kopfschütteln und blickte träumend über ihr Glas hinweg ins Weite.
Er kam sich vor wie ein Parvenu und gelobte sich, seinen Wohlstand mit Geschmack zu tragen.
Die Nichtswürdigkeit der Bevölkerung schien mit dem Quadrat der Entfernung zu wachsen; bald saß das ganze Kupee voll, und draußen im Schatten waren es 30 Grad. Zwei dicke Bauernweiber saßen da in dicken Wollkleidern und die Kopfe in dicke Wolltücher gewickelt; sie wollten nicht dulden, daß ein Fenster geöffnet werde. Darüber geriet ein cholerischer Herr in die größte Aufregung; aber unser Paar vermochte kein Mitgefühl für ihn aufzubringen; denn erstens: warum war er eingestiegen? und zweitens: wie kann man sich ärgern, wenn man durch lauter Sonne fährt, wenn man sozusagen geradeswegs in die Sonne hineinfährt?
So kamen sie nach Eisenach, und bevor sie ein Hotel suchten, suchten sie mit ihren Blicken die Wartburg. Da ragte sie aus Waldwipfeln empor ins Abendlicht. Welcher Deutsche sucht nicht schon in Kindertagen mit den Augen der Seele die Wartburg? Von weitem hörten sie die Stimme Walthers von der Vogelweide und Wolframs von Eschenbach, sahen sie das stille Gemach des Bibelübersetzers und sahen sie die flammenden Feuer der Burschenschaft wie brausenden Aufschwung junger Herzen in altgewordener, bittertrauriger Zeit.
Und tief enttäuscht waren sie, als sie am folgenden Tage mit vielen andern durch die Räume der Burg geführt wurden und der »Führer« in schauderhaftem Deutsch allerlei ungewaschenes, unnützes Zeug schwatzte. Warum gab man den Besuchern nicht einen Zettel mit dem Nötigsten in die Hand? Wenn man ihnen schon ein Notwendiges zum Schauen nicht gewähren kann: Einsamkeit, warum gewährt man ihnen nicht wenigstens das Notwendigste: Schweigen? Wer spricht denn laut, wenn Wolfram singt und Dr. Martinus sinnt? Und wenn zwei Liebende das Geschenk solcher Stunden mit einem einzigen, einem verdoppelten Herzen empfangen, und wenn eines von ihnen, in der Furcht, es möchte dennoch dem andern ein Hauch des Glückes entgehen, den Mund auftun muß, wird er nicht flüstern vor der Gegenwart des Vergangenen? Wie wenig, deutsches Volk, kennst du deine Schätze, wenn du sie nicht besser zu zeigen verstehst.
So waren sie nicht in der Wartburg, als sie drinnen waren; erst als sie wieder bergab stiegen und zwischen grünem Laub nach ihr zurückschauten, da lag sie wieder vor ihnen im Morgenrot der Sage, da wagten sie wieder einzutreten und ein Jahrtausend lang durch ihre Räume zu wandeln.
Und Gott sei Dank. Vor dem Denkmal Johann Sebastians störte niemand den Zwiegesang ihrer Herzen, mischte sich niemand ein, als sie entrückten Ohres singen hörten: »Kommet, ihr Töchter, helft mir klagen« und »Wir setzen uns mit Tränen nieder.«
Auf dem Markte kauften sie Kirschen, und am Abend saßen sie am offenen Fenster ihres Hotelzimmers, sahen den Mond aus dem Hörselberge hervorsteigen und schoben die besten Kirschen, die sie fanden, einander in den Mund. Oder sie faßte den Stiel einer Kirsche mit den Zähnen, und er pflückte mit dem Munde die Frucht von ihren Lippen.
»Sind wir nicht viel zu verliebt für so alte Eheleute?« fragte sie furchtsam.
»Wenn du noch einmal so etwas sagst, benehme ich mich gesetzt,« drohte er.
»Hast du mich noch so lieb wie vor sieben Jahren?« fragte sie, die Hände auf seine Schultern legend.
»Sieben mal so toll,« sagte er. »Und so wird es weiter wachsen mit den Jahren.«
»Allmächtiger!« rief sie erschrocken. Aber dann schmiegte sie sich in seinen Arm und fragte: »Glaubst du, daß schon jemals ein Paar eine so schöne Hochzeitsreise gemacht hat?«
»Nie!« versetzte er mit vollkommener Bestimmtheit. Und er mußte wieder sinnend in die Vergangenheit blicken, die im Mondlicht auf den Bergen lag. Er machte eine Hochzeitsreise. Mit voller Börse. An der Seite eines solchen Weibes sah er Thüringen, die Wartburg, sollte er Weimar sehen, Weimar. Und jetzt, in diesem reizenden Hotelzimmer, saß er mit ihr allein am Fenster. Bei solchem Mondschein. Und aß die schönsten Kirschen. Du lieber Gott, wie viele Menschen gab's denn, denen das zuteil wurde.
»Und es ward aus Abend und Morgen ein Tag«; wer immer im Rausch ist, der bedarf kaum des Schlafes; sie nippten vom Schlaf wie Vögel aus dem Bach: ein Tröpfchen und husch – davon. Es war nicht ein Rausch wie vom Wein, nein: viel leichter und darum viel seliger, ein Luftrausch, ein Lichtrausch, ein Lebensrausch. Sie entschlummerten spät unter halbgeträumten Worten, und ihr frühes Erwachen war nur ein anderer Traum.
Freilich, im Lichtrausch kann man sich übernehmen, wenn es sich um physisches Licht handelt: das sollten sie erfahren. Sie hatten sich beim Frühstück verspätet – es plauschte sich so unendlich gut mit ihr beim Morgenimbiß – und machten sich erst um neun auf den Weg. Alles, wessen sie auf ihrer kurzen Reise bedurften, führten sie mit sich; eine strotzende Reisetasche hatte er sich umgehängt; ein Köfferchen trugen sie bald gemeinsam, bald trug er's allein. Sie hätten es wohl mit der Post vorausschicken können; aber man mußte sparsam sein. Es war eine seiner Schwächen, daß er sich ein Talent zum Sparen einbildete. So schritten sie schlank ein munteres Tal hinauf, ein Tal voll blinkender Wasser unter hängendem Gezweig, voll moosiger Felsen und blitzender Schwalben, ein Tal voll Sonntag. Die Burschen standen im Sonntagsputz vor den Türen zusammen und schmauchten mit feiertäglicher Umständlichkeit; die Mädchen schafften noch an Herd und Brunnen, im Gang und im Blick schon den kommenden Tanz. Was Wunder, daß unser Paar alsbald zu singen begann. Und was anders konnten sie singen als:
»Ich hört' ein Bächlein rauschen Wohl aus dem Felsenquell, Hinab zum Tale rauschen So frisch und wunderhell«
und
»Eine Mühle seh ich blinken Aus den Erlen heraus, Durch Rauschen und Singen Bricht Rädergebraus«
und das seltsame Lied mit der wundersamen Stelle:
»Und da sitz' ich in der großen Runde, In der stillen, kühlen Feierstunde, Und der Meister spricht zu allen: Euer Werk hat mir gefallen«
ein Lied, das aus der Werkstatt kommt und wie aus einer Kirche klingt und uns mit unbegreiflichem Zauber offenbart, daß Arbeit Schönheit und daß Ruhe nach der Arbeit ein frommer Gesang ist. Nie begreift, wer es aus solchen Liedern nicht begreift, daß es ein eigenes Ding ist um das deutsche Vaterland. Ja, sie waren altmodisch, diese beiden Hochzeitsreisenden; sie sangen Franz Schubert und Wilhelm Müller, die man in unseren Konzerten kaum noch hört, weil sie nicht neu genug sind. Hier waren ihre Lieder jedenfalls neu; hier sprangen sie plätschernd aus dem Stein hervor; hier wuchsen sie ihnen von jedem Zweig wie Kirschen in den Mund; hier sang sie jeder Vogel, und jeder Fels hallte sie wieder. Da, vor dem Tor am Brunnen stand der Lindenbaum, und da – horch:
»Von der Straße her das Posthorn klingt! Was hat es, daß es so hoch aufspringt, Mein Herz?«
Und als der siebenjährige Ehemann im Walde sang:
»Durch den Hain, durch den Hain Schalle heut ein Reim allein: Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein!«
da klang es so merkwürdig, daß die zwanzig Schritt vor ihm herwandelnde Geliebte stehen bleiben und sich nach ihm umschauen mußte, obwohl sie nie in ihrem Leben Müllerin gewesen war. Er aber machte die zwanzig Schritt in dreien, warf den Koffer ins Moos und gab ihr einen einzigen Kuß, der aber unter Verliebten seine zwölfe wert war.
»O Kuß in eines Walds geheimstem Grund! Fernoben über Wipfeln rauscht die Welt Und weiß es nicht, daß unten, Mund auf Mund, Zwei Welt- und Selbstvergessene versinken! Der Lippen Duft wie junges Tannengrün, Und tief im trunken-stillen Blick ein Licht, Das hoch herab von heiliger Wölbung fällt! O sternendunkler Abgrund, ende nicht Und laß uns ewig deine Dämmerung trinken –«
Indessen: der Abgrund tat ihnen nicht den Gefallen; sie traten aus dem Hain auf eine Chaussee. Chausseen können sehr schön sein, wenn sie wollen; aber gewöhnlich wollen sie nicht. Es war Mittag geworden, und bis zu dem Orte, wo sie die Eisenbahn erreichen wollten, waren es noch zwei Stunden. Nach ungefährer Schätzung mußten es jetzt einige Grade über dreißig im Schatten sein; aber das interessierte hier um deswillen nicht, weil die Chaussee keinen Schatten hatte. Immerhin konnte man, wenn man nicht kurzsichtig war, das Ende der Landstraße absehen, und dann – überhaupt: konnte man sie mit Sonnenschein schrecken? »Sonne ist gerade was Feines,« riefen sie und schritten mit höhnischem Trotz in den Zügen fürbaß. Sie schätzten die in weißglitzerndem Lichte vor ihnen liegende Straße auf eine gute Viertelstunde; aber man unterschätzt diese Landstraßen. Nach einer guten halben Stunde erreichten sie das Ende; aber dieses Ende war ein neuer Anfang.
»So knüpfen ans fröhliche Ende Den fröhlichen Anfang wir an«
sang er, und sie schritten weiter. Vorsichtiger geworden, schätzten sie das vor ihnen liegende Stück auf eine kleine halbe Stunde; aber man unterschätzt diese Landstraßen. Nach ¾ Stunden kamen sie endlich ans Ende; aber dieses Ende war ein neuer Anfang. Sie waren offenbar auf einen weiten Umweg geraten; die Augen eines jungen Weibes sind eben keine Landkarte. Sie schritten weiter; aber singen tat er nicht mehr; das Klima war der Stimme nicht günstig. Immerhin war es ein Trost, daß das Stück vor ihnen höchstens eine halbe Stunde sein konnte; aber man unterschätzt diese Landstraßen. Selbstverständlich trug der sparsame Mann schon seit langem das ganze Gepäck; aber das drückte ihn nicht; ihn drückte das Gefühl: sie überanstrengt sich. Freilich versicherte sie auf seine Fragen immer wieder lachenden Gesichts, sie fühle sich vollkommen wohl und frisch; aber das beruhigte ihn nicht; sie, die Wahrhaftigkeit selbst, konnte, wenn es ihm Beschwerden zu verbergen galt, lügen wie ein Dichter, das wußte er. Nach dreiviertel Stunden sahen sie Dächer. Ha, das Ziel. Als sie aber an das Dorf kamen, da hieß es ganz anders. Sie erfuhren, daß sie bis zu ihrem Ziel »nur« noch eine halbe Stunde zu gehen hätten. Er wollte sie überreden, in diesem allerdings wenig versprechenden Dorfe zu rasten; aber sie sagte: »Wenn ich jetzt sitze, steh ich nicht wieder auf. Jetzt halten wir schon aus bis ans Ende.« So war sie. Wenn sie die Ausdrucksweise der Landbewohner besser gekannt hätten, hätten sie gewußt, daß diese immer nur halb mit der Sprache herauskommen. Nach einer halben Stunde sahen sie den ersehnten Ort aus der Ferne. Er vertrieb ihr und sich die Zeit mit einem anmutigen Spiel. Bei jedem fünften Schritt nickte er mit dem Kopfe, und dann fiel von seiner Stirn ein Schweißtropfen in den Sand. Eins, zwei, drei, vier, fünf – ein Tropfen; eins, zwei, drei, vier, fünf – ein Tropfen usw. Sie lachte, und so kamen sie endlich in den erstrebten Ort, in das erhoffte Wirtshaus, in die ersehnte schattige Stube und auf die in visionären Wüstenträumen erschaute Bank. So. Der Rest war Schweigen. Hier wollten sie den Rest ihrer Tage verbringen. Hier sollte man sie abholen, wenn man sie einmal begraben wollte.
Sie stützten den Kopf in beide Hände und starrten einander an wie zwei, die sich schon irgendwo einmal gesehen haben müssen. Der Kellner fragte, ob die Herrschaften etwas zu speisen beliebten.
»Trinken,« gurgelte er.
»Wasser,« sagte sie drei Minuten später.
»Mit Kognak!« fügte er nach zwei Minuten schnell hinzu.
Dann schob er ihr ein Stückchen von dem dreimal wöchentlich erscheinenden Kreisblatt zu, das auf dem Tische lag und das heute, am Sonntag, mit zwei Seiten Text und vier Seiten Anzeigen erschienen war. Er las, daß der Bauer Henneberg ein Paar Ochsen billig verkaufen wolle. Sie las, daß Dr. Miquel einen Urlaub angetreten habe. Dann las er, daß Frau Hasenbek seine Herrenwäsche übernehme. Und dann las sie, daß der Amtsgerichtssekretär Ranke in den Ruhestand getreten sei. Und dann las er wieder, daß der Bauer Henneberg ein Paar Ochsen billig verkaufen wolle; denn vordem hatte er es nicht ganz erfaßt. So saßen sie zwei Stunden lang einander gegenüber. Dann dachten sie ans Essen und erhoben sich, um sich von dem Staub der Wanderung zu befreien. Als sie zur Tür schritten, machten sie in ihren Bewegungen jenen rührenden Eindruck, den wir bei Betrachtung Philemons und seiner Baucis empfangen.