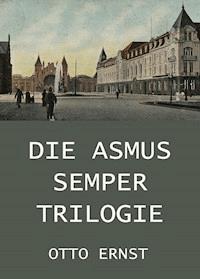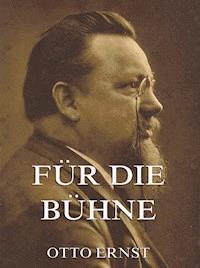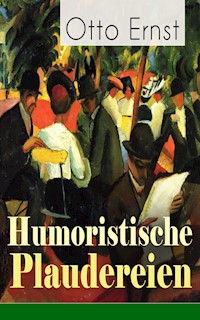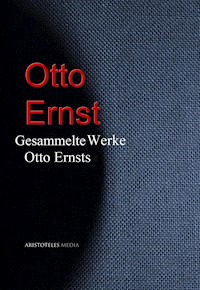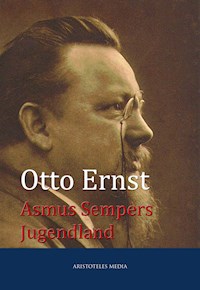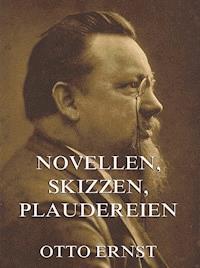
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dieser Sammelband beinhaltet eine Vielzahl von Schriften des Hamburger Dichters und Schriftstellers. Inhalt: - Appelschnut Ein Tag aus dem Leben Appelschnuts Appelschnut und die Philosophie Wie Appelschnut umzog Im alten und neuen Heim Appelschnuts Dummheit Ein Ausflug mit Appelschnut und anderem Kleinzeug An der See Von toten und lebendigen Puppen Die Kunstreise nach Hümpeldorf Von Schiffahrt, Angst, Courage und dergl. Der große Sonntag Flieh, auf, hinaus in's weite Land! Von den Frauen. Wenn Kinder spielen. Die Hosentaschen des Erasmus. Asmodi oder Der hinkende Teufel im Theater Vom Essen und Trinken - Bekenntnisse einer schönen Seele. Ernsthafte Predigt vom Commersieren. Das Wintersonnenmärchen. Im Vorhof des Lebens Das Leben nach dem Abreißkalender Hornbold beglückt die Menschheit Der Kuchen, der Pfirsich und das Mädchen ... Viel zu wenig Jung ist nicht alt Die deutsche Familie Das Bett - Eine sybaritische Plauderei. Rückkehr zur Freude Garten unterm Regenbogen Sterntaler und Sonnengulden Bescheidenheit ziert den Jüngling Vorschlag, wie man aus einem halben Fest ein ganzes machen könnte. Aus meinen Wander- und Lesejahren Das vierbeinige Geschenk. Von zweierlei Ruhm. Die späte Hochzeitsreise. Was Ortrun sprach. Herder Meine Damen! Die Marienbader Kur. Über den Umgang des Autors mit Schauspielern. Warnung vor der Sommerfrische. - Meersymphonie. I. Allegro impetuoso. II. Scherzo furioso. III. Largo mesto. - Adagio religioso. IV. Allegro beatissimo. Anna Menzel. Von Schiffahrt, Angst, Courage und dergleichen. An die Zeitknicker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 898
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Novellen, Skizzen, Plaudereien
Otto Ernst
Inhalt:
Appelschnut
Ein Tag aus dem Leben Appelschnuts
Appelschnut und die Philosophie
Wie Appelschnut umzog
Im alten und neuen Heim
Appelschnuts Dummheit
Ein Ausflug mit Appelschnut und anderem Kleinzeug
An der See
Von toten und lebendigen Puppen
Die Kunstreise nach Hümpeldorf
Von Schiffahrt, Angst, Courage und dergl.
Der große Sonntag
Flieh, auf, hinaus in's weite Land!
Von den Frauen.
Wenn Kinder spielen.
Die Hosentaschen des Erasmus.
Asmodi oder Der hinkende Teufel im Theater
Vom Essen und Trinken - Bekenntnisse einer schönen Seele.
Ernsthafte Predigt vom Commersieren.
Das Wintersonnenmärchen.
Im Vorhof des Lebens
Das Leben nach dem Abreißkalender
Hornbold beglückt die Menschheit
Der Kuchen, der Pfirsich und das Mädchen ...
Viel zu wenig
Jung ist nicht alt
Die deutsche Familie
Das Bett - Eine sybaritische Plauderei.
Rückkehr zur Freude
Garten unterm Regenbogen
Sterntaler und Sonnengulden
Bescheidenheit ziert den Jüngling
Vorschlag, wie man aus einem halben Fest ein ganzes machen könnte.
Aus meinen Wander- und Lesejahren
Das vierbeinige Geschenk.
Von zweierlei Ruhm.
Die späte Hochzeitsreise.
Was Ortrun sprach.
Herder
Meine Damen!
Die Marienbader Kur.
Über den Umgang des Autors mit Schauspielern.
Warnung vor der Sommerfrische.
Meersymphonie.
I. Allegro impetuoso.
II. Scherzo furioso.
III. Largo mesto. – Adagio religioso.
IV. Allegro beatissimo.
Anna Menzel.
Von Schiffahrt, Angst, Courage und dergleichen.
An die Zeitknicker.
Novellen, Skizzen, Plaudereien, Otto Ernst
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster
Germany
ISBN: 9783849611965
www.jazzybee-verlag.de
Appelschnut
Ein Tag aus dem Leben Appelschnuts
Eigentlich heißt mein dreijähriges Töchterchen Roswitha; aber ich sage immer »Appelschnut«. Man darf diesen Namen nicht ins Hochdeutsche übersetzen; »Apfelschnauze« klingt roh, klingt gräßlich. »Schnauzerl«, »Schnäuzchen« käme der Sache schon näher, deckt sie aber nur zum Teil. »Schnut« umfaßt nämlich nicht nur Mund und Nase, sondern so ein ganzes kleines Gesichtchen, das man noch ganz und gar in eine Hand nehmen kann. Ja, zuweilen umfaßt es einen ganzen fünfundzwanzigpfündigen Menschen; wenn er eine geniale Bemerkung macht, sagt man: »Du Klooksnut«, wenn er im Feuerungsverschlag gespielt und Steinkohlen gegessen hat: »Du Swattsnut.« Und da nun Roswitha nicht nur zwei rote Wangen hat, sondern alles in allem genommen ausschaut wie ein rundes, blankes, rot und goldenes, zum Einbeißen herausforderndes Früchtlein, so hab' ich in einer begnadeten Stunde den Namen »Appelschnut« gefunden. »Appelschnut« ist unübersetzbar.
Die junge Dame hat es gut; das darf man wohl sagen. Schon früh am Morgen umstehen ihre Geschwister, bevor sie sich zum Schulgang rüsten, mit nackten Beinchen ihr Bett und bewundern die Anmut ihres Schlummers, die Dicke ihrer Ärmchen, die Blondheit ihres Haares und ihre Kunst, auch im Schlaf noch mit Ausdauer auf dem Daumen zu lutschen. Wenn sie endlich die Augen aufschlägt, begegnet sie gewiß irgendeinem Blick, der sie mit Liebe oder Bewunderung anschaut.
»Was ist los?«
»Appelschnut hat geträumt? Holla, Appelschnut hat geträumt! Also los, Appelschnut! Erzähl mal! Was war's denn?«
Appelschnut: »Also, ich wollte nach Hamburg, und da wollte ich Bonbons kaufen. Und da vergangte ich mich, und schließlich kamte ich wieder nach Hause.«
Hurra, Appelschnut kam »schließlich« wieder nach Hause. »Schließlich!« Was so ein miserables Formwort für eine Wirkung ausüben kann! Einen ganzen vergnügten Morgen kann es machen. Besonders, wenn man bedenkt, daß »Hamburg« eine benachbarte Straße ist, in der ein Bonbonkrämer wohnt.
Appelschnut braucht nur das Mäulchen aufzutun, und das ausverkaufte Haus ist entzückt. Jedes falsch konjugierte Verb ist ein Erfolg, wie ihn mancher Schriftsteller mit gleichen Mitteln ewig vergeblich erstrebt. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis.
Nicht, daß solch ein Kinderleben nicht auch seine Schatten hätte! Jeden Morgen tritt auch in dieses Leben die hundertzähnige Pflicht in der für die Pflicht so bezeichnenden Gestalt des Kammes. Und man lächle, bitte, nicht über den Kamm als über etwas Geringfügiges! Ihr müßt hier mit Proportionen rechnen und bedenken, daß für das Kind ein Kamm genau dasselbe ist, was für uns ein unangenehmer Vorgesetzter mit abgebrochenen und verbogenen Zähnen ist.
Eines Tages saß Roswitha auf dem Schoß ihrer Mutter und blinzelte hinter ihren Liebkosungen wie ein Kätzchen in der Sonne.
»Du bist meine Zuckerdirn«, sagte die Mutter.
»Jaa«, versetzte Appelschnut mit Überzeugung, und mit treuherzigem Blick fügte sie hinzu: »Du schicks mich auch garnich in Paket, nich?«
Meine Frau verstand sie anfangs nicht. Erst allmählich ging ihr ein Licht auf. Mehrere Tage vorher hatte ich aus der Ferne geschrieben: »Schick mir doch die Appelschnut im Paket!« Meine Frau hatte den Kindern aus dem Briefe vorgelesen, und Roswitha hatte sich tagelang mit der Angst getragen, sie würde als Paket auf die Post gebracht werden.
Nachdem Appelschnut heute gekämmt und fertiggeputzt ist, kommt sie in meine Hände. In diesem Stadium gefällt sie mir am wenigsten. Ein frischgekämmtes und frischgebügeltes Kind sieht aus wie ein Kunstwerk, das die Kritik berichtigt und verbessert hat. Aber nach einem halben Stündchen schon fangen die ängstlich nebeneinandergeduckten Härchen wieder an zu leben und stehen leis und behutsam auf, und wenn sie merken, daß der Kamm nicht mehr daherfegt, beginnen sie sogleich wieder ihr leises, lustiges Flimmergespräch mit Luft und Sonne.
Der heutige Tag gehört meinem Töchterlein Appelschnut. Das kommt daher: Eines Tages kam sie an meinen Schreibtisch und sprach:
»Pappa, weiß du was? Wir spielen Mutter und Kind zusammen. Du bis das Kind un ich bin die Mutter. Un denn muß du immer tüchtig ungezogen sein un denn bekomms du Schläge, aber nur aus Spaß, mein ich! O ja – nich?«
»Ich kann aber jetzt nicht mit dir spielen.«
»Worum nich?«
»Weil ich arbeiten muß.«
»Worum muß du arbeiten?«
Da ich nicht hoffen durfte, ihr den Schöpferdrang eines Dichterherzens klarzumachen, so ergriff ich die Gelegenheit zu einer ökonomischen Aufklärung und sagte:
»Weil ich Geld verdienen muß.«
»Worum muß du denn Geld verdienen?«
»Weil ich für euch was zu essen kaufen muß.«
»Mamma hat was zu essen!« ruft sie mit der Kraft eines befreienden Gedankens. »In'n Küchenschrank: 'n ganze Masse!«
Das ist eines jener Argumente, die unwiderleglich sind. Die Dreijährigen haben's überall in der Welt so leicht, recht zu behalten! Und das hat man nun davon: Da rackert man sich unaufhörlich, um sieben »tägliche Brote« zu schaffen, und den Ruhm der Ernährerin trägt die »Mamma« davon.
Nach einer höchst nachdenklichen Pause nahm Appelschnut das Gespräch wieder auf.
»Pappa, wann muß du mal garnich, garnich, garnich mehr arbei'n!«
»Ja, das weiß ich nicht. Was willst du denn, wenn ich nicht mehr arbeite?«
»Denn will ich mal 'n ganzen Tag mit dir spiel'n!«
Der freudige Glanz aus ihren Augen überlief mir so schmeichlerisch das Herz, daß ich ihr versprach, ich wolle bald einmal einen ganzen Tag mit ihr spielen. Selbstverständlich wurde ich am andern Morgen um fünf Uhr durch eine Bearbeitung meines Bartes und meiner Nase aus dem Schlaf geweckt. Appelschnut stand an meinem Bett und fragte:
»Wills du heute mit mir spiel'n?«
»Nein, heute noch nicht.«
»Wann denn?«
»Bald.«
»Morgen?«
»'mal seh'n. Vielleicht.«
»O Mamma, Pappa will fürleich morgen mit mir spiel'n!!«
Auf diese Weise wurde auch »Mamma« geweckt. Appelschnut bewährte sich außerordentlich als Erzieher zum Worthalten. Freilich hätt' ich unter allen Umständen mein Versprechen erfüllt. Denn ich bin gewöhnlich ein Freund vom Worthalten, bin es aber besonders Kindern gegenüber, und das kommt daher, daß mir einmal eine liebe schöne Dame eine kleine Geschichte erzählt hat. Als die liebe schöne Dame noch ein kleines dünnes Mädel war, kam eines Tages in ihr sehr bescheidenes Elternhaus ein ganz berühmter und reicher Onkel. Ach, war das ein Mann und war das ein Fest! So freundlich war er zu allen und so spaßig und war doch ein so berühmter Mann, und das kleine Mädel nahm er auf den Schoß und sagte zu ihm: »Wenn ich wiederkomme, mein Kind, dann kriegst du eine Puppe, wie du sie noch nicht gesehen hast!« Und dann verschwand der Onkel wie ein Komet und ließ einen sieben Wochen langen Schweif von Glanz und Erinnerungen hinter sich zurück. Es dauerte aber viel länger als sieben Wochen, bis der Komet wiederkam, und da kann sich jedermann denken, wie die Puppe in der Zwischenzeit wuchs und sich veränderte! Immer größer wurde sie, und die Arme und Beine wurden beweglich, und die Augen konnte sie schließen, ordentlich, als wenn sie schliefe, und eines Tages fing sie mit einem Male laut an zu schreien, und wenn man genau hinhorchte, dann sagte sie »Mama! Mama«! Und nach einem Jahre konnte sie gehen und sprechen und essen und mochte keine Milchsuppe und unterschied sich in gar nichts mehr von einem gewöhnlichen Menschen; es war ja doch eine Puppe, wie man sie noch nie gesehen hatte! Und Kleider hatte sie – na! Ordentlich zum Aus- und Anziehen! Hemdchen und Höschen mit Spitzen! Und das Kleid nach der neuesten Mode! Und endlich, endlich eines Tages erschien der Onkel wieder am Himmel. »Guten Tag«, konnte das kleine Mädchen gar nicht sagen; ihm stak etwas im Halse, und nur die strahlenden Augen grüßten den Onkel. Der reiche und berühmte Onkel war diesmal wieder sehr freundlich, aber auch sehr eilig; das kleine Mädel dachte immer: Wo mag er nur die Puppe haben; für die Rocktasche ist sie doch zu groß! – es war aber zu wohlerzogen, um von der Puppe anzufangen. Da trat der Onkel auf sie zu (jetzt kommt's, dachte das kleine Mädel), klopfte ihr leichthin die Bäckchen, als habe er sie noch nie auf dem Schoße gehabt, und dann sagte er »Adieu« und war weg. Und dem kleinen Mädel war, als habe sie der Onkel gerade aufs Herz geschlagen, so daß es gar nicht mehr klopfen konnte. Ja, aber glaubt denn so ein kleines Mädel, daß so ein großer Onkel an nichts Besseres zu denken hat als an Puppen?! Dem gehen Kreditaktien und Geschäfte und italienische Gesandte im Kopf herum, aber Puppen –? Und die liebe schöne Dame, so groß und schön sie war, hat die verlorne Puppe niemals ganz verwunden. Und ich hab' es ihr damals gleich gesagt: Wenn mir der reiche und berühmte Onkel einmal über den Weg läuft, dann geht es ihm eine Viertelstunde lang hundeschlecht.
Es ist Winterzeit; draußen steht blendendes Schneelicht und umschließt wie eine Mauer die einsame Welt. Bis ins Innerste der Wohnungen glänzt es bläulich-silbern. Wir beginnen das Divertissement mit Puppen- und Mutter- und Kindspielen, dem A und O der Mädchenspiele. Mama Roswitha hat heute drei Kinder: Ursula, Hedwig und mich. Meine Schwestern Ursula und Hedwig sind Puppen; aber ich habe Grund zu dem eifersüchtigen Gedanken, daß sie dem Herzen Appelschnuts mindestens so nahe stehen wie ich. Besonders erregt Ursula meinen Neid, obendrein ein gänzlich abgenutztes Kind, das bei jeder Bewegung Sägespäne verliert und Backen hat, so rissig wie ein altes Nashornfell. Sie wird mir vorgezogen, darauf möchte ich wetten, sie hat freilich auch viel öfter mit ihrer Mama gespielt als ich, und daher mag's kommen. Und nun stellt gefälligst mal einen Professor vor Appelschnut hin und laßt ihn erklären: »Liebes Kind, die Puppe ist nur das Bild eines Menschen, nicht aber ein wirklicher Mensch!« – was, glaubt ihr, würde Appelschnut erwidern, wenn sie ihn überhaupt verstünde? Sie würde lachen und sagen: »Ursula ist gerade so gut ein Mensch wie du.« Als unser Junge noch ein Baby war, hatte er eine Puppe, die den für einfache Zungenverhältnisse passenden Namen »Dadda« trug, und diese Puppe hatte eines Tags aus irgendeinem Grunde keinen Hinterkopf mehr. Als meine Frau nun den ganzen Kopf entfernen wollte, da zeigte sich, daß er sehr fest auf dem Rumpfe saß. Sie ergriff daher einen Hammer und zertrümmerte den Kopf, um ihn stückweise zu entfernen. Aber sie hatte nicht bemerkt, daß unser männliches Baby sie beobachtete, und als der Hammer auf Daddas Kopf niederfuhr, stieß der Junge einen so durchdringenden Schrei aus, daß wir tief erschraken. Wie aus der Brust eines Erwachsenen, so schmerzlich hatte es geklungen. Meine arme Frau hatte nichtsahnend ein beseeltes Wesen erschlagen. Denn Dadda hatte eine Seele gehabt, das fühlten wir nun, eine treue Seele, die durch das große Loch im Hinterkopf nicht entwichen war.
Sehr merkwürdig ist es nun, daß die erste Tätigkeit, welche Appelschnut an ihren Kindern vornimmt, darin besteht, daß sie sie kämmt, wie denn ja das in der Tat ein erhabener Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit ist, daß auch die unangenehmsten Prozeduren zum Vergnügen werden, wenn man sie an andern ausübt. Und wie indigniert die kleine Mama tut, daß »so große Mädchen« wie Ursula und Hedwig sich schreiend gegen die Toilette sträuben! Noch merkwürdiger aber ist es, daß, als ich nun darankomme und mich artig kämmen lasse und mir einbilde, mir dadurch bei der strengen Mama einen weißen Fuß zu machen, die Mama erst ernstlich unzufrieden wird.
»Ach nein, Pappa, pfui, du muß auch schrein!« ruft sie enttäuscht und entrüstet.
Ich heule also wie ein Torpedoboot und bemerke deutlich, daß selbst so brave Kinder wie Appelschnut die Ungezogenheit unvergleichlich interessanter finden als die Wohlerzogenheit. Das beobachtet man auch, wenn die Kinder Schule spielen. Eine Weile geht das Spiel in korrekten Formen dahin; dann wird ein beweglicher Geist unter den Schülern unverschämt, die Klasse geht sofort zur Meuterei über; die Lehrerin notiert einen »Tadel« nach dem andern; der Lehrer prügelt wie ein Drescherquartett, und die Pädagogik hat begonnen, interessant zu werden.
Da Appelschnut inzwischen Lust bekommen hat, einen Besuch zu machen, so muß ich die für diesen Zweck erforderliche Tante abgeben.
»O ja, Pappa, nich?? Du muß mal aus Spaß die Tante sein!«
»Aus Spaß« ist der Gegensatz von »wirklich«; die ganze Welt zerfällt für sie in eine Welt der Wirklichkeit und eine Welt »aus Spaß«.
»Oh, un hier muß aus Spaß dein Haus sein, nich??« Sie führt mich in einen Winkel, wo ich zwischen einem Schrank und einem Ofen niederkauern muß. Nachdem sie sodann in ihrem Puppenwagen ihren Töchtern ein Bett gemacht hat und die Kissen so kunstgerecht aufgeschüttelt und geklopft hat, als hätte sie seit zwanzig Jahren nichts anderes getan, und nachdem sie sich ein buntes Stück Zeug, das »aus Spaß« ein Hut ist, auf den Kopf gelegt hat, macht sie sich mit ihren Kindern auf den Weg zur Tante.
»Lingelingeling!« ruft sie, als sie nahe vor mir steht. Das ist die Türglocke.
»Ah, guten Tag« –, ruf ich, werde aber sofort unterbrochen.
»Nein, du muß erst ›Schließ!‹ sagen.« Das Wort »Schließ« markiert das Türaufmachen. Ich sage also »Schließ«, und sie tritt ein.
»Guten Tag.«
»Ah, sieh da, guten Tag, Frau Appelschnut«
»Ach nein, ich bin doch Frau Schmidt!«
»Ach ja, richtig, Frau Schmidt, das ist aber hübsch von Ihnen, daß Sie mich besuchen.«
»Ja.«
»Und das sind wohl Ihre Kinderchen? Die sind aber niedlich!«
»Ja. – Ich krieg noch'n Baby, wenn mein Geburtstag is.«
»So! – Aber nehmen Sie doch, bitte, Platz, Frau Schmidt!«
»Ja.« Sie läßt sich auf ein Stühlchen nieder mit der Miene einer Dame, die sich auf acht Tassen Kaffee einrichtet. Dann aber »fliegt ein Engel durchs Zimmer«; die kleine Frau Schmidt ist noch nicht so weit fortgeschritten, um mit dem Wetter anzufangen. Endlich weiß sie was.
»Was wollen Sie heute kochen?« fragt sie.
»Bohnen mit Speck«, sage ich.
»Das mag ich nicht. Ich koch heute Pudding.«
»So!«
»Ja. – – Nu muß ich wieder nach Hause.«
Frau Schmidt alias Appelschnut alias Roswitha geht also heim und begibt sich an ihre häuslichen Geschäfte. Wer muß das erforderliche Dienstmädchen spielen? Natürlich ich.
»Amanda, nehmen Sie den Korb; Sie müssen was zum Mittagessen einholen.«
»Jawohl, Frau Appelschnut!«
»Ich heiß doch nich Appelschnut, ich heiß doch Frau Schmidt!!«
»Ach ja, richtig! Was soll ich denn holen, Frau Schmidt?«
»Zucker.«
»Wieviel?«
»Für swanzig Mark.«
»Ist das nicht etwas viel?«
»Na ja, für'n Fennig!«
»Ist das nicht etwas wenig?«
»Vater, sag mal, wieviel!«
»Ich heiß doch nicht ›Vater‹, ich heiß doch ‹Amanda‹!«
»Ach Vaa–te–r– –!!!«
»Na ja: also für 50 Pfennige.«
»Ja.«
»Und was soll ich sonst noch holen?«
»Bonbons.«
»Wieviel?«
»Für tausend Bijonen Mark.«
Frau Schmidt hat nämlich vier Zahlvorstellungen: Eins, zwei, drei und »tausend Billionen«. Sie gebraucht zwar auch andere Zahlen; aber bei denen denkt sie sich nichts. Wenn sie ein größeres Quantum bezeichnen will, so sagt sie »tausend Bijonen«. Frau Schmidt läßt aber mit sich handeln.
»Für tausend Billionen Mark Bonbons ist zuviel. Da kriegen Sie Leibschmerzen, Frau Schmidt.«
»Für wieviel denn?«
»Für fünf Pfennige.«
»O ja!!«
»Was soll ich sonst noch holen?«
»Mehr nich.«
Das heutige Diner umfaßt also Zucker und Bonbons. Angenehme Aussichten.
In diesem Augenblick zerflattert Roswithas hausfrauliches Phantasiespiel in nichts; denn ein großer, blankpolierter Gegenstand ist ihr ins Auge gefallen und hat für den Augenblick die Interessen der Mutter und Hausfrau verdrängt. Es ist die »Bimm-Kommode«.
Wer die kindliche Etymologie weniger oft studiert hat als ich, ist sich vielleicht nicht ganz klar über die Bedeutung des Wortes »Bimm-Kommode«.
Als Appelschnut eines Tages eine Kommode sah, die, wenn man sie aufmachte, eine Menge weißer und schwarzer Zähne zeigte und »Bimm-bimm« machte, wenn man ihr auf die Zähne schlug, da taufte sie das Klavier mit feierlichem Entzücken auf den Namen »Bimm-Kommode«.
Appelschnut will also musizieren. Ich lege die Nibelungen-Tetralogie auf den Klavierstuhl und setze sie obendrauf. Sie schlägt ein dutzendmal dieselbe Taste an und bemerkt, das sei »O Tannenbaum«. Dann erklärt sie, das Lied vom »Hänschen klein« spielen zu wollen – es bewegt sich genau innerhalb desselben Tonumfangs. Ich mache sie darauf aufmerksam, daß auch die schwarzen Dinger Musik von sich geben. Sie spielt jetzt sehr chromatische Sachen. Allmählich kommt sie dahinter, daß es noch mehr Spaß macht, wenn man die ganze Hand, und noch mehr, wenn man beide Hände nimmt und damit so viele Zähne niederschlägt wie möglich. Aber sie fühlt, daß an dem Vergnügen noch etwas fehle, und jetzt fällt's ihr ein: die Noten!
»Pappa, nu muß ich auch dabei lesen, nich?«
»Ja, richtig! Das ist ja die Hauptsache!«
Ich hole den dritten Band von Beethovens Sonaten her und schlage ihn auf: Op. 106, Sonate für Hammerklavier. Also los. Im Notenlesen beschämt sie den gewiegtesten Partiturenleser. Immer nach drei Schlägen aufs Klavier schlägt sie um.
»Pappa, nu muß du auch sing'n!«
Wenn man bedenkt, daß der Kanarienvogel sich schon seit zehn Minuten in einem wahnwitzigen Geschmetter Luft macht, so wird man begreifen, daß hier die Vaterliebe ihre Grenze findet. Ich weiß, was sie auf andere Gedanken bringt. »Appelschnut, woll'n wir Bilder besehen?«
Im selben Augenblick rutscht sie mitsamt der Tetralogie vom Stuhl und etabliert sich auf dem Fußboden.
Bilder müssen genossen werden, indem man bäuchlings auf dem Fußboden liegt und beide Backen in beide Hände legt. So verlangt es Appelschnut, auch von mir. Ein großes Passagierschiff erregt zunächst ihre Bewunderung.
»O Pappa, kuck ma, was 'n großes Schiff! Das fährt ganz weit, bis nach Berlin, nich!«
»Ja, noch weiter sogar!«
»Oha! Da möcht ich auch 'mal mitfahr'n!«
»Das glaub' ich.«
»Weiß du noch, Pappa, einmal, da fahrten... fuhrten wir auch in Schiff, weiß noch?«
»Ja natürlich, wie sollt ich denn das nicht wissen!«
»Da war so 'ne ganz, ganz große Elbe!« Sie meint die Ostsee. Meere, Ströme, Bäche und Regentümpel faßt sie zusammen unter dem Namen »Elbe«.
»Oh, eine lektersche Bahn (elektrische Bahn)!« ruft sie bei einem neuen Bilde aus. Es stellt das antike Theater zu Segesta dar. Ihr Bruder hat nämlich eine Eisenbahn mit einem kreisförmigen Schienenweg, und die konzentrischen Sitzreihen des Amphitheaters hält sie für solche Schienen. Noch überraschender ist es, daß sie bei einer Abbildung des Parthenons zu Athen ausruft:
»O Pappa, wie in ßuggologischen Garten, nich?«
»Im zoologischen Garten? Warum?«
»Ja, bei den Löwe sein Bauer, weiß noch?«
Heiliger Parthenon! Deine erhabenen Säulen hält sie für die Gitterstäbe eines Löwenkäfigs. Für die Antike ist sie noch nicht reif. Gehen wir zu anderem über. Da ist ein Blatt mit wunderschön gemalten Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren usw. usw.
»Pappa, das sind doch keine wirklichen Stachelbeeren, nich? Das sind doch bloß ausspaßige, nich?«
»Ja, das sind bloß ausspaßige.«
»Junge, ich möcht', das wär'n wirkliche!«
Auch auf einer Tafel mit Tierbildern weiß sie gut Bescheid.
»Oh, ein Löwe! – ein Affe! – ein Bär! – Pappa, was is das?«
»Ein Rhinozeros.« – Ich beschließe, mir einen Extragenuß zu verschaffen, und frage: »Wie heißt das Tier!«
»Zirozenos!«
»Richtig!« Ist das nicht ein Ohrenschmaus? Als sie zwei Jahre alt war, sagte sie statt »Elefant« – »Hameninth«. Ihr Ohr hatte nur den Rhythmus bewahrt, hatte nur behalten, daß der Elefant ein anapästisches Tier ist – das übrige machte sie selbst.
»Oh, der böse Wolf!« ruft sie plötzlich. »Will er jetz nach die Großmutter?«
»Ich weiß nicht. Ich glaub's wohl.«
»Du böser Wolf«, ruft sie und prügelt mit ihrem Händchen den Räuber in effigie gehörig durch, »du solls nich das süße Rotkäpschen auffressen!« Bei einer Abbildung der deutschen Reichskleinodien zeigt sie auf die Krone und fragt: »Was is das?«
»Das ist die Krone, die trägt der Kaiser auf dem Kopf.«
»M!«
»Sieh nur, da sind eine Menge Edelsteine darin.«
»M! – Die bekommen die Kinder, nich?«
»Die Kinder?«
»Ja, du weiß doch: Der Vater soll ihnen doch Edelsteine mitbringen!«
»Der Vater? Welcher Vater?«
»Der Vater!!! – Die Kinder sind doch so ungeschämt un woll'n Edelsteine haben; aber Aschenputtel wollte bloß 'n Zweig von ihrer Mutter Grab haben!«
»Aaah – Aschenputtel! Jawohl! Verzeihung, Prinzessin Appelschnut; ich vergaß, daß Sie im Märchenlande wohnen.«
Die Menschen teilt Appelschnut mit feinem Instinkt in »Menschen« und »Kinder« ein. Die »Menschen« zerfallen wiederum in »Frauen« und »Onkel«.
»Wie heiß der Onkel?«
»Das ist Onkel Beethoven.«
»Un der Onkel?«
»Onkel Waldersee.«
»Un der Onkel?«
»Onkel« – ja... darf man den Mann eigentlich Onkel nennen?... Sei's drum: Die Sonne dieser Kinderstunde soll scheinen über Gerechte und Ungerechte; also los denn: »Onkel Caracalla.«
Nachdem sie bei einer belvederischen Apollobüste bezeichnenderweise gefragt hat: »Wie heiß die Frau?«, wird ihre Aufmerksamkeit durch einen Raben abgelenkt, der draußen mit lautem Schrei durch die winterstille Luft fliegt.
»Der Rabe rabt!« spricht sie mit andächtigem Blick.
Sie schaut noch immer nach draußen und sagt plötzlich:
»In der Quickbornstraße war es viel schöner als hier.«
In der Quickbornstraße wohnten wir ehemals.
»Warum?« frage ich.
»Da war so'n schönes Gitter.«
Ein schönes Gartengitter hat sie damals glücklich gemacht, und keine Seele hat es geahnt. Um dieses Gitter haben sich unbekannte Träume gerankt, hinter diesem Gitter hat vielleicht das Paradies gelegen, was sie nicht wiederfinden wird, wenn sie einmal an die alte Stätte kommt, das sie suchen wird ihr Leben lang wie wir andern alle.
»Jetz is doch Winter, nich?« fragt sie.
»Ja, jetzt ist Winter.«
»Nach Winter kommt Frühling«, erklärt sie mit weisem Gesicht, »Pappa, wann kommt eigenlich Frühling?«
»Bald.«
»Morgen?«
»Nein, morgen noch nicht.«
»Wann denn?«
»Nach sieben Wochen.«
»Is jez sieben Wochen?«
»Nein, jetzt muß erst Sonntag werden, und dann noch mal Sonntag, und dann noch mal, und dann noch mal, und dann noch mal, und dann noch mal, und dann noch mal, und dann ist Frühling!«
»O ja!« Sie freut sich, als wenn sie ihn schon in der Hand hätte. Und auf dem Boden liegend, die Wangen in die Hände gedrückt, beginnt sie eine aus Reminiszenz und eigener Dichtung gemischte Litanei zu singen:
»Jetz kommt der schöne Frühling, Dann scheint die liebe Sonne so schön, Und dann singen die Vögelchenlein, Und dann spiel'n wir wieder in Garten, Und dann gibt Rudi mir wieder seine Schaufel, Und dann graben wir wieder in Garten...«
Es ist ein Kinderlied nach unendlicher Melodie, die aber jäh abgerissen wird durch die Sensationsnachricht, daß der Tisch gedeckt sei. Ich reiche ihr herablassend den Arm, sie hakt ein und hüpft an meiner Seite zu Tisch wie der Hase in den Kohl.
Als die Suppe auf den Tisch kommt, ruft sie mit leuchtenden Augen: »Ei, Kerbelsuppe, das is mein Liebstes!« Es ist ein Glück, daß sie diese Erklärung ungefähr bei jeder Speise abgibt. Selten nur erklärt sie beim Anblick einer Speise, daß sie »solche Leibschmerzen« habe. Wenn meine Frau ihr dann die Speise fortnimmt und sagt: »Da kannst du ja heute auch kein Obst essen«, so versichert sie strahlenden Angesichts: »Jaaa, Mamma, für Obs hab ich kein Leibweh!« Daß man ihre kleinen Schwindeleien nicht durchschaue, diese naive Meinung, die uns an den Erwachsenen so sehr entzückt, findet man schon bei den Kleinen.
Als gebratene Fische auf den Tisch kommen, ruft sie:
»Ei, gebrat'ne Schiffe! Mein Liebstes!«
Die beiden Wassertiere »Fisch« und »Schiff« kann sie durchaus nicht auseinanderhalten, und es ist eines der anmutigsten Schauspiele, zu sehen, wie ihre Lippen und ihr Zünglein sich bei diesen Worten in Zweifelsqualen wälzen.
Ich erläutere ihr nochmals mit logischer Distinktion die beiden Dinge. Nach Beendigung meines Vortrages frage ich sie: »Also, was liegt auf deinem Teller?«
»Ein Schfffff-schiff!!!«
»Und was fährt auf dem Wasser?«
»Ein Schschf-fisch!«
Das wollte ich nur hören.
Sie bittet inständigst, ihr die Fische mit den Gräten zu geben, wie sie auch Kirschen, Pflaumen und dergleichen mit den Steinen erbittet. Meine Frau läßt denn auch ein paar riesengroße Gräten in dem Fisch, die Appelschnut nach beendeter Mahlzeit mit großem Stolze vorzeigt, ein Gefühl, das ich durchaus verstehe. Wenn man drei Jahre alt ist, will man schließlich nicht mehr bevormundet sein wie ein kleines Kind. Bei welcher Gelegenheit man mit der Selbständigkeit anfängt ist einerlei; aber anfangen muß man mit ihr, das liegt so im Wesen der Selbständigkeit.
Mittlerweile hat die hohe Mittagssonne den Schnee draußen an manchen Stellen weggeleckt, und als ich zufällig hinausblicke, sitzt auf dem Fenstersims ein verfrühter Schmetterling. Ich sage nichts, sondern nehme nur Appelschnut auf den Arm, trage sie ans Fenster und zeige ihr schweigend das stille Wunder. Im nächsten Augenblick wäre sie mir fast aus dem Arm geschnellt wie ein springlebendiger Karpfen.
»Ein Schmeckerling, ein Schmeckerling! Mamma, Mamma, ein Schmeckerling, Trude, Rasmus, Hertha, ein Schmeckerling, ein Schmeckerling!«
Die ganze Familie versammelt sich am Fenster.
»Der is doch wirklich, nich? Das is doch ein gar kein ausspaßiger, nich, Pappa?«
»Nein, das ist ein wirklicher lebendiger Schmetterling.«
»Ja, ein gebendiger Schmeckerling! Irene, ein gebendiger Schmeckerling!« Ich habe die größte Mühe, sie zu halten; ihr ganzes Körperchen ist Zittern und Jauchzen. Das ist Freude! Das ist die Freude an den Dingen, die noch nicht fragt, was sind uns die Dinge und was sind wir den Dingen – die in jeder Blume ein entdecktes Land sieht und in jedem Steinchen ein persönliches Geschenk.
»Bitte, bitte, süßer Pappa, laß den Schmeckerling mal reinkommen!« fleht die Kleine.
Vaterschaft verpflichtet. Ich mache mich also mit großer Vorsicht daran, den »Frühling« ins Zimmer zu schaffen, ohne daß ich seine Flügel berühre, und es gelingt. Jetzt sitzt er auf dem Tisch unter dem Kreuzfeuer von sieben Augenpaaren.
»Hertha, du muß nich so laut sprechen«, flüstert Appelschnut, »das mager nich hören.«
Und jede leise Regung seiner Fühler und Flügel wird mit unterdrücktem Jubel begrüßt. Dann aber geschieht etwas Großes, etwas unerhört Großes. Der Falter hebt sich auf und setzt sich auf Roswithas Arm.
Nun sitzt sie da, rührt keinen Muskel, nur ihre weit offenen Augen gehen behutsam von einem zum andern. Ihr Glück hat auf ihrem Gesichtchen nicht Platz und strahlt weit darüber hinaus wie ein Glorienschein.
»Er mag mich leiden«, spricht sie mit seligem Stolz. –
Der Schmetterling hat – nach Art der Schmetterlinge – die Dame seiner Wahl verlassen und ist weit fortgeflogen, bis hoch oben auf das Gardinenbrett. Er macht keine Miene, von dort zurückzukehren, und so erkalten allmählich auch Appelschnuts Gefühle.
Da aus der Gewohnheit sich das Recht bildet, so hat Appelschnut das Recht erworben, mich nach dem Essen schlafen zu legen. Sie bekommt bei dieser Gelegenheit nicht selten ein Stück von der Schokolade, die auf meinem Schreibtisch liegt. Das Schlafengehen geht so vor sich: Ich muß mich vor die Chaiselongue stellen; Appelschnut gibt mir einen Stoß, dann muß ich lang aufs Ruhebett fallen und eine Minute lang schrecklich mit den Beinen strampeln. Ich muß heut eine besonders geniale Strampel-Intuition gehabt haben; denn die ganze kleine Roswitha explodiert in ein wahrhaft beseligendes Gelächter. Und wieder hab ich es ganz genau beobachtet, daß solch ein Kinderlachen unmittelbar aus dem Herzen hervorbricht.
Inzwischen befinden wir uns bereits bei Nr. 2 des Programms; Appelschnut ist zu Pferde gestiegen. Das Pferd bin ich. Die Aufgabe besteht nun darin, die Literatur der Reiterlieder zu durchhopsen, zum Beispiel »Hoppe hoppe Reiter« und »Hopp hopp Reiterlein« und so weiter, eine väterliche Leistung, die nur derjenige würdigen kann, der weiß, was Embonpoint heißt. Dabei gibt es Literaturwerke, die mindestens sechsmal wiederholt werden müssen, zum Beispiel:
Zuck zuck zuck noh Möhlen Roswitha sitt op't Föhlen, Trudel op de bunte Koh Un Rasmus op'n Swanz bitoo. Rid wi all noh Möhlen.
»Goden Dag, Froo Möllerin, Wo sett wi unsen Sack denn hin?« »Buten op de Trepp, Mang all de bunten Säck'. Morgen geiht de Möhl; Denn geiht se: Rumpumpel rumpumpel rumpumpel rumpumpel.«
(in infinitum.)
Plötzlich hält sie im Reiten inne, macht ein tief nachdenkliches Gesicht und fragt:
»Pappa, wie heiß noch man das Lied von den Schwalben?«
Sie meint Chamissos Schwalbengedicht:
»Mutter, Mutter, unsre Schwalben, Sieh doch, liebe Mutter, sieh: Junge haben sie bekommen, Und die Alten füttern sie.«
Sie gibt nicht eher Ruhe, bis ich ihr das ganze Gedicht vorspreche. Und während ich spreche, muß ich denken: Wer doch den Blick eines Kinderauges beschreiben könnte! Denselben Blick sah ich einmal, als ich an einem trüben Ostertage durch die traurigen Straßen einer Vorstadt schlenderte. Ein kleiner Knabe ergriff mich beim Rock und sagte: »Du, kuck mal, ich hab'n neue Mütze gekriegt!«
Er mußte sein Glück hinaussprechen, und er vertraute es mir, dem völlig fremden Manne, an. Aus einem schmutzigen Gesichtchen lachten mich zwei große Augen an. Und der Ostertag wurde schön.
Als ich das Schwalbengedicht zu Ende gesprochen habe, atmet sie tief auf und sagt:
»Das is zu hübsch! Das lern' ich mir, und denn zieh ich einfach mein Mantel an un geh in die Schule.«
Kinder in diesem Alter haben bekanntlich ein kaum zu zügelndes Verlangen nach der Schule – sozusagen ein mathematischer Beweis für die Naivität dieser kleinen Wesen. Dabei hat sie offenbar die Vorstellung, daß man in die Schule gehe, um daselbst zu Hause Gelerntes abzulagern.
Die Gedanken, welche Appelschnut in dieser Unterhaltung produziert, muß man sich übrigens wohl untermischt denken mit Schokoladegedanken. Betteln darf sie natürlich nicht; aber von Zeit zu Zeit schleicht ein tiefernster Schokoladeblick nach dem Schreibtisch, und dann betrachtet sie mich mit einem Blick, welcher konstatiert: Er merkt noch immer nichts. – Da wir bei der Schule waren, so kommt sie auf den Gedanken, ihre wissenschaftlichen Kenntnisse auszukramen.
»Soll ich mal ßählen?«
»Ja, zähl mal!«
Sie zählt; bei »zwei« und »zwölf« und »zwanzig« aber macht sie jedesmal ein verschmitzt triumphierendes Gesicht, als wollte sie sagen: Was sagst du dazu?!! Früher sagte sie nämlich »ßei« und »ßölf«; aber jetzt sagt sie ganz richtig »ßwei« und »ßwölf«.
Natürlich wälze ich mich vor Bewunderung; als sie aber gar vollkommen richtig »ßweiunßwanzig« sagt, drohe ich zu vergehen. Wie nun aber die jungen Künstler gewöhnlich sind – sie wollen den Gipfel übergipfeln; Appelschnut denkt: Ich muß ihm noch mehr bieten, und mit einem Triumph, der schon an Größenwahn grenzt, fährt sie fort: »Dreiunßwanzig – vierunßwanzig« –
Siehst du, Appelschnut: das war gefehlt. 23 ist keine Kunst mehr; 24 noch weniger. 22 war das Höchste.
Als der Erfolg ausbleibt, erklärt sie mit dem bekannten Primadonnengesicht: »Ich mag nich mehr ßähl'n.«
»Warum nicht?«
»Das is so wangleilig.«
Folgt eine längere Pause mit einem längeren Blick nach dem Schreibtisch.
»Pappa, wo wächst eignlich Schokolade?«
»Schokolade wächst gar nicht, die wird gemacht.«
»M!«
»Aus so kleinen schwarzen Bohnen, und die wachsen auf einem Baum.«
»M! – In Hamburg, nich?«
»Nein, ganz weit weg, in Ländern, wo es viel wärmer ist als bei uns.«
»M!«
Wieder Schweigen. Aber mein Mannesherz schmilzt, und ich frage:
»Magst du denn gern Schokolade?«
Das war das befreiende Wort.
»Latürlich!!« ruft sie und illuminiert sofort aus beiden Augen, und auf der strahlenden Stirn steht: »Endlich!«
»Na, dann steig mal vom Pferde und hol die Tüte!«
Es war getan fast, eh gedacht.
Einen großen Teil, dieser Schokolade hat Appelschnut mir gelegentlich geschenkt. Sie kommt oft zu mir herein, wenn ich mitten in der Arbeit bin, um mir ein Stück Schokolade oder ein Bildchen oder eine Puppe, oder ein in ihren warmen Händchen längst verwelktes Gänseblümchen zu schenken, und alles muß ich unweigerlich annehmen. Nach dem Gesetze des Stoffkreislaufes kehrt also diese Schokolade jetzt an ihren Ursprungsort zurück.
»Die bewahr ich mir bis Sonntag auf!« ruft Appelschnut.
Diesen »Sonntag«, verehrtes Fräulein, hoff ich ganz bestimmt zu erleben. Dieser »Sonntag« wird nach 5 Minuten angebrochen, nach 8 Minuten zur Hälfte und nach 10 Minuten ganz vergangen sein.
Und als sie ihr Naschwerk empfangen hat, gibt sie mir eilig einen Kuß, sagt »Schlaf wohl«, und springt davon. Und das – habe ich immer gefunden – unterscheidet die Kinder von den Erwachsenen. Wenn die ihre Schokolade erreicht haben, bleiben sie immer noch etwas sitzen und reden von Richard Wagner oder von Afghanistan.
Hier folgt nun des Vaters Mittagsschlaf, den der geneigte Leser hoffentlich als einen wohlverdienten anerkennen wird. –
Vom Baum der Träume fiel mir eine weiche, köstliche Kirsche gerade auf den Mund, und als ich erwachte, war es Appelschnuts Mäulchen, das mich wachküßte. »Pappa –! Aufwecken –! Kaffee trinken –!« ruft sie in einer Art Nachtwächterton.
»Ich bin aber noch so müde! Laß mich doch noch'n bißchen schlafen!«
»Nein, mein Liebling, jetz muß du aufstehn, nich? Bis auch mein Engel!«
Sie sagt das mit einer mütterlichen Milde und Zärtlichkeit, daß ich mir wie ein Wickelkind vorkomme.
»Ich kann aber nicht allein hochkommen; du mußt mir helfen!« Sie faßt mich bei den Händen und zieht aus Leibeskräften, und als ich stehe, ist sie fest davon überzeugt, daß sie an meinem Aufkommen schuld sei. Als ich dann kaum einen Schluck Kaffee zu mir genommen habe, erinnert Appelschnut mit ernstem Pflichtgefühl daran, daß wir jetzt »arbeiten müssen«. Da ich beim Arbeiten wohl mit den Händen auf dem Rücken im Zimmer auf und ab zu gehen pflege, so legt sie die Hände auf den Rücken und wandert gesenkten Hauptes auf und ab, mit einem Gesicht, als grübe sie nach der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Ich muß natürlich das gleiche tun, und dabei begegnen sich einmal unsere Blicke, und dabei muß es um meinen Mund herum irgendwo unwillkürlich gelacht haben.
»Ach Vaaater!!« ruft sie beleidigt.
»Entschuldigen Sie, Herr Schopenhauer, entschuldigen Sie!« Wir »arbeiten« weiter.
»Nu muß ich auch schreiben, Pappa.«
»Natürlich, warum solltest du nicht schreiben?«
Ich muß ihr meinen Armstuhl an den Schreibtisch rücken, sie darauf setzen und ihr Papier und Bleistift geben. Sie macht zunächst eine lange Reihe von n-Strichen; dann fällt ihr ein, daß es auch lange Buchstaben gibt, solche, die nach oben, und solche, die nach unten gehen; sie macht also mit dem Bleistift einige kühne Abstecher nach oben und unten, und schließlich bringt sie sogar etwas wie eine h-Schleife an.
»Pappa, les mal, was da steht!«
»Das kann ich nicht lesen, das ist zu schwer.«
»Da steht: Mama is eine süße Deern.«
»Richtig, das steht da.«
»Was soll ich nu mal schreiben?«
»Schreib: Appelschnut is auch eine süße Dirn.«
»O ja.«
Mit derselben Leichtigkeit schreibt sie auch diesen Satz. Dann malt sie mancherlei wurmartige Gebilde, von denen sie mit großer Unbefangenheit behauptet, das sei ein Ofen, und das sei ein Pferd und das sei ich. Dann will sie lesen.
»Aber im Lexikomm!« ruft sie.
Ich hole einen Band »Meyer« herbei und schlage ihn auf bei dem Artikel »Salpetersäureanhydrid.« Sie wirft sich mit dem ganzen Oberkörper auf die Lektüre, und mit dem lächerlich kleinen Zeigefinger die Zeilen gewissenhaft verfolgend, liest sie:
»Eia popeia, was raschelt im Stroh, Das sind die kleinen Gänselein, die haben kein' Schuh«. Schuster hat Leder, kein Leister dazu, Darum kann er auch den Gänselein keine Schuh' machen.«
Und so liest sie noch gar manche Sachen aus dem »Meyer«, die noch kein Mensch darin gefunden hat. Als sie auf das Lied: »Ringel Rangel Rosen« stößt, rutscht sie vom Stuhl und hat mich im selben Augenblick bei der Hand.
»Das woll'n wir mal spiel'n!!«
Wir zwei spielen also Ringelreih'n:
»Ringel Rangel Rosen, Schöne Apfrikosen, Veilchen un Vergiß man nich, Alle Kinder setzen sich«
und viele andere schöne Sachen, so viele, daß ich vollauf befriedigt bin.
»Tanz, Püppchen, tanz! Deine Schühchen sind noch ganz; Tanzt du sie entzweien Kauft der Vater neue.«
O ahnungsloses, grenzenloses Kindervertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Vaters! O Kinderschuhe, ihr laufenden Ausgaben! Und doch würde ich Kinderschuhe über Kinderschuhe kaufen, wenn ich mir damit einen Ruhm erwerben könnte wie Buko von Halberstadt. Der war im grauen Mittelalter ein mächtiger Bischof, besiegte die Slawen, machte Päpste und Könige und setzte Könige ab; aber wenn er mal ein Mensch sein wollte, dann spielte er mit den Kindern, schenkte ihnen Naschwerk und dachte tief innen, ich meine: so ganz, ganz im Innersten seines streitbaren Herzens sicherlich wie alle großmächtigen Herren: »Dies ist das Gescheitere.« Von dem Slavenüberwinder und Königmacher, der den armen Kaiser Heinrich bedrängte, wissen nur ein paar absonderliche Leute, die Geschichte lernen und behalten. Von dem Kinderfreund aber singen noch nach über achthundert Jahren die Mütter:
»Buko von Halberstadt Bringt all de lütten Kinner wat. Wat sall he uns' denn bringen? Schoh mit goll'ne Ringen, Denn wüllt wi danzen un springen.«
Auf »springen« reimt sich »singen«, und indem ich (endlich!) in meinem Stuhle sitze und Appelschnut (vorläufig) auf meinem Schoße sitzt, singen wir (oft sehr zweistimmig) alles, was in ihrem kleinen Herzen an Liedern wächst.
»O Pappa, weiß du was?«
»Na?«
»Ich will mal ›O Tannenbaum‹ singen!«
»O ja, das tu mal!« Und sie singt:
»O Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie kosten deine Blätter – –«
Ich sehe, geneigter Leser, wie diese Version Sie stutzen macht. Gestatten Sie, daß ich Sie durch ein kleines Labyrinth zur Klarheit führe. Die richtige Lesart lautet bekanntlich:
»Wie treu sind deine Blätter.«
Der Begriff der Treue war aber Roswithen fremd. Sie verstand die Zeile dahin: »Wie teuer sind deine Blätter?« Und da sie von dieser Zeile nicht den Wortlaut, wohl aber den Sinn behielt, so singt sie jetzt standhaft: »Wie kosten deine Blätter?«
Zu solchen Aufschlüssen zu gelangen, ist natürlich nur der exakten, sorgsam beobachtenden Appelschnut-Philologie beschieden. Ich wette, meine Damen und Herren, Sie ahnen nicht, warum Appelschnut ein Geldstück, das ich ihr zeigte, auf meine Frage, was das sei, als »Silberpapiergeld« bezeichnete. Wollte das Kind einen Währungswitz machen? O nein! Der Appelschnutforscher löst die Frage mit spielender Leichtigkeit. Schokolade ist häufig in Stanniol eingewickelt, nicht wahr? Dieses Stanniol nennen die Kinder »Silberpapier«. Appelschnut hat nun offenbar von allen metallisch glänzenden Gegenständen die Vorstellung, daß sie mit »Silberpapier« überzogen seien. Und so nannte sie das Geldstück »Silberpapiergeld.«
Inzwischen haben die Mädchen ihre Schularbeiten beendigt, nur der Junge muß noch übersetzen, daß der Reiteroberst Quintus Fabius mit den Samnitern kämpfte, obgleich Papirius Kursor verboten hatte, daß eine Schlacht geliefert würde – was der Knabe im Interesse seiner menschlichen Bildung natürlich mit vielen Freuden tut. Und dann ist die Abend- und Märchenstunde da; alles versammelt sich um den Tisch, und meine Frau erzählt eine »Geschichte«, heute zum soundsovielten Male mit immer gleichem Erfolge »Rotkäppchen«. Alle Kinder, auch die größten, sind mit den Ohren dabei; nur Appelschnut hört mit Ohren, Augen, Mund und Nase – was sage ich: Sie hört mit dem ganzen Körper und mit der ganzen Seele zu. Meine Frau erzählt:
»... Und einmal schenkte ihr die Großmutter ein rotes Käppchen, und weil das kleine Mädchen so hübsch damit aussah, nannten es die Leute nur noch das ›Rotkäppchen‹. Da sagte einmal die Mutter: ›Komm, Rotkäppchen, hier ist Wein und Kuchen – ‹«
»O ja!« stößt Appelschnut hervor.
»›– – bring's der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und soll sich daran laben. Sei aber auch ja hübsch artig – ‹«
»Jaa!!« beteuert Appelschnut voll Andacht.
»›Lauf auch nicht vom Weg ab – ‹«
»Nein!« versichert Appelschnut gehorsam. Sie ist immer mitten in der Sache, und als meine Frau auf die Frage des Wolfes »Wo wohnt denn deine Großmutter?« das Rotkäppchen erwidern läßt: »Eine Viertelstunde von hier, unter den drei großen Bäumen –«, da unterbricht Appelschnut:
»So heiß das gar nich, ›das heiß: unter den drei großen Eichbäumen‹!«
Und als die Erzählung zu Ende ist, da ist die Produktivität Roswithas so auf den Gipfel gebracht, daß sie herausplatzt: »Nu will ich auch mal'n Geschichte gezähl'n!«
»Hallo, Appelschnut will 'ne Geschichte gezähl'n! Man zu, Appelschnut, man zu!«
Es wird so still, daß man unsere Winterfliege würde atmen hören, wenn sie nicht in diesem Augenblick den Atem anhielte. Ich blicke zufällig zum Kanarienvogel hinauf: Er neigt das Ohr und richtet sein kleines schwarzes Auge fest auf Appelschnut. Und Appelschnut erzählt:
»Ein Jäger gingte still in den Wald. Und da verlierte... verlorte er sein Schoßgewehr. Und da freuten sich all die Tiere, daß er sie nu nich mehr totschossen konnte.«
Dies also ist die Historia vom verlornen Schoßgewehr von Roswitha der Jüngeren. Sie hat allen, die sie hörten, das Herz erwärmt und ungeheuren Jubel erregt. Appelschnuts Produktivität zeigt sich auch in der Art, wie sie gehörte Geschichten wiedergibt. Auf allseitiges Verlangen muß Appelschnut die Geschichte von »Hänsel und Gretel« erzählen. Hänsel und Gretel spazieren in folgender Gestalt aus ihrem Köpfchen hervor:
»Also, es war einmal ein armer Holzhacker, der hießte Papa, un seine Frau hießte Mutter. Und sie hatten ßwei Kinder, die hießten Hänsel und Gretel. Na und als es abends war, sagte die Mutter: ›Wir wollen Hänsel un Gretel in Wald schicken.‹ Und das tun sie auch. Und da kamten sie an ein Hexenhaus, das war ganz voll Zucker, un voll Kuchen, un voll Schokolade, un voll Mazipan, un voll Kakes, un voll Bonbons un noch viel mehr. Da brachen sie ein Stück ab, da riefte die Hexe: ›Wer knappert an mein Häuschen?‹ – ›Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.‹ Da kam sie raus und sagte: ›Kommt nur herein, liebe Kinder, ihr sollt Reis mit Zucker und Kaneel haben.‹ Un da wollte sie Hänsel un Gretel in Ofen stecken, aber da ließen sie es lieber sein un steckten die Hexe in Ofen. Aber die Hexe mögte auch nich in den Ofen sein, un da schrie sie – oha, was schrie sie! Ganz doll! ›Ich will es auch nich wieder tun, ich will es auch nich wieder tun!‹ Da ließen sie sie wieder raus. Un da gingten sie fröhlich wieder zu ihr Eltern. Un da gingten sie alle in den Wald, un da eßten sie das ganze Kuchenhaus auf.«
Der gesunde Sinn der Dichterin sagte sich mit Recht: Wozu soll dieses wunderschöne Haus ungegessen im Walde stehen? Allen früheren Dichtern des Märchens ist dieses wichtige Moment entgangen, und so blieb es Appelschnut vorbehalten, den Stoff erst vollends zu bewältigen.
Inzwischen hat die Mutter das Appelschnütchen auf den Schoß gezogen und ihr Kleiderknöpfchen und Schuhbändchen gelöst. Der kluge Leser erwartet jetzt den üblichen tränenreichen Widerstand gegen das Zubettegehen. Der kluge Leser irrt sich. Erstens weiß Appelschnut genau, daß dergleichen Bemühungen nutzlos sind. Zweitens ruht ihre ganze Weltanschauung auf der Grundlage: »Morgen ist es ebenso schön, und so leben wir alle Tage.« Und drittens erwachte sie eines Abends spät und rief nach ihrer ältesten Schwester, die den Posten einer Vize-Mutter bekleidet. Aufrecht im Bette sitzend, mit weit geöffneten Augen sprach Appelschnut zu ihrer Schwester:
»Trudel, fühl mal nach, ob meine Ohr'n noch da sind!«
Trudel fühlte nach und stellte fest, daß beide Ohren noch da seien. Und Appelschnut warf sich befriedigt ins Kissen zurück, steckte den Daumen in den Mund und entschlief sofort.
Ihr Traum ist Leben und ihr Leben Traum. Während des Auskleidens nehmen ihre Augen schon den Ausdruck aus jener anderen, verschwiegeneren Welt des Traumes an...
»Mamma«, ruft Appelschnut plötzlich, »die Diebe sind doch ganz dunkel, nich?«
»Warum meinst du das?«
»Ach – ich meine – die sind doch ganz dunkel, nich??«
»Nein, die Diebe sehen geradeso aus wie andere Menschen.«
Die Diebe spielen nämlich in Appelschnuts Phantasie eine Rolle seit einer dunkeln Nacht, in der ein dunkler Ehrenmann ihr Kaninchen stahl. Sie hatte sich so sehr ein lebendiges Tier gewünscht; erst wollte sie mit einem richtigen Pferd spielen, dann mit einer Ziege, und so wurde das Pferd immer kleiner, bis es ein entzückend weißes Kaninchen war. Appelschnut küßte und drückte es mit einer Liebe, die für ein Pferd genügt hätte, und brachte ihm so viel Zärtlichkeit entgegen, daß es selbst dem Karnickelchen zuviel wurde; es sprang ihr mit einem jähen Entschluß vom Arm; Appelschnut fiel ins Gras, und das Nickelchen sprang über ihre Nase hinweg. Appelschnut war ihm anderthalb Minuten lang wirklich böse; dann verzieh sie ihm, und so sprangen die beiden zwei Tage lang durch den Sonnenschein. Am Morgen des dritten aber war das Ställchen leer, und Appelschnut hörte, daß ein Dieb das Nickelchen weggenommen habe. Es zuckte bedenklich um Appelschnuts Mäulchen – da sah sie im Sande ihre kleine Gießkanne liegen.
»O Mamma«, rief sie begeistert, »sieh mal: Der süße Dieb hat meine Gießkanne nich weggenommen!« – –
Unter den Seligpreisungen der Bergpredigt fehlt die eine: »Selig sind, die dankbaren Herzens sind. Schon unter Menschen werden sie glücklich sein.«
Appelschnut und die Philosophie
Denkt euch einen wunderbaren Sommertag und einen Garten, der mit seinem grünen Rasen, seinen Obstbäumen, seinen turmhohen Kastanien, Akazien und Ulmen in einem Meer von Sonne treibt... Denkt euch in diesem Garten eine Laube und in der Laube einen närrischen Menschen, der sich verankert hat an schweren, dickleibigen Büchern und an einem Tintenfaß, das wie ein unförmlicher schwarzer Fels aus der Sonnenflut emporragt...
Und riesige Ulmen und zarte Syringen und schwebende Schmetterlinge und stille Rosen schwimmen an ihm vorüber. Er hat strengen Befehl gegeben, daß ihn niemand störe, weil es ein sehr schweres und wichtiges Werk ist, an das er sich festgeschmiedet hat... Und wie er eben über Kants Schematismus der reinen Verstandesbegriffe nachdenkt, schwimmen zwei große, sonnenhelle Augen vorüber. Die Augen gehören zu einem Gesichtchen, und das Gesichtchen gehört zu einem kleinen Mädchen namens Roswitha. Der Mann in der Laube hat ihr den Namen Appelschnut gegeben, weil ihr Gesichtchen einmal aussah wie ein runder rotbäckiger Apfel, der weiter nichts zu tun hat, als zwischen grünen Blättern zu schaukeln, mit der Sonne Versteck zu spielen und zu wachsen. Inzwischen ist der Apfel gewachsen und hat angefangen – was man so nennt –: zu denken; er hat sozusagen schon Gesichtszüge bekommen, und zwei emsige Augen sind unaufhörlich an der Arbeit, um Mund und Nase Aufklärung zu verbreiten. Gleichwohl hat Roswitha den Namen Appelschnut behalten, und wenn man erst hört, welcher unerhörten Dummheiten sie noch fähig ist, dann wird man das auch ganz gerechtfertigt finden. So tritt sie jetzt an den denkenden Menschen in der Laube heran und sagt:
»Pappa, wenn wir 'ne neue Wohnung kriegen, mit'm Garten mein ich un mit 'm Birnbaum, un wenn dann welche 'runterfallen – die darf ich doch aufsammeln, nich?«
Was soll nun der denkende Mensch in der Laube dazu sagen? Die Frage steht mit dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe in keinem, aber auch gar keinem Zusammenhange! Er macht denn auch ein Gesicht, das zu der Tiefe seiner Gedanken in keinem Verhältnis steht, und fragt:
»Wie? Was willst du?«
Der Mund und die zwei Augen wiederholen ihre Frage, und mit finsterer Stirn versetzt der Mann: »Ja, ja – aber du mußt mich jetzt nicht stören, hörst du?«
»Nein«, verspricht das kleine Mädel und taucht wieder unter im Sonnenschein.
Kant sagt:
»In allen Subsumtionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muß die Vorstellung des ersteren mit dem letzteren gleichartig sein, das heißt der Begriff muß dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumierenden Gegenstande vorgestellt wird: denn das bedeutet eben der Ausdruck: ein Gegenstand sei unter einem Begriffe enthalten.«
Sehr wahr. Aber die Sonnenflut schwemmt wieder die beiden Augen heran, und unter den beiden Augen klingt etwas wie:
»Pappa: diese Gießkanne kann doch auch'n Bett sein, nich?«
»Wie? Was?«
»Ach, meine Puppe is jetz schon so groß, un nu kann sie doch nich mehr in der Wiege liegen, nich? Un nu soll sie in Bett liegen, un nu hab ich doch kein Bett, un nu kann doch auch die Gießkanne mal'n Bett sein, nich?«
Kann man die Vorstellung einer zerbrochenen Gießkanne unter den Begriff Bett subsumieren? Nein. Aber wer weiß, ob nicht die Gießkanne eigentlich ein Bett und das Bett eigentlich eine Gießkanne oder beide Dinge keins von beiden sind, da wir ja das Ding an sich nicht erkennen können? Also...
»Ja, Pappa?«
»Ja, ja, die Gießkanne kann ein Bett sein! Nun sollst du mich aber nicht mehr stören!«
»Nein!« verspricht das kleine Mädel.
»Nun sind aber reine Verstandsbegriffe, in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgendeiner Anschauung angetroffen werden. Wie ist nun die Subsumtion der letzteren unter die erste, mithin die Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen möglich, da doch niemand sagen wird: diese, zum Beispiel die Kausalität, könne auch durch Sinne angeschauet werden und sei in der Erscheinung enthalten?«
Ich verfolge gerade den Gedanken, daß der Mensch die Kategorie der Kausalität in die Erscheinungen legt wie Appelschnut ihr Kind in die Gießkanne – als auch schon da, wo das transzendentale Schema sein sollte, wieder die beiden runden Augen sind.
»Pappa, woher kommen eigentlich die kleinen Kinder?«
Ja, das ist auch so ein Fall, wo die Menschen zwei Vorgänge durch Kausalität verbinden, obgleich doch in den Erscheinungen kein Begriff der Kausalität enthalten ist. Es stimmt aber immer.
»Pappa!«
»Ja, ja! Das kannst du jetzt noch nicht verstehen; das lernst du, wenn du groß bist.«
»M! Nächstes Jahr, nich? Denn bin ich doch groß, nich?«
»Nein, nächstes Jahr bist du noch nicht groß.«
»Wie groß bin ich denn nächstes Jahr?«
»So groß vielleicht.«
»M. Ich weiß, was ich tu: ich trink fix Milch, denn werd' ich ganz größer!«
»Ja, das tu nur. Aber jetzt darfst du mich nicht wieder stören!«
»Nein. – Weiß du was, Pappa?«
»Na?«
»Ich bin Rudi ganz böse.«
»So? Warum denn?«
»Wenn ich sag: Der Storch soll bei uns 'n Baby bringen, denn sagt er immer: Nein, bei uns, un wenn ich denn sag: Nein, bei uns, denn sagt er immer wieder: Nein, bei uns. Das soll er doch gar nich, nich? Der Storch soll doch bei uns 'n Baby bringen, nich?«
»Das glaub' ich nicht, Appelschnut. Ich glaube, er bringt eins bei Rudi.«
Appelschnut wird sehr nachdenklich. Und dann spricht sie aus der Tiefe ihrer Sehnsucht heraus:
»Junge, ich möcht, das Fenster bleibte mal nachts bei mir offen, vielleicht bringt der Storch uns denn 'n Baby, un denn sucht er, wo das kleinste Bett is, un denn legt er das gerade in mein Bett! Meinst, ich bring das denn in eure Schlafstube? Nee! Wenn es schreit, denn mach ich sch–sch–sch–, denn wird es wohl bis morgens ruhig sein. Da weck ich euch nich ers um!«
Liebe und Ehe! Man sollte nicht glauben, welchen Raum sie in einem Kinderköpfchen einnehmen und wie sich da die schwierigsten und verworrensten Dinge glatt und leicht lösen. Schon mit drei Jahren bekundete Appelschnut die Absicht, zu heiraten, wenn sie groß sei, und zwar stand es für sie außer allem Zweifel, daß sie einmal ihren Bruder Erasmus heiraten werde. Als ihr dann jemand erklärte, daß man seinen Bruder nicht ehelichen könne, rief sie verzweiflungsvoll: »Wen soll ich denn aber bloß heiraten!« Diese Frage ist inzwischen ihrer Lösung näher gerückt. Rudi, der Nachbarssohn, ein allerliebster kleiner Blondkopf und ihr ständiger Spielgefährte, hat bis jetzt die meisten Aussichten auf ihre Hand. Aber wer kann dem Flattersinn der Weiber trauen? Im Seebade lernte Appelschnut Gustav kennen, Gustav aus München. Sie sehen und sie lieben war für Gustav eins. Schon am dritten Tage ihrer Bekanntschaft trat Gustav vor seine Eltern hin mit der Frage: »Wenn ich groß bin, darf ich doch Roswitha heiraten, nicht wahr?« und erhielt das Jawort seiner Eltern. Auch Roswitha erklärte: »Gustav soll mein Vater werden.« (»Vater« hier soviel wie »Gatte«.) Meine Frau zeigte sich sehr bestürzt und machte ihr ernstliche Vorhaltungen. »Was ist das?« rief sie aus. »Gustav soll dein ›Vater‹ werden? Was wird denn aus Rudi? Ich denke, der soll dein ›Vater‹ werden!«
Appelschnut, verächtlich: »Der will ja was anderes werden! Der will ja Eisenbahnmann werden.«
Dieselbe Auffassung wie vom Vatersein hat sie löblicherweise auch vom Muttersein; sie betrachtet es als Beruf. Aber sie betrachtet das Ideal des Mutterwerdens vollkommen unabhängig vom Heiraten. Sie hat lange geschwankt, ob sie Schneiderin oder Mutter werden wolle. Schneiderin, wenn man's bedenkt, ist ja sehr schön: Man kann sein ganzes Leben lang Puppenkleider machen. Was wunder, daß Roswitha daher ein Stein vom Herzen fiel, als ihre Mutter ihr eines Tages erklärte, daß sich beides sehr wohl vereinigen lasse.
»O ja!« rief Appelschnut glückselig. »Was werd' ich denn erst, Mamma?«
»Na, zuerst wirst du wohl Schneiderin.«
»O ja, un denn werd ich Mutter! Grade so wie Fräulein Annie, nich? Die is auch Schneiderin, un nu wird sie bald Mutter, nich?«
Meine Frau hatte Mühe, ihr die Richtigkeit dieser Folgerung auszureden und Fräulein Annies Ruf vor Schaden zu bewahren.
Ach, armer Gustav aus München, deine Sachen stehen schlecht! Du kannst nicht täglich zu Stelle sein, um deinen Vorteil wahrzunehmen, wie der blonde Lockenkopf Rudi. Da kommt er um die Ecke durch den Garten geschlendert. Roswitha eilt jubelnd davon und umschlingt ihn, dem sie ganz böse ist.
»Mein süßer Rudi!«
Rudi ist ein männlich-herber Charakter; er erwidert nur mit einem halblauten »–switha«? Er ist überdies wieder mit einer Untersuchung beschäftigt. Er hat irgend etwas in der Hand, das er, wie alles, was er Auffallendes findet, beguckt, befühlt, behorcht und endlich mit der Zunge prüft. Er ist eine ausgesprochene Gelehrtennatur und führt mit Appelschnut zuweilen sehr tiefsinnige Gespräche. So hat er ihr unter anderem die Überzeugung beigebracht: Wenn ein Regenwurm sterbe, dann gebe es Regen. Er verfügt denn auch schon über einen angemessenen Gelehrtenstolz. Eines Tages fragte er seine erwachsene Schwester:
»Du, Sabine, was war das man noch, was in der Schachtel von der Apotheke war?«
»Pulver.«
»Nein!«
»Pillen?«
»Nein!«
»Kapseln?«
»Ja, aber was war das man noch?«
»Junge, ich versteh' dich nicht.«
»Was so ist!« Und er zeichnete auf ein Stück Papier ein länglich-rundes Etwas.
»Ein Ei?«
»Nein!!!«
»Ach – meinst du vielleicht eine Ellipse?« fragte die Schwester zweifelnd.
»Ja, eine Ellipse!« schrie Rudi, und im nächsten Augenblick war er im Garten bei Appelschnut.
»Roswitha, weißt du, was 'ne Ellipse ist?«
»Nee«, versetzte Appelschnut mit herzlicher Entschiedenheit.
»O Roswitha«, rief Rudi mit Entrüstung, »wie bist du dumm! Du weißt nicht mal, was 'ne Ellipse ist!«
Da Appelschnut nun einen Gefährten hat, ist der Grund für mein Nichtstun eigentlich hinfällig, und ich versuche denn auch, das transzendentale Schema wieder in Sicht zu bekommen und zu entern. Zu meiner großen Freude werde ich aber bald durch ein erregtes Gespräch wieder gestört.
»Ich bin doch älter«, ruft Rudi.
»Nein!«
»Doch!«
»Nein! Sieh mal, du bist doch fünf, nich? Und wenn wieder Sommer is, denn is mein Geburtstag, un denn bin ich auch fünf.«
»Denn bin ich sechs«, versetzt Rudi schnöde.
»Nein!«
»Doch!«
»Denn wer' ich auch sechs!«
»Denn werd' ich sieben.«
»Pfui, Rudi! – Pappa, Rudi will immer älter sein als ich!« Sie ist dem Weinen nahe.
»Ja, Schätzchen, das ist nun einmal so. Dagegen ist nichts zu machen.«
»Er soll aber nich älter sein!«
»Dscha –!«
Damit ist der eheliche Zwist wieder da. Jede Überlegenheit gesteht sie ihm zu; nur daß er älter und größer ist als sie, das ist für ihr Kraftbewußtsein ein unverwindbarer Schmerz. Rudi ist zur Rechten gegangen und Appelschnut zur Linken. Wenn aber Rudi sich einbildet, daß Appelschnut um einen Spielgefährten verlegen sei, dann irrt er sich: Sie tanzt mit ihrem Schatten. Mit wunderlichen Kapriolen springt sie umher und bemerkt mit Vergnügen, daß der Schatten ihr alles nachmacht. Sie scheint diesen Kameraden, des Menschen getreuesten Gesellen und Persifleur, erst heute so recht kennenzulernen.
»Was machst du denn da?« frage ich sie.
»Ich spiegel mich in der Erde.«
»So!«
Im nächsten Augenblick schießt sie wie ein Pfeil in die äußerste Ecke des Gartens. Eine Henne auf ihrem Beet! Auf Appelschnuts Blumenbeet! Diese Keckheit!
»Hast du sie weggejagt?«
»Ja. Die kommen immer wieder, die sind so frech, die Hühner! Aber wenn sie nu wiederkommen, weiß, was ich denn tu?«
»Na?«
»Denn schleich ich mich ganz leise hin un denn mach ich mit einmal ›Huuu!!!‹ Denn meinen sie, ich bin 'n Tiger, un denn werden sie bange un laufen weg.«
Man darf hieraus jedoch nicht schließen, daß Appelschnut ein Tigerherz im Busen trüge. Eines Tages lief sie mit meiner Frau um die Wette. Nach wenigen Schritten blieb sie stehen und ließ ihre Mutter ans Ziel gelangen. Meine Frau markierte einen großen Siegesjubel. Appelschnut aber wandte sich heimlich zu mir und sagte mit listig-lustigem Augenzwinkern: »Ich wollt' ihr mal 'ne Freude machen!«
Sieht das einem Tiger ähnlich?
Und als sie eines Tages auf meinem Schreibtisch eine Tüte bemerkte, da fragte sie vorsichtig:
»Was hast du mir man noch versprochen?«
»Was ich dir versprochen habe? Das weiß ich nicht.«
»Das fängt mit'n ›i‹ an.«
»Fängt mit einem ›i‹ an? Was ist das?«
»'n Bonbon!!«
Ach soo!
Sie erhielt also einen Hustenbonbon; als sie aber mit dem Bonbon im Schnabel davongesprungen war zu ihrem Rudi, kam sie nach einigen Minuten wieder und rief:
»Du Pappa, weiß du was? Rudi hat noch nie in sein ganzes Leben geschmeckt, wie'n Hustenbonbon schmeckt!«
Da aber der Vorrat an Bonbons erschöpft war, so konnte dem Erkenntnisdurste Rudis des Forschers kein Genüge geschehen. Als Appelschnut jedoch drei Tage später wieder einen Hustenbonbon bekam, war sie in drei Sprüngen an der Tür.
»Wo willst du denn hin?«
»Rudi bringen! Du weiß ja doch!«
Ich frage euch: Welcher Tiger tut denn das?
Ich hebe wieder den Blick und sehe die beiden tief Entzweiten in inniger Umschlingung auf dem Rasen sitzen und miteinander spielen. Und habt ihr einmal zugesehen, wenn zwei Kinder an einem Sommertage auf grünem Rasen unter Bäumen spielen? Habt ihr bemerkt, daß gleich die Sonne dabei ist und mitspielt, sie am Öhrchen zupft, die Hand auf den Kopf legt und ihnen tief in die Augen schaut? Und nicht zu vergessen die Vögel! Kinder und Vögel sind Geschwister; sie sind des gleichen warmen und behenden Bluts. Darum hüpfen und springen und zwitschern in gemessenem Umkreis alle geflügelten Gäste unseres Gartens mit, wie fremde Kinder, die anfangs von ferne zuschauen und sich nicht ganz herantrauen, aber endlich mit fortgerissen werden in den Kreis der Freude. – Ja, Appelschnut ist gewiß ein Geschwister der Vögel, sie geht eigentlich nie, sie hüpft und tanzt ständig dahin. Auch jetzt kommt sie herangehopst, und während sie mit mir spricht, tanzt sie ununterbrochen vor mir herum.