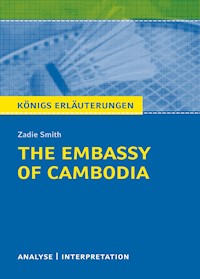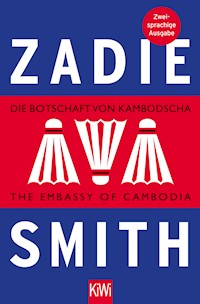22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Großartige Essays von Zadie Smith, »einer der wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit« (Die Welt). Zadie Smith ist nicht nur Autorin vieler hochgelobter Romane, sondern sie brilliert auch besonders in dieser kurzen Form, den Essays. Der vorliegende Band zeigt sie politischer denn je, denn Zadie Smith hat viel zu sagen über die zunehmend bedrohliche Verfasstheit der Welt und der Gesellschaft und bezieht sehr persönlich Stellung. Die Essays sind in fünf Kategorien unterteilt, und alle haben es in sich: »In der Welt« versammelt die politischen Essays, und gerade ihre Gedanken zum Brexit und zu Trump sind vielschichtig und erhellend, authentisch und engagiert. Die Kapitel »Im Publikum«, »Im Museum«, »Im Bücherregal« und »Freiheiten« erzählen uns ihre Sicht auf kulturelle Ereignisse oder persönlich Erlebtes und geben dabei immer ganz viel über sie selbst preis. Da sie sich mit schlechter Politik, guten Büchern, amerikanischen Rappern, Facebook und alten Meistern ähnlich gut auskennt, schreibt sie mit leichter Hand und mal böse, mal bewundernd Essays von besonderer Qualität, die uns die Welt schärfer sehen lassen. Ein Muss für jeden politisch denkenden Leser!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Ähnliche
Zadie Smith
Freiheiten
Essays
Aus dem Englischen von Tanja Handels
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Zadie Smith
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Die vorliegende Übersetzung wurde mit dem Übersetzerstipendium des Freistaats Bayern 2018 ausgezeichnet.
Vorangestellte Mottos entnommen aus:
Hurston, Zora Neale, Ich mag mich, wenn ich lache: Autobiographie. Zürich, Ammann, 2000. Übersetzt von Barbara Henninges.
Daniel Kehlmann, F. © 2013 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Für Kit und Hal
und
für Robert B. Silvers, in memoriam
»Menschen können wandelnde Sklavenschiffe sein.«
Zora Neale Hurston
»Augen sind keine Fenster. Da sind Nervenimpulse, aber niemand liest sie, zählt sie, übersetzt sie und denkt über sie nach. Such, so lange du willst, niemand ist zu Hause. Die Welt ist in dir, und du bist nicht da.«
Daniel Kehlmann
Vorwort
Ich saß in Rom beim Abendessen mit alten Freunden, als mich einer von ihnen plötzlich ansah und meinte: »Eigentlich ist dein bisheriges Schreiben doch ein einziges, fünfzehn Jahre währendes Psychodrama.« Alle lachten – ich auch –, aber ein wenig getroffen fühlte ich mich schon und quälte mich über mehrere Wochen mit diesem Gedanken herum. Jetzt schreibe ich ihn sogar in dieses Vorwort. Es stimmt schon, ich denke seit vielen Jahren laut und habe mich oft gefragt, ob ich mich damit nicht auf die eine oder andere Weise lächerlich mache. Ich glaube, diese Sorge entspringt dem Wissen, dass ich eigentlich gar nicht richtig qualifiziert dafür bin, so zu schreiben, wie ich es tue. Ich bin keine Philosophin oder Soziologin, keine echte Literatur- oder Filmprofessorin, keine Politikwissenschaftlerin, keine professionelle Musikkritikerin, keine ausgebildete Journalistin. Ich unterrichte in einem Studiengang, der mit dem Master of Fine Arts abschließt, habe aber selbst keinen solchen MFA und auch keinen Doktortitel. Meine Beweisführung – soweit vorhanden – ist praktisch immer sehr intim. Ich empfinde das so – Sie auch? Dieser Gedanke beschäftigt mich – und Sie? Essays, die von der affektiven Erfahrung eines einzelnen Menschen handeln, stehen schon ihrem Wesen nach auf verlorenem Posten. Sie haben nur ihre Freiheit. Und die Leserin ihrerseits ist ebenso ungewöhnlich frei, weil ich ihr absolut nichts voraus-, keine Macht über sie habe. Sie darf meine Gefühle jederzeit von sich weisen, sie darf sagen: »Nein, so habe ich das noch nie empfunden«, oder auch: »Mein Gott, dieser Gedanke ist mir wirklich noch nie gekommen!«
Schreiben existiert (aus meiner Sicht) an der Schnittstelle dreier recht heikler, unsicherer Elemente: Sprache, Welt und Ich. Ersteres gehört mir niemals ganz, zweiteres kann ich allenfalls teilweise erfassen, und das dritte Element ist eine formbare, improvisierte Antwort auf die ersten beiden. Wenn mein Schreiben also ein Psychodrama ist, dann liegt das, glaube ich, nicht daran, dass ich zu emotional wäre – so many feels, wie es im Internet so schön heißt –, sondern daran, dass die richtige Balance und Gewichtung jedes einzelnen dieser drei Elemente für mich niemals offensichtlich ist. Dieses Ich, dessen Grenzen unsicher bleiben, dessen Sprache niemals rein, dessen Welt in keiner Hinsicht »offensichtlich« ist – das ist es, aus dem heraus, an das ich zu schreiben versuche. Ich hoffe dabei auf eine Leserin, die sich wie die Autorin häufig fragt, wie frei sie wirklich ist, und es als selbstverständlich hinnimmt, dass Lesen genau dieselben Freiheiten und Erfordernisse umfasst wie Schreiben.
Ein Hinweis noch: Mir ist klar, dass mein recht ambivalenter Blick auf das menschliche Ich komplett aus der Mode ist. Die Essays, die Sie jetzt in Händen halten, wurden während der achtjährigen Präsidentschaft Barack Obamas in England und Amerika verfasst und sind folglich Produkte einer vergangenen Welt. Angesichts der Dinge, mit denen wir seither konfrontiert sind, ist es natürlich nahezu unmöglich, sich noch irgendein Gefühl der Ambivalenz zu erhalten – weder diesseits noch jenseits des Atlantiks. Millionen mehr oder weniger formloser Ichs werden sich jetzt notgedrungen zu Protestlern, Aktivistinnen, Demonstranten, Wählerinnen, Aufwieglern, Anklägerinnen, Lobbyisten, Soldatinnen, Verfechtern, Verteidigerinnen, Historikern, Expertinnen, Kritikern verdichten. Ein Feuer lässt sich nicht mit Luft bekämpfen. Genauso wenig kann man aber um eine Freiheit kämpfen, die man nicht mehr als solche erkennen kann. Der Leserin, dem Leser, die sich ihre Neugier auf die Freiheit erhalten haben, bringe ich diese Essays dar – um sie zu verwenden, zu verändern, zu zerlegen, zu zerstören oder gar nicht zu beachten, ganz nach Bedarf!
Zadie Smith
New York
18. Januar 2017
Nordwestlondon-Blues
Als ich das letzte Mal in Willesden Green war, ging ich zusammen mit meiner Tochter meine Mutter besuchen. Die Sonne schien. Wir schlenderten über die Brondesbury Park in Richtung Hauptstraße. Gerade war der sogenannte »Französische Markt« im Gange, eine einigermaßen erstaunliche Ansammlung von Ständen, die auf der Betonfläche zwischen den hübsch verwinkelten Überresten der ursprünglichen Willesden Library samt Türmchen (beides von 1894) und dem brutal-backsteinernen gestrandeten Kreuzfahrtschiff des sogenannten Willesden Green Library Centre (von 1989), einem maßgeblichen örtlichen Wahrzeichen, das jährlich fast fünfhunderttausend Besucher verzeichnet, französische Produkte feilbieten. Wir gingen im Sonnenschein die Großstadtstraße entlang zu der Betonfläche – zum Markt. Es war völlig anders als der Gang über den schattigen Feldweg eines urigen Marktfleckens zum perfekt erhaltenen Platz aus dem 18. Jahrhundert. Es war sogar anders als der Gang zu einem der vielen Bauernmärkte, die in ganz London an den Kreuzungen aus dem Boden schießen und persönlichen Reichtum mit einem markanten Interesse an ungewöhnlichen Käsesorten vereinen.
Trotzdem war es aber sehr schön. Der Französische Markt von Willesden verkauft billige Handtaschen. Er verkauft CDs mit altmodischem Jazz und Rock ’n’ Roll. Er verkauft Schirme und Kunstblumen. Er verkauft Nippes und Krimskrams und Kinkerlitzchen, die in Thema und Ausführung nicht immer auf den ersten Blick als französisch zu erkennen sind. Er verkauft Wasserpistolen. Er verkauft französisches Brot und Gebäck für kaum mehr Geld, als man bei Greggs an der Kilburn High Road für die Backwaren bezahlen würde. Er verkauft Käse, aber erschwingliche und leicht identifizierbare Sorten – Brie, Ziegenkäse, Blauschimmel –, als hätte der komplette Markt unverändert aus einem leicht verlotterten Pariser Vorort über den Ärmelkanal gesetzt. Wer weiß, vielleicht hat er das sogar? Das Entscheidende am Französischen Markt von Willesden ist aber, dass er die Betonfläche vor dem Willesden Green Library Centre betont und feiert, die immer ein allgemeiner Treffpunkt ist, wenn auch nie so stark wie am Markttag. Alle stehen dort herum, reden, kaufen Käse oder kaufen keinen, je nach Lust und Laune. Das ist wirklich nett. Man könnte fast vergessen, dass nur zehn Meter weiter die Willesden High Road liegt. So etwas ist wichtig. Wenn man auf dem Markt steht, ist man nicht unterwegs zur Arbeit, unterwegs zur Schule, man wartet nicht auf den Bus. Man will nicht zur U-Bahn oder macht notwendige Besorgungen. Man ist nicht auf der Hauptstraße, wo all das üblicherweise stattfindet. Man ist ein kleines Stück davon entfernt, man hängt einfach herum, an einem Ort mitten in der Großstadt, wo sich die großstädtischen Hauptstraßen doch gerade ganz konkret dahin entwickelt haben, die Menschen genau daran zu hindern.
Nun ist es ja bekannt, dass Menschen, wenn sie über längere Zeit zweckfrei an einem Ort in der Großstadt herumhängen, Gefahr laufen, »asozial« zu werden. Und tatsächlich hocken da drüben vier obdachlose Trinker auf einer der seltsamen architektonischen Ausbuchtungen der Bibliothek und trinken Special Brew aus der Dose. Auf dem Dorf säßen sie vielleicht unter einem Baum oder wären längst von einem Bauern mit der Mistgabel verjagt worden. Ich will gar nicht behaupten, dass ich wüsste, wie es auf dem Dorf zugeht. Hier in Willesden jedenfalls hockten sie auf ihrem Vorsprung, und wir anderen versammelten uns ohne jeden Sinn und Zweck auf der wenig ansprechenden Betonfläche und standen einfach im Sonnenschein herum, als wären wir so etwas wie eine Gemeinschaft. Von diesem Standort aus konnten wir geradeaus auf das hübsch verwinkelte Türmchen blicken oder nach links zu dem viktorianischen Polizeirevier (von 1865) oder auch nach rechts auf die fast schon gespenstische Fassade des Pubs, The Spotted Dog (von 1893).
Wir hatten Gelegenheit, ansatzweise ein Gefühl für den Fortbestand dessen zu entwickeln, was vor uns war. Natürlich nicht so sehr wie die Bewohner von Hampstead oder die Leute, die in den pittoresken Marktflecken im ganzen Land leben, aber hier und da ist auch in Willesden die Vergangenheit noch erhalten. Und darüber sind wir froh. Was gar nicht heißen soll, dass wir übertrieben nostalgisch wären, was Architektur betrifft (da muss man sich ja nur die Bibliothek anschauen!), aber wir finden es trotzdem schön, uns daran zu erinnern, dass wir das gleiche Recht auf Lokalgeschichte haben wie alle anderen auch, obwohl viele von uns erst kürzlich hier eingetroffen sind und aus allen Winkeln der Welt stammen.
Am Markttag gönnen wir uns das Gefühl, dass unser Viertel mit seinem vielfältigen Gemisch aus Menschen und Architekturstilen trotzdem ein Ort von einer gewissen Schönheit bleibt, der ein Mindestmaß an Erhalt und Fürsorge verdient. Es ist, will ich damit nur sagen, eine schöne Abwechslung für uns. Allerdings gibt sich ein Kleinkind nur eine gewisse Zeit damit zufrieden, seiner Großmutter dabei zuzusehen, wie sie all die vielen Leute aus Willesden begrüßt, die die Großmutter so kennt. Also drehten meine Tochter und ich eine Runde. Und weil sich auf der Hauptstraße nicht gut Runden drehen lassen, wandten wir uns rückwärts, zur Bibliothek. Naturgemäß auch rückwärts in der Zeit, auch wenn ich meine Tochter nicht mit meinen Erinnerungen gelangweilt habe, sie gar nicht damit langweilen konnte: Sie ist noch klein und außerhalb der Reichweite jeder Nostalgie. Stattdessen langweile ich jetzt Sie damit. Da, an dem Tisch dort, habe ich immer gelernt. Dort drüben, wo früher die Telefonzellen waren, habe ich mich mit einem Jungen getroffen. Und hier habe ich mit meinen Schulfreundinnen Das Piano und Schindlers Liste geschaut (den Kinoraum gibt es längst nicht mehr), und anschließend waren wir dahinten Kaffee trinken (auch das Café gibt es längst nicht mehr) und haben eine echte Diskussion über Kunst geführt, weil wir damals schon ahnten, dass es Unterschiede zwischen einem gut gemeinten und einem wirklich guten Film geben könnte.
Derweil rennt meine Tochter wie eine Verrückte den langen Flur der Bibliothek entlang, zusammen mit einem anderen Kleinkind, das den gleichen Einfall hatte. Dann biegt sie ab und flitzt direkt in den Willesden Bookshop, einer bibliotheksunabhängigen Buchhandlung, die ihre Räumlichkeiten von der Stadt gemietet hat und, allen Aussagen der Stadtteilverwaltung von Brent zum Trotz, ein unentbehrlicher lokaler Dienstleister ist. Geführt wird der Laden von Helen. Helen ist eine unentbehrliche lokale Größe. Ich würde ihre Unentbehrlichkeit etwa wie folgt umschreiben: »Den Menschen geben, was sie wollen, bevor sie wissen, dass sie es wollen.« Eine wichtige Kategorie. Ganz anders als das von Mr Rupert Murdoch berühmt gemachte Konzept, den Leuten zu geben, was sie wollen. Mit dieser Version von Gemeinwohl, wie sie der Dirty Digger darstellt, sind wir inzwischen alle bestens vertraut – schließlich leben wir seit dreißig Jahren damit. Helens Version ist anders und spielt sich zwangsläufig in sehr viel kleinerem Umfang ab.
Helen gibt den Menschen aus Willesden das, was sie wollen, obwohl sie noch gar nicht wussten, dass sie es wollen. Kluge Bücher, sonderbare Bücher, Bücher über das Land, aus dem sie kommen, oder über das Land, in dem sie angekommen sind. Kinderbücher mit Kindern, die zumindest ein klein wenig so aussehen wie die Kinder, die sie lesen. Radikale Bücher. Klassische Bücher. Abstruse Bücher. Bekannte Bücher. Sie liest sehr viel, sie hat immer eine Empfehlung parat. Hoffentlich haben auch Sie so eine Helen in einem Buchladen in Ihrer Nähe und wissen, wovon ich spreche. 1999 hatte ich keine Ahnung, dass ich David Mitchell lesen will, bis Helen mich auf Chaos hinwies. Und ich habe noch sehr lebhaft in Erinnerung, wie ich hier einmal ein Buch von Sartre gekauft habe, weil es im Regal stand und ich es dort sah. Ich weiß nicht, woher ich hätte wissen sollen, dass ich Sartre lesen will, wenn ich ihn nicht im Regal gesehen hätte – sprich: wenn Helen ihn nicht dorthin gestellt hätte. Jahre später habe ich meine erste Buchpremiere in diesem Buchladen gefeiert, und als es zu voll wurde, was vor allem an den vielen Bekannten meiner Mutter aus dem Viertel lag, gingen wir alle zusammen ein Stück die Straße hinauf in ihre Wohnung und feierten dort weiter.
Und während ich mit Helen nostalgisch in solchen Erinnerungen schwelgte und schon überlegte, ob es nicht möglich wäre, wieder einmal eine Buchpremiere an diesem Ort abzuhalten, hörte ich zum ersten Mal von den Plänen der Stadtteilverwaltung, das Library Centre abzureißen, mitsamt dem Buchladen, dem Türmchen aus dem 19. Jahrhundert, der Betonfläche und dem Vorsprung, wo die vier Trinker hockten. An seine Stelle sollten Luxus-Eigentumswohnungen treten, eine stark verkleinerte Bibliothek, »Geschäftsräume«, aber kein Buchladen. (Steve, der Besitzer, konnte sich die gestiegene Pacht nicht mehr leisten. Das Gleiche ist ihm mit seinem Buchladen in Kilburn passiert, der kürzlich nach dreißig Jahren schließen musste.) Meine Mutter kam herein, mit Käse im Gepäck. Zu dritt beklagten wir die Veränderungen und den Kulturvandalismus, den sie aus unserer Sicht bedeuteten. Oder aus der Gegenperspektive betrachtet: Wir standen sinnlos herum, wie es von fortschrittsfeindlichen, wirtschaftlich ahnungslosen Liberalen wie uns zu erwarten war, und jammerten über das Unvermeidliche.
Ein paar Tage später stieg ich ins Flugzeug zurück nach New York, wo ich einen Teil des Jahres unterrichte. Von der Logik her sollte es einfacher sein, schlechte Nachrichten aus der Heimat mit Fassung zu tragen, wenn man selbst weit weg ist, doch wer schon einmal unter Exilanten gelebt hat, weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist: Keiner empört sich mehr über die Ereignisse in Rom als der junge Italiener, der am Broadway den Cappuccino serviert. Ohne das ausgleichende Umfeld des Alltagslebens bleiben einem ja nur die Nachrichten, und Nachrichten sind schon ihrem Wesen nach durchweg schlecht. Da wird man schnell hysterisch. Ich kann also nicht sagen, ob die Nachrichten aus meiner Heimat wirklich so schlecht sind, wie sie mir vorkommen, oder ob ein Gegenstand, den man aus fast fünftausend Kilometern Entfernung betrachtet, nicht schweren Übertreibungen hinsichtlich Größe und Farbgebung unterworfen ist. Hat die Labour-geführte Stadtverwaltung wirklich im Rahmen einer frühmorgendlichen Razzia Schlägertrupps in die Kensal Rise Library geschickt, um alle Bücher und Mark-Twain-Plaketten gewaltsam zu entfernen? Werden die Menschen aus Willesden Green allen Ernstes ihre Buchhandlung verlieren, dafür eine kleinere Bibliothek (die wegen der anderen Bibliotheken, die der Brent Council bereits geschlossen hat, von mehr Kunden genutzt werden wird) und einen hässlichen Luxus-Wohnblock – und das alles als »Kultur« präsentiert – bekommen?
Ja. Genau das passiert gerade. Mit minimalster Rücksprache und unter Einsatz von Einschüchterungstaktik, Geheimniskrämerei sowie ein wenig unverblümter Betrügerei. Die Mitglieder der örtlichen Behörde befinden sich zweifellos in einer schwierigen Lage: Die prozentualen Kürzungen in Brent zählen landesweit zu den höchsten und wurden von der Regierung verordnet. Aber die chronische finanzielle Misswirtschaft lässt sich ohne weiteres bis zur letzten Labour-Regierung zurückverfolgen, und so wird der Staffelstab der Schuldzuweisungen immer weiter herumgereicht. Die derzeitigen Planungen für Willesden Green verschaffen der Baubranche derart offensichtlich einen profitablen Grundstücksdeal – und entheben sie gleichzeitig der Verpflichtung zum Bau von Sozialwohnungen –, dass man sich, wenn man darauf hinweist, fast schon vorkommt wie ein Kind. Wer außer einem Kind würde in der aktuellen Wirtschaftslage überhaupt etwas anderes erwarten?
Liest man solche ungeheuer ortsgebundenen Geschichten mit der Geschichte des ganzen Landes zusammen, entsteht ein weiterer Effekt, vielleicht auch nur eine optische Täuschung in anderer Form: eine Spiegelung. Denn im Bericht über die Leveson-Untersuchung zur »Ethik der britischen Presse« finden sich sämtliche genannten Charakterzüge ebenfalls, nur noch deutlicher. Minimalste Rücksprache, Einschüchterungstaktik, Geheimniskrämerei, unverblümte Betrügereien. Werden die größten Entscheidungen des politischen Lebens Großbritanniens wirklich zum Teil bei privaten Abendessen einer winzig kleinen Elite getroffen? Warum schreibt Jeremy Hunt, seinerzeit Minister »für Kultur, Olympia, Medien und Sport«, SMS-Nachrichten an Murdoch? Was hat Rebekah Brooks dem Premierminister und der Premierminister Rebekah Brooks in dem pittoresken kleinen Marktflecken namens Chipping Norton damals tatsächlich versprochen? Während einer früheren Phase als Exilantin in Italien saß ich auf einer Renaissance-Piazza in Rom am Tisch eines Cafés und verdrehte die Augen über die Seifenoper des politischen Lebens in Italien: abgehörte Politiker, Fußballer und Fernsehstars, Mediengeschäfte im Hinterzimmer, himmelschreiende Interessenkonflikte, eine völlig aus dem Ruder gelaufene Boulevardpresse, Zeitungen, die Einfluss auf Politiker ausübten. Kichernd las ich La Repubblica und zog meine italienischen Freundinnen und Freunde mit Problemen auf, die wir in unserer grundsätzlich intakten britischen parlamentarischen Demokratie überhaupt nicht hatten.
Also muss ich mir jetzt eine ungeheure Naivität bescheinigen. Das trifft auf die meisten Romanautoren zu, allen vielfach behaupteten tiefen gesellschaftspolitischen Einsichten zum Trotz. Und ich bewahre mir zudem noch eine besondere Naivität im Hinblick auf Großbritannien, die vielen, vor allem vielen jüngeren Menschen, wahrscheinlich ziemlich lustig vorkommt. Richtig erklären kann ich das nur, indem ich noch einmal kurz auf die Vergangenheit zurückgreife. Es handelt sich um eine kurze Geschichte über Schulden – ich schulde diesem Staat nämlich eine ganze Menge. Manche Menschen verdanken alles, was sie haben, dem Bankkonto ihrer Eltern. Ich verdanke es dem Staat. Kurz zusammengefasst hat der Staat für meine Schulbildung gesorgt, er hat mir das Bein gerichtet, als es gebrochen war, und mir ein Stipendium verschafft, mit dem ich studieren konnte. Er hat mir die Zähne gerichtet (halbwegs zumindest) und meinem Vater, dem Kriegsveteran, eine Unterkunft für seinen Lebensabend gesichert. Als mein jüngster Bruder von einem Laster überfahren wurde, hat der Staat ihm das Leben und vor allem auch die zertrümmerte rechte Hand gerettet, ein Vorgang, der ein halbes Jahr in Anspruch nahm und auf dem freien Markt eine Million Pfund gekostet hätte, wie mir ein Arzt damals erzählte. Das sind die richtig großen Dinge, es gab aber auch noch genügend kleine: mein subventionierter Sportverein und die Praxis meines Hausarztes, der Musikunterricht in der Schule, für den wir nur ein paar Pennys bezahlten, meine Studiengebühren. Mit neun meine Brille, vom NHS finanziert. Mit dreiunddreißig die Geburt meines Kindes, vom NHS finanziert. Und meine öffentliche Bibliothek. Um den Titel eines Autorenkollegen abzuwandeln: Ich bin eine Tochter Englands. Mir ist es niemals schwergefallen, Steuern zu zahlen, weil ich das als Tilgung einer gewaltigen, im Grunde sogar unermesslichen Schuld auffasse.
Aber die Dinge ändern sich. Ich brauche den Staat heute nicht mehr so wie damals, und der Staat ist nicht mehr, was er damals war. Er ist an dieser neuen, gemeinsamen globalen Realität beteiligt, in der Staaten deregulieren, um Gewinne zu privatisieren, und dann re-regulieren, um die Verluste wieder zu verstaatlichen. Ein mit großem Elan von der Labour-Regierung angestoßener Prozess wird jetzt von David Camerons Koalition aus Torys und Liberal Democrats zur Perfektion geführt. Die oben beschriebene reizende Geschichte vom gütigen Vater Staat ist längst ins Reich der Märchen verbannt: Sie ist nicht mehr nur naiv, sondern phantastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Erfahrung, dass die eigene Geschichte so plötzlich und unerwartet irreal wird, betrifft eine ganze Generation von Britinnen und Briten, die jetzt vermutlich alle herumlaufen wie Coleridges alter Seebär und Fremde mit Geschichten darüber langweilen, wie sie noch umsonst studieren durften und an jeder Hauptstraße ein Zahnarzt des National Health Service zu finden war.
Ich langweile mich ja selbst damit, wenn ich solche Geschichten erzähle. Und ganz besonders langweilig ist die Unterstellung, jedes Argument zur Verteidigung öffentlicher Bibliotheken müsse zwangsläufig ein sozialliberales Argument sein. Ich habe erst vor Kurzem überhaupt mitbekommen, dass die persönliche Haltung zu Bibliotheken – nicht zu Schulen oder Krankenhäusern, sondern zu Bibliotheken! – Ausdruck eines ideologischen Bruchs sein kann. Ich dachte immer, eine Bibliothek sei einer der wenigen Schauplätze, an dem sich der Drang zur Erhaltung und der Wunsch nach Verbesserung – diese beiden Pole unseres politischen Geistes – problemlos und natürlich verbinden ließen. Und außerdem, was soll denn das für eine Liberale sein, die keine Partei mehr findet, für die sie noch stimmen kann, und dem Staat nicht mehr mit Dankbarkeit begegnet, sondern vielmehr mit Abneigung und mitunter sogar Angst?
Am nächsten komme ich einem Gefühl von Zugehörigkeit oder einem politischen Imperativ inzwischen eigentlich nur noch mit der Aussage des altgedienten Sozialdemokraten Tony Judt: »Wir müssen den Staat wieder neu denken.« Vor allem aber muss ich weniger naiv werden. Das Geld ist weg, und die Bedingungen, die Judts Generation bereits ererbt und die meine Generation von Judts geerbt hat, werden, falls überhaupt je, zu meinen Lebzeiten ganz sicher nicht wieder eintreten. Das sind die schlechten Nachrichten aus der Heimat. In politischer Hinsicht bleibt einer Sozialliberalen nur noch die Fähigkeit, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Fatalismus bloß eine Falle ist und man nicht nur auf eine Art naiv sein kann. Noch einmal Judt:
Wir haben uns von der in den Nachkriegsjahrzehnten verbreiteten Annahme befreit, dass der Staat die beste Lösung für jedes Problem ist. Nun müssen wir uns von der entgegengesetzten Vorstellung befreien, dass der Staat – grundsätzlich und in jedem Fall – die schlechteste Lösung ist.
Was für ein Problem ist denn eine Bibliothek? Es liegt auf der Hand, dass sie für viele Menschen überhaupt kein Problem darstellt, sondern nur eine Art Relikt. Am äußersten Pol dieser Sichtweise steht der unerschütterliche Glaube des Technokraten: Wozu brauchen wir noch die physische Realität, wo doch jedes Buch der Welt online zu finden ist? Ein solches Argument denkt die Bibliothek als Funktion, nicht als eine Vielzahl einzelner Räume. Dabei ist jede Bibliothek ein ganz eigenes Problem, und »das Internet« kann all diese Einzelprobleme ebenso wenig lösen, wie es ihnen in ihrer Gesamtheit den Todesstoß versetzen würde.
Jeden Morgen erkämpfe ich mir einen Platz in der überfüllten Unibibliothek, in der ich auch diesen Text schreibe, obwohl doch jede einzelne Studentin hier zu Hause sitzen und mit ihrem MacBook auf Google Books herumstöbern könnte. Und die Kilburn Library, die, ihrem Namen zum Trotz, ebenfalls der Stadtteilverwaltung von Brent untersteht, aber im begüterten Queen’s Park liegt, floriert nicht nur, sondern ist auch wegen Renovierung geschlossen. Die Kensal Rise Library wird nicht etwa geschlossen, weil sie nicht beliebt wäre, sondern weil sie keinen Profit macht, wobei die Tatsache, dass der Förderverein der Bibliothek bereit wäre, sie selbsttätig weiterzuführen (sofern das All Souls College in Oxford, dem die Bibliothek gehört, ihm das erlaubt), völlig außen vor bleibt. Da fällt es doch schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, die Bibliothek von Willesden Green solle nicht zuletzt deswegen verstümmelt werden, weil die Behörden die Möglichkeit eines lukrativen Immobiliengeschäfts wittern.
Jede Bibliothek hat ihren eigenen Charakter, ihr eigenes Umfeld. Manche wenden sich hauptsächlich an Kinder, an Studierende oder an die allgemeine Öffentlichkeit, sie beherbergen hauptsächlich Bücher oder Mikrofilme oder digitalisiertes Material, sie haben vielleicht ein Café im Keller oder einen Markt vor der Tür. Bibliotheken scheitern nicht, weil sie Bibliotheken sind. Bereits vernachlässigte Bibliotheken werden weiter vernachlässigt, und mit der Zeit bietet dieser Kreislauf dann den Vorwand, sie zu schließen. Gut geführte Bibliotheken sind voller Menschen, weil das, was eine gute Bibliothek zu bieten hat, sich anderswo nicht so ohne weiteres finden lässt: ein geschlossener und doch öffentlicher Raum, in dem man kein Geld ausgeben muss, um bleiben zu dürfen.
Der moderne Staat hält nur sehr wenige Orte bereit, an denen das möglich ist. Die einzigen anderen, die mir spontan einfallen, stellen den Glauben an einen allmächtigen Schöpfer als Bedingung für eine Mitgliedschaft. Man sollte meinen, dass es kaum offensichtlicher sein könnte, warum der freie Markt keine effiziente Lösung für Bibliotheken ist: Der freie Markt braucht keine Bibliotheken. Aber anscheinend müssen wir heutzutage auch auf das Offensichtliche immer wieder hinweisen. Es gibt nicht mehr viele Einrichtungen, auf die John Maynard Keynes’ Definition von Dingen, die einzig und allein der Staat noch zu übernehmen bereit ist, so genau zuträfe. Und das Bibliothekserlebnis lässt sich auch nicht online reproduzieren. Es geht nicht nur um Bücher, die man kostenlos lesen kann. Eine Bibliothek ist eine andere Form sozialer Realität (in ihrer dreidimensionalen Variante), sie vermittelt durch ihre bloße Existenz ein Wertesystem, das über das Finanzielle hinausreicht.
Ich glaube gar nicht, dass Argumente zugunsten einer Bibliothek sonderlich ideologisch oder ethisch sind. Ich würde ja sogar denen zustimmen, die sagen, sie seien nicht einmal sonderlich logisch. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das eine emotionale Frage. Keine von Logos oder Ethos, sondern eine von Pathos. Das soll keine Abwertung sein: Auch Emotionen haben ihren Platz in der politischen Öffentlichkeit. Wir sind Menschen, keine Roboter. Die Leute, die gegen die Schließung der Kensal Rise Library protestiert haben, lieben diese Bibliothek. Sie wären jedem Lösungsvorschlag von links oder rechts gegenüber aufgeschlossen gewesen, wenn das bedeutet hätte, dass die Bibliothek erhalten bleibt. Sie waren – von wegen Big Society – sogar jederzeit bereit, sich dafür zivilgesellschaftlich zu engagieren. Eine Bibliothek zählt zu den gesellschaftlichen Gütern, die Menschen mit ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung etwas bedeuten. Die Freunde und Förderer der Kensal Rise und der Willesden Library und ähnlicher Einrichtungen im ganzen Land sagen doch im Grunde nur eines: Diese Orte sind uns wichtig. Wir verstehen ja, dass das Geld knapp ist, wir begreifen, dass es eine Bedürfnishierarchie gibt und dass der Französische Markt und eine Erinnerungsplakette an Mark Twain nicht mit Krankenhausbetten und größeren Klassenzimmern gleichzusetzen sind. Trotzdem sind sie aber ein bedeutender Teil unserer gesellschaftlichen Realität, die letzte Bastion an der Hauptstraße, die uns nicht entweder das Geld oder die Seele abknöpfen will.
Wenn die Verluste privater Firmen schon unbedingt auf die bereits schwer belasteten Kommunen umgelegt werden sollen, ist es doch wohl das Mindeste, den Menschen zuzuhören, die uns mitteilen wollen, wo in der Bedürfnishierarchie Dinge wie öffentlicher Raum, Zugang zu Kultur und Erhalt des gewohnten Umfelds aus ihrer Sicht angesiedelt sind. »Aber ich geh da doch nie hin!«, schreibt Mr Nicht-mit-meinen-Steuergeldern auf der Leserbriefseite. Das glaube ich Ihnen gern, Sir. Aber trotzdem. Im vergangenen Jahr konnten britische Bibliotheken insgesamt mehr als dreihundert Millionen Besucher verzeichnen, und das trotz der ganz alltäglichen Vernachlässigung, die sie durch die diversen zuständigen Behörden erfahren. Im Nordwesten Londons sind die Leute sogar bereit, eine Menschenkette vor ihrer Bibliothek zu bilden. Sie schreiben lange Zeitungsartikel zu ihrer »Verteidigung«. Und sie sagen alle dasselbe, immer und immer wieder. Rettet unsere Bibliotheken. Wir mögen unsere Bibliotheken. Können wir bitte unsere Bibliotheken behalten? Wir müssen dringend über die Bibliotheken reden. Sie betteln wie die Kinder. Ist es wirklich so weit mit uns gekommen?
Nachtrag: Kurz nachdem dieser Text in der New York Review of Books erschienen war, wurden Bibliothek und Buchhandlung abgerissen. Doch eine Wirkung hatte der gemeinschaftliche Aufstand der Aktivisten immerhin: Die Bibliothek, die an ihrer Stelle gebaut wurde, läuft tatsächlich gut. Es gibt zwar weniger Bücher dort, das stimmt, dafür beleben viele Studierende, Familien und Leserinnen und Leser die neonlichthellen Räume, und im zweiten Stock hat ein kleines, aber feines Ortsmuseum den Bauunternehmern mehrere hundert Quadratmeter ihrer Topimmobilie abgerungen.
Klagelied auf ein Land und seine Jahreszeiten
Was mit unserem Wetter geschieht, wird in der Sprache der Wissenschaft und der Sprache der Ideologie abgehandelt, es gibt aber so gut wie keine persönlicheren Äußerungen dazu. Wen wundert’s? Trauernde neigen zum Euphemismus, und denen, die sich schuldig fühlen oder schämen, geht es genauso. Und der wehmütigste all dieser Euphemismen ist »das neue Normal«. Das ist jetzt das neue Normal, denke ich, wenn ein geliebter Birnbaum halb ertrunken seinen Halt im Boden verliert und umstürzt. Die Bahnstrecke nach Cornwall wird weggeschwemmt: das neue Normal. Wir schaffen es nicht einmal mehr, das Wort »unnormal« voreinander laut auszusprechen: Es erinnert uns nur an das, was einmal war. Und man vergisst doch besser, was einmal normal war, wie die Jahreszeiten einmal aufeinanderfolgten, mit maßvoller Anmut, wie sie nur die Dichter zu schätzen wussten.
Es schmerzt, sich zu erinnern, wie es früher war. Wie wir den Stecken einer ungezündeten Silvesterrakete in den kalten, trockenen Boden rammten. Auf dem Weg zur Schule den Raureif auf den Ilexbeeren bewunderten. Am zweiten Weihnachtstag im grellen Winterlicht einen langen, belebenden Spaziergang machten. Mit knirschenden Schritten ganze Fußballfelder überquerten. Ein bisschen Sonne am Karnevalsdienstag; ein bisschen mehr zum Grand National Anfang April. Kühle Aprilschauer, Wärme zu Wimbledon. Juli-Hochzeiten, die auf schönes Wetter zählen konnten. Die reelle Chance, sich beim Glastonbury Festival einen Sonnenbrand zu holen. Wenigstens, versichern wir uns gegenseitig, wenigstens im August ist es noch verlässlich heiß – in Cornwall, wenn auch nicht beim Notting Hill Carnival. Und es ist doch auch schön für die Schotten, dass sie ein etwas wärmeres Klima mitnehmen können, wenn sie sich demnächst aus dem Staub machen wollen.
Vielleicht werden wir uns ja an dieses neue England gewöhnen und es – so wie die sehr Jungen und die frisch Zugezogenen – für selbstverständlich halten, dass im April die Zeit für Shorts und Sandalen gekommen ist und das Neue Jahr sich traditionell mit einer Sintflut ankündigt. Es heißt, es werde an ganz neuen Orten Schmetterlinge geben, und die Zugvögel würden früher eintreffen und später fortziehen – das könnte doch auch ganz spannend werden, neu und nicht zwingend schlechter. Womöglich haben wir die Vergangenheit ja ganz falsch in Erinnerung! Die Themse war schon seit Generationen nicht mehr zugefroren, und der Traum von der weißen Weihnacht ist nur eine kollektive Dickens-induzierte Wahnvorstellung. Und war es nicht immer schon feucht in diesem Land?
Erstaunlich, durch was für Schotterpisten man sich zwängt, um die vierspurige Schnellstraße direkt vor der Nase zu vermeiden. Es war nie so feucht in England, wie es die bekanntesten Romane behaupten oder unsere amerikanischen Verwandten es glauben. Das Klima hat sich verändert, es verändert sich immer weiter, und mit ihm gehen – neben Bahnstrecken und Häusern, Lebensgrundlagen und sogar Menschenleben – so viele scheinbar unbedeutende Dinge verloren. Nichts war beispielsweise leichter, als davon auszugehen, dass wir in irgendeiner Ecke eines Londoner Gartens immer einen Igel finden würden, den wir mit beiden Händen vorsichtig aufheben und für unsere Kinder auseinanderrollen konnten, oder dass wir beim Picknick den dicken Hummeln dabei zusehen könnten, wie sie am Rand des offenen Marmeladenglases entlangkrochen. Jedes Land hat seine eigene Version solcher ortsgebundener Traurigkeit. (Und jedes Land hat auch seine eigenen Argumente, was die Kausalität betrifft. Autos oder Klimawandel? Klimawandel oder Mobilfunkmasten?) Die kleineren Verluste darf man nicht erwähnen, sie scheinen gar nicht erwähnenswert – zumindest nicht im Vergleich mit den apokalyptischen Visionen, die von Klimaforschern und Kinoregisseuren heraufbeschworen werden. Und dann sind da noch all die Leute, die glauben, es passiere doch eigentlich kaum etwas.
Trotz der vielen strengen Worte zu den kindlichen Reaktionen der Öffentlichkeit auf den bevorstehenden Ernstfall wundert mich auch diese Reaktion nicht weiter. Es fällt schwer, ständig die Apokalypse im Hinterkopf zu haben, vor allem wenn man morgens noch aus dem Bett kommen will. Und in der Darstellung fehlt eben immer der Aspekt, wie emotional viele unserer Reaktionen sind. Würde das berücksichtigt, dann wäre die ganze Debattenkultur eine andere. Wir können uns beispielsweise problemlos eine Welt ausmalen, in der die Leugner gar keine Leugner sind, sondern einfach nur knallharte Pragmatiker, Leute, die sagen: »Ich weiß sehr wohl, was da auf uns zukommt, aber meine Enkelkinder interessieren mich nicht; ich interessiere mich nur für mich, meine Aktionäre und die Konkurrenz in China.« Und es gibt tatsächlich einige, die das sagen, wenn auch längst nicht so viele, wie man realistischerweise erwarten könnte.
Eine andere, ebenso natürlich scheinende Reaktion wäre die, ein Gefühl tiefer Religiosität auf die Sorge um die Umwelt zu projizieren, denn diejenigen, die das Land als seliges Geschenk des Herrn betrachten, sollten, rational betrachtet, doch unter den Ersten sein, die es schützen wollen. Auch davon gibt es durchaus einige, aber wiederum nicht einmal halb so viele, wie ich vermutet hätte. Stattdessen soll man die Belege »glauben« oder »leugnen«, als wären wissenschaftliche Abhandlungen nichts weiter als ein paar ans Tor genagelte Luther’sche Thesen. In den USA hat sich sogar ein eigentümliches Schlupfloch in Gottes Schöpfung gefunden, das sich die Hierarchie zunutze macht. Die Argumentation geht dahin, dass Gott den Menschen schließlich über die sogenannten »Dinge« gestellt hat – über die Tiere, die Pflanzen und das Meer – und wir diese Dinge daher guten Gewissens vor die Hunde gehen lassen können. (In England lässt sich die traditionell christliche Liebe zum Land dagegen sehr viel leichter ins Umweltbewusstsein überführen, vor allem unter den Adligen, denen so viel vom Land gehört.)
Trotzdem glaube ich nicht, dass wir wissenschaftliche Themen aus bloßer Dummheit zu Glaubensfragen machen. Glaube hat immer auch einen emotionalen Anteil, er ist verkapptes Verlangen. Sicher, bei unseren Regierungen lässt sich die Politisierung der Problematik größtenteils mit Zynismus und böser Absicht sowie wirtschaftlichen Motiven erklären, doch hier unten bei uns ist das Verlangen nach Unschuld die treibende Kraft. Denn beide sogenannten »Seiten« sind voller Schuldgefühle, voller Selbsthass – Martin Amis hat das einmal als »Speziesscham« bezeichnet –, und das projizieren wir nach außen. Es befeuert den kleinlichen Eifer unserer Debatten, selbst noch mitten in der Krise.
Als der Supersturm Sandy tobte, stieg ich, ziemlich schwanger, im Stockdunkeln fünfzehn Stockwerke hinunter, nur um ein WLAN-Signal zu finden und einem Klimawandelleugner aus meinem Bekanntenkreis eine Mail zu diesem neuesten Beleg seiner Blödheit zu schicken. Und oft reicht schon ein Polarwirbel, damit mein Posteingang von hämischen Gegenerzählungen der konservativeren Verwandtschaft überquillt – als wäre das alles nur ein Spiel, als ginge es letztlich nur um die Frage, wer jetzt »alarmistisch« oder »realistisch« ist, man selbst oder der verrückte Onkel aus Florida. Währenddessen fallen auf Jamaika, wo Sandy zuerst auf Festland traf, die stetig zunehmenden tropischen Tiefdruckgebiete, die Unwetter, Wirbelstürme, Dürren und Erdrutsche längst nicht mehr in die Kategorie ontologischer Argumente, zumindest nicht für die Jamaikaner.
Singt ein Klagelied auf die Fortgespülten! Auf die Lebenszyklen, die Salzwiesen, die Häuser, die Menschen – ganze Inseln voller Menschen. Schluss, aus, vorbei! Aber noch nicht gleich. Die Apokalypse liegt immer noch günstig in der Zukunft – wenn man nicht gerade auf Mauritius lebt oder auf Jamaika oder an einem der vielen anderen gefährdeten Orte. Jüngsten Berichten zufolge könnte es, wenn der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen weiter »konstant« bleibt, etwa um 2050 richtig ernst werden, gerade rechtzeitig zum siebten Geburtstag meiner Enkelin. (Künftige Enkelkinder werden in Klageliedern wie diesem häufig heraufbeschworen.) Manchmal ist das weltumspannend Gebetsmühlenartige solcher Klagen so erschöpfend und traurig – und so abgetrennt von jeglichem Versuch sinnvoller Maßnahmen –, dass man nicht umhinkann, bei den Klagesingenden ein fatalistisch-liberales Bewusstsein wahrzunehmen, das, wenn man ihm auf den Zahn fühlt, ein mindestens ebenso verdrehtes Verlangen nach der Apokalypse hegt, wie es die religiösen Fundamentalisten tun, die wir angeblich so verachten.
Neuerdings lässt sich beobachten, wie beide Seiten ein wenig die Ohren spitzen, um den optimistischen Argumenten der Technokraten zu lauschen. Durch irgendeinen Taschenspielertrick bewegen wir uns aktuell weg von Gesprächen über Kampf und Aufhalten, hin zu Diskussionen über CO2-Abscheidung und -Speicherung, über höhere Dämme, Generatoren auf Dächern und darüber, ganz allgemein die Schotten dicht zu machen. Beide Seiten treffen sich im Scheitern. Sie sagen zueinander: »Ja, vielleicht hätten wir vor einiger Zeit anders streiten sollen, aber jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.«
Das alles wird meiner siebenjährigen Enkelin mit Sicherheit reichlich merkwürdig vorkommen. Ich rechne nicht damit, dass sie mir verzeihen wird, aber es wäre sicher ganz sinnvoll, wenn sie Einblick in diese Denkweise bekäme, und sei es nur zum besseren Verständnis. Was werde ich ihr also sagen? In der Schule wird sie bereits gehört haben, dass das, was 2014 mit dem Wetter geschah, eine unbequeme Wahrheit darstellte, finanziell wie politisch – aber das kann ja selbst jetzt schon jeder sehen. Eine weltweite Protestbewegung könnte es am Ende vielleicht doch noch auf die politische Agenda gesetzt haben, ungeachtet aller Kosten. Aber meine Enkelin wird sicher wissen wollen, warum sich diese Bewegung erst so spät formiert hat. Da könnte ich ihr vielleicht sagen: Sieh mal, du musst auch bedenken, dass wir gerade ein ganzes Jahrhundert des Relativismus und der Dekonstruktion hinter uns hatten, in dem uns vermittelt wurde, dass die allermeisten unserer bestgehegten Prinzipien entweder ungewiss oder einfach nur Wunschdenken sind, und in sehr vielen Lebensbereichen wurde längst von uns verlangt, uns damit abzufinden, dass nichts wirklich wesentlich ist und alles sich verändert – das hat uns wohl ein bisschen demoralisiert.
Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass unsere Lebensgrundlagen – all die Dinge, von denen wir glauben, sie seien unverrückbar da – nicht nur Diskussionsgegenstand für Physiker und Philosophen sind, sondern auf irrationale Weise auch in unser aller Köpfen fortbestehen, vom Verstand zwar allenfalls belächelt, von uns aber dennoch als dauerhafte Tatsache erlebt. Zu diesen Tatsachen gehörte auch das Klima. Wir konnten einfach nicht glauben, dass es sich ändern würde. Sprich: Wir wussten immer schon, dass wir dem Planeten erheblichen Schaden zufügen, doch selbst die Hochmütigsten unter uns konnten sich nicht vorstellen, dass wir jemals in der Lage wären, seinen Rhythmus und sein Wesen grundlegend zu verändern, so wie ein kleines Mädchen, das den ganzen Tag herumschreit und dabei doch nie damit rechnet, dass sein Vater irgendwann heulend auf dem Küchenboden zusammenbrechen könnte. Mal ehrlich, glauben Sie, dass meine (nicht ganz unanstrengende und durchaus kritische) künftige Enkelin mich damit vom Haken lässt? Ich habe Bedenken.
Oh, was haben wir nur getan! Ein Ausruf wie aus der Bibel, und offenbar sind wir nicht fähig, uns aus seinem vertrauten – und letztlich religiösen – Kreislauf aus Scham, Leugnung und Selbstgeißelung zu befreien. Und deshalb (werde ich meiner Enkelin sagen) haben die ganzen Weltuntergangsszenarien auch nichts genützt – die schreckliche Wahrheit ist nämlich, dass der Weltuntergang einen tief sitzenden, historischen Reiz auf uns ausübt. Am Ende konnte nur eins noch die nötige Schubkraft in unseren Köpfen auslösen: der persönliche Verlust der Dinge, die wir geliebt haben. Als sich beispielsweise die Jahreszeiten auf unserer geliebten kleinen Insel veränderten, als im fünfzehnten Stock das Licht ausging. Oder als ich einmal Anfang Juli in einen Garten in Italien trat, zusammen mit seiner Besitzerin, einer Frau über achtzig. Da sah ich die gelb verbrannte Erde und die verdorrten Rosen, ich hörte das Eingeständnis, zu dem sich nur die sehr Betagten durchringen können – mein ganzes Leben lang habe ich so etwas noch nicht gesehen –, und ich merkte, wie mein Kopf doch noch anfing, das klagende Was haben wir getan? in ein pragmatisches Was können wir tun? zu verwandeln.
Zäune: Ein Brexit-Tagebuch
Nach längerer Abwesenheit zurück in der alten Gegend im Nordwesten Londons kam ich an der örtlichen Grundschule vorbei und bemerkte eine Veränderung. Viele meiner ältesten Freundinnen und Freunde waren hier zur Schule gegangen, und vor einiger Zeit – als uns ein Krankheitsfall in der Familie für ein Jahr nach England zurückholte – hatte ich auch meine Tochter dort angemeldet. Das Schulhaus ist ein ausgesprochen schöner viktorianischer Backsteinbau und wurde lange Zeit unter »special measures« geführt, ein Urteil der Schulaufsichtsbehörde Ofsted und die niedrigste Bewertung, die eine staatliche Schule bekommen kann. Naturgemäß geraten viele Eltern in Panik, wenn sie ein solches Urteil lesen, und nehmen ihre Kinder von der Schule; andere hingegen, die mit eigenen Augen sehen, was die Ofsted – deren Urteil hauptsächlich auf Daten beruht – nach menschlichem Ermessen nicht erkennen kann, zweifeln an der Weitsicht der Bewertung und bleiben. Und wieder andere können vielleicht gar kein Englisch lesen oder haben kein Internet zu Hause, oder sie haben noch nie von der Ofsted gehört und kämen folglich nicht auf die Idee, zwanghaft auf deren Website zu schauen.
In meinem Fall kam mir die Ortsgeschichte zugute: Mein Bruder hat an dieser Schule jahrelang die Nachmittagsbetreuung für Einwandererkinder geleitet, und ich wusste genau, wie gut die Schule war, immer schon war, und wie herzlich sie ihre bunt durchmischte Belegschaft begrüßte, die vielfach noch gar nicht lang im Land war. Jetzt, ein Jahr später, hat die Ofsted die Schule offiziell als »gut« eingestuft, und wie ich die Gegend kenne, dürfte das wohl bedeuten, dass viele mittelständische und in aller Regel weiße Eltern das von ihnen empfundene »Risiko« eingehen, in den Einzugsbereich der Schule ziehen und ihre Kinder dorthin schicken werden.
Falls dieser Prozess auch nur ansatzweise so abläuft wie in New York, wird die weiße Mittelstandsbevölkerung, im Einklang mit einer generellen Gentrifizierung der Gegend, immer mehr zunehmen, und die Grenzen des sogenannten »Einzugsbereichs« der Schule werden immer enger werden, bis sie irgendwann, nach etlichen Jahren, nahezu homogen sein wird, mit ein paar multikulturellen Einsprengseln. Das dürfte dann auch der Zeitpunkt sein, zu dem die Aufsichtsbehörde endlich ihre Bestnote vergibt. Bisher ist in der alten Gegend aber nichts dergleichen passiert, und angesichts der langen, stolzen Geschichte jeder denkbaren Form von Multikulturalität, auf die sie zurückblickt, passiert es vielleicht auch nie, und im Übrigen war das auch gar nicht die Veränderung, die mir im Vorbeigehen auffiel.
Meine ganz persönliche Ausprägung liberaler Paranoia konzentrierte sich zu diesem Zeitpunkt nämlich auf etwas anderes: Ich bemerkte den Zaun. Denn die viktorianische Schule, der es über hundert Jahre hinweg vollkommen genügt hat, ihr Territorium mit einer niedrigen gusseisernen Brüstung zu markieren, hatte zwischen den einzelnen Pfeilern jetzt hohe Latten aus Bambusholz angebracht sowie eine Begrünung, die an diesen Latten fast zwei Meter hinaufrankte und den Blick von der Straße auf den Schulhof und damit auch auf die dort spielenden Kinder versperrte. Ich ging nach Hause und schrieb eine unbeherrschte Mail an zwei Vertreter des Elternbeirats:
Gerade bin ich zum ersten Mal seit meiner Rückkehr (gestern) an der Schule vorbeigekommen und habe diese hölzerne Verschleierung bemerkt – ein besseres Wort will mir nicht einfallen –, die rings um das Schulgelände hochgezogen wurde. Das hat mich furchtbar traurig gemacht. Ich wohne jetzt seit vierzig Jahren hier in der Gegend. Ich habe zugesehen, wie vor zehn Jahren eine Mauer vor der jüdischen Schule errichtet wurde und dann vor ein paar Jahren eine vor der muslimischen. Aber ich hätte nie damit gerechnet, auch eine vor der – zu sehen. Ich würde wirklich zu gern wissen, wie es dazu gekommen ist, wer das beantragt hat, wie die Entscheidung gefallen ist, ob die Eltern alle damit einverstanden sind und was überhaupt die offizielle Funktion sein soll? »Sicherheit«? »Privatsphäre«? Oder etwas ganz anderes?
Eine unbeherrschte Mail voll liberaler Paranoia. Im Gegensatz dazu war die Antwort, die ich bekam, maßvoll und höflich. Als Gründe wurden »Privatsphäre und Luftverschmutzung« angegeben, wobei vor allem die Luftverschmutzung »gerade ein ganz großes Ding« sei, das von der Bezirksverwaltung als Problem an die Schule herangetragen worden war. Außerdem sei der Schulhof viel zu betonlastig, die Pflanzen machten den Anblick insgesamt weicher, und der Elternbeirat sei wahrhaftig nicht auf die Idee gekommen, dass diese Neukonstruktion auf Passanten in irgendeiner Form abschreckend oder seltsam wirken könnte. Ich las meine Mail noch einmal durch und schämte mich ein bisschen, sie abgeschickt zu haben. Was für eine Geisteshaltung hatte mich bloß dazu veranlasst, eine schlichte kosmetische Veränderung so negativ auszulegen?
Ich bin Veränderungen gewohnt: Sie sind hier die Regel. Die einstige Grammar School oben auf dem Hügel ist jetzt eine der größten muslimischen Schulen Europas, die alte Synagoge ist zur Moschee geworden, die alte Kirche zum privaten Wohnhaus. Die Einwanderungs- und Gentrifzierungswellen schwappen mit der Regelmäßigkeit von Linienbussen durch die Straßen. Doch diese örtliche Schule war für mich wohl so etwas wie ein Symbol. Und wenn wir in letzter Zeit eines über Großbritannien gelernt haben, dann doch, dass wir Briten uns mitunter sehr eigenartig verhalten, wenn wir zulassen, dass Realien zu Symbolen werden.
Mir hat diese kleine Schule besonders und symbolhaft als bunt gemischte Institution etwas bedeutet, in der die Kinder vergleichsweise Reicher und Armer, die Kinder von Muslimen, Juden, Hindus, Sikhs, Protestanten, Katholiken, Atheisten, Marxisten und Menschen mit religiösen Gefühlen für Pilates allesamt gemeinsam im selben Klassenzimmer unterrichtet werden, auf demselben Schulhof zusammen spielen, sich miteinander über ihren Glauben – oder den Mangel daran – austauschen, während ich draußen vorbeigehen, häufig hineinschauen und auf diese Weise immer wieder die wesentliche, symbolische Bestätigung bekommen konnte, dass die Welt meiner Kindheit noch nicht vollständig verschwunden ist. Die jüdische Schule sieht inzwischen aus wie Fort Knox. Die muslimische Schule ist auf dem besten Weg dorthin. Würde auch unsere kleine Schule jetzt zu einem Ort mit einem Zaun werden, sich abgetrennt, privatisiert, paranoid, sicherheitsbesessen von der größeren Gemeinschaft abwenden?
Zwei Tage später stimmten die Briten für den Brexit. Ich war gerade in Nordirland bei meinen Schwiegereltern, zwei reizenden, sanft konservativen nordirischen Protestanten, mit denen ich zum ersten Mal in unserer gemeinsamen Geschichte in einer politischen Frage einer Meinung war. Den gleichen Schockmoment wie vor dem Schultor erlebte ich jetzt vor ihrem riesigen Fernseher, während wir gemeinsam zusahen, wie England sich vom Rest Europas abschottete, fast ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was das für die schottische und irische Verwandtschaft im Norden und Westen bedeuten würde.
Seither wurde viel über das entsetzlich unverantwortliche Verhalten sowohl von David Cameron als auch von Boris Johnson geschrieben, aber ich glaube gar nicht, dass ich persönlich mich so umfassend auf Boris und Dave eingeschossen hätte, wenn ich an diesem Tag in meinem eigenen Bett in London aufgewacht wäre. Nein, dann wären meine ersten Überlegungen grundsätzlich hermeneutischer Natur gewesen. Was hat diese Wahl zu bedeuten? Worum ging es wirklich dabei? Um Einwanderung? Ungleichheit? Historisch motivierte Fremdenfeindlichkeit? Souveränität? Europäische Bürokratie? Einen anti-neoliberalen Aufstand? Einen Klassenkampf?
In Nordirland allerdings war klar, dass es vor allem um eins explizit nicht gegangen war, nicht einmal im Ansatz, und zwar um Nordirland, und das wiederum führte zu einer Fixierung auf den beispiellos solipsistischen Akt, der dieses vielgeschundene kleine Land sehenden Auges zum Kollateralschaden einer Spaltung innerhalb des konservativen Lagers macht. Und Schottland! Es ist kaum zu fassen. Dass zwei angeblich gebildete Männer, die aller Vermutung nach die britische Geschichte gut kennen müssten, derart leichtfertig – und nur zur Befriedigung des eigenen professionellen Ehrgeizes – einen hart erkämpften, dreihundertjährigen Bund aufs Spiel setzten, das erschien mir an diesem Morgen ein noch viel größeres Verbrechen als die Aufkündigung des jahrzehntealten europäischen Pakts, der das alles ausgelöst hatte.
»Konservativ« ist für keinen von beiden mehr die richtige Bezeichnung: Das Wort enthält zumindest einen Anklang von Sorgfalt und der Bewahrung eines Erbes. »Brandstifter« erscheint da schon passender. Michael Gove und Nigel Farage hingegen sind die wahren rechten Ideologen mit ganz klaren Absichten, auf die sie bereits seit vielen Jahren hinarbeiten. Ersterer hatte vor allem das trojanische Pferd der »Souveränität« im Visier, ein hohles Symbol, aus dessen Bauch angeblich ein ungehindert deregulierter Finanzsektor entspringen sollte. Zweiterer, am 4. Juli 2016 zurückgetreten, schien von einer waschechten Rassenobsession ergriffen, die mit dem festen Entschluss einherging, Großbritannien nicht nur hinsichtlich der Frage der Freizügigkeit, sondern auch eines ganzen weiteren Themenspektrums, vom Klimawandel über Waffengesetze bis hin zur Rückführung von Einwanderern, vom europäischen Konsens abzuschotten.[1]
Ein Referendum verstärkt die schlimmsten Seiten eines ohnehin unvollkommenen Systems – der Demokratie –, indem es eine überwältigend breite Vielfalt von Themen durch einen äußerst schmalen Durchgang schleust. Es gibt sich den Anschein einer Intensivierung – die ultimative demokratische Entscheidung! Daumen hoch oder Daumen runter! –, erzielt in der Praxis aber nur eine gefährlich irreführende Reduktion. Selbst unter denen, die für »Leave« gestimmt haben, hatten viele am Ende den Eindruck, dass ihr Votum ihren Gefühlen nicht ganz entsprach. Sie hatten ihre Stimme aus einer Vielzahl von Motiven abgegeben, und das »Remain«-Lager war zu großen Teilen ähnlich zersplittert.
Manche Argumente gingen auf fast schon komische Weise an der binären Fragestellung vorbei. Eine Freundin, deren Mutter noch in unserer Gegend wohnt, berichtet von einem Gespräch am Gartenzaun zwischen ihrer Mutter und einer weiteren Nordlondoner Linken, die der Mutter meiner Freundin auseinandersetzte, sie habe für »Leave« gestimmt, um »endlich diesen grässlichen Gesundheitsminister loszuwerden«! Ach, wie so viele Angehörige unserer großartigen Nation sehne auch ich mich danach, endlich frei zu sein von diesem fast perfekt benamsten Jeremy Hunt (man müsste nur das H gegen ein C austauschen), aber ein Referendum erweist sich doch als wenig effizienter Hammer, um so vielen schiefen Nägeln zu Leibe zu rücken.
Der erste Eindruck vieler linker »Remain«-Wähler bestand darin, dass es eigentlich nur um die Einwanderung ging. Als dann die Zahlen kamen und die Statistiken nach Alter und sozialer Schicht aufgeschlüsselt wurden, zeichnete sich hingegen eine populistische Revolte der Arbeiterschicht ab, wenn auch eine von der Sorte, wie sie mittelständische Liberale, die ebenso sehr zur politischen Naivität wie zur sentimentalen Betrachtung der Arbeiterklasse neigen, immer sehr verblüfft. Den Tag über rief ich viel zu Hause an, schrieb Mails und versuchte, gemeinsam mit großen Teilen von London – zumindest des London, das ich kenne –, diesen gewaltigen Schock zu verarbeiten. »Was haben sie nur getan?«, fragten wir einander und meinten damit manchmal die Politiker, die, wie wir fanden, doch hätten wissen müssen, was sie da tun, und manchmal auch die Bevölkerung, die das, wie wir stillschweigend implizierten, nicht wusste.
Inzwischen bin ich versucht zu glauben, dass es genau umgekehrt war. Auf eine irgendwie unausgereifte Weise bestand das Ziel darin, etwas zu tun, egal was: Die auffälligste Eigenschaft des Neoliberalismus ist es doch, den Eindruck zu vermitteln, man könne nichts tun, um ihn zu ändern, während diese Wahl die rare Gelegenheit verhieß, einem System, das sonst immer alles niederwalzt, was sich ihm in den Weg stellt, einen Riss aus Chaos zuzufügen. Doch selbst diese optimistischste linke Deutung – dass es sich nur um eine heftige, mehr oder weniger durchdachte Reaktion auf vorangegangene Entbehrungen und den neoliberalen Wirtschafts-Crash handelt – kann den Alltagsrassismus nicht wegreden, der dabei offenbar als Nebenprodukt entfesselt wurde, sowohl im Wahlkampf als auch durch das Wahlergebnis.
Den vielen diesbezüglichen Anekdoten möchte ich zwei hinzufügen, die von meiner auf Jamaika geborenen Mutter stammen. Eine Woche vor der Abstimmung kam in Willesden ein Skinhead auf sie zugerannt und brüllte ihr »Deutschland über alles!«[2] ins Gesicht, wie ein Echo aus den späten siebziger Jahren. Am Tag nach der Abstimmung trat in einem Geschäft für Bettwäsche und Handtücher an der Kilburn High Road eine Dame zu meiner Mutter und dem halben Dutzend weiterer Leute anderer Herkunft und sagte etwas unbestimmt in die Runde: »Na, ihr müsst dann ja jetzt auch alle zurück nach Hause!«
Was hast du bloß getan, Boris? Was hast du bloß getan, Dave? Und doch enthält die Fabel von unseren solipsistischen Anführern, die gedankenlos Feuer an die Lunte legen, auch die weit weniger angenehme Geschichte unseres eigenen London-zentrischen Solipsismus, der mir gleichermaßen real erscheint und eine andere Form von Verschleierung darstellt, womöglich sogar ebenso undurchsichtig wie der grelle persönliche Ehrgeiz eines Mannes wie Boris. Mein tief sitzender Schock angesichts des Ergebnisses – den so viele andere Londoner ebenfalls erlebt haben – legt doch zumindest nahe, dass wir offenbar selbst hinter einem Schleier gelebt und unser Land nicht als das erkannt haben, was es geworden ist.
Am Abend vor meinem Aufbruch nach Nordirland saß ich mit alten Freunden, Nordlondoner Intellektuellen von genau der Sorte, auf die der Labour-Abgeordnete Andy Burnham symbolisch verwies, als er sagte, die Labour-Partei habe so viel Terrain an die UKIP verloren, weil sie »zu viel Hampstead und zu wenig Hull« enthalte (wobei wir Hampstead in Wahrheit natürlich längst an die vermögenderen Banker und russischen Oligarchen verloren haben), beim Abendessen. Wir bedachten den Brexit. Wahrscheinlich ging es allen anderen Abendgesellschaften in London genauso. Doch wie sich herausstellen sollte, hatten wir ihn wohl nicht gründlich genug bedacht, denn niemand von uns glaubte auch nur eine Sekunde daran, dass er womöglich eintreten könnte. Wie sollte er auch? Er war doch so offensichtlich falsch, und wir hatten so offensichtlich recht.
Nachdem wir diese Frage geklärt hatten, gingen wir dazu über, die eigentümliche Neigung der Generation jüngerer Linker zu beklagen, jede Äußerung oder Meinung, die sie in irgendeiner Form für falsch hielten, zu zensieren oder zum Schweigen zu bringen: durch Plattformentzug, geschützte Räume und dergleichen mehr. Auch damit hatten wir alle recht. Dann aber ließ sich aus der Sofaecke die Klügste von uns allen vernehmen, die gerade ihr neugeborenes Baby stillte; sie wartete, bis wir zu Ende schwadroniert hatten, dann sagte sie: »Na ja, die Angewohnheit haben sie wohl von uns übernommen. Wir wollten doch auch immer als die wahrgenommen werden, die recht haben. Die auf der richtigen Seite der Diskussion stehen. Das war noch wichtiger als konkretes Handeln. Recht haben war immer schon das Allerwichtigste.«
In den Tagen nach dem Wahlergebnis habe ich viel an diese Erkenntnis gedacht. Immer wieder las ich Artikel stolzer Londoner, die stolz von ihrer multikulturellen, aufgeschlossenen Stadt berichteten, so ganz anders als diese engstirnigen, fremdenfeindlichen Orte im Norden. Es klang richtig, und ich wollte, dass es stimmte, doch was ich mit eigenen Augen beobachtete, bot mir eine Gegenerzählung. Denn die Menschen, die in dieser Stadt ein wahrhaft multikulturelles Leben führen, sind die, deren Kinder in einer durchmischten Umgebung heranwachsen, die selbst in einer wirklich durchmischten Umgebung leben, in Sozialsiedlungen also oder in der Handvoll historisch durchmischter Viertel, von denen es längst nicht mehr so viele gibt, wie wir gern glauben möchten.
Für viele Menschen in London repräsentiert sich der angeblich so multikulturelle und klassenübergreifende Aspekt ihres Lebens aktuell vor allem in ihren Angestellten – den Kinderfrauen, dem Putzpersonal, denjenigen, die ihnen Kaffee ausschenken oder sie im Taxi fahren – und allenfalls noch in der Handvoll nigerianischer Adliger, auf die man in den Privatschulen trifft. Die schmerzhafte Wahrheit lautet, dass auch überall in London Zäune hochgezogen werden. Um Schulbezirke, um ganze Viertel, um einzelne Leben. Eine nützliche Folge hat der Brexit zumindest: Er fördert den tiefen Riss durch die britische Gesellschaft, der bereits seit dreißig Jahren im Entstehen ist, endlich ganz offen zutage. Die Gräben zwischen Norden und Süden, zwischen den sozialen Schichten, zwischen den Bewohnern von London und allen anderen, zwischen reichen und armen Bewohnern von London und zwischen Weiß und Braun und Schwarz sind real, und wir müssen uns ihnen alle stellen, nicht nur diejenigen von uns, die für »Leave« gestimmt haben.
Inmitten all der hysterischen Darstellungen ebenjener Leavers unmittelbar nach der Abstimmung – darunter nicht zuletzt auch meine eigene – hielt ich inne und dachte an die junge Frau, die mir in dem Jahr, das meine Tochter in der damals mit »special measures« bewerteten Schule verbracht hatte, oft am Schulhof aufgefallen war. Sie war ebenfalls Mutter, so wie wir alle, wenn auch mindestens fünfzehn Jahre jünger. Nachdem ich auf der Straße, die den Hang hinauf zu meinem Haus führte, ein paarmal hinter ihr gegangen war, wurde mir klar, dass sie in demselben Sozialwohnungsblock leben musste, in dem ich aufgewachsen war. Sie war mir überhaupt nur deswegen aufgefallen, weil meine Tochter ihren Sohn heiß und innig liebte. Eine Verabredung zum Spielen wäre der naheliegende nächste Schritt gewesen.
Aber ich ging diesen Schritt nie, und sie ging ihn auch nicht. Ich wusste nicht, wie ich die Angst und Abscheu überwinden sollte, die sie mir nach meinem Gefühl entgegenbrachte, gar nicht, weil ich schwarz war – ich sah sie häufig ganz fröhlich mit anderen schwarzen Müttern plaudern –, sondern weil ich zur Mittelschicht gehörte. Sie hatte mich ja genauso die glänzend schwarze Tür des Hauses gegenüber der Sozialsiedlung aufschließen sehen, wie ich sie jeden Tag ins Treppenhaus ihres Wohnblocks treten sah. Ich konnte mich noch gut an ähnlich aufgeladene Episoden aus meiner Kindheit erinnern, als es umgekehrt gewesen war. Konnte ich das Mädchen aus dem schönen, großen Haus am Park in unsere beengte Sozialwohnung einladen? Und konnte ich später, nachdem wir in eine richtig schöne Wohnung im richtigen Teil von Willesden umgezogen waren, noch meine Freundin in ihrem verranzten Zuhause im falschen Teil von Kilburn besuchen?
Die Antwort lautete in aller Regel »Ja«. Nicht ohne Spannungen, nicht ohne gelegentliche hochnotpeinliche Gesellschaftskomödien-Momente oder Einblicke in häusliche Zustände, die an eine Tragödie grenzten – aber trotzdem: »Ja«. Damals waren wir alle noch bereit, das »Risiko« einzugehen, falls »Risiko« überhaupt das richtige Wort dafür ist, ins Leben der anderen einzutreten, nicht einfach nur symbolisch, sondern ganz real. In diesem neuen England schien es zumindest mir aber unmöglich. Und ich glaube, ihr auch. Der Graben zwischen uns war zu groß geworden.
Das hohe, schmale viktorianische Haus, das ich vor fünfzehn Jahren gekauft habe, ist zwar noch genau die Art Haus, die meine Mittelschichtsfreundinnen in meiner Jugend bewohnt haben, sein Wert beläuft sich aber inzwischen auf eine obszön hohe Summe, und ich war in Sorge, sie könnte glauben, ich hätte diese obszön hohe Summe tatsächlich auch dafür bezahlt. Die Entfernung zwischen ihrer Wohnung und meinem Haus – in der Realität höchstens zweihundert Meter – ist symbolisch sehr viel weiter als früher. Und irgendwo über dieser Kluft lag die potenzielle Verabredung zum Spielen und kam nie zustande, weil ich nie danach zu fragen wagte.
Extreme Ungleichheit spaltet Gemeinschaften, und nach einer Weile klaffen die Spalte so breit, dass das ganze Gebäude einstürzt. Ein Prozess, bei dem es schon seit geraumer Zeit nur Verlierer gibt, wenn auch womöglich keinen größeren als die weiße Arbeiterschicht, die buchstäblich nichts mehr hat, nicht einmal die vermeintliche moralische Überlegenheit, die sich aus einem zugestandenen Trauma oder einem anerkannten Opferstatus ergibt. Die Linke schämt sich fürchterlich für sie. Die Rechte sieht sie als nützliches Werkzeug, um ihre eigenen Ambitionen zu fördern. Die unbequeme Arbeiterrevolte, die wir jetzt erleben, wurde bereits der Dummheit bezichtigt – ich selbst habe am Tag, als es passierte, so darauf geschimpft –, doch je länger man sie betrachtet, desto mehr stellt man fest, dass sie in anderer Hinsicht ans Geniale grenzt, denn sie hat die Schwäche ihrer Feinde erspürt und sie effizient ausgenutzt. Die Mittelschichts-Linke hat doch solchen Spaß daran, recht zu haben! Und so viele der entrechteten Arbeiter haben sich entschieden, offen und schamlos falsch zu handeln.
In Großbritannien hat es Tradition, die Armen lächerlich zu machen, weil sie sich »selbst eins reinwürgen«, weil sie »gegen die eigenen Interessen stimmen«. Doch die neoliberale Mittel- und obere Mittelschicht hat sich in ihren goldenen Londoner Käfigen genauso selbst eins reingewürgt. Falls Sie das für übertrieben halten, gehen Sie doch einfach mal nach Notting Hill und schauen sich die Wagen der privaten Sicherheitsfirmen an, die im Auftrag der Anwohner langsam in den Straßen Patrouille fahren, vorbei an all den Zwanzig-Millionen-Pfund-Wohnhäusern, vielleicht aus Furcht vor den letzten Bewohnern der Sozialsiedlung, die sich auf der anderen Seite der Portobello Road noch halten. Oder gehen Sie ins Savoy und werfen Sie einen Blick auf die Karte mit den Jahrgangscocktails, von denen der billigste für hundert Pfund angeboten wird (der hochpreisigste ist der sogenannte Sazerac – angeblich der teuerste Cocktail der Welt –, der mit fünftausend Pfund veranschlagt wird). Seltsame Zeiten.
Selbstverständlich ist auch diese Cocktailkarte nur ein weiteres unsinniges Symbol, aber sie entspricht ihrer Zeit und ihrem Ort. Seit einer Weile herrscht in London jetzt schon eine Art Geldwahn, und uns, die wir zuschauen, fällt es schwer, in solchen Symbolen irgendwelche Anzeichen für ein schönes, harmonisches oder gar glückliches Leben zu finden (welcher glückliche Mensch muss sich denn mit einem fünftausend Pfund teuren Cocktail zeigen?), wobei man sich, wenn man so reich ist, zumindest bequem einreden kann, man sei glücklich, unter Zuhilfenahme dessen, was die alten Nordlondoner Marxisten immer als »falsches Bewusstsein« bezeichnet haben. Zur Beschreibung der ökonomisch und sozial Entrechteten des Landes taugt dieser verstaubte Allgemeinplatz allerdings nicht mehr: Sie mühen sich ab, sind zutiefst unglücklich und wissen das auch.
Ich glaube, wenn man die wahrhaft ideologisch Gläubigen der Rechten und die hochfliegenden Linken, die die EU als Instrument des weltweiten Kapitalismus ablehnen, einmal beiseitelässt, hat die Mehrheit derer, die für »Leave« gestimmt haben, das aus Wut, Verletztheit und Enttäuschung getan, befördert durch eine jahrelange bewusste Manipulation gewisser niederer Gefühle und Instinkte durch Politik und Presse. So schmerzhaft es auch ist, das zu schreiben – wenn Google in den Stunden nach der Abstimmung große Zahlen britischer Staatsbürger verzeichnet, die »Was ist die EU?« als Suchanfrage eingeben, lässt sich wirklich schwer bestreiten, dass ein erheblicher Anteil unseres Volkes seine demokratischen Pflichten am 23. Juni 2016 schmählich vernachlässigt hat.
Wie die Menschen auch wählen, wir müssen auf sie hören, trotzdem sollte Unverstand an der Wahlurne nicht noch gefeiert oder arglistig verteidigt werden. Jenseits allen Unverstands ist es auch schlichtweg falsch, sich vor einer ernsthaften Tat nicht ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was für Folgen sie für andere haben wird, in diesem Fall für ganze souveräne Staaten nördlich und westlich des eigenen, vom übrigen Europa ganz zu schweigen. Aber für mich bilden die Menschen, die für »Leave« gestimmt haben, mit ihren niederen Motiven ohnehin in keiner Hinsicht eine Ausnahme.