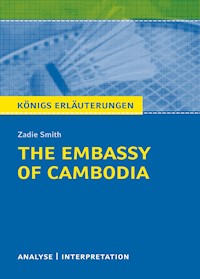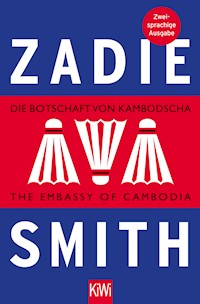9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Zadie Smith eröffnet literarische Räume, in denen wir uns selbst und unsere Welt besser begreifen können« Die Welt. Dieser erste Erzählungsband von Zadie Smith vereint neunzehn auch formal sehr unterschiedliche Storys, die sich um die Themen drehen, mit denen Zadie Smith zur Ikone der Literatur geworden ist: Frau-Mann, schwarz-weiß, Macht-Ohnmacht – und zunehmend auch Politik und das Älterwerden. Von Leserinnen und Lesern geliebt und von der Kritik hochgeschätzt ist Zadie Smith seit ihrem Debüt »Zähne zeigen« als Romanautorin und Verfasserin brillanter Essays eine der wichtigsten Autorinnen überhaupt. In dieser ersten Erzählungssammlung nutzt sie ihre außergewöhnliche Beobachtungsgabe und ihre unverwechselbare Stimme, um die Komplexität des modernen Lebens auszuloten. Dabei bewegt sie sich scheinbar mühelos zwischen den Genres: von der historischen Erzählung über die aktuelle Story bis hin zur Dystopie – »Grand Union« ist eine kluge literarische Bestandsaufnahme, welche Ereignisse der Vergangenheit unsere Identität bestimmen und bis in die Zukunft wirksam werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Ähnliche
Zadie Smith
Grand Union
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Zadie Smith
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Dialektik
Éducation sentimentale
Der Fluss der Faulheit
Worte und Musik
Gerade recht
Morgendliche Offenbarung für Eltern
Erzähler setzen bestimmte Techniken ein, zum Beispiel …
Erzähler arbeiten stets auf eines der folgenden Ziele hin:
Downtown
Miss Adele kauft ein Korsett
Stimmungslage
Zeit
Roberta
Schwarzmarkt
Auf der Suche nach dem Ich I
Stimmungslagen auf Tumblr
Absurd-moderne Stimmungslage
Mittelalterliche Stimmungslagen: Blut, schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim
Roberta und Preston (ein Zwiegespräch)
Alle Stimmungslagen gegen das Individuum
Stimmungserinnerung
Flucht aus New York
Wichtige Woche
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Besuch beim Präsidenten
Zwei Männer kommen ins Dorf
Kelsos Dekonstruktion
Blockade
Der Wurm
Für den König
Jetzt mehr denn je
Grand Union
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Für Maud
Inhaltsverzeichnis
»Wie kann irgendwer das nicht sein«
Frank O’Hara, »Yesterday Down at the Canal«
Inhaltsverzeichnis
Dialektik
»Ich hätte gern ein gutes Verhältnis zu allen Tieren«, sagte die Frau zu ihrer Tochter. Sie saßen am Strand von Sopot im groben Sand und schauten auf das kalte Meer. Der älteste Junge war in die Spielhalle gegangen. Die Zwillinge waren im Wasser.
»Hast du aber nicht!«, rief die Tochter. »Kein bisschen!«
Das stimmte. Die Aussage der Frau stimmte als Absicht, aber die Aussage des Mädchens stimmte auch, im wirklichen Leben. Obwohl die Frau im Allgemeinen auf Rind-, Schweine- und Lammfleisch verzichtete, aß sie doch – mit großem Genuss – viele andere Tiere, auch Fisch, hängte im Sommer Fliegenfänger in die stickige Küche ihrer kleinen Stadtwohnung und hatte einmal (wovon ihre Tochter allerdings nichts wusste) den Familienhund getreten. Die Frau war damals zum dritten Mal schwanger und leicht reizbar. Die Verantwortung für den Hund war ihr in dem Moment eins zu viel.
»Ich habe auch nicht gesagt, dass es so ist. Ich habe gesagt, ich hätte es gern.«
Die Tochter ließ ein grausames Lachen hören.
»Leeres Geschwätz«, sagte sie.
Tatsächlich hielt die Frau gerade einen halb abgenagten Hühnerflügel in der Hand, ungelenk hochgereckt, damit er keinen Sand abbekam, und die gut sichtbaren Knochen dieses Hühnerflügels sowie die dünne, grillgebräunte Haut, die sich darüber spannte und so gemartert aussah, hatten sie überhaupt erst auf das Thema gebracht.
»Ich find’s furchtbar hier«, sagte die Tochter entschieden. Mit bösen Blicken maß sie den Strandwächter, der sich gerade erneut veranlasst sah, in die trübe Brühe zu waten, um die einzigen Badegästen – die Brüder des Mädchens – zu ermahnen, nicht weiter rauszugehen als bis zu der roten Boje. Sie schwammen nicht – sie konnten gar nicht schwimmen. In der Stadt gab es kein Gewässer, in dem sie Unterricht hätten nehmen können, und die sieben Tage, die sie jedes Jahr in Sopot verbrachten, genügten nicht, um es zu lernen. Nein, sie sprangen einfach hinein in die Wellen und ließen sich von ihnen umwerfen, so unsicher auf den Beinen wie neugeborene Kälber und beide mit grauer Brust von dem seltsamen Schlick, der den Strand säumte, als hätte Gott mit dreckigem Daumen einen riesigen Rand darum gezogen.
»Ist doch total sinnfrei«, fuhr die Tochter fort, »an einem so dreckigen, unwirtlichen Meer ein Strandbad zu bauen.«
Ihre Mutter hielt den Mund. Sie war selbst schon mit ihrer eigenen Mutter nach Sopot gefahren, so wie diese vorher mit ihrer Mutter. Seit mindestens zweihundert Jahren kamen die Menschen hierher, um der Großstadt zu entfliehen und ihre Kinder frei auf den öffentlichen Plätzen toben zu lassen. Und der Schlick war selbstverständlich kein Dreck, er war ein Produkt der Natur, auch wenn der Frau bisher niemand genau erklärt hatte, um welche Art natürlicher Substanz es sich handelte. Sie wusste nur, dass es wichtig war, jeden Abend ihre komplette Badekleidung im Hotelwaschbecken auszuspülen.
Früher hatte die Tochter der Frau Spaß am Meer von Sopot gehabt und auch an allem anderen. An der Zuckerwatte und den schicken batteriebetriebenen Autonachbildungen – Ferrari und Mercedes –, die man kreuz und quer durch die Straßen steuern konnte. Wie allen Kindern, die nach Sopot kommen, hatte es ihr Spaß gemacht, ihre Schritte zu zählen, wenn sie auf der berühmten hölzernen Seebrücke übers Wasser ging. Aus Sicht der Frau war das Beste an einem solchen Seebad, dass man einfach alles genauso machen konnte wie die anderen, ohne nachzudenken, wie ein Rudel. Für eine vaterlose Familie, wie sie es jetzt waren, bot diese kollektive Seite die perfekte Tarnung. Hier gab es keine Einzelpersonen. Im Gegensatz zur Stadt, wo die Frau durchaus ein Individuum war, mit vier vaterlosen Kindern am Hals sogar ein Individuum der besonders glücklosen Sorte. Hier war sie nur eine Mutter unter vielen, die Zuckerwatte für ihren Nachwuchs kaufte. Ihre Kinder waren wie alle anderen Kinder, deren Gesichter hinter gewaltigen Wolken aus rosa Spinnzucker verschwanden. Aber dieses Jahr brachte die Tarnung nicht viel, soweit es ihre Tochter betraf. Die war nämlich praktisch im Begriff, selbst zur Frau zu werden, und hätte sie sich in eins der albernen Spielzeugautos gesetzt, hätten ihr die Knie bis zum Kinn gereicht. Da hatte sie doch lieber beschlossen, Sopot in seiner Gesamtheit widerlich zu finden und ihre Mutter und die Welt gleich mit.
»Es ist ein Ziel«, sagte die Mutter leise. »Ich würde gern einem Tier, jedem beliebigen Tier, in die Augen sehen können und dabei keinerlei Schuldgefühle haben.«
»Na, dann hat es aber doch gar nichts mit dem Tier zu tun«, erwiderte das Mädchen schnippisch, wickelte sich endlich aus dem Handtuch und bot ihren kostbaren, jugendlichen Körper der Sonne und den Gaffern dar, die sie neuerdings überall, hinter jeder Ecke, vermutete. »Es geht mal wieder nur um dich, wie üblich. Schon wieder schwarz! Mama, du weißt schon, dass es Badeanzüge in verschiedenen Farben gibt? Bei dir wird auch alles zur Beerdigung.«
Das Papierschiffchen, in dem das Grillhähnchen gelegen hatte, musste wohl weggeweht sein. So warm es in Sopot auch wurde, war da doch ständig dieser Nordostwind, der die Wellen zu »weißen Pferden« aufpeitschte, und der Strandwächter stellte gefühlt immer sein Warnschild auf, nie gab es eine gefahrlose Zeit zum Schwimmen. Es war nicht leicht, das Leben so zu gestalten, wie man es haben wollte. Jetzt winkte sie ihren Jungs zu, weil die ihr winkten. Aber das hatten sie nur getan, um sich die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu sichern, damit sie jetzt zusehen würde, wie sie die Zungen unter die Unterlippe rollten, die Hände in die Achselhöhlen schoben und sich kaputtlachten, als sie von einer weiteren großen Welle umgenietet wurden. Ihr Vater, der – nach allem, was man hier in Sopot wusste – problemlos einfach kurz um die Ecke verschwunden sein konnte, um noch ein paar Erfrischungen für seine Familie zu besorgen, war im wirklichen Leben nach Amerika ausgewandert und montierte jetzt irgendwo in einer riesenhaften Fabrik Autotüren an Autos, anstatt weiterhin glücklicher Mitinhaber einer kleinen Reparaturwerkstatt zu sein, so wie früher, bevor er gegangen war.
Sie machte ihn nie schlecht vor den Kindern, verfluchte ihn nicht für seine Blödheit. So gesehen konnte man sie weder für die schlechte Laune ihrer Tochter noch für den unreifen Leichtsinn ihrer Söhne verantwortlich machen. Insgeheim hoffte sie aber und malte sich aus, dass seine Tage grausam und düster waren, dass er in dieser ganz speziellen Armut lebte, der man, nach allem, was sie hörte, in amerikanischen Städten verfallen konnte. Und während ihre Tochter sich den straffen Bauch mit etwas einrieb, das stark an Bratfett erinnerte, steckte die Frau ihren Hähnchenflügel unauffällig in den Sand und schob dann rasch und verstohlen mit dem Fuß noch mehr Sand darüber, wie über ein Kackwürstchen, das sie vergraben wollte. Und derweil werden die kleinen Hühnerküken zu Hunderttausenden, vielleicht auch zu Millionen, über Fließbänder transportiert, tagtäglich, die ganze Woche, und die Geschlechtsbestimmer drehen sie einmal um und fegen die Männchen dann in riesige Mahlanlagen, wo sie bei lebendigem Leib geschreddert werden.
Inhaltsverzeichnis
Éducation sentimentale
Damals wirkte sie verunsichernd auf Männer. Begriff aber nicht, wieso, und bemühte auf der Suche nach Antworten wenig verlässliche Quellen. Frauenzeitschriften – andere Frauen. Später, in der Lebensmitte, zog sie neue Schlüsse. Lag vor dem begrünten Pavillon über dem Serpentine-Café im Gras und bewunderte, wie ein Kleinkind, ihr Sohn, in den Planschbereich hinein und wieder heraus watete. Plötzlich stand ihre Tochter neben ihr: »Du guckst, als ob du verknallt in ihn bist. Als ob du ihn malen willst.« Besagte Tochter kam gerade aus dem See und war voller Entengrütze. Das Kleinkind trug eine dicke, durchnässte Windel, die hinten an ihm herunterhing und aushärtete wie Ton. Ein bemerkenswerter Anblick. Mitten in den See hatte Christo eine oben abgeflachte, zwanzig Meter hohe Mastaba gesetzt, erbaut aus lauter aufeinandergestapelten Ölfässern in Rot und Violett. Tretboote rangierten um sie herum. Wagemutige Frauen in Wetsuits schwammen daran vorbei. Möwen setzten sich darauf und kackten. Auch das war als bemerkenswerter Anblick gedacht. Die Wolken teilten sich, und die Spätsommersonne schloss Christos ewige Heimstatt in die Arme und alles andere auch, sogar das wütende, grünliche Gesicht ihrer Tochter. Sowohl die Frauenzeitschriften als auch die Frauen hatten den Hauptakzent auf Mangel und Irrtum gelegt. Ihr »fehle« etwas, das sei das Problem. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, erkannte sie, dass es sich bei dem scheinbaren Mangel tatsächlich um eine Form von ungünstigem Überfluss gehandelt hatte. Überfluss wovon? Kann man Ich im Überfluss haben?
Aber es stimmte schon: Sie hatte Männer immer als Musen betrachtet. Und sie auch so behandelt.
Darryl war der Erste, dem das gefiel. Er war nicht sehr groß. Aber dermaßen schön! Er hatte den afrikanischen Hintern, den sie selbst gern gehabt hätte, war am ganzen Körper kompakt und muskulös. Hinreißender Schwanz, nicht übertrieben spektakulär, für alle Lebenslagen geeignet. Am meisten mochte sie es, wenn er sich flach an Darryls Bauch drückte und auf den wolligen Streifen aus Härchen deutete, der sich aufwärtsschlängelte und sich dann auf der symmetrischen Brust zu zwei weichen Flächen auffächerte. Seine Brustwarzen wirkten sehr weltoffen, ganz versessen darauf, wie die zitternden Fühler eines Insekts. Der einzige Teil ihres Körpers, der ähnlich reagierte, war das Gehirn. Besonders bewunderte sie sein Kopfhaar, weich und ebenmäßig, ohne harte Kanten. Sie selbst hatte sich nach Jahren des Missbrauchs von chemischen Keulen beim Friseur den Kopf kahl rasiert. Sie wollte noch einmal neu anfangen, es dichter nachwachsen lassen, in der Hoffnung, die afrikanischen Wurzeln wieder anzuregen, doch in dieser kleinen Universitätsstadt war ein solcher Anblick nie da gewesen, und sie wurde zur unfreiwilligen Sensation. Nur er wusste Bescheid.
»Kennst du Darryl schon?«
»Aber du musst Darryl kennenlernen! Oh mein Gott, unbedingt!«
Das College beharrte einhellig darauf, dass sie sich kennenlernten. Sie waren zwei von nur vier schwarzen Gesichtern auf dem Campus. »Darryl, Monica. Monica, Darryl! Endlich!« Sie wollten gekränkt sein, dabei waren sie, beide schüchtern, in Wahrheit dankbar für jede Hilfestellung. Sie ließen die Beine über dem Wasser baumeln und stellten fest, dass sie im selben Postleitzahlenbereich aufgewachsen waren, nur zehn Minuten voneinander weg, ohne sich je über den Weg gelaufen zu sein, und dass man ihnen ähnlich niedrige Notenziele gesteckt hatte – bei ihr meistens »Gut«, bei ihm meist »Befriedigend« –, um ihre Bedürftigkeit, die niedrigen Erwartungen an sie oder aber die Großzügigkeit des Colleges unter Beweis zu stellen. Schwer zu sagen, was es war. Sie nahmen die niedrigen Hürden jedenfalls problemlos, heimsten überall Bestnoten ein. Als soziales Experiment waren sie unangreifbar.
Allmählich merkten sie, dass sie für das College und überhaupt auf dem Papier kaum zu unterscheiden waren. Aber sie wussten es besser. Straßennamen, Schulen, die An- respektive Abwesenheit eines Vaters. Als sie zwischen Darryls Haltestelle und ihrer eigenen – sie hatte ihn seit fünfundzwanzig Jahren nicht gesehen – in der Metro blätterte, las sie einen brutalen Bericht und dachte sich: Ja, meine Schule hat einen englischen Nationalspieler und zweieinhalb Popstars hervorgebracht und Darryls Schule diesen grinsenden Irren, der gerade im Irak jemanden enthauptet hat. Andererseits hatte der erste Junge, den Monica je geküsst hatte, später in einer Imbissbude einen Mann erstochen, etwa zur selben Zeit, als sie sich ihren Doktorhut aufsetzte. Zwischen Darryls Haltestelle und ihrer eigenen hing sie der trägen Überlegung nach, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie Darryl geheiratet hätte oder diesen mordlüsternen Jungen oder überhaupt niemanden. Vermutlich verfügte ihr Mann über seine eigene dröge Straßenkarte nicht genommener Abzweigungen. In der Lebensmitte wird man eben konventionell. Die Entscheidungen, die man im Lauf der Zeit getroffen hat, verkörpern sich in den Ästen der robusten Eichen entlang der oberirdischen Bahnstrecke nach Kensal Rise. Man wird grau und fester um die Hüften. Und doch sah sie an glücklicheren Tagen immer noch dieselben kleinen, festen Brüste, dieselben starken, langen Beine, blickte ihr noch das vertraute, wundersam braune Tier entgegen, das praktisch nie krank war und voller Kraft. Wie viel davon war Wirklichkeit? Wie viel Einbildung? Das war, soweit sie es beurteilen konnte, die altersgemäße Frage. Und der Unterschied zwischen Jetzt und Damals, mit zwanzig, lag darin, dass sie das vom einen Moment zum nächsten nie gleich beantworten konnte. Nächster Halt Canonbury. Nächster Halt Menopause und Abschied vom Jeanstragen. Oder doch nicht? Blinde Würmer, die im eigenen Körper Kompost erzeugen, sind eine viel bessere Metapher als nicht genommene Abzweigungen oder verdorrende Äste. Aber eigentlich bildet keine Metapher es wirklich ab. Es ist hoffnungslos.
Ein halbes Jahr bevor sie Darryl kennenlernte, als sie noch in London lebte, verbrachte sie einen hochinteressanten Sommer mit dem zwei Meter großen Assistenten eines Fotografen, einem Weißen aus Brixton, Ex-Skater, der früher eine große Nummer im Taggen gewesen war. Einer seiner lila Drachen zierte einen U-Bahn-Zug der Bakerloo-Line. Sie entdeckte bei sich eine völlig irrationale Verehrung für sehr große Menschen. Wenn sie vor ihm kniete, war das wie eine Art Anbetung. Eines Tages saßen sie in der Badewanne, und sie erzählte eine Menge Witze und brachte ihn zum Lachen, aber dann, wie ein Comedian, der auf immer noch mehr Lacher aus ist, wurde sie zunehmend bemühter und erntete immer weniger Lohn für ihre Anstrengungen: verhalteneres Lachen, Seufzer. Sie änderte die Taktik. Eine dreiseitige Abhandlung über seine eisblauen Augen, die Leni-Riefenstahl-Frisur und den fünfzehn Zentimeter langen, unbeschnittenen Penis. Versuchsweise tauchte sie unter und schob sich mit offenem Mund auf ihn zu. Er stieg aus der Wanne, ging nach Hause, rief ein paar Tage lang nicht an und schrieb ihr dann einen äußerst hochtrabenden Brief, dass er nicht mit einem Nazi verglichen werden wolle. Einen Brief! Bei der Ankunft im College behielt sie das als warnendes Beispiel im Kopf. Sprich nie von ihnen, als wären sie Objekte, das mögen sie gar nicht. Sie wollen in allen Lebenslagen das handelnde Subjekt sein. Versuch bloß nicht, dich selbst zum handelnden Subjekt zu machen. Versuch auch nicht, sie zum Lachen zu bringen, und sag ihnen keinesfalls, wie hübsch sie sind.
Für Darryl musste sie all diese Regeln abändern. Er lachte für sein Leben gern und freute sich an der Verehrung seines Körpers. Aggressionen kannte er nicht. Er legte sich einfach hin und ließ sich anbeten. Wie leicht, wie schmerzlos sie ihn beispielsweise in sich aufnahm, ihn eingemeindete, ihm kurzfristig Zuflucht gewährte, bis es an der Zeit war, ihn wieder freizugeben. Aber man schrieb die Neunziger: Die Sprache war nicht auf ihrer Seite. Männer wurden nicht »freigegeben«, sie »zogen sich zurück«. Sie waren das handelnde Subjekt. Längst war es normal, sie im Pub vom Leder ziehen zu hören, berauscht von der neuen Freiheit, laut über Sex reden zu dürfen: »Da hab ich ihn ihr so richtig reingerammt« oder »Ich hab sie in den Arsch gefickt«. Mit Darryl dagegen entdeckte Monica, dass das nur Gerede war, Machogehabe, und dass die Freigiebigkeit tatsächlich genau umgekehrt gelagert war. An einem Nachmittag, als sie die komplette Zeit, die den morgendlichen Kursen vorbehalten war, vervögelt hatten, probierte sie den Gedanken an ihm aus:
»In einem Matriarchat würden die Frauen vor ihren Freundinnen prahlen: ›Ich habe ihn ganz mit dem Anus umschlossen. Ich habe seinen Schwanz total verschwinden lassen. Ich habe ihn mir einfach geschnappt und tief in mir versteckt, bis er gar nicht mehr vorhanden war.‹«
Darryl wischte sich gerade mit einem Taschentuch ab, musterte stirnrunzelnd die braunen Flecken daran. Kurz unterbrach er sich und lachte, legte sich dann aber wieder auf ihren spermafleckigen blauen Futon und runzelte erneut die Stirn, nahm die Vorstellung ganz ernst (er studierte Sozialpolitik).
»›Richtig verschluckt hab ich ihn‹«, fuhr Monica fort und wurde unwillkürlich lauter, »›ich hab mir sein Fleisch geschnappt und es mit meinem Fleisch komplett ausgelöscht.‹«
»Tja … Ich weiß ja nicht, ob sich das durchsetzt.«
»Sollte es aber! Das wäre doch TOLL!«
Darryl, nicht größer und nicht kleiner als sie, wälzte sich auf sie und küsste ihr das ganze Gesicht.
»Weißt du, was noch toller wäre?«, sagte er. »Wenn es weder Matriarchate noch Patriarchate gäbe und die Leute einfach sagen würden: ›Die Liebe hat unsere Körper zusammengeführt, und wir sind eins geworden.‹«
»Jetzt werd nicht eklig«, sagte sie.
Es gibt dieses alte Klischee über das Leben auf der Straße: Egal, wo man hingeht, die Straße kommt immer mit. In Darryls Fall war das ganz wörtlich zu nehmen. Monica – die mit der Straße nichts am Hut hatte, außer dass sie in einer wohnte – hatte nur ein paar Bilder mitgebracht, eine Topfpflanze und einen nachgemachten Senufo-Hocker, den ihre Mutter einmal in Kenia am Flughafen erstanden hatte. Darryl hatte Leon mitgebracht, einen in der dritten Generation irischstämmigen Kleinkriminellen aus South Kilburn. Und zwar weder im Geiste noch metaphorisch, sondern höchstpersönlich: Leon hauste in Darryls Wohnheimzimmer, auf einer Luftmatratze, aus der Darryl jeden Morgen die Luft herausließ und die er dann in einem Koffer versteckte, damit die Putzfrauen nichts merkten. Es war ein seltsames Arrangement, aus Monicas Sicht war aber das Merkwürdigste daran, dass Darryl es kein bisschen seltsam fand. Leon und er machten alles zusammen; sie waren Freunde, seit sie drei Jahre alt waren. Hatten denselben örtlichen Kindergarten und dieselbe Grundschule besucht und danach auch dieselbe weiterführende Schule. Und jetzt würden sie gemeinsam das Studium absolvieren. Ungeachtet der Tatsache, dass Leon seine sämtlichen GCSE-Prüfungen in den Sand gesetzt hatte, keinen Hochschulabschluss hatte und an der Universität nicht einmal eingeschrieben war.
Monica erkannte sehr bald, dass jede Beziehung mit Darryl auch eine mit Leon sein musste. Die beiden Freunde aßen zusammen, soffen zusammen, ruderten zusammen, sie lernten sogar zusammen – in der Form, dass Darryl in die Bibliothek ging und Leon sich neben ihn setzte, die Füße auf dem Tisch, und auf seinem MiniDisc-Player Paul’s Boutique hörte. Monica hatte Darryl nur für sich, wenn sie sein Fleisch mit ihrem auslöschte, und das lag oft erst wenige Minuten zurück, wenn sie Leon draußen vor der Tür vernehmlich beatboxen hörten – sein »Geheimsignal«. Dann mussten Darryl und Monica sich anziehen, und zu dritt begaben sie sich: in die College-Kneipe, an den Fluss fürs erste High, aufs Dach der Kapelle, um das High noch zu steigern.
»Ist ja nicht so, als würde ich nix zahlen«, entgegnete Leon eines Abends, als Monica high genug war, um anzudeuten, er nutze das weichherzige Wesen ihres Lovers aus. »Ich trag meinen Teil bei, kannste glauben!«
Und kein Mensch konnte etwas Gegenteiliges behaupten. Er versorgte den ganzen Campus mit Gras, E und Zauberpilzen, sofern es welche gab, und dazu, wie er es gern ausdrückte, dem »billigsten Koks diesseits der M4«.
Leon trug wechselnde Kappa-Trainingsanzüge. An besonders kalten Tagen kamen eine neongelbe Daunenjacke und eine pelzgefütterte Kangol-Kappe dazu. Wenn es heiß war, behielt er die Trainingshose an und kombinierte sie mit eng anliegenden Muscleshirts, die einen straffen, sehnigen, geisterweißen Oberkörper freilegten. Seine alten British-Knights-Sneakers trug er bei jedem Wetter: Er hatte sie in Japan bestellt, noch vor dem Internet, als so was gar nicht einfach war. Äußerlich unterschied er sich von allen anderen, fiel aber trotzdem nicht weiter auf: Er hatte ein Allerweltsgesicht, kein unschöner Anblick, weder sonderlich attraktiv noch sonderlich hässlich. Kurzes blondes Haar, das vor Gel starrte, blaue Augen, Brilli im linken Ohrläppchen. Er war der Inbegriff des »weißen Jugendlichen« aus den Polizeiberichten. Er hätte einem das Auto vor der Nase wegklauen können, und man hätte ihn bei der Gegenüberstellung trotzdem nicht identifiziert. Und dennoch war er am Ende des ersten Semesters überall bekannt und beliebt. Manche Menschen können eben »mit jedem reden«. In einem Umfeld, in dem alle versuchten, jemand zu sein – Eindruck zu schinden hofften, eine Rolle entwickeln wollten –, bewunderte man ihn für seine Beständigkeit. Er redete mit allen gleich, mit den reichen Tussis, den Chorstipendiaten, den Naturwissenschaftlern aus dem Norden, den Mathegenies aus der Workingclass, den beiden afrikanischen Königssöhnen, den Ex-Reservisten unter den Collegedienern, den jüdischen Intellektuellen aus dem Londoner Norden, den marxistischen Absolventen aus Südamerika, der Seelsorgerin und – als schließlich doch alles aufflog und die Kacke am Dampfen war – auch mit dem Hochschulleiter höchstpersönlich. Zum Teil beruhte seine Anziehungskraft darauf, dass er die Vision vom Unileben ohne die Bürde des Studiums verkörperte. Die ganzen Fantasiebilder aus den Prospekten, mit denen die Studierenden geködert worden waren – Bilder von jungen Menschen, die auf dem Fluss dahinglitten oder philosophierend im hohen Gras lagen: So ein Leben war nur für Leon wahr geworden. Vom buntverglasten Panopticon der Bibliothek aus konnte Monica ihn dort unten sehen, ganz frei: in den Backs, wo er einer Kuh Zigarettenrauch ins Gesicht pustete, oder in einem Punting-Boot mit einem Schwarm Studienanfängerinnen und einer Flasche Cava. Unterdessen schrieb sie an ihrer Abschlussarbeit über Gartenlyrik des achtzehnten Jahrhunderts und schrieb sie immer wieder um. Monicas Leben war nichts als Arbeit.
Auch abends arbeitete sie eifrig weiter, an dem Projekt, herauszufinden, ob der G-Punkt real oder nur ein ideologisches Hirngespinst des Siebzigerjahre-Feminismus war. Mit dem Zeigefinger konnte sie tief drinnen eine leicht erhöhte Stelle ertasten, so groß wie ein Penny, oben, zum Bauch hin, und der Plan war, die Frage womöglich ein für alle Mal zu klären, indem sie sich auf Darryl setzte, ihn fest mit den Beinen umschlang, während er es ihr gleichtat, sie beide aufrecht blieben, sich im gleichen Rhythmus bewegten und dabei Foxy Brown hörten. Aber Leon ging ihr nicht aus dem Kopf.
»In den Gärten, also diesen angelegten Gärten, da gab es immer auch einen Eremiten. In einem Hain vielleicht oder mitten in einem Labyrinth. Das war ein echter Mensch, also ein echter Obdachloser, und er saß einfach nur da, ganz frei, während sich in Haus und Garten alles nur um Fleiß und Arbeit drehte, um Plackerei und Kapitalertrag. Er diente als nette Ablenkung. Ich glaube, Leon ist im Grunde auch so ein Eremit.«
»Ich will jetzt wirklich nicht über Leon reden.«
»Und wenn diese ganzen reichen Tussis ihn bumsen, dann ist das wie Lady Schießmichtot, die aus dem Herrenhaus herüberkommt, um mit dem Eremiten zu verkehren.«
»Für mich ist Leon eher eine Art Hofnarr. Oder das College-Gespenst. Er ist ja auch weiß wie so’n Geist!«
»Puh – mir ist plötzlich viel zu heiß.«
»Gal, du weißt doch, ich steh drauf, wenn Frauen schwitzen. Du schwitzt wie’n echtes Weib!«
»Wenn schon, dann bitte wie ne echte Frau! Nein, im Ernst, ich muss runter – mir ist viel zu heiß.«
»Ich dachte, wir suchen deinen geheimen Garten? Dabei wollte ich das alles für Nancy Friday aufschreiben. Du lässt hier das ganze Team hängen!«
Ein Scherz, aber er saß trotzdem.
Monica war sehr daran gelegen, dass Leon aufflog. Sie sagte das nie laut, gab es auch Darryl gegenüber nicht zu, aber so empfand sie. Trotz ihrer Jugend stand sie insgeheim auf der Seite von Recht und Ordnung. Anfangs setzte sie ihre Hoffnung auf die Putzfrauen – die »Aufräumerinnen« –, aber die hatten das Spielchen schon nach ein paar Wochen durchschaut und meldeten es nie. Einmal kam Monica morgens in die Gemeinschaftsküche und fand dort Leon, der, auf der Anrichte hockend, mit zweien von ihnen Tee trank, plauderte und eine Frühstückszigarette rauchte. Ganz gesellig. Monica ihrerseits erntete von den Aufräumerinnen nichts als Schweigen und Verachtung. Es waren größtenteils nicht mehr ganz junge Irinnen, die ihre Arbeit verabscheuten und die faulen, anspruchsvollen und meistens schrecklich schlampigen Studierenden, für die sie putzten, gleich mit. Sie konnten nicht begreifen, wie man sich mit ein paar popeligen Prüfungen das Recht verdiente, drei Jahre lang rumzusitzen und auf Kosten der Steuerzahler scheinbar keinen Finger krumm zu machen. Monica allerdings hing mit Inbrunst dem Konzept der Leistungsgesellschaft an – es war das grundlegende Prinzip, das ihr Leben untermauerte. Etwas in ihr rechnete ständig damit, von sämtlichen Erwachsenen, die gerade in der Nähe waren, spontanen Applaus für ihre Anstrengungen auf allen Gebieten zu bekommen. Sie wollte unbedingt die Zuneigung der Aufräumerinnen erringen, ihre gemeinsame Klassenzugehörigkeit zum Ausdruck bringen, denn schließlich war ihre Großmutter auch eine Art Aufräumerin: Sie leerte im St. Mary’s Hospital die Bettpfannen. Monica gab sich die größte Mühe, diesen schwer geplagten Frauen keine zusätzliche Arbeit zu machen, sie nicht mit unnötigen Forderungen zu belasten. Manchmal ließ sich das aber nicht vermeiden. Als sich im Sommertrimester ein süßlich fauliger Gestank in ihrem Zimmer nicht mehr ignorieren ließ, erkundigte sie sich zaghaft bei ihrer Aufräumerin, ob diese ihr vielleicht helfen könne, das Geheimnis des Gestanks zu lüften? Ob sie womöglich, wie Darryl, glaube, dass sich irgendwo hinter der Wandverkleidung eine tote Maus befinden könnte?
»Entschuldigen Sie mal, seh ich aus wie Columbo?«
Bei Leon war das anders. Bei ihm wussten die Aufräumerinnen ganz genau, dass er sich absolut nichts verdient hatte, und liebten ihn aus ebendiesem Grund. Er hatte schließlich auch keine besseren Noten gehabt als ihre eigenen Kinder und war trotzdem hier, und indem er immer weiter bei dem schwarzen Jungen im Zimmer hauste – und damit durchkam –, bewies er doch, dass an diesen hochnäsigen kleinen Knalltüten, die sich für die Herrscher der Welt hielten, gar nichts Besonderes war. Sie brachten ihm selbst gebackene Leckereien mit und gaben ihm Ratschläge für sein Liebesleben.
»Weißt du, Marlene, sie steht halt ständig bei mir vor der Tür. Also bei Darryl.«
»Ich hab ja gehört, sie soll über zwei Ecken mit Prinzessin Diana verwandt sein, ob man’s glaubt oder nicht.«
»Die vornehmen Tussis sind immer besonders notgeil.«
»Zumindest haben sie das schlechteste Benehmen. Ich sag dir mal was, Leon: Wir finden ja alle, du hast was Besseres verdient, ganz im Ernst.«
»Marlene, gräbst du mich gerade an?«
»Ach, jetzt hör aber auf!«
»Du weißt schon, dass du meine Mutter sein könntest, Marlene?«
Sie hatten etwas Neues ausprobiert, wobei er in kleinen weißen Kringeln auf ihre Brüste kam und sie hinterher sauber lecken musste. Noch mehr Arbeit. Sie zog daraus allerdings nur die Erkenntnis, dass ihr die Vorstellung besser gefiel als das konkrete, kalte Sperma auf ihren Brüsten. Und Leon ging ihr immer noch nicht aus dem Kopf.
»Was willst du seinetwegen unternehmen?«
»Wie, seinetwegen?«
»Früher oder später wird er erwischt, und dann fliegt ihr beide raus.«
»Man darf doch Freunde zu Besuch haben.«
»Er ist aber schon seit neun Monaten ›zu Besuch‹.«
»Magst du Leon nicht?«
»Ich mag nur den Gedanken nicht, dass ein junger Weißer einen jungen Schwarzen mit sich in den Abgrund reißt. Das ist überaus grotesk.«
»Überaus grotesk« gehörte zu den neuen Ausdrücken, die sie sich auf dem College angewöhnt hatte.
»›Einen jungen Schwarzen?‹ ›Hallo, mein Name ist Darryl, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich darf Ihnen dann heute das Sperma von den Titten lecken?‹«
»Du weißt schon, wie ich das meine.«
»Monica, ohne Leon wär ich gar nicht hier.«
»Mein Gott, was redest du denn da!«
Dann sagte er etwas, das sie nicht begriff.
»Er glaubt an mich.«
Oft hörte sie, wie Eltern ihre Kleinkinder mit den Nazis oder faschistischen Diktatoren verglichen, dabei war nach ihrer Erfahrung die einzig korrekte Analogie die Stasi oder irgendein anderer Geheimdienst. Für die Kinder bestand das größte Glück darin, sich gegenseitig anzuschwärzen. Manchmal war sie nach der Arbeit gerade erst durch die Tür getreten, schon kam ihr, mit einer Leidenschaft jenseits aller Zuneigung, ein Kind entgegengeflogen, erfüllt von dem Verlangen, ihr zu erzählen, was das andere Schreckliches angestellt hatte. Was dann folgte, war im Grunde völlig sinnlos: »Nicht petzen!«, mahnte sie automatisch, verlangte aber im nächsten Atemzug schon nach weiteren Informationen; dann musste sie, begleitet von wütendem Protestgeheul, sowohl die Tat als auch ihre Meldung ahnden und sich dabei weiterhin als allmächtige Richterin geben, die selbstverständlich nie im Leben ein Verbrechen begangen oder einen Verbrecher angeschwärzt hatte. Aber jedes Mal wenn der entzückende Mund ihrer Tochter vom fast schon erotischen Genuss des Preisgebens erbebte, führte sie das zur Erinnerung an sich selbst zurück, wie sie, einen ganz ähnlichen Ausdruck im Gesicht, den anonymen Brief unter der Tür des Hochschuldirektors durchschob.
Zwei Tage nachdem sie das getan hatte, war Leon weg. Kein Mensch wusste, dass sie es gewesen war, kein Mensch vermutete das auch nur, Darryl am allerwenigsten. Er klammerte sich an sie, als wäre sie sein Rettungsring, ohne zu ahnen, dass sie das Schiff zum Sinken gebracht hatte. Natürlich hatte sie sich vorgestellt, dass er wegen Leon traurig sein würde, aber wie sich herausstellte, ging ihre Vorstellungskraft nicht weit genug. Die Auswirkungen waren erschreckend. Er ging nicht mehr zu den Vorlesungen, machte eigentlich überhaupt nichts mehr und weigerte sich, sie irgendwohin zu begleiten, wo andere Leute waren, nicht einmal in die Kneipe im Erdgeschoss. Sie kam sich zunehmend vor wie der Amtsarzt, der Elliott und E.T. getrennt hat. Darryl schien dahinzuwelken – seine Welt wurde immer kleiner. Sie bestand nur noch aus ihr. Vögeln, essen, kiffen und wieder von vorn. Mausausdünstungen, Grasausdünstungen, Sexausdünstungen. Ein Tag sollte kommen, da würde sie sich wünschen, sie hätte diese Gerüche in einen Flakon abgefüllt und könnte jetzt eine tiefe, stärkende Nase daraus nehmen: Ach, 1995 … Aber währenddessen war es scheußlich. Er wollte immer nur mit ihr zusammen sein, die ganze Zeit. Es war nicht normal. Wenn sie von einer Party sprach, fuhr er aus der Haut:
»Was willst du denn immer mit diesen Leuten abhängen?«
»Diese Leute sind unsere Freunde.«
»Wir haben hier keine Freunde. Die kommen aus einer anderen Welt.«
»Das ist aber die Welt, in der wir leben.«
»Wir leben in der Liebe.«
Aber es war doch absurd, dass sie sich liebten! Sie waren neunzehn! Was sollten sie denn tun: einfach das ganze Studium über verliebt bleiben, womöglich auch noch länger, zwei Menschen, die praktisch Tür an Tür aufgewachsen waren? Einfach bis zum Ende durchhalten, wie in einem dieser präfreudianischen Neunzehntes-Jahrhundert-Romane? Und dabei zahllose sexuelle und psychologische Erfahrungen versäumen? Das war doch buchstäblich Wahnsinn!
»Von wegen buchstäblich Wahnsinn! Meine Mutter und mein Vater sind zusammen, seit sie fünfzehn sind. Mich hat sie mit siebzehn gekriegt!«
»Darryl, deine Mutter räumt bei Iceland die Regale ein.«
Wie hatte sie nur zulassen können, dass ihr das über die Lippen kam!
In den Monaten nach der Trennung machte sie sich an die Arbeit und sammelte sexuelle und psychologische Erfahrungen. Eine Zeit lang hielt sie sich eine reiche Tussi aus Mumbai namens Bunny als Muse, aber das gestaltete sich bald weniger harmlos: Es war durchzogen von einem starken Hang zum unwillkürlichen Frauenhass, vielleicht eine Art kulturelles Überbleibsel, das sich aber ganz konkret in Monica manifestierte. Eines Abends war sie selbst geschockt, als sie an ihrem nackten Körper hinunterschaute, um einen besseren Blick auf Bunny zu haben, die gerade dabei war, Monicas Tampon mit den Zähnen am Bändel herauszuziehen, und währenddessen dachte Monica, ohne dass Bunny etwas davon ahnte: Ja, zieh ihn raus. Zieh ihn raus, du kleine Schlampe. Angeekelt von sich, machte sie Schluss, in der hochfliegenden, jugendlichen Hoffnung, eines Tages die perfekte Übereinstimmung von Sex und Moralempfinden zu erreichen. Wenig später fing sie an, viel Zeit in der Unikneipe zu verbringen, wo sie Hof hielt und versuchte, mit willigen Opfern verzwickte, beschwipste Diskussionen über Kulturtheorie zu führen, die sie dann »gewann«, indem sie umgehend widersprach, sobald jemand mit ihr übereinstimmte, so wie sich der Springer beim Schach aus dem hoch aufragenden Einflussbereich des Turms flüchtet.
Eines Abends, fünf Monate später, sah sie Leon. Es war der Abend vor dem College-Ball, der ein trübseliger Rave für Reiche zu werden drohte, mit teuren Jungle-DJs aus London, die fast alle von Leon ausfindig gemacht worden waren und vom Lieblingstrottel aller Aufräumerinnen bezahlt wurden: dem Braven Britischen Steuerzahler. Fast war sie froh, auf einen alten Freund zu treffen: Sie hatte einen langen, seltsamen Tag hinter sich. Am Morgen war sie – infolge eines unseligen Anfalls von volltrunkenem »Wir sind eh die Letzten in der Kneipe«-Sex – mit einem Mordskater aus Bunnys Bett gestiegen; dann, nach dem Unterricht, hatte sie bei Darryl geklopft, um zu sehen, ob sie nicht doch »einen Weg finden könnten, Freunde zu bleiben«, obwohl sie schon, während sie es aussprach, merkte, dass sie gar nicht deswegen hier war. Er war bekifft; Widerstand erwies sich als zwecklos. Er kicherte auf die alte Art, als sie an seinen Brustwarzen spielte, aber kaum war es vorbei, wurde er eiskalt. Er ging zu seinem Schreibtisch, setzte sich splitternackt dorthin und schlug ein Buch auf. Erst hielt sie das für einen Witz – aber nein. Als sie ihn fragte, ob sie noch ein bisschen bleiben dürfe, sagte er: »Mach doch, was du willst.« Sie zog sich an und ging, ohne sich zu verabschieden oder selbst einen Abschied zu hören. Das war um fünf gewesen. Seitdem saß sie in der Kneipe und trank Wodka Lemon, der vom Steuerzahler bezuschusst wurde und deshalb nur ein Pfund zwanzig kostete. Bisher hatte sie sechs davon gekippt. Leicht schwankend stand sie auf und lugte durch die Sprossenfenster nach draußen. Es war eindeutig Leon. Neben der im Entstehen begriffenen Pyramidenbühne, die gerade von einem kleinen Heer Bauarbeiter errichtet wurde, mitten auf dem Innenhof. Sie sah zu, wie eine gewaltige Lautsprecherbox mithilfe eines Krans aufgerichtet wurde, wie ein Standbild von Stalin. Das musste die teure Anlage sein, zu der Leon das Ballplanungskomitee höchstpersönlich überredet hatte, damals, im Januar, als er noch an den Treffen des Planungskomitees teilnehmen konnte. Jetzt war der verlorene Sohn heimgekehrt. Um sich das Denkmal anzuschauen, das er errichtet hatte. Und E zu verkaufen.
Als er hereinkam und sich zu ihr in die Sitznische setzte, machte er ein sehr ernstes Gesicht. Sie fühlte sich verurteilt, ein Gefühl, das sie von allen Empfindungen der Welt am wenigsten mochte. Wusste er Bescheid? Hatte er es irgendwie herausgefunden? O Gott, war es wegen der Iceland-Sache?
»Er hat dich geliebt, Mensch. Und du lässt ihn einfach sitzen, als wär nix dabei. Ist dir eigentlich klar, dass du ihn echt verletzt hast? Am Scheißboden zerstört war der! Und wir reden hier von meinem Bruder!«
Sie war verblüfft. In all den vielen Geschichten, die sie sich seit ihrer Kindheit über sich erzählte, war nie, nicht mal im Ansatz, die Variante vorgekommen, die ihr die Macht zusprach, jemand anders irgendwie zu verletzen. Das Gefühl war so erschreckend und für ihr Empfinden derart unerträglich, dass sie Leon schnurstracks Koks abkaufte, eine Line zog, sehr viel mehr trank, als ihr guttat, und wie eine Wahnsinnige mit ihm flirtete. Es dauerte nicht lange, da ging sie Hand in Hand mit Leon aus der Kneipe hinaus in die warme Luft.
»Was machen wir hier?«
»Wir holen uns die Nacht zurück. Laberst du doch ständig von. So feminismusmäßig. Das machen wir jetzt einfach.«
»So ist das aber nicht gemeint.«
»Komm mit.«
»Und was ist mit Darryl?«
Er zog erstaunt die Augenbrauen hoch. An einer hatte er ein neues Piercing, einen kleinen schwarzen Balken, der leicht schräg saß, so wie die Striche, die Monica an den Rand ihrer Romane malte, gleich neben das Wort SUBTEXT.
»Uns hat noch keine Frau auseinandergebracht, mach dir da mal keine Sorgen.«
Er nahm ihre Hand und ging mit ihr über den Rasen. Normalerweise war das weder Studierenden noch Nicht-Studierenden erlaubt, doch an diesem Abend glitten sie unbemerkt zwischen all den Schutzhelmen und orangefarbenen Signalwesten hindurch. Sie krochen durch ein Loch unter die schwere Plane neben der Bühne. Ließen sich in den Matsch sinken. Sie stellte fest, dass sie regelrecht wild auf ihn war.
»Langsam, langsam. Monica, du versuchst aber nicht, mir irgendwas reinzustecken, oder? Da steh ich nämlich gar nicht drauf.«
»Was?«
Dann fiel es ihr wieder ein. Aber es war nicht fair: nur dieses eine rein hypothetische Gespräch über Strap-ons, im Zusammenhang mit einem rein theoretischen Gespräch über Hélène Cixous. Dabei wollte sie Männer gar nicht penetrieren, sie wollte sie umschließen. Sie fühlte sich gekränkt und scheußlich missverstanden. Außerdem war damit bewiesen, was sie seit Langem befürchtet hatte: Darryl erzählte Leon absolut alles.
»Nein, verdammt, mach ich nicht. Komm her.«
Von oben kam der Lärm der Arbeiter, die schufteten, hämmerten, Nägel einschlugen, um einen Mehrwert für aufgedunsene Plutokraten zu erschaffen, während unter ihnen zwei Anarchisten, nackt von der Taille abwärts, versuchten, in dem Planen-Mausoleum, das sie vor Blicken schützte, mitten auf dem Innenhof zu vögeln. Monica spürte, wie ihr ein Rinnsal kaltes Koks aus der Nasenhöhle die Kehle hinunterrann, und wurde das Gefühl nicht los, dass diese ganze Geschichte als Anekdote besser funktionieren würde als im wirklichen Leben. Nichts passte richtig zusammen, jede Berührung landete am falschen Ort, war falsch getimt – sie sehnte sich nach Darryl. Sie sehnte sich nach allen Menschen auf dieser Welt und auch nach der einen Person, die sie von all der Sehnsucht erlösen würde. Sie versuchte, es analytisch zu betrachten. Was war das Problem? Weder sein Gesicht noch sein Körper, sein Geschlecht, seine soziale Schicht oder ethnische Zugehörigkeit. Es lag am Energiefluss. Unglaublich. Da war sie gerade zwanzig geworden und schon auf die Antwort gestoßen, die alle suchten, seit Anbeginn der Kulturtheorie – ja, Monica war es zugefallen, sie aufzudecken. Manchmal fließt die Energie einfach … falsch. Es gab Menschen, vor denen man sich erniedrigen, und Menschen, die man selbst erniedrigen wollte; es gab Menschen, denen wollte man auf ebener Spielfläche begegnen – was dann, aus Kapitalismus- wie Bequemlichkeitsgründen, »Liebe« genannt wurde –, und es gab solche, mit denen man absolut nichts anzufangen wusste. Wie sich zeigte, fiel Leon in letztere Kategorie. Mit ihm konnte sie nicht arbeiten. Er war der Mehrwert, der Überfluss. Für irgendwen bedeutete er Reichtum, aber sie war es nicht.
Leon brach seinen aktuellen Versuch ab, wälzte sich von ihr herunter und deutete seufzend auf das Kappa-Logo auf seinem Ärmel.
»Yin. Yang. Mann. Frau.«
»Wie bitte?«
»Meine Oma meint immer, das ist wie Tanzen. Es können nicht beide führen.«
Sie schleppte sich in ihr Zimmer zurück. Und hatte einen Traum. Sie stand vor einem französischen Schloss, inmitten einer prächtigen Gartenanlage aus dem achtzehnten Jahrhundert. Sie sah gepflegte Hecken, Rabatten, Irrgärten, Brunnen und Statuen. Vielleicht war auch ein Eremit vorhanden, aber den sah sie nicht. Inmitten des Ganzen befand sich ein riesiges Schwimmbecken. Es war voll mit jungen Männern, bildschön, vielfältig hinsichtlich Haut- und Augenfarbe sowie Haarstruktur, aber doch alle perfekt gebaut. Sie tollten im Wasser herum, sprangen und tauchten wie die Delfine, und in allen vier Ecken schlugen etliche unter ihnen von vier Sprungbrettern aus spektakuläre Salti ins Becken. Und während sie diese Kunststücke noch bewunderte, bemerkte Monica, dass all diese perfekten Körper eine Anomalie aufwiesen: Sämtliche Lenden waren von einem Umschlag aus schimmernder, durchsichtiger Haut bedeckt, die alles, was sich in dem Beutel befinden mochte, so sicher barg und verbarg wie Baryshnikovs weiße Balletthosen. Im Traum griff sie in eine Tasche, die sie offenbar an sich hatte, ertastete dort die Gegenwart eines kleinen Taschenmessers und wusste gleich, dass es ihr Werkzeug war: Jeder einzelne Beutel musste zerschnitten werden.
Das hätte selbst Nancy Friday noch gefallen. Warum erwachte sie dann so angsterfüllt? Nicht weil der Traum direkt abartig gewesen wäre, sondern weil ihr klar war, dass sie ihn und damit auch die Erfahrungen, die ihn ausgelöst hatten, nie mehr vergessen würde. Und sie wollte doch vergessen. In Monicas Leistungsdenken war es wichtig, Erinnerungen nicht festzuhalten: Sie ketteten einen nur an eine Vergangenheit, die man bereits hinter sich ließ. Sie bemühte sich nie aktiv darum, irgendetwas in Erinnerung zu behalten. Mit Träumen war das anders. Ein Traum war ein Haus, das das Gehirn unerlaubt baute, nur mit dem Ziel, Erinnerungen und Erfahrungen und abwegige Impulse für alle Ewigkeit zu speichern, selbst noch die toten, die einem nur Schmerz bereiteten, die, von denen man sich unbedingt befreien wollte. Als sie schließlich ein richtiges Weib geworden war, überlegte sie manchmal, ob ihre Tochter auch einmal solche Träume erleben würde oder ob derartige psychologische Verrenkungen und Überraschungen für das Ich schon nicht mehr existierten, einfach aus der Mode gekommen, so wie der MiniDisc-Player, oder von der Evolution überholt, wie der Blinddarm. Träume von einer Art, bei der man, hätte man sie auch nur irgendjemandem an der Uni erzählt – selbst Menschen, die einen gut kannten und angeblich schätzten –, unweigerlich damit rechnen musste, dass das Gegenüber grinst und etwas Richtung Doktor Freud, bitte in die Notaufnahme! sagte. Sie erzählte keiner Menschenseele davon.
War das möglich? Hatte sie wirklich in zwölf Stunden mit drei Menschen geschlafen? Was wir jungen Körpern so alles zumuten! Und weil es keine Vorauserinnerungen gibt, würde sie sehr, sehr lange warten müssen, bis sie in der Zukunft auf ein leises Echo dieser Extremsituation stieß: erst ein Kind stillen, ein paar Stunden später neben dem anderen liegen, bis es einschlief, um schließlich – und das alles in ein und derselben Nacht – in einem dritten Zimmer aufzuwachen und sich nach hinten an den Geliebten zu drängen, um sein Fleisch mit ihrem auszulöschen und umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis