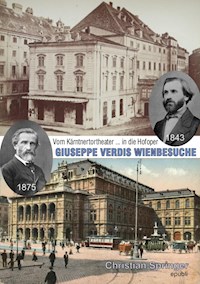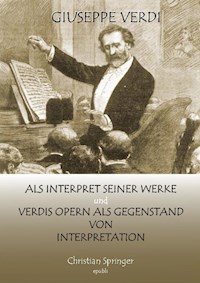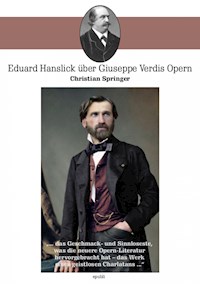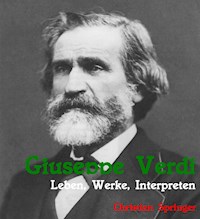
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Dies ist eine Biographie Giuseppe Verdis, die sich auch als Entstehungsgeschichte seiner Werke und als Darstellung der Arbeit und Wirkung der Interpreten seiner Uraufführungen versteht. Ein Buch, das anhand zahlreicher zeitgenössischer Dokumente ein Bild vom Leben und Schaffen des großen Komponisten zeichnet. Teile aus diesem Bild sind seinen Librettisten und Verlegern, Dirigenten und Sängern gewidmet. Sie alle werden hier zitiert und portraitiert. Dadurch gelingt es dem Autor, die Atmosphäre der Uraufführungen wiedererstehen zu lassen und eine authentische Sicht auf die damalige Opernwelt zu vermitteln. Behandelt wird etwa auch die Verdi-Rezeption im deutschen Sprachraum am Beispiel von Eduard Hanslick und die sogenannte Verdi-Renaissance im 20. Jahrhunderts. In einem eigenen Kapitel wird Giuseppe Verdi als Interpret seiner Werke dargestellt, ebenso wie die Interpretationen seiner Werke, wie sie aus Besprechungen der von ihm selbst geleiteten Aufführungen seiner Werke, aus seinen schriftlich und mündlich überlieferten Anweisungen und aus der zu seiner Zeit geübten Aufführungspraxis abgeleitet werden können. Schließlich wird auch die Entstehungsgeschichte des Librettos zu Re Lear und Verdis Auseinandersetzung mit diesem Shakespeare-Stoff in Augenschein genommen, der immer dann, wenn die Sujetwahl für ein neues Werk anstand, über einen Zeitraum von fünfzig Jahren in seinen Überlegungen präsent war und den er letztendlich doch nicht komponierte. Eine detaillierte Betrachtung ist dem "Verdi-Bariton" gewidmet, einer oft mißverstandenen Stimmkategorie. Bislang unbekannte Informationen wie z.B. Details über den Briefwechsel Giuseppe Verdi-Giuseppina Strepponi-Teresa Stolz runden das Bild Verdis im Jahr seines 200. Geburtstages ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1268
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Springer
GIUSEPPE VERDI
LEBEN, WERKE, INTERPRETEN
epubli GmbH, Berlin
Imprint
Inhalt
Vorbemerkung
Zu den Dokumenten und Übersetzungen
Prolog
I
Jugend und Studienzeit – Rocester – Sei romanze – Oberto conte di San Bonifacio – Ignazio Marini – Lorenzo Salvi – Mary Shaw – Antonietta Rainieri-Marini – Luigia Abbadia – Un giorno di regno – Bartolomeo Merelli
II
Nabucco– Otto Nicolai – Giorgio Ronconi – Prosper Dérivis – Giuseppina Strepponi – Corrado Miraglia – Verdi, ein politischer Komponist? – Temistocle Solera – I Lombardi alla prima crociata – Carlo Guasco – Erminia Frezzolini – Ernani – Sofia Loewe
III
I due Foscari– Francesco Maria Piave – Emanuele Muzio – Marianna Barbieri Nini – Achille De Bassini – Giacomo Roppa – Mario – Giovanna d’Arco – Antonio Poggi – Filippo Colini – Alzira – Salvadore Cammarano – Eugenia Tadolini – Gaetano Fraschini – Filippo Coletti
IV
Attila– Andrea Maffei – Macbeth – Napoleone Moriani – Verdis Präferenz für Shakespeare – Shakespeare In Italien – Papa Shakespeare – Ein Wagnis und eine Neuerung: Das Libretto in prosa – Das Meer in einem Löffel einfangen – Vom Shakespeare-Text zum Opernlibretto – Die musicabilità – Kürze und Erhabenheit – Felice Varesi – Die Revision des Macbeth – I masnadieri – Jenny Lind – Luigi Lablache – Italo Gardoni – Jérusalem – Gilbert-Louis Duprez
V
Il corsaro– Giuseppina Strepponi – Revolutionsjahr 1848 – La battaglia di Legnano – Teresa De Giuli Borsi – Luisa Miller – Marietta Gazzaniga – Settimio Malvezzi – Antonio Selva – Stiffelio – Aroldo – Marcellina Lotti della Santa – Emilio Pancani – Gaetano Ferri
VI
Rigoletto– Teresa Brambilla – Raffaele Mirate – Annetta Casaloni – Il trovatore – Elena Rosina Penco – Emilia Goggi – Carlo Baucardé – Giovanni Guicciardi – La traviata – Fanny Salvini Donatelli – Lodovico Graziani
VII
Intermezzo I
Erste Erwähnung des Lear – Der erste Entwurf – Die Sängerkategorien zu Verdis Zeit – Antonio Somma – Neue Wege – Eine Besetzung für die Uraufführung des Lear – Änderungen am Lear trotz erlahmendem Interesse – Langsamer Abschied von ReLear – Fünfzig Jahre Beschäftigung mit Re Lear – Endgültiger Verzicht
VIII
Les Vêpres siciliennes –Charles Santley – Sofia Cruvelli – Louis Gueymard – Marc Bonnehée – Louis-Henri Obin – Simon Boccanegra – Leone Giraldoni – Luigia Bendazzi – Carlo Negrini – Giuseppe Echeverria
IX
Un ballo in maschera– Verdi und die Politik – La forza del destino (Erstfassung 1862 und Neufassung 1869) – Inno delle nazioni – Caroline Barbot – Enrico Tamberlick – Francesco Graziani – Gian Francesco Angelini – Alessandro Manzoni – Luigi Colonnese – François-Marcel Junca – Mario Tiberini – Libera me
X
Don Carlosund seine Revisionen – Pauline Lauters-Gueymard – Marie-Constance Sasse – Jean-Baptiste Faure – Sir Michael Costa – Giorgio Stigelli – Antonio Cotogni – Antonietta Fricci – Mathilde Marchesi – Angelo Mariani – Paul Lhérie
XI
Intermezzo II
Der Verdi-Bariton
XII
Aida– Camille du Locle – Verdi und Ägypten – Auguste Mariette – Antonio Ghislanzoni – Von Nitteti über Bajazet zu Aïta? – Antonietta Pozzoni – Giovanni Bottesini – Eleonora Grossi – Pietro Mongini – Francesco Steller – Paolo Medini – Teresa Stolz – Der Briefwechsel zwischen Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi und Teresa Stolz – Maria Waldmann – Giuseppe Fancelli – Francesco Pandolfini – Ormondo Maini – Streichquartett e-Moll – Messa da requiem
XIII
Intermezzo III
Verdi-Interpretation und Verdi als Interpret
Verdi als Dirigent – Aufführungsanweisungen, Missverständnisse und unerwünschte Wirkungen – Echte Traditionen: Appoggiaturen und Kadenzen – Falsche Traditionen – Veränderungswürdige Zustände in italienischen Theatern – Verdi setzt seine Ideen durch – Zuerst die Sänger, dann der Stoff – „Verdi-Sänger“ – Entweder die Opern für die Sänger oder die Sänger für die Opern – Vortragen bedeutet nicht Brüllen! – Verdis Verhältnis zum gesungenen Wort – Ein erbitterter Feind von Strichen und Transpositionen oder die Ablehnung einer Lieblingssängerin – Wechselwirkung zwischen Sängern und dem Komponisten – Eingelegte Höhen – Gesangsausbildung und schöne Wissenschaften – Rückkehr zum Macbeth – Husten und Lachen – Ein gefälschter Brief – Intelligente Interpretation – Impertinente Esel, die Opern massakrieren – Die szenische Komponente – Don Carlo und Aida – Kehrt zu den Kavatinen zurück – Weg mit den Menschen da! – Die parola scenica – Es gibt nur eine einzige Interpretation eines Kunstwerks – Intelligenz und Gefühl – Falstaff, eine überaus leicht aufzuführende Oper – Abgesang
XIV
Die Revision des Simon Boccanegra– Arrigo Boito – Anna D’Angeri – Édouard de Reszke – Franco Faccio – Otello – Giulio Ricordi – Pater noster – Ave Maria – Romilda Pantaleoni – Francesco Tamagno
XV
Falstaff –Victor Maurel – Antonio Pini-Corsi – Edoardo Garbin – Adelina Stehle – Emma Zilli – Giuseppina Pasqua – Vittorio Arimondi – Premiere und Folgeaufführungen – Einige Besonderheiten des Falstaff
XVI
Intermezzo IV
Musikkritik im Italien des 19. Jahrhunderts – „Schmeissfliegen, die das Banner der himmlischen Kunst besudeln“ – Internationale Kritiker im 19. Jahrhundert – Der Verdi-Hasser Hanslick – Verdis Opern „lauter schlechtes Zeug“ – Das „schwarze, ameisenartige Gewimmel von Noten“ im Don Carlos – Aida, eine eingeschränkte Lobeshymne – „Die Wahl des Otello für eine Oper ist mir unsympathisch“ – „Die Lustigen Weiber sind Verdis Falstaff musikalisch entschieden überlegen“ – Hanslick an dem „geistlosen Charlatan“ kläglich gescheitert – Das Aufatmen nach Hanslick: Die Verdi-Renaissance
XVII
Quattro pezzi sacri– Letzte Jahre
Epilog
Eine Primadonna – Das Ende einer Epoche:Adelina Patti
Dank
Ausgewählte Bibliographie
Einige Disposizioni sceniche zu Verdi-Opern
Quellennachweis und Bibliographische Abkürzungen
Bilder
Notenbeispiele
Vorbemerkung
D
as vorliegende Werk, das unter dem seinen Aufbau und Inhalt etwas reduzierenden Titel Verdi und die Interpreten seiner Zeit in Wien im Jahr 2000 erschienen ist und von der internationalen Fachkritik ausgezeichnet aufgenommen wurde, wird jetzt aus Anlaß der Wiederkehr des 200. Geburtstages des Komponisten in überarbeiteter und erheblich erweiterter Form vorgelegt.
Während sich in den seit damals vergangenen zwölf Jahren keine grundlegenden neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Biographie des Komponisten ergeben haben, konnte doch etwas Licht in einige Randbereiche seiner Vita gebracht werden. So erscheinen hier beispielsweise erstmals bislang unveröffentlichte Informationen über den Briefwechsel zwischen Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi und Teresa Stolz, von dem man sich Erhellendes über das ominöse Dreiecksverhältnis erhoffte.
Die Überarbeitung wirkte sich im wesentlichen auf zusätzliche umfangreiche Informationen über die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichten etlicher Opern sowie auf neue Interpretenbiographien und Ergänzungen bestehender Biographien aus.
Die Erweiterungen fallen nicht nur vom Umfang her ins Gewicht: So leitet etwa das Kapitel „Die Verdi-Rezeption im deutschen Sprachraum am Beispiel von Eduard Hanslick“ zur Verdi-Renaissance im 20. Jahrhunderts über. In einem eigenen Kapitel werden Giuseppe Verdi als Interpret seiner Werke und die Interpretationen seiner Werke dargestellt, wie sie aus Besprechungen der von ihm selbst geleiteten Aufführungen seiner Werke, aus seinen schriftlich und mündlich überlieferten Anweisungen und aus der zu seiner Zeit geübten Aufführungspraxis abgeleitet werden können. Schließlich wird die Entstehungsgeschichte des Librettos zu Re Lear und Verdis Auseinandersetzung mit diesem Shakespeare-Stoff in Augenschein genommen, der immer dann, wenn die Sujetwahl für ein neues Werk anstand, über einen Zeitraum von fünfzig Jahren in seinen Überlegungen präsent war und den er letztendlich doch nicht komponierte. Und nicht zuletzt ist das Bildmaterial des Bandes großteils neu und wesentlich umfangreicher.
All das und vieles andere mehr soll das Phänomen Verdi noch deutlicher darstellen und es dem Besucher und Hörer seiner Opern leichter zugänglich machen.
Wien, im November 2012
Ch. S.
Zu den Dokumenten und Übersetzungen
D
ie Briefe Giuseppe Verdis, die bei weitem noch nicht alle bekannt sind und wissenschaftlich ausgewertet oder veröffentlicht wurden, gehen in die Tausende. Allein das Archiv des Istituto Nazionale di Studi Verdiani in Parma verfügt über mehr als 28.000 Briefdokumente (auch in Form von Photokopien oder auf Mikrofilm). Schon Verdis Korrespondenz mit Vertretern von drei Generationen des Verlagshauses Ricordi beläuft sich auf über 3.500 Briefe.
Weitere bedeutende Institutionen in Italien, in welchen ein Großteil von Verdis Korrespondenz aufbewahrt wird, sind u.a. die Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova d’Arda, das Archivio Storico di Casa Ricordi, das Museo Teatrale alla Scala in Mailand sowie die Bibliothek des Conservatorio „G. B. Martini“ in Bologna.
Der bereits bekannte Schriftwechsel wird seit kurzem um ein seit Jahrzehnten von einem Mysterium umgebenen Konvolut von 234 Briefen bereichert, die zwischen Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi und Teresa Stolz gewechselt wurden. Man erwartete, daraus Einblick in Verdis Privatleben zu gewinnen. Einer italienischen Musikwissenschafterin und Autographenexpertin wurde vom neuen Besitzer dieses Briefkonvoluts Einsicht in die Dokumente gewährt. Ihre daraus vorläufig gewonnenen Erkenntnisse hat sie dem Verfasser freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Sie werden im Kapitel „Der Briefwechsel zwischen Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi und Teresa Stolz“ ausführlich behandelt.
Die bekannten Briefe wurden und werden, nach Themen, Werken, Schaffensperioden usw. geordnet und mit Kommentaren versehen, als Auswahlen immer wieder veröffentlicht. Während vorwiegend in Italien, aber auch im englischen Sprachraum gewichtige Bände erscheinen, die Dokumente von und über Verdi präsentieren und aufarbeiten, ist ein beträchtlicher Teil seiner Korrespondenz, trotz mancher verdienstvoller Bemühungen, im deutschen Sprachraum wenig bekannt: Umfassende Dokumentensammlungen wie Copialettere, Carteggio Verdi-Ricordi I-III, Carteggio Verdi-Somma, Carteggio Verdi-Luccardi, Carteggio Verdi-Cammarano, Verdi intimo, Carteggi verdiani, Giuseppe Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi oder Oberdorfers Autobiografia dalle lettere liegen nur im Originalwortlaut vor und sind hier allenfalls aus Bibliographien bekannt oder von einigen wenigen Spezialisten verwertbar. In meiner rezenten Simon Boccanegra-Monographie[1] sind zahlreiche Briefe und Dokumente enthalten, die bislang nicht in deutscher Sprache erschienen sind.
Es war mein Bestreben, für das vorliegende Buch Dokumente auszuwählen und vorzulegen, die nicht jedem Leser, der sich für Verdi interessiert, bereits bekannt sind. Aus der Überfülle des verfügbaren Materials mußte eine Auswahl getroffen werden, die einerseits den zur Verfügung stehenden Platz nicht sprengte und andererseits eine angemessene Behandlung der jeweiligen Themen gewährleistete.
Wie in seinen Werken zeigt Verdi auch in seiner Korrespondenz eine Geradlinigkeit der Aussage, die in ihrer Schnörkellosigkeit kaum zu überbieten ist. Man kann also getrost die Dokumente für sich selbst sprechen lassen, ohne erläuternd oder interpretierend eingreifen zu müssen.
B
ei der Übersetzung der im Text zitierten Dokumente habe ich größtes Augenmerk auf Genauigkeit und Vollständigkeit gelegt. Weggelassene, da für das Thema nicht relevante Textpassagen sind mit [...] gekennzeichnet. Ergänzungen, die dem Sinn nach vorzunehmen waren (z.B. aufgrund von Auslassungen im Original, sprachlicher Gegebenheiten oder Flüchtigkeit), sind in [] kenntlichgemacht. Passagen in () stammen von den Autoren der Dokumente. In den Autographen unterstrichene Passagen werden kursiv wiedergegeben.
Stil und Sprachebene der Dokumente wurden beibehalten, unbeholfene Formulierungen nicht geglättet, Interpunktionseigenheiten, Wort- und Gedankenwiederholungen, Fehler bei der (z.T. phonetischen) Schreibweise von Eigennamen („Shaspeare“, „Shachespeare“, „Shespeare“, „Vagner“, „De Restke“, „Rotschild“, „Loeve“, „Tamberlich“, „Quichly“ usw.), Werktiteln (Macbet,Nabuco, Dame aux Camelia) u.dgl. beibehalten.[2] In italienischen Briefen enthaltene fremdsprachige Zitate wurden samt Fehlern („bietifol“, „Ledys“) übernommen und ggf. in [] oder in Fußnoten übersetzt bzw. erklärt. Auch offensichtliche Irrtümer der Autoren der Dokumente (wenn Muzio beispielsweise die Cordelia im Macbeth ansiedelt) wurden im Text belassen und in Fußnoten kenntlichgemacht. Auf die Kennzeichnungen mit [!], [sic!] oder [sic] wurde dabei bewußt verzichtet. Die Orthographie und Zeichensetzung deutschsprachiger Texte der Zeit wurde unverändert übernommen.
Die von den Verfassern der verschiedenen Briefe und Dokumente sehr differenziert verwendeten Anreden „Voi“, „Ella“ oder „Lei“ (Verdi sprach Boito mit „Voi“ an, während Boito das modernere „Lei“ verwendete; Verdi duzte Morelli, dieser blieb hingegen beim respektvollen „Voi“) wurden im Deutschen entsprechend wiedergegeben. Verdi unterschrieb alle seine Briefe, auch die an die wenigen Duz-Freunde gerichteten, unterschiedslos und psychologisch aufschlußreich mit „G. Verdi“, mit einem den Namen schützend umschließenden Schnörkel. Datumsangaben werden in den zitierten Briefen immer vollständig wiedergegeben, auch wenn sie im Original abgekürzt aufscheinen. Fehlende oder falsche Datierungen bei Briefen wurden auf der Grundlage des letzten Wissensstandes der Verdi-Forschung ergänzt bzw. richtiggestellt. Auch unleserliche Passagen in Verdis oft schwer leserlicher Handschrift (er schrieb „wie ein Riese, für den das Schreibwerkzeug zu klein war“, wurde einmal gesagt), die manchmal nicht korrekt transkribiert sind, wurden derart richtiggestellt. Dank gebührt dafür den im Quellennachweis und Bibliographischen Abkürzungsverzeichnis genannten Autoren und Herausgebern, deren aufwendige Forschungstätigkeit bei der Aufarbeitung der zahlreichen Dokumente gar nicht hoch genug geschätzt werden kann.
Werktitel werden, der jeweiligen Fassung bzw. Aufführung entsprechend, immer in ihrer Originalsprache wiedergegeben: z.B. Jérusalem oder Les Vêpres siciliennes in ihrer französischen Originalfassung, Gerusalemme oder I vespri siciliani in ihrer italienischen Version usw. Bei Otello weist die italienische Schreibweise auf die Oper Verdis oder Rossinis oder auf die italienische Textfassung von Shakespeares Theaterstück hin, Othello auf die englische, deutsche oder französische Version der Oper oder des Theaterstücks. Die Schreibweise Don Carlos findet nur für die französische Originalfassung der Oper Verwendung; die italienische Übersetzung trägt den Titel Don Carlo.
Dasselbe gilt für die Opern anderer Komponisten. Die Sprache des zitierten Titels weist immer auf die Sprache der jeweiligen Produktion hin: Guglielmo Tell, Il profeta, Il re di Lahore, L’africana, Gli ugonotti etc. für Aufführungen in italienischer Sprache, Guillaume Tell, Le prophète, L’Africaine, Le roi de Lahore, Les Huguenots etc. für Aufführungen in französischer Sprache usw. Auch die erwähnten Rollennamen in den Sängerportraits folgen diesem System (z.B. Hélène in Jérusalem oder Les Vêpres siciliennes, Elena in Gerusalemme oder I vespri siciliani).
In den verschiedenen Quellen scheint das Pariser Théâtre Italien auch als Théâtre-Italien und Théâtre des Italiens auf. Alle Bezeichnungen sind möglich und gebräuchlich.
Eigennamen von Personen werden immer in der Schreibweise wiedergegeben, in der sie von ihren Trägern verwendet wurden: z.B. Gioachino[3] Rossini, Salvadore Cammarano usw.
Irrtümer und fehlende Textpassagen in der Sekundärliteratur, die auf fehlerhafte oder unvollständige Transkription von Dokumenten zurückzuführen sind, wurden nach bestem Wissen und Gewissen berichtigt, ergänzt und gekennzeichnet.
D
ie Kaufkraft der in Italien im 19. Jahrhundert gebräuchlichen und im Text bei Honoraren und Gagen angegebenen Währungen (bis zur Einigung Italiens Dukaten, Francs, österreichische Lire und Napoleondor, ab 1862 die italienische Lira) und ihre Beträge sind z.T. nur kaum in der Kaufkraft heutiger Währungen wiederzugeben. Grund dafür ist unter anderem der Umstand, daß zwar für manche Währungen Goldparitäten bekannt sind, für andere wiederum nur Silberparitäten, was eine auch nur annähernd genaue Umrechnung unmöglich macht. Bei der Angabe der nur als ungefähre Richtwerte zu verstehenden Umrechnungen habe ich mich unter Berücksichtigung der amtlicherseits angegebenen Inflation außer auf die Angaben der Oesterreichischen Nationalbank (Abteilung für Veranlagungsstrategie und –risiko) und der von den Wirtschaftskammern Österreichs angegebenen Inflationsraten (2000-2011) auch auf die von Herbert Weinstock[4] im Jahre 1967 errechneten Berechnungsgrundlagen, auf die von John Rosselli[5] in mehreren Währungen erstellten Gagentabellen sowie auf den Katalog der Ausstellung Il titanico oricalco. Francesco Tamagno (Teatro Regio di Torino1997, S. 51) gestützt.
Wien, im November 2012
Ch. S.
In allen Opernhäusern der Welt fehlt ein Raum.
Dieser Raum müßte ein beträchtliches Fassungsvermögen besitzen und allen Besuchern vor Beginn, vor allem aber nach Ende der Vorstellungen zugänglich sein. Über seinem Eingang müßte die Aufschrift „Auf der Suche nach den verlorenen Goldenen Zeitaltern“ angebracht sein.
Der Raum, den ich meine, ist der Klageraum.
Ch.S.
Prolog
W
er sich für Gesang in seiner speziellen Ausformung als Operngesang interessiert und zu diesem Thema einschlägige Äußerungen von Komponisten, Sängern, Impresari, Gesangspädagogen, Dirigenten und sonstigen Experten aus den Jahrhunderten seit Erfindung der Kunstform Oper nachliest, wird zwei Dinge bald bemerken. Erstens: Der Begriff „Gesangskunst“ ist seit jeher untrennbar mit dem Wort „Niedergang“ verbunden. Und zweitens: Wirklich gut gesungen wurde anscheinend weniger in der jeweiligen Gegenwart, als vorwiegend in lange zurückliegenden „Goldenen Zeitaltern“.
Die Existenz mancher dieser Goldenen Zeitalter ist nicht von der Hand zu weisen. Viele in sich abgeschlossene Phasen oder Perioden weisen ein solches Goldenes Zeitalter auf, womit eine Zeit der Hochblüte gemeint ist. Das gilt sowohl für Kulturen – vom Alten Ägypten über das antike Griechenland bis zum Römischen Imperium – als auch für Musikepochen, die Karrieren von Komponisten, Interpreten usw. All das kann nur im Rückblick erkannt und zeitlich abgegrenzt werden. Weder Bach noch Mozart, Beethoven oder Verdi hätten ihre Periode bezeichnen, den Verlauf ihres Schaffensprozesses definieren oder deren jeweilige Höhepunkte bezeichnen können.
Das Gesagte gilt auch für die Lebenszeit einer Kunstform wie der Oper. Ungeachtet aller Stile und im nachhinein gewählter Epochenbezeichnungen wie Barock, Klassik oder Romantik hat auch die Kunstform und ihre Ausübung immer wieder Zeiten der Hochblüte erlebt, ob es sich nun um die Epoche der neapolitanischen Oper oder jene der Zeiten der großen Interpreten des Belcanto wie Primadonnen und Kastraten im 17. und 18. Jahrhundert gehandelt hat. Daß die einzelnen Komponisten – abgesehen von den Pionieren wie Peri oder Monteverdi – eine Hochblüte der Kunstform und ihrer Interpretation jeweils zumeist in der Zeit der eigenen Jugend ausmachten und die eigene Gegenwart im Vergleich dazu als Niedergang betrachteten, liegt in der Natur der Dinge und der menschlichen Psyche.
Daraus abzuleiten, daß früher alles besser war, ist – nicht nur wegen der pauschalen Vereinfachung und Verallgemeinerung des Sachverhaltes – ein zweischneidiges Schwert. Der Ausspruch: „Früher war nicht alles besser. Nur das Schlechte war besser gemacht“ ist zwar witzig und trifft auf Einzelbereiche zu, ist aber nicht allgemeingültig. Zutreffend ist die Sichtweise, daß früher nicht alles besser, sondern einfach nur anders war.
Der Cellist Mstislav Rostropowitsch (1927-2007) hat in einem kurz vor seinem Tod produzierten TV-Portrait[6] die Entwicklung zusammengefaßt. „Zu meiner Zeit“, sagte er sinngemäß, „gab es weltweit fünf bis sechs Cellisten, die auf meinem Niveau spielten. Heute gibt es zweihundert und mehr.“ Diese Beobachtung trifft auf Pianisten, Geiger und Sänger gleicherweise zu, ebenso auf Orchester. Es ist geradezu lächerlich, wenn Musikchauvinisten heute behaupten, dieses oder jenes Opernhaus oder dieses oder jenes Orchester sei „das beste der Welt“. Schon Verdi fand derlei Behauptungen lächerlich: „Und überhaupt: das Erste Theater der Welt!? Ich kenne fünf oder sechs dieser Ersten Theater, und ausgerechnet in denen macht man am häufigsten schlechte Musik.“[7]
Wer Ohren hat, um zu hören, und mit international tätigen Dirigenten spricht, weiß, daß die Orchester der großen Opernhäuser wie auch die renommierten Symphonieorchester weltweit heute praktisch alle auf demselben hohen Niveau spielen. Auch verschiedene Jugendorchester können da durchaus mithalten. Unterschiede zwischen Orchestern sind allenfalls aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Instrumente feststellbar, oder auch in der Philosophie der einzelnen Orchester. James Levine beispielsweise hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Tätigkeit an der Metropolitan Opera, New York, die Spielweise des Orchesters dieses Hauses daraufhin ausgerichtet, daß es im Falle einer plötzlich auftretenden Diskrepanz zwischen Orchestergraben und Bühne, die ein Dirigent nicht blitzartig beheben kann, bei den Sängern – Solisten und/oder Chor – „bleibt“, d.h. sich aus eigenem Antrieb darauf konzentriert, die Begleitung der Stimmen aufrechtzuerhalten und nicht auf allfällige, in der Hektik möglicherweise falsche Reaktionen des Dirigenten achtet. So etwas war einmal an der Wiener Staatsoper zu beobachten, als einem berühmten Dirigenten das Schlußterzett im Rosenkavalier so hoffnungslos auseinanderfiel, daß er den Taktstock wegwarf und laut „Aufhören!“ rief. Der Konzertmeister überließ den Maestro seiner Panikattacke und fing Orchester und Solisten wieder ein.
Ebenso weiß man, daß die Qualitätsunterschiede zwischen den Orchestern sogenannter erster Häuser und jenen mittlerer und sogar kleinerer Häuser immer geringer werden. Ein (vorwiegend aus Laien zusammengesetztes) Orchester eines mittleren oder sogar großen italienischen Opernhauses aus der Mitte des 19. Jahrhunderts[8] heute zu hören, ließe einen wohl an die Darbietung der Banda eines süditalienischen Dorfes, die auf dem Hauptplatz Opernpotpourris darbietet, denken.
Auch wenn heute oft beklagt wird, es gäbe keine großen Sängerpersönlichkeiten mehr, trifft das nur bedingt zu. Es gibt sie, in statu nascendi, sozusagen als Rohmaterial, nach wie vor. Und da es im Vergleich zu früher so viele gibt, die hervorragend ausgebildet sind und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere besitzen, können sie sich oft nicht entwickeln, sich durchsetzen und entsprechend ihrem Potential und Können bekannt werden, weil sie zumeist nicht an kleinen und mittleren Häusern sorgfältig und langsam aufgebaut werden, sondern sofort nach der Ausbildung mit (zu) großen und schweren Aufgaben betraut und im internationalen Opernbusiness herumgereicht werden. Das ist verlockend, weil man rasch bekannt wird und gut verdient, führt aber karrieremäßig kaum irgendwo hin. „Heute arbeitet niemand mit diesen Leuten“, sagt die Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, „damit sie womöglich auch zu Persönlichkeiten heranreifen können. Manchmal scheint es, als würde Persönlichkeit sogar stören.“[9] Die Betroffenen machen die Karrieren, die sie eigentlich machen könnten, dann oft nicht, weil die Stimme binnen kurzem überfordert und beschädigt wird, aber auch, weil andere Kollegen physisch resistenter oder billiger sind, willfähriger, an unsäglichen Inszenierungen mitzuwirken, über bessere Beziehungen und Netzwerke verfügen, aggressivere Agenten oder stärkere Nerven haben usw. Die Anzahl der potentiellen Könner beträgt jedenfalls ein Vielfaches von jenen, die dann tatsächlich Karriere machen. Ausnahmen wie die sattsam bekannten, von PR-Maschinerien und Medien extrem und besinnungslos gehypten Karrieren, die dann auch nach wenigen Jahren wieder vorbei sind, bestätigen die Regel.
„Heute macht man auf der Bühne das, was der Markt fordert oder was der Regisseur will“, stellt die Sopranistin Montserrat Caballé fest. „Und wenn sich Erfolg einstellt, werden die jungen Sänger verrückt und wagen alles – obwohl ihnen noch die Reife fehlt. Viele Operndirektoren sind nur noch Funktionäre oder Manager, die auf den Kartenverkauf schauen. Und manchmal sehe ich Vorstellungen, die einfach peinlich sind. Dann denke ich: ‚Der arme Komponist, was hat man mit ihm gemacht.‘“[10]
Daß der Klassiksektor der Musikindustrie seit Jahren in einem beklagenswerten Zustand ist, ist bekannt. Weniger bekannt sind die Gründe, die zu dieser Misere geführt haben. Obwohl oft die Internetpiraterie als Hauptverursacher der eingebrochenen Verkaufszahlen ins Treffen geführt wird (wobei unberücksichtigt bleibt, daß nicht jeder, der sich Musik irgendwo gratis herunterlädt, auch wirklich ein potentieller Käufer des Produkts wäre), sind sie zum Teil selbstverschuldet. Der Bariton Thomas Quasthoff, der 2012 seine Gesangskarriere abrupt beendete, gibt darüber Auskunft: „So wie die Branche mittlerweile funktioniert, bin ich froh, auch mit diesen Dingen in Hinkunft nichts mehr zu tun haben zu müssen. [...] Seit 1999 hatte ich [bei der Deutschen Grammophon] zehn unterschiedliche Produzenten erlebt, auch da war keine Kontinuität. Es gibt auch keine Kontinuität in dem Sinne, daß junge Sänger in aller Ruhe aufgebaut werden. Auch war die exklusive Zugehörigkeit eines Künstlers zur DG früher eine hohe Auszeichnung. Das kann ich nicht mehr entdecken. Da werden Leute schnell hochgepuscht, die den Status gar nicht verdienen. [...] Die Zeiten haben sich geändert. Wenn ich mir heute von einem 30jährigen Wirtschaftsmenschen sagen lassen soll, wie das Musikgeschäft funktionieren muss – dazu habe ich mit 52 keine Lust. Ein Beispiel: Als ich meine erste Jazz-CD plante, kam tatsächlich ein Marktanalytiker zu mir und meinte, sie hätten eine Untersuchung durchgeführt und diese hätte ergeben, die CD würde überhaupt niemanden interessieren, würde nicht laufen! Wie konnten die eine Analyse machen, wo sie doch das Produkt nicht wirklich kannten, überhaupt nicht wussten, was für Repertoire geplant war? Das kann es doch nicht sein! Die Tatsache dazu: Das Jazzprojekt führte zur zweiterfolgreichsten CD in meiner DG-Karriere, verkauft wurden fast 100.000 Stück. So sieht das heute aus. Da sitzen Leute, die glauben, mir etwas über Musik und Management erzählen zu können – da lache ich mich kaputt!“[11]
W
ie der folgende Zitatenquerschnitt zeigt, setzte der Niedergang der Gesangskunst bald nach der Etablierung der Kunstform Oper ein. Schon 1723 beklagte Pier Francesco Tosi dies in einem Werk[12], das auch heute noch immer wieder neu aufgelegt wird: „Meine Herren Maestri, in Italien hört man nicht mehr die Stimmen der vergangenen Zeiten!“ Fünfzig Jahre später schlug Giovanni Battista Mancini in dieselbe Kerbe: „Viele meiner Leser werden sich fragen, weshalb nach einer so großen Anzahl von tüchtigen Sängern seit einiger Zeit nicht nur bei den Italienern selbst, sondern sogar bei den Menschen jenseits der Alpen die Meinung entstanden ist, daß unsere Musik völlig in Verfall geraten ist und daß es an guten Schulen und guten Sängern mangelt. [...] Man muß jedoch zugeben, daß diese Meinung hinsichtlich der Sänger leider der Wahrheit entspricht, bei denen man fast niemanden nachkommen sieht, der die Leere, die [das Abtreten der] alten Künstler hinterlassen hat, auffüllt.“[13] Man sieht, daß es selbst in der damaligen Hochblüte der Gesangskunst – die Oper wurde zu jener Zeit von virtuosen Kastraten und Primadonnen dominiert – Anlaß zu nostalgischen Klagen gab.
Apropos Kastraten: Sie und ihre unversehrten Sängerkollegen waren im 18. Jahrhundert die geradezu mythischen Vertreter des bel canto[14]. Gesangsexperten wie Pacini[15], der in seiner Jugend noch den Kastraten Pacchiarotti[16] gehört hatte, erinnerte sich nostalgisch: „Ach, wo sind nur die Sänger geblieben, die mit einem einfachen Rezitativ [dem Publikum] einen allgemeinen Aufschrei der Bewunderung entlockten? Wo sind die Töne geblieben, die einem zu Herzen gingen?“
Auch Rossini, in seiner Jugend selbst sängerisch aktiv, schloß sich dem Chor der Gesangspessimisten an. An Florimo[17] schrieb er: „Heutzutage ist die Kunst auf die Straße gegangen; das alte Genre mit seinen Verzierungen wird durch Hektik ersetzt, der getragene Vortrag durch Gebrüll [...] und schließlich das lieblich Empfindsame durch geifernde Tollwut. Wie Ihr seht, lieber Florimo, wird die Sache heute gänzlich von den Lungen bestimmt; der Gesang, der einem zu Herzen geht[18], und die Pracht des Gesanges stehen auf dem Index.“[19]
1826 arbeitete Rossini seinen Maometto II für die Pariser Opéra zu Le Siège de Corinthe um, im Jahr darauf den Mosè in Egitto zu Moïse et Pharaon, ou Le passage de la Mer Rouge. Bei der Ausgestaltung der Gesangspartien nahm er auf die Virtuositätsfeindlichkeit des an die Gluck-Interpreten gewöhnten Pariser Publikums Rücksicht: Die Rollen sind in den französischen Neufassungen weit weniger ausgeziert als in den italienischen Fassungen. Die französischen Kritiker reagierten darauf begeistert: „Endlich“, so der Tenor einiger Besprechungen, „hat sich jemand [nämlich Rossini] gefunden, der die aboyements [Gekeife, Geschrei] der Gluck-Interpreten aus der Opéra verbannt und die Sänger zu stimmlichem Wohlverhalten erzieht“. Gemeint waren jene Sänger, die der sogenannten école du cri [Schule des Schreiens] der Gluck-Tradition angehörten. Nicht einmal Napoleon Bonaparte höchstselbst war es gelungen, den ihm verhaßten cri der Gluckisten auszurotten, obwohl er einmal einige Sängerinnen ebenso unverblümt wie vergeblich aufgefordert hatte: „Meine Damen, würden Sie heute abend etwas weniger schreien als sonst?“
Einem spanischen Musiker, der Rossini 1845 in Bologna besucht hatte und bei dieser Gelegenheit über den Niedergang des Musiktheaters geklagt hatte, schrieb der Meister: „Ihr habt recht, heute geht es nicht mehr darum, wer besser singt, sondern wer mehr schreit. In ein paar Jahren werden wir in Italien keinen einzigen Sänger mehr haben.“[20] Diese Äußerung trifft aus Rossinis Sicht insofern zu, als der kultivierte falsettone-Gesang[21], den Rossini über alles liebte und in seiner Jugend selbst erlernt und betrieben hatte, ausstarb. Auf Rossinis hypersensibles Gehör wirkten die mit Vollstimme gesungenen hohen Töne wie der „Schrei eines Kapauns, dem die Gurgel durchgeschnitten wird“.[22] Als der mit einer ausgezeichneten Höhe gesegnete Tenor Enrico Tamberlick einmal zu Rossini auf Besuch kam, sagte letzterer zu seinem Diener: „Er soll eintreten, aber sein Cis in der Garderobe ablegen. Er kann es dann wieder mitnehmen, wenn er geht.“
1858 hatte sich die Situation für Rossinis Ohren nicht gebessert, im Gegenteil. Bei einem Essen in seiner Villa in Passy, zu dem auch Edmond Michotte[23] eingeladen war, äußerte Rossini zu dem leidigen Thema folgendes:
Leider ist der bel canto nun vollkommen verloren: Es besteht keine Hoffnung mehr auf seine Wiederkehr. Für die Künstler unserer Tage besteht der Gesang in einer konvulsivischen Verzerrung der Lippen, aus denen, besonders bei den Baritonen, tremolierende Töne herauskommen, die dem Dröhnen sehr ähnlich sind, das in meinen Ohren das Schwanken des Fußbodens beim Eintreffen des Karrens meines Bierlieferanten verursacht; gleichzeitig ergehen sich die Tenöre in lautem Geschrei und die Primadonnen in gurgelnden Geräuschen, die mit der wahren Stimmgebung und den Roulades außer den Reimen[24] nichts gemein haben. Ich spreche gar nicht von den Portamenti der Stimme, von dieser Art Eselsgeschrei, das von der Höhe in die Tiefe gleitet, und von dem Trompeten der Elefanten, das von der Tiefe in die Höhe fährt. Die Natur erschafft bedauerlicherweise kein ganz vollkommenes Organ, es ist deshalb erforderlich, daß der künftige Sänger das Instrument, dessen er sich bedienen muß, selbst aufbaut. Und wie lang und schwierig ist diese Arbeit! In vergangenen Zeiten half man dem Fehler der Natur dadurch ab, daß man Kastraten herstellte. Diese Methode erforderte zwar Heldenmut, aber die Ergebnisse waren wunderbar. Ich erinnere mich, den einen oder anderen in meiner Jugend gehört zu haben: Die Reinheit, die ans Wunderbare grenzende Flexibilität dieser Stimmen, und vor allem die zu Herzen gehenden Töne bewegten und faszinierten mich so sehr, daß ich es gar nicht auszudrücken vermag.[25]
Beinahe zur gleichen Zeit meldete sich Giuseppe Verdi zu dem Thema zu Wort: „Die Frauen wie die Männer sollen singen und nicht schreien: Sie sollen daran denken, daß vortragen nicht brüllen bedeutet! Wenn man in meiner Musik nicht viele Vokalisen findet, darf man sich deswegen nicht die Haare raufen und wie Besessene toben.“[26]
Außer den Beschwerden über schreiende Sänger gab es teilweise recht deftig formulierte Klagen über andere Sängermankos, geäußert von unbezweifelbar kompetenten Experten wie zum Beispiel Gaetano Donizetti. Als er im Juni 1844 am Wiener Kärntnertortheater die Generalprobe seines Roberto Devereux besuchte, mußte er nolens volens das Weite suchen: „Ich habe mir bei der letzten Probe zwei Akte in einer Loge angehört, den dritten hielt ich nicht mehr aus – es gab zu viele falsche Noten, Rollenunkenntnis, mangelndes Spiel etc. Man sagt mir, daß gestern alles noch schlimmer gewesen sein soll.“ Und über die Premiere: „Die Montenegro[27] hatte jedes nur erdenkliche Pech: Sie begann sogar eine Phrase eine Terz zu tief, unterbrach sich in der Mitte und setzte eine Terz höher wieder ein. Die falschen Noten, die gestern von ihr, von Ronconi und von Varesi produziert wurden, sind unbeschreibbar.“[28] Und, im selben Brief: „Es tut mir leid wegen der Montenegro. [...] Aber, bei Gott!, wenn diese arme Frau beim Singen nicht richtiger intoniert und dabei einen weniger schiefen Mund macht, wird es schwer sein, daß sie gefällt. Sie hat kein Solfège studiert und hat kein gutes Gedächtnis; sie hat Gefühl, aber ihr Gefühl kann sich keinem Rhythmus anpassen.“
Ähnliche Probleme hatte offenbar die berühmte Eugenia Tadolini[29], die gegen Verdis Willen 1848 in Neapel die Lady Macbeth sang. Über sie wußte Donizetti zu berichten: „Sie hatte eine Stimme wie eine alte Zikade, machte Fehler, unterbrach sich und war schrecklich.“ Auch der gefeierte Tenor Napoleone Moriani[30], der in Italien als „tenore della bella morte“ – der Tenor mit den schönen Sterbeszenen – bekannt war, blieb nicht verschont. Dieser hätte nach Donizettis Wunsch bei seinen Auftritten öfter „gut bei Stimme sein und den guten Willen haben [müssen], nicht immer, aber wenigstens manchmal allegro zu singen. Was die Seele anlangt, so haben er und die Primadonna davon soviel wie ein Spatz.“[31]
Felix Mendelssohn Bartholdy äußerte sich über die berühmte Giuditta Pasta, Bellinis erste Amina (La sonnambula) und Norma sowie Donizettis erste Anna Bolena, folgendermaßen:
Neulich hörte ich die Pasta in der Semiramide. Sie singt jetzt, namentlich in den Mitteltönen, so fürchterlich falsch, daß es eine wahre Qual ist; dabei sind natürlich die herrlichen Spuren ihres großen Talents, die Züge, die eine Sängerin ersten Ranges verrathen, oft unverkennbar. In einer andern Stadt würde man das schreckliche Detoniren erst empfunden und nachher überlegt haben, daß dies die große Künstlerin sei; hier sagte sich jeder vorher, dies sei die Pasta, sie sei alt, sie könne daher nicht mehr rein singen, man müsse also davon abstrahiren. So würde man sie anderswo vielleicht ungerechterweise herabgewürdigt haben; hier war man ungerechterweise entzückt, und zwar mit voller Refexion, mit Bewußtsein des Drüberstehens entzückt. Das ist ein schlimmes Entzücken.[32]
Dieser vom 23. August 1841 stammende Kommentar berichtet über die erst 43jährige Sängerin, die sich wegen ihrer seit ungefähr 1837 bestehenden stimmlichen Probleme im Vorjahr von der Bühne zurückgezogen hatte, jetzt aber gezwungen war, wieder aufzutreten, weil sie dank einer unfähigen Wiener Bank fast ihr ganzes Vermögen verloren hatte. Die von Mendelssohn als „alt“ empfundene, für heutige Begriffe aber durchaus junge Künstlerin hatte ihre Probleme in der Mittellage vermutlich durch den Wechsel vom Mezzosopran- ins Sopranfach verursacht.
Eine wenig bekannte, plastische Beschreibung Giuditta Pastas verdanken wir George Sand[33]:
Auf der Bühne erschien die Pasta noch immer jung und schön. Sie war klein, dick und hatte zu kurze Beine, wie viele Italienerinnen, deren herrliche Büste nicht zu den übrigen Körperverhältnissen paßt. Aber dennoch gelang es der Künstlerin durch den Adel ihrer Bewegungen und die Feinheit ihrer Gestikulation groß und majestätisch zu erscheinen. Ich war sehr unangenehm überrascht, als ich ihr am folgenden Tage begegnete. Sie stand in ihrer Gondel und war mit jener übertriebenen Sparsamkeit gekleidet, welche die Hauptsorge ihres Lebens geworden war. [...] in ihrem alten Hut und Mantel hätte man die Pasta für eine Logenschließerin halten können. Als sie jedoch eine Bewegung machte, um dem Gondelführer den Platz zu bezeichnen, wo sie landen wollte, lag darin die ganze Majestät der Königin oder Göttin.[34]
Zitate wie jenes von Felix Mendelssohn Bartholdy könnte man beinahe beliebig fortsetzen. Sie finden sich auch bei anderen nicht-italienischen Komponisten wie zum Beispiel bei Franz Liszt, der 1838 oft die Mailänder Scala besuchte und sich danach abfällig über Berühmtheiten wie die Schoberlechner[35] oder die Brambilla[36] äußerte. Eines wird aus all diesen Klagen klar: daß die bei Opernliebhabern – einer Species, die mit jener der Musikliebhaber nur entfernt verwandt ist – weit verbreitete Annahme, es habe einmal ein „Goldenes Zeitalter“ des Gesanges – zum Unterschied von den Goldenen Zeitaltern der Kunstform Oper – gegeben, dessen unwiederbringlicher Verlust zu beklagen sei, oft mehr auf eine subjektive Empfindung als auf eine nachweislich bestehende Realität zurückzuführen ist. Die bis heute gerne mit dem Epitheton „legendär“ ausgestatteten Sänger dieser obskuren mythischen Epoche hätten demnach Wunder an überwältigender Stimmschönheit, vollendeter Gesangstechnik, raffiniertester Eloquenz der Interpretation, höchster Musikalität, ausgeprägtem Stilgefühl, erlesenstem Geschmack, raumfüllender Bühnenpräsenz, überbordendem schauspielerischen Talent und derlei Qualitäten mehr gewesen sein müssen. Mit einem Wort, sie müssen in jeder Hinsicht besser als alles gewesen sein, was in späteren Jahren zu hören war.
Wenn man derlei Äußerungen allerdings näher betrachtet, stellt sich zumeist heraus, daß das jeweilige Goldene Zeitalter entweder in die Prägungsphase der ersten jugendlichen Begeisterung des Betreffenden für die Oper (Abteilung: Verklärte Jugenderinnerungen) fällt, oder aber eine oder zwei Generationen zurückliegt, je nachdem, ob das Hörensagen von der Generation der opernbegeisterten Eltern oder Großeltern des Verherrlichers verlorener Größe herstammt. Es ist Aufgabe der Psychologen und Soziologen, zu erklären, was es mit dem verbreiteten Phänomen der Schaffung von Mythen, Helden und Göttern und deren Anbetung auf sich hat. Und weshalb „früher“ vieles oder sogar alles „besser“ war.
Selbst Gesangsdarbietungen im privaten Bereich evozierten die Nostalgie nach der Kunst vergangener Tage. George Sand, eine realitätsbezogene Kämpfernatur mit hellsichtigem Intellekt, nimmt diesen Standpunkt ein, wenn sie in ihren Lebenserinnerungen unter Bezugnahme auf die Schwester ihrer Urgroßmutter berichtet:
Literatur und Musik waren die einzige Beschäftigung dieses Kreises. Aurora war von engelhafter Schönheit; ihr Verstand war ausgezeichnet; durch die Gründlichkeit ihrer Bildung stand sie den aufgeklärtesten Geistern ihres Zeitalters gleich. IhreFähigkeiten wurden durch den Umgang, die Unterhaltung und die Umgebung ihrer Mutter noch entwickelt und ausgebildet. Überdies hatte sie eine prächtige Stimme, ich habe nie eine bessere Musikerin gekannt. Man gab auch komische Opern bei Ihrer Mutter; sie machte Colette im Devin du village[37], Azemia in den Sauvages[38] und alle Hauptrollen in den Stücken Gretry’s und Sedaine’s. In ihrem Alter habe ich sie hundert Mal die Melodien alter italienischer Meister singen hören, die sie zu ihrer Hauptnahrung erkoren hatte, wie Leo, Porpora, Pergolesi, Hassa[39] u.s.w. Ihre Hände waren gelähmt, sie begleitete sich mit zwei oder drei Fingern auf einem alten, kreischenden Klaviere: ihre Stimme zitterte, war aber immer richtig und umfangreich, und Schule und Vortrag verlieren sich nie. Sie las alle Partitionen[40]vom Blatte undich habe niemals besser singen oder begleiten gehört.Sie hatte jene großartige Manier, jene breite Einfachheit, jenen reinen Geschmack, jene Klarheit der Betonung, die man nicht mehr hat, die man heut zu Tage nicht einmal kennt.[41]
Seit jeher waren auch große Teile des Publikums, genau wie die oben zitierten Musiker, mit dem „Früher war alles besser“-Bazillus infiziert. Als beispielsweise der später allseits vergötterte Tenor Enrico Caruso seine ersten Auftritte an der New Yorker Metropolitan Opera absolvierte, wurde er von Publikum und Kritik mit dem abschätzigen Vorwurf konfrontiert, er könne seinem Vorgänger Jean de Reszke nicht das Wasser reichen. Auch das ist ein Phänomen der Opernwelt: Erfolgreiche Sänger werden seit Orpheus’ Zeiten mit gekrönten, regierenden Häuptern gleichgesetzt und müssen derohalber zwangsweise „Nachfolger“ haben oder sein, und zwar indem sie „ein(e) neue(r) ...“ sind. An die Stelle der Punkte kann man in der Musikgeschichte beliebige Namen setzen, von Farinelli bis Rubini, Duprez, Fraschini, Bonci, Patti, Caruso, Ruffo, Schaljapin oder Callas.
Die Erforschung und Dokumentation der historischen Realität dieser sagenhaften Goldenen Zeitalter, in denen Publikum und Autoren aus der Sicht mancher heutiger Opernbegeisterter sich wohl gleichermaßen in einem ständigen Begeisterungsrausch befunden haben müssen, erscheint nicht nur aus den genannten Gründen von Interesse, sondern auch, wenn man liest, wie Giuseppe Verdi, jener italienische Komponist, der wie kein anderer den Höhepunkt der italienischen Opernkunst im 19. Jahrhundert (wiederum ein Goldenes Zeitalter) personifiziert, die Opernhäuser seiner Zeit und deren Personal beurteilte:
Das Repertoiretheater wäre eine ausgezeichnete Sache, aber ich halte es nicht für realisierbar. Die Beispiele der Opéra und Deutschlands[42] haben für mich sehr wenig Wert, weil die Aufführungen in all diesen Theatern beklagenswert sind. In der Opéra ist die mise en scène hervorragend, an sorgfältiger Ausstattung und gutem Geschmack ist sie allen Theatern überlegen, aber der musikalische Teil ist miserabel. Immer höchst mittelmäßige Sänger (seit ein paar Jahren mit Ausnahme von Faure[43], Orchester und Chor lustlos und ohne Disziplin. Ich habe in dem Opernhaus Hunderte von Vorstellungen gehört, kein einziges Mal eine musikalisch gute. Aber in einer Stadt mit 3.000.000 Einwohnern finden sich immer zweitausend Personen, die den Zuschauerraum auch bei einer schlechten Vorstellung füllen.
In Deutschland sind die Orchester und Chöre aufmerksamer und gewissenhafter; sie spielen genau und gut; dennoch habe ich in Berlin klägliche Vorstellungen gesehen. Das Orchester ist grob und klingt grob. Der Chor nicht gut, die mise en scène ohne Charakter und ohne Geschmack. Die Sänger ... oh, die Sänger schlecht, absolut schlecht. Ich habe dieses Jahr in Wien die Meslinger[44] (ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig schreibe) gehört, die als die Malibran[45] Deutschlands gilt. Gott im Himmel! Eine jämmerliche und ausgesungene Stimme; geschmackloser und unziemlicher Gesang, annehmbares Spiel. Unsere drei oder vier Primadonnen von Ruf sind ihr, was Stimme und Gesangsstil anbelangt, unendlich überlegen und spielen mindestens ebenso gut.
In Wien (das ist heute das erste Theater Deutschlands) liegen die Dinge besser, was Chor und Orchester (beides hervorragend) anbelangt. Ich habe mehrere Vorstellungen gehört und die Leistungen von Chor und Orchester sehr gut gefunden, die mise en scène aber mittelmäßig, und Sänger, die unter dem Mittelmaß waren; die Vorstellungen kosten aber gewöhnlich wenig; das Publikum (man läßt es während der Vorstellung im Dunkeln sitzen[46]) schläft und langweilt sich, applaudiert am Ende jedes Aktes ein bißchen und geht nach Schluß der Vorstellung nach Hause, ohne Unbehagen und ohne Begeisterung. Und das mag für diese nordischen Naturen ausreichen; aber bringe mal eine ähnliche Vorstellung in eins von unseren Opernhäusern, und Du wirst sehen, was Dir das Publikum für Symphonien komponiert! Unser Publikum ist zu erregbar und würde sich nie mit einer Primadonna wie in Deutschland zufriedengeben, die achtzehn- oder zwanzigtausend Gulden im Jahr bekommt. Wir brauchen Primadonnen, die nach Kairo, Petersburg, Lissabon, London usw. für 25000 bis 30000 Francs im Monat gehen, aber wie soll man die bezahlen? An der Scala haben sie dieses Jahr eine Truppe, wie man sie besser nicht finden kann. Eine Primadonna, die eine schöne Stimme hat, gut singt, äußerst lebendig ist, jung, schön, und noch dazu eine der Unseren. Einen Tenor, der vielleicht der erste ist, bestimmt aber unter den allerersten. Einen Bariton, der nur einen einzigen Rivalen, Pandolfini, hat. Einen Baß, der keinen Rivalen hat. Und trotzdem macht das Theater nur magere Geschäfte. Letztes Jahr sprach man sehr gut von der Mariani! Dieses Jahr begann man zu sagen, daß sie ein bißchen müde sei (notabene das ist nicht wahr).
Jetzt sagt man, daß sie gut singt, aber das Publikum nicht anzieht etc. ... etc. ... wenn sie nächstes Jahr zurückkäme, würden alle sagen ... oh, immer dasselbe etc. etc. Ich erinnere mich, in Mailand einen gewissen Villa gekannt zu haben, einen alten Impresario aus der Zeit, in der Lalande, Rubini, Tamburini und Lablache[47] an der Scala waren, der mir sagte, daß das Publikum nach [anfänglich] großer Begeisterung Rubini schließlich auspfiff und nicht mehr ins Theater ging, so daß die Impresa[48] eines Abends ganze sechs Billette verkaufte!! Unglaublich!! Jetzt frage ich Dich, ob bei unserem Publikum eine ständige Truppe wenigstens drei Jahre lang möglich ist! Und weißt Du, was eine Truppe, wie sie jetzt an der Scala ist, jährlich kosten würde? Der Mariani kann es wohl Vergnügen machen, an der Scala eine Saison lang für 45000 oder 50000 Francs zu singen, aber wenn man ihr einen Jahresvertrag böte, würde sie natürlich eine Monatsgage von 15000 Francs verlangen, wie sie im Ausland 25 oder 30 verdienen kann. Ebenso ein Tenor ... etc. etc. Oh, mein Gott, was für ein langer Brief! Ich hätte Dir viele, viele andere Sachen zu sagen, aber zu dem, was ich Dir gesagt habe, wirst Du den Rest stillschweigend ergänzen.[49]
1875 interviewte eine Musikzeitschrift Verdi anläßlich der Aufführungen der Messa da requiem und der Aida in Wien zweimal zu Fragen des Gesanges:
Ueber Sänger hat Verdi seine eigenen Ansichten. „An Stimmen fehlt es gewiß nicht in Deutschland“, sagt er, „sie sind beinahe klangvoller als die italienischen, die Sänger aber betrachten den Gesang als eine Gymnastik, befassen sich wenig mit der Ausbildung der Stimme und trachten nur in der kürzesten Zeit ein großes Repertoire zu erhalten. Sie geben sich keine Mühe, eine schöne Schattirung in den Gesang zu bringen, ihr ganzes Bestreben ist dahin gerichtet, diese oder jene Note mit großer Kraft hervorzustoßen. Daher ist ihr Gesang kein poetischer Audruck der Seele, sondern ein physischer Kampf ihres Körpers.[50]
Ein Wiener Reporter, welcher Verdi heimsuchte, erzählt Folgendes: Der Maestro sprach voll Lobes vom Chor und Orchester unserer Oper. „Ich habe selten so viele jugendkräftige Stimmen zusammen gehört. Der Chor ist bewunderungswürdig, der beste, der mir noch vorgekommen.“ Wir sprachen von den Sängern, die dem Requiem zu so glänzender Aufnahme verholfen haben. „Einen Theil der Ehre“, sagte Verdi, „kann Oesterreich für sich in Anspruch nehmen, die Damen gehören ja zu Euch.[51] Indessen“, corrigirte er sich fein lächelnd, „ganz können wir sie Euch doch nicht überlassen, die Art, wie sie singen, ist italienisch. Das haben sie bei uns gelernt.“ Ich stimmte bei. „Sehen Sie“, fuhr Verdi fort, „man ist gegen die italienischen Sänger manchmal ungerecht, wenn man ihnen vorwirft, daß sie dem bel canto, dem Gesang zuliebe, das Spielen vernachlässigen. Wie viele Sänger giebt es denn, die beides vereinigen, spielen und singen können? In der komischen Oper ist beides leicht vereint. Aber in der tragischen! Ein Sänger, der von der dramatischen Action ergriffen ist, dem jede Fiber seines Körpers bebt, der ganz aufgeht in der Rolle, die er schafft, der wird den rechten Ton nicht finden. Vielleicht eine Minute lang, in der nächsten halben Minute singt er schon falsch oder die Stimme versagt. Für Action und Gesang ist selten eine Lunge stark genug. Und doch bin ich der Meinung, daß in der Oper die Stimme vor Allem ein Recht hat, gehört zu werden. Ohne Stimme giebt es keinen rechten Gesang.“[52]
Bei der Beurteilung der Sänger, der von ihnen verursachten Krisen der Gesangskunst und deren anscheinend irreversiblem Verfall ist ein Faktum von herausragender Bedeutung: Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sangen die Sänger überwiegend zeitgenössische Musik. Sie sind in diesem Sinne also als Spezialisten zu betrachten. Viele Klagen über Sänger sind deshalb primär unter dem Gesichtspunkt eines sich verändernden Kompositions- und Vortragsstils zu verstehen, dem sich diese anzupassen hatten. Ein Extremfall für Anpassungsprobleme an einen neuen Stil war Adolphe Nourrit (Paris 1802 – Neapel 1839). Er war fünfzehn Jahre lang der erste Tenor der Pariser Opéra, ein kultivierter falsettone-Sänger, der nach dem Auftauchen von Gilbert-Louis Duprez (Paris 1806 – Poissy 1896), einem Tenor, der zu seiner Zeit als Brachialsänger empfunden wurde und der – gesangshistorisch nicht ganz korrekt – als der Erfinder des mit Bruststimme gesungenen hohen C bezeichnet wird, nach Italien ging, um seine Gesangsmethode auf diesen vom Publikum bejubelten neuen Stil umzustellen. Angesichts der Erfolglosigkeit seiner Versuche beging Nourrit Selbstmord.[53]
Als Beispiel für das Repertoire eines berühmten Sängers der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts möge der Tenor Giovanni Battista Rubini (Romano Bergamasco 1794 – 1854) dienen. Der mit einem formidablen musikalischen Gedächtnis ausgestattete Sänger trat im Laufe seiner Karriere in 156 Rollen in Opern von 59 Komponisten auf. Darunter befanden sich zahlreiche Uraufführungen von Werken, deren Hauptrollen eigens für ihn komponiert worden waren. Die in seinem Repertoire meistvertretenen Komponisten sind Bellini (8 Opern), Donizetti (14), Fioravanti (5), Generali (4), Mayr (11), Mercadante (6), Mosca (5), Pacini (9), Paër (4), Raimondi (4), Rossini (20 Opern, 2 Kantaten)[54], allesamt Musiker, die zum Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens Rubinis in der jeweiligen Rolle noch am Leben waren, also zeitgenössische, „moderne“ Autoren. Als Rubini 1815 den Ferrando in Mozarts Così fan tutte, 1831 den Don Ottavio in Don Giovanni oder 1821 den Uriel in Haydns Schöpfung sang, Werke „alter“ Autoren, war dies eher ungewöhnlich.[55] Selbstverständlich differierten auch die Kompositionsstile und die vokalen Anforderungen der Werke, die Rubini im Repertoire hatte, doch schrieben ihre Komponisten sie alle in Kenntnis und unter Berücksichtigung der stimmlichen Konstitution und technischen Möglichkeiten ihres Interpreten (so schrieb Bellini „seinem“ Tenor Rubini viele Partien „in die Kehle“).
Im Gegensatz dazu sehen sich heutige Sänger mit der beinahe unlösbaren Aufgabe konfrontiert, Gesangsstilen von Monteverdi bis Reimann zu entsprechen. Die Folge davon können zwei Phänomene sein: einerseits Sänger, die mehr oder minder die ganze Palette des Repertoires abdecken (müssen) und dabei nicht allen Interpretationsstilen wirklich gerecht werden können, und andererseits Sänger, die sich auf eine Epoche oder einen Kompositionsstil spezialisieren und deshalb bewußt auf Musik mehrerer Jahrhunderte verzichten.
Daß Klagen über stilistische Unzulänglichkeiten zutreffend nur über die erste Gruppe von Interpreten geäußert werden können, versteht sich von selbst. Wenn Rossini, Bellini, Donizetti, Pacini oder Mercadante mit dem gesangstechnischen und stilistischen Rüstzeug eines Mascagni-Interpreten gesungen wird, oder Verdi mit jenem eines Purcell- oder Händel-Sängers – all dies möglicherweise noch mit Aussprache-, Betonungs- oder Phrasierungsfehlern garniert, die aus Unkenntnis der gesungenen Sprache gemacht werden –, mag das von unerfahrenen und ahnungslosen Zuhörern hingenommen werden, ist aber im Sinne der betroffenen Komponisten inakzeptabel. Die in diesen Fällen gerne ins Treffen geführte „Universalität“ und „Internationalität“ der Musik, mit der solche Mängel kaschiert werden sollen, führt sich bei der Lektüre des Briefwechsels zwischen Komponisten und Librettisten ad absurdum und entlarvt sich dabei rasch als Festrednergeschwätz. Es wird nämlich ersichtlich, daß die Mühe und skrupulöse Gewissenhaftigkeit, die die Autoren – im vorliegenden Fall Verdi und seine Textdichter – auf ihre Arbeit verwandten, selbstredend für ein Publikum unternommen wurde, das demselben Kulturkreis wie sie selbst angehörte, wie Verdi im Gespräch mit dem Orientalisten Italo Pizzi selbst formulierte:
Die Kunst muß nationalen Charakter haben; die Wissenschaft nicht. Aber die Italiener sind Italiener und die Musik für die Italiener muß italienisch sein. Wir sind anders als die Deutschen, und noch mehr als die Franzosen (und er betonte diese Worte) und die Russen, und wir haben eine andere Weise zu fühlen.[56]
Libretto- und Musiksprache sowie szenische Umsetzung der Werke waren im 19. Jahrhundert – im Gegensatz zu heute – auf allgemeines Publikumsverständnis ausgerichtet und setzten eine gewisse Bildung und die Kenntnis der Sprache, in der gesungen wurde, voraus. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 1869 auf die rund 21 Millionen zählende Bevölkerung Italiens 17 Millionen Analphabeten[57] entfielen: Verdis Werke waren in einer Weise populär, die heute kaum mehr vorstellbar ist (selbst in den 1950er Jahren konnte man in Italien noch Bauarbeiter bei der Arbeit Verdi-Arien singen hören). Darüber hinaus wurde das Publikum, dem eine Vorbereitung auf das Stück ermöglicht werden sollte, über das zur Aufführung gelangende Werk informiert: Zu diesem Zweck wurden bei den Vorstellungen die Libretti der Opern in der jeweils gespielten Fassung verkauft. Diese jeweils aktuellen Textbücher berücksichtigten alle musikalischen und/oder textlichen Änderungen, Kürzungen, Striche oder Hinzufügungen der jeweiligen Aufführungsserie; sie stellen daher für die Musikwissenschaft wichtige aufführungsgeschichtliche Dokumente dar.
Da die Oper nicht nur in Italien erfunden, sondern dort auch zur Hochblüte gebracht wurde und in ihrer Breitenwirkung am erfolgreichsten war[58], erscheint es zielführend, die Wechselwirkungen zwischen Komponisten und Interpreten anhand eines italienischen Komponisten darzustellen. Die ausführlichsten Äußerungen über Gesangssolisten und sonstige Interpreten sowie über Fragen der Theaterpraxis finden sich in der Korrespondenz Giuseppe Verdis mit seinen zahlreichen Briefpartnern. Diese Dokumente decken einen Zeitraum von rund sechzig Jahren ab und sind als völlig unbeschönigte Aussagen zu werten, da Verdi beim Verfassen seiner Briefe nicht mit deren Veröffentlichung liebäugelte, im Gegenteil. Doch auch gegen seinen Willen greift die Musikforschung zwangsläufig auf diese Dokumente zurück und hält es mit Johann Wolfgang von Goethe: „Von bedeutenden Männern nachgelassene Briefe haben immer einen großen Reiz für die Nachwelt, sie sind gleichsam die einzelnen Belege der großen Lebensrechnung, wovon Thaten und Schriften die vollen Hauptsummen darstellen“[59], ein Gedanke, dem sich auch Arnold Schönberg anschloß: „Erstens ist bei einem großen Menschen nichts Nebensache. Eigentlich ist jede seiner Tätigkeiten irgendwie produktiv. In diesem Sinne hätte ich sogar Mahler zusehen wollen, wie er eine Krawatte bindet, und hätte das interessanter gefunden und lehrreicher, als wie irgendeiner unserer Musikhofräte einen „heiligen Stoff“ komponiert.“[60]
Ein weiterer unschätzbarer Vorteil bei Verdis Äußerungen über seine Interpreten liegt in dem Umstand, daß Tondokumente etlicher von ihm geschätzter Sänger, darunter solche von Uraufführungen, vorliegen, anhand derer man die Urteile des Komponisten und seiner Mitarbeiter mit der akustischen Realität vergleichen kann.
Vorwegnehmend kann ganz allgemein gesagt werden, daß sich bei den Sängern über die Jahrhunderte hinweg kaum etwas geändert hat: Überragendes Talent, höchste Interpretationsintelligenz, fabelhaftes gesangstechnisches Können, grandiose stimmliche Voraussetzungen, wunderbare Musikalität, aber auch Eitelkeit, gepaart mit pomadiger Selbstgefälligkeit und dreister Selbstüberschatzung, intellektuelles und bildungsmäßiges Elend, musikalische und gesangstechnische Inkompetenz, dumpfes Unverständnis dem Beruf gegenüber, die Gesangsleistung beeinträchtigende Geldgier, alles ist schon dagewesen und war und ist wohl auch zum Teil als Reaktion der Betroffenen auf die Haltung der Gesellschaft ihnen gegenüber zu verstehen, von welcher sie entweder als Zieraffen vorgeführt oder als Götter angebetet wurden und werden. Kurz gesagt: Gut und schlecht gesungen wurde zu allen Zeiten.[61] Aber auch: Darstellungs-, Interpretations- und Gesangstalent hängt mit Intellekt und Bildung nur lose zusammen. Und eines darf man nicht vergessen: Singen kann man nicht wollen, singen muß man müssen. Soll heißen: Eine Sängerkarriere kann man nicht wie eine Beamtenkarriere anstreben und durchlaufen, sondern man muß, im Besitz der erforderlichen physischen Voraussetzungen, den ausgeprägten Drang, ja den unwiderstehlichen Zwang verspüren, sich auf diese Weise mitzuteilen und die beträchtlichen Risiken dieses Berufs auf sich zu nehmen.
Der Anteil des Phonationsorgans an einer erfolgreichen Sängerkarriere ist relativ gering. Den überwiegenden Anteil haben Gesangstechnik, Musikalität, Rhythmusgefühl, Stil- und Sprachkenntnis, Sensibilität, Eloquenz, Phantasie, Interpretations- und Kommunikationstalent (Singen hat vor allem mit Kommunikation zu tun), Fleiß, Intelligenz, ständig weitergeführtes Studium (nicht nur reines Rollenstudium), Selbstkritik, die Bereitschaft, objektive, lobhudeleifreie Kritik von Personen des Vertrauens anzunehmen, hohe physische und psychische Belastbarkeit, gutes Gedächtnis, Reiselust inklusive der Bereitschaft, Wochen und Monate auch fern der Familie (in zumeist lauten Hotels) aus dem Koffer zu leben, die Fähigkeit zur richtigen Rollenauswahl, die Stärke, zu Angeboten auch öfter nein zu sagen, Konfliktbereitschaft, auch Glück. Kurzum: Ein Stimmbesitzer ist noch lange kein Sänger.
Ein heute in der Sängerausbildung an führender Stelle tätiger berühmter Sänger hat die aktuelle Situation pointiert zusammengefaßt: „Non mancano le voci, mancano le teste.“ Das heißt, daß es nicht an Stimmen mangelt, wie oft behauptet wird, sondern am Verstand: an der Summe der erwähnten Voraussetzungen und der Bereitschaft, sich diese für die erfolgreiche Berufsausübung zu erarbeiten.
Die schwedische Sopranistin Birgit Nilsson (1918-2005) gründete einige Jahre vor ihrem Tod die Birgit Nilsson Foundation, die – ähnlich dem Nobelpreis oder dem Ernst von Siemens Musikpreis – einen hochdotierten Preis an Künstler verleiht, die auf ihren Gebieten Herausragendes geleistet haben. Der Präsident dieser Stiftung begründet das wie folgt: „Birgit Nilsson was very concerned with the general decline of cultural values, in particular with the decline of performance standards in classical music.“[62]
Dieser von vielen Seiten angesprochene Verfall impliziert, daß den seit Jahrhunderten beschworenen Krisen der Gesangskunst in der Gegenwart eine Krise bei großen Teilen des Publikums und der Kritik gegenübersteht. Immer öfter wird auf diese reale Krise mit drastischen Worten in Fachpublikationen hingewiesen, wobei die zunehmend undifferenzierte Zustimmung des Publikums zu qualitativ stark schwankenden musikalischen und gesanglichen Darbietungen auf gesellschaftspolitische Faktoren zurückgeführt wird. (Angesichts unverständlicher Publikumsreaktionen sagte Jean Cocteau einmal: „Heute war das Publikum wieder untalentiert!“) Der Tenor dieser Aussagen ist, daß die in vielen westlichen Gesellschaften (auch im Musikbetrieb) verbreitete Leistungsfeindlichkeit[63], das schwindende Bildungsniveau und die immer schlechtere Ausbildung der Studenten an Massenuniversitäten, der immer stärker zurückgedrängte Musik- und Kunstunterricht an Schulen sowie die willfährige Anpassung vieler Bereiche an wenig gebildete bis bildungsfeindliche Bevölkerungsschichten (das letzte eklatante Beispiel aus einem anderen Bereich: die deutsche Rechtschreibreform[64]) zur unkritischen Akzeptanz eines objektiv inakzeptablen künstlerischen Niveaus[65] und, parallel dazu, zum Aufkommen rein kommerziell orientierter, dubioser, musikalisch völlig wertloser Erscheinungen wie Crossover führen, eine Art verlogen-verkitschter Schunkel-Klassik-Pop, dargeboten von exzellent gemanagten Instrumentalisten, denen bestenfalls ein Platz an einem hinteren Pult eines Provinzorchesters zustände, oder Sängern, die bei manchem Vorsingen für eine Choristenstelle abgewiesen würden. Das Begriffspaar „Qualität“ und „Erfolg“ sollte, wie man naiverweise anzunehmen geneigt ist, im Idealfall in einer untrennbaren Verbindung leben. In der Praxis ist dies allerdings immer seltener der Fall: Die Partner folgen der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, denn es kommt immer öfter zu Trennungen und Scheidungen, wonach die beiden als unabhängige Singles auftreten. Während das Single „Qualität“ oft ein Mauernblümchendasein fristet und aggressiv beworben werden muß, um überhaupt wahrgenommen zu werden und überleben zu können, feiert das Single „Erfolg“ fröhliche Urständ, indem es ein luxuriöses Dasein, vielfach ohne jeglichen nachvollziehbaren Anlaß, führt. Die Folgen dieses Phänomens sind jedenfalls geeignet, die Situation nachhaltig zu verschlimmern[66], denn wer wollte es strikt wirtschaftlich agierenden Operndirektoren verübeln, daß sie folgerichtig reagieren und zweitklassige Künstler engagieren (die wesentlich billiger einzukaufen sind als ihre erstklassigen Kollegen), da sie doch die gleiche ungeteilte Zustimmung erhalten?
All das sind Phänomene der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts. Wie zu sehen sein wird, war auch im 19. Jahrhundert – eine der interessantesten Epochen, was Musik in ihren verschiedensten Erscheinungsformen anlangt, und gleichzeitig eine Endzeit – auf diesem Gebiet nicht alles Gold, was da glänzte, doch stand, auch abseits herausragender Erscheinungen wie Verdi, das handwerkliche Können bei produzierenden wie reproduzierenden Künstlern auf hohem Niveau. Aus diesem Grund schien es mir gerechtfertigt, den Protagonisten des vorliegenden Buches, wie auch seine Mitarbeiter und Interpreten, so oft wie möglich in erster Person zu Wort kommen zu lassen.
Wie zu sehen sein wird, war Verdi kein Theoretiker der Musikästhetik, sondern ein genialer Theaterpraktiker („Im Theater ist lang ein Synonym für langweilig, und Langeweile ist das schlimmste aller Übel“[67]), der es vorzog, Musik zu schreiben und sie für sich selbst sprechen zu lassen anstatt sich verbal über sie zu verbreitern. Er gehörte darüber hinaus zu den wenigen Komponisten, die die eigenen Arbeiten nicht für die besten von allen hielten und die imstande waren, ihre Werke zumeist richtig einzuschätzen, und nicht zu jener großen Gruppe, die von Musik nicht mehr verstehen als ein Vogel von der Ornithologie.[68] Die Bühnenwerke dieses populärsten Opernkomponisten der Musikgeschichte sprachen und sprechen das Publikum unvermittelt an, kein Zuhörer befand sich bei Verdi je in dem von Joseph Hellmesberger[69] in Wiener Dialekt formulierten Dilemma: „Was geberten die då drunt jetzt drum, wånn’s wisserten, wia’s ihna gfoi’n håt.“[70]
Um Verdis Größe zu verdeutlichen, wurde darauf hingewiesen, daß der Komponist, wäre er aus irgendeinem Grund nicht Musiker geworden, dem Italien des neunzehnten Jahrhunderts wohl auf einem anderen Gebiet seinen Stempel aufgedrückt hätte: Im Falle eines (von Verdis Vater ursprünglich gewünschten) Jusstudiums möglicherweise als Politiker, vielleicht als fortschrittlicher Agronom oder als Kunstkritiker.[71]
I
Jugend und Studienzeit – Rocester – Sei romanze – Oberto conte di San Bonifacio – Ignazio Marini – Lorenzo Salvi – Mary Shaw – Antonietta Rainieri-Marini – Luigia Abbadia – Un giorno di regno – Bartolomeo Merelli
V
erdis bekannte Reserviertheit zu definieren ist so manchem Biographen besser gelungen als in seine Persönlichkeit vorzudringen:
Wenn wir wissen wollen, was dieser Mensch in seinem Kopf dachte, sieht es schlecht aus. [...] Es ist wesentlich leichter, in die militärischen Geheimnisse des Pentagons oder des Kremls oder in die Klausur eines Trappistenklosters einzudringen als in die Seele Verdis.[72]
Wenngleich es gilt, diese Aussage des eminenten Verdikenners Massimo Mila im Zeitalter gewitzter jugendlicher Computerhacker zu relativieren, trifft sie in ihrem Kern nach wie vor zu, denn es „ist Verdi immer gelungen, sich seinen Biographen zu entziehen. Die bekannten Fakten seiner langen, arbeitsreichen Karriere wurden unzählige Male erzählt, als Mensch aber bleibt er immer auf Distanz, bis heute geschützt durch seine ihm eigene Reserviertheit und sein Mißtrauen.“
Damit hat der Verdi-Biograph Frank Walker[73] das Problem auf den Punkt gebracht, dem man bei dem Versuch begegnet, sich Verdi biographisch zu nähern. Doch auch die vermeintlichen Fakten besitzen einen erst in den letzten Jahrzehnten langsam schwindenden Unsicherheitsfaktor, denn unzählige Legenden und nicht fundierte Interpretationen durchwucherten Verdis Biographie schon zu seinen Lebzeiten, von ihm unerwünscht oder unwidersprochen, zum Teil aber auch bewußt oder unbewußt gefördert. So liebte Verdi in späteren Jahren nicht nur die Legendenbildung um sich selbst als Kind analphabetischer Bauern aus allerärmsten Verhältnissen, das sich gegen widrigste Umstände aus eigener Kraft hochgearbeitet und autodidaktisch zum Komponisten ausgebildet hatte und niemandem etwas schuldete, sondern auch die Darstellung seiner Person als jemand, dem es völlig gleichgültig war, was Dritte über ihn denken mochten. Über seinen ausgeprägten Sinn für soziale Verantwortung, über die von ihm gestifteten Stipendien, Krankenhäuser und Altersheime oder die anonyme Unterstützung von in Not geratenen Mitarbeitern oder deren Familien äußerte er sich nicht oder höchstens widerwillig.[74]
Gewisse Episoden seiner Biographie, wie beispielsweise das Zustandekommen des Nabucco, wurden mit seinem Wissen und Zutun geradezu auf Groschenromanebene trivialisiert und hierauf unüberprüft von einer Biographengeneration zur nächsten übernommen.
Doch auch der Griff zu Dokumenten, die solche Unsicherheiten beseitigen sollten, erweist sich manchmal als tückisch: In einem Autobiographischen Bericht, den er am 19. Oktober 1879 seinem Verleger Giulio Ricordi diktierte und der zur Richtigstellung verschiedener Anwürfe die Uraufführung des Oberto betreffend dienen sollte, der aber eher als subjektivistisches Selbstportrait denn als Chronologie von Fakten und Daten zu werten ist und als Ergänzung einer Biographie[75] gedacht war, komprimiert Verdi beispielsweise den Zeitablauf des Todes seiner ersten Frau und seiner beiden Kinder – „Innerhalb eines Zeitraums von nurzwei Monaten[76] hatte ich drei geliebte Wesen verloren. Meine ganze Familie war dahin!“ – und vertauscht auch die Reihenfolge der Todesfälle, die sich in den Jahren 1838, 1839 und 1840 ereigneten.
Zeitlebens legte der Komponist jeglicher Art von Publicity sowie unqualifizierter Lobhudelei gegenüber eine heftige Abneigung an den Tag und liebäugelte auch nicht wie viele seiner ihm nachfolgenden Komponistenkollegen mit der Veröffentlichung seiner Korrespondenz, wie er seinem Freund Arrivabene[77] schrieb:
Wozu ist es nötig, die Briefe eines Komponisten hervorzuholen? Briefe, die immer in Eile geschrieben wurden, ohne Sorgfalt und ohne ihnen Bedeutung beizumessen, weil der Musiker weiß, daß er keinen literarischen Ruf wahren muß. Reicht es nicht, daß man ihn wegen seiner Musik auspfeift? Nein, mein Herr! Jetzt auch noch die Briefe! Ach! Die Berühmtheit ist eine große Plage! Die armen kleinen großen Männer bezahlen teuer für ihre Popularität! Nie ist ihnen eine Stunde der Ruhe vergönnt, weder im Leben noch im Tod![78]
Bei dieser auf die Veröffentlichung von Briefen Vincenzo Bellinis gemünzten Aussage dachte Verdi wohl auch an seine eigenen, in die Tausende gehenden Briefe, die für den Biographen auch gegen den Willen des Betroffenen die wichtigsten Quellen darstellen. Sie sind nach wie vor über die ganze Welt verstreut und bei weitem nicht zur Gänze erfaßt und wissenschaftlich aufgearbeitet.
Jugend und Studienzeit
H
ier die gesicherten Fakten der Biographie Verdis bis zum Entstehen seiner ersten Oper: Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, im Geburtenregister als Joseph Fortunin François und im Taufregister als Joseph Fortuninus Franciscus eingetragen, wird am 9. oder 10.[79]