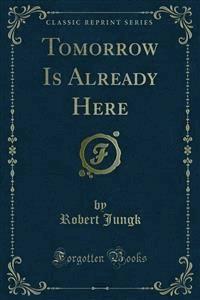12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Roberts Jungks Buch von 1956 ist eine Warnung vor der Zerstörung der Erde - und heute ein Klassiker der politischen Literatur, der eine ganze Generation geprägt hat. Jungk beschreibt die Geschichte der Atombombe als «eine Geschichte wirklicher Menschen» (Carl Friedrich Frhr. von Weizsäcker), die im Sommer 1939 noch in der Lage gewesen war, den Bau von Atombomben zu verhindern und die Chance ungenutzt vorbeigehen ließen - weil sie der bedrohlichen neuen Erfindung moralisch und politisch nicht gewachsen waren. Er breitet ein überwältigendes Tatsachenmaterial aus, und macht auf erregende Weise das Dilemma berühmter Wissenschaftler deutlich, die zwischen Forscherdrang und Gewissensqual schwanken. Was in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts als kollegiales Teamwork junger Wissenschaftler begonnen hatte, entwickelt sich wie wir heute wissen zur Tragödie. Forscher, die sich ursprünglich allein dem wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtet fühlten, begannen zu erkennen, dass sie, wie der amerikanische Atomphysiker Robert Oppenheimer sich ausdrückt, «die Arbeit des Teufels» getan hatten. Heute steht die Welt vor einer anderen Art der Selbstzerstörung, dem Klimawandel. Zeit also für die Wiederauflage eines Buches, das sein Verfasser als Beitrag zu dem großen Gespräch verstanden wissen, «das vielleicht eine Zukunft ohne Furcht vorbereiten kann".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Ähnliche
Robert Jungk
Heller als tausend Sonnen
Das Schicksal der Atomforscher
Über dieses Buch
Robert Jungk beschreibt die Geschichte jener Menschen, die die Atombombe entwickelt haben, ihre Gefahr erkannten und die Chance, den Bau zu verhindern, ungenutzt vorbeigehen ließen. Jungk breitet das umfangreiche Material und auch lange unzugängliche Quellen aus und macht auf eindrucksvolle Weise das Dilemma jener berühmten Wissenschaftler deutlich, die zwischen Forscherdrang und Gewissensqual schwankten. Was in den zwanziger Jahren als kollegiales Teamwork junger Physiker begonnen hatte, entwickelt sich schließlich zur Tragödie. Forscher, die sich ursprünglich allein dem wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtet fühlten, sahen sich sehr bald in das Spannungsfeld machtpolitischer Auseinandersetzungen gerissen, und viele von ihnen begannen zu erkennen, dass sie, wie der amerikanische Atomphysiker Robert Oppenheimer es beschrieb, «die Arbeit des Teufels» getan hatten.
Robert Jungk liefert in dieser Spurensuche die Antwort auf die Frage: Wie kam es zur Atombombe? Und er stellt die bis heute aktuelle Frage nach der Verantwortung: nach der moralischen Verantwortung unserer modernen Wissenschaft.
Vita
Robert Jungk, geboren 1913 in Berlin, war Journalist, Autor und einer der ersten Zukunftsforscher. 1933 emigrierte er nach Paris und schrieb während des Krieges für die «Weltwoche» in Zürich. Nach 1945 lebte er als Korrespondent in Paris, Washington und Los Angeles. Jungk gehört zu den prägenden Figuren der internationalen Umwelt- und Friedensbewegung. 1952 erschien sein erstes Werk «Die Zukunft hat schon begonnen», gefolgt von «Heller als tausend Sonnen» (1956) und «Strahlen aus der Asche» (1959) – Bücher, die eindringlich vor den Gefahren der Atomkraft warnen. Er hatte einen Lehrauftrag für Zukunftsforschung an der TU Berlin und war Vorsitzender der Gruppe «Mankind 2000» in London. Jungk starb 1994 in Salzburg.
Inhaltsübersicht
Widmung
Bruch der Gutgläubigkeit Von Robert Habeck
Wie das vorliegende Buch entstand Ein kurzer Werkstattbericht des Autors
Die Zeit der Wandlungen
Die schönen Jahre
Zusammenstoß mit der Politik
Die unerwartete Entdeckung
Der Zerfall des Vertrauens
Die Furcht vor Hitlers Atombombe
Das Laboratorium wird Kaserne
Oppenheimers Aufstieg
Ein Mensch wird gespalten
Jagd auf Gehirne
Atomforscher gegen Atombombe
Denn sie wissen nicht, was sie tun
Die Geschlagenen
Der Kreuzzug der Wissenschaftler
Die bitteren Jahre
«Joe I» und «Super»
Gewissensnot und technische Versuchung
Im Zeichen des «Maniac»
Oppenheimers Fall
Auf der Anklagebank
Nachwort Am Ende einer Möglichkeit?
Anhang
Dank des Verfassers
Quellenangaben
Namenregister
Bildteil
Für Ruth
Bruch der GutgläubigkeitVon Robert Habeck
Einige Bücher kennt man, obwohl man sie nicht gelesen hat. Ihre Titel oder Textabschnitte haben die Gesellschaft geprägt. Mindestens zwei von Robert Jungks Büchern gehören dazu. «Die Zukunft hat schon begonnen» ist fast zu einem Sprichwort geworden, «Heller als tausend Sonnen» zu einer Mahnung. Dieses Buch steht am Anfang der Friedensbewegung. Und es ist eine Entdeckung für unsere Zeit, das Jahr 2020, das vielleicht wieder eine Friedensbewegung braucht. Nach drei Jahrzehnten der Begrenzung von atomaren Arsenalen stehen die Welt und Europa heute vor einem neuen nuklearen Wettrüsten, nachdem der amerikanische Präsident, Donald Trump, den INF-Vertrag über die Vernichtung aller nuklearer Waffensysteme zwischen 500 und 5500 km Reichweite aufgekündigt hat. Als Grund geben die USA an, dass sich Russland nicht an den Vertrag halte, wofür mit Blick auf die in Kaliningrad stationierten Iskander-Raketen viel spricht. Russland behauptet zwar, es halte sich daran, hat aber selbst das strategische Interesse, dass dieser Vertrag aufgelöst wird. So funktioniert Politik, wenn sie nur noch das eigene Machtinteresse im Blick hat …
Solche Mechanismen einer auf reine Macht reduzierten, zum Zynismus bereiten Politik kann man in dem Buch von Jungk studieren. So zeichnet er nach, wie es zum ersten und bislang letzten Einsatz von atomaren Waffen – dem Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki – kam. Die USA hatten demnach schon lange die japanischen Codes entschlüsselt und konnten im Grunde die gesamte japanische Kommunikation mitlesen. Sie wussten, dass Japan wusste, dass es den Krieg verloren hatte und zur Kapitulation bereit war. Aber die USA, so recherchierte Jungk, hatten kein Interesse daran, denn das Programm zur Entwicklung der Atombombe der USA, das «Manhattan Project», war teuer, und die Militärs und Politiker hatten Angst, die Milliarden Dollar umsonst ausgegeben zu haben, wenn der Krieg ohne Einsatz der Bombe enden würde. Die Bombe wurde also, so Jungks Recherche, abgeworfen, aus Angst, sich lächerlich zu machen.
Robert Jungks auf intensivem Quellenstudium beruhendes Buch ist reich an solchen Erkenntnissen, an Entdeckungen und Aufdeckungen, die einem den Atem stocken lassen. Es zeichnet den Weg von der Entdeckung der Atomspaltung über die Forschung im Zweiten Weltkrieg bis zum Einsatz der Atombombe und schließlich den Einstieg in die nukleare Aufrüstung nach. Aber das Erstaunliche ist, dass ein Buch, das im Jahr 1956 geschrieben wurde und von der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs bis etwas nach dem Ende des Zweiten reicht, sich spannend liest wie ein Roman. Den, so schrieb der Autor damals im Vorwort, hatte er auch zuerst im Sinn. Aber als er sich mit der Materie zu beschäftigen begann, merkte er, dass die Wirklichkeit jede Fiktion in den Schatten stellt. Und so ist es.
Die Riege der Atomforscher ist wie ein Stammbaum oder wie eine «Familie», wie Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, der neben Werner Heisenberg, dem Entdecker der Unschärfenrelation, eine der zentralen Figuren des Buches ist, schrieb. Alle kannten sich, schrieben sich Briefe, auch während der Kriegszeit, teilten sich ihre Ergebnisse mit, waren Kommilitonen oder Studenten voneinander. J. Robert Oppenheimer, der Leiter des Manhattan Project, hatte in Göttingen bei Max Born studiert. Das vollständige Zitat von Weizsäcker lautet: «Es genügt eben nicht, dass wir eine Familie waren, vielleicht hätten wir ein internationaler Orden sein müssen mit disziplinarischer Gewalt über seine Mitglieder. Aber ist so etwas bei der Natur der modernen Wissenschaft überhaupt durchführbar?»
Das ist eine Frage, die mit großer Dringlichkeit in unsere heutige Zeit reicht, eine Zeit, in der mit den technischen Möglichkeiten nicht nur vollautomatische Waffensysteme gebaut werden können, sondern Lebewesen geklont und die Grenze zwischen Mensch und Maschine aufgehoben werden kann. Wo verläuft die ethische Grenze? Was dürfen wir nicht tun, obwohl wir es tun können? Wie verhindern wir, dass wissenschaftliche Ergebnisse zum Schaden der Menschheit eingesetzt werden? Was bedeutet die potenzielle Überwindbarkeit des Menschen und des Menschlichen für die Freiheit der Forschung? Diese Fragen machen «Heller als tausend Sonnen» zu einem zeitgenössischen Buch, einem Spiegel unserer Zeit.
In Jungks Buch werden die Fragen konkret und zu menschlichen Schicksalen. Denn die Forscher und wenigen Forscherinnen stellten sich diese Fragen permanent. Sie wussten, dass sie «des Teufels Werk» verrichteten, wie Oppenheimer formulierte, und sie litten darunter, waren zerrissen. Eindringlich ist die Schilderung der Zeitgenossen, wie Otto Hahn, der Entdecker der Uranspaltung, auf den Atombombenabwurf reagierte. «Seine Bewegung war so groß, daß seine Kollegen zeitweise befürchteten, er könne sich aus Verzweiflung das Leben nehmen. ‹Auf Hahn aufpassen!› flüsterte einer dem anderen zu. Unter dem Datum vom 7. August 1945 notierte Dr. Bagge in seinem Tagebuch: ‹Der beklagenswerte Professor Hahn! Er erzählte uns, dass er schon damals, als er zum erstenmal erkannte, welche furchtbaren Wirkungen die Uranspaltung haben könne, mehrere Nächte lang nicht geschlafen und erwogen habe, sich das Leben zu nehmen. Eine Zeitlang sei sogar der Plan aufgetaucht, ob man zur Verhütung dieser Katastrophe nicht alles Uran im Meer versenken solle …›» Nach seiner Entdeckung soll Otto Hahn gesagt haben: «Das kann doch Gott nicht wollen.» Kaum ein Wissenschaftler, der diese Skrupel nicht irgendwann hatte. Selbst Oppenheimer warnte am Ende vor der Wasserstoffbombe und blockierte und verschleppte die Forschungsarbeiten, wofür er entlassen und vor den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe gestellt wurde.
Es sind ja immer Wissenschaftler, die die Grundlage für neue Rüstungs- und Vernichtungswaffen schaffen. Und in diesem Fall – dem Fall der Atombombe – war ihnen das von Anfang an bewusst. Aus diesem Bewusstsein und dem Zusammenprall von Forscherethos mit Politik bezieht das Buch seine Wucht. Der Ungar Leo Szilard drängte die wissenschaftliche Familie beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu einer Selbstzensur. Kein Forscher und kein Professor sollte mehr etwas veröffentlichen, was das Wissen über die Uranspaltung vermehrte, um Hitler oder Stalin nicht Wissen über eine Atombombe an die Hand zu geben. Aber die Idee hielt nicht. Zu groß waren der nationale Druck und Stolz. So überlegten die Forscher, die um die fürchterliche potenzielle Macht der Atomspaltung wussten, das europäische Wissen den Amerikanern mitzuteilen. Mittelsmann war Albert Einstein, der Zugang zum Weißen Haus und Präsident Roosevelt hatte. Er überbrachte ihm einen Brief mit den Forschungsergebnissen. Diese waren noch weit von einer Bombe entfernt. Sie lösten aber das Gegenteil aus: Panik und den Einstieg in das eigene forcierte Atomwaffenprogramm. Und Einstein, der von sich selbst sagte, dass er nur als Briefkasten fungierte, wurde so zu seinem Entsetzen zum Auslöser des atomaren Aufrüstens.
Während also die Amerikaner alles daransetzten, die Bombe zu bauen, versuchten die deutschen Atomwissenschaftler das Gegenteil. Heisenberg und von Weizsäcker teilten den Nazis mit, dass es mit dem Atombombenbau wohl nichts werden würde. Jungk schreibt: «Es erscheint paradox, daß die in einer säbelrasselnden Diktatur lebenden deutschen Kernphysiker, der Stimme ihres Gewissens folgend, den Bau von Atomwaffen verhindern wollten, während ihre Berufskollegen in den Demokratien, die keinen Zwang zu befürchten hatten, mit ganz wenigen Ausnahmen sich mit aller Kraft und Energie für die neue Waffe einsetzen. Die Erklärung dafür versuchte fünfzehn Jahre später ein deutscher Wissenschaftler zu geben: ‹Wir waren wahrhaftig nicht bessere Menschen oder klüger als unsere ausländischen Kollegen, aber wir hatten bei Kriegsbeginn bereits aus der bitteren Erfahrung von fast sieben Jahren unter Hitler gelernt, daß man sich dem Staat und seinen ausführenden Organen gegenüber mißtrauisch und zurückhaltend verhalten muß. Angehörige von totalitär regierten Ländern sind selten gute Patrioten. Die anderen aber besaßen damals noch volles Vertrauen in die Anständigkeit und Gerechtigkeit ihrer Regierungen … Ich bezweifle übrigens, daß es dort heute noch ganz so ist.›»
Robert Jungk zeichnet das wissenschaftlich-politische Porträt einer Forschergeneration, die die Zeit nicht ohne moralische Schuld hat leben lassen, von der Weigerung, bei der Forschung mitzumachen, um die Kettenreaktion der Uranspaltung nicht militärisch zu nutzen, bis zum bewussten Forschen für den Kriegseinsatz der Technik, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Unschuldig ist man aus der Sache nicht rausgekommen. Man musste sich entscheiden, welche Verantwortung man übernahm. Unpolitisch sein, das konnte man nicht. Die Wissenschaft hat damals die Politik doppelt unterschätzt. Zum einen, dass sie begierig darauf aus war und sicher heute noch ist, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu nutzen und ihren Zwecken unterzuordnen. Zum anderen, dass Politik gestaltet werden kann, dass sie sich selbst zu leicht aus der Affäre ziehen, wenn sie sagen, wir sind nur neutrale Forscher. Beides waren Fehleinschätzungen, und im Laufe des Buches erkennen das zumindest Einzelne. An diesen Erkenntnissen, an dem Bruch der Gutgläubigkeit, lässt uns Robert Jungk teilhaben. Er rekonstruiert ihn. Und wir Heutigen, wir sollten uns an sie erinnern und aus ihnen lernen. Um eine ethische Verantwortung in der Wissenschaft und der Politik zu tragen.
Wie das vorliegende Buch entstandEin kurzer Werkstattbericht des Autors
«Weshalb denken wir eigentlich immer nur darüber nach, was der Wissenschaftler tut, und niemals darüber, was er ist?» Diese Frage, die ich in einem Aufsatz des amerikanischen Erziehers George N. Shuster fand, hat mich nicht losgelassen. Sie führte mich auf die lange Reise von Erdteil zu Erdteil, von Land zu Land, von Atomforscher zu Atomforscher, deren Resultat die vorliegende Arbeit ist.
Allerdings fiel der Samen dieses Ausspruches bereits auf vorbereiteten Boden. Am Ende meines ersten Besuches in der amerikanischen Atomstadt Los Alamos im August 1949 hatte mir ein seit Jahren dort lebender Forscher mitteleuropäischen Ursprungs, ein paar Minuten nur, bevor der Bus abfuhr, plötzlich ein erschütterndes persönliches Geständnis gemacht: «Es ist doch seltsam, und ich kann es nicht begreifen», sagte er, «meine Jugend stand ganz unter dem Zeichen der Sehnsucht nach Wahrheit, Freiheit und Frieden. Und nun hat mich das Schicksal gerade hierher verschlagen, wo meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, die Wahrheit, die ich zu entdecken versuche, hinter Safetüren versperrt bleibt und meine Arbeit letzten Endes dem Bau der furchtbarsten Kriegswaffen gewidmet sein muß. Welch widerspruchsvolles Schicksal!»
Seither hatte ich oft über den Lebensweg der Atomforscher nachgedacht und auch versucht, die Tragödie eines solchen Menschen in Romanform zu erzählen. Um diesen Roman lebensecht zu gestalten, mußte ich beginnen, die wirklichen Hintergründe dieser Karriere zu studieren. Der erste bedeutende Kernphysiker, den ich nun traf, war der an der Universität Bern lehrende Professor Fritz Houtermans. Das war ein Glücksfall. Denn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die mehr in der Welt der Formeln als der Anekdoten leben, mehr in der Zukunft als in der Vergangenheit, wußte Houtermans auf lebendige und spannende Weise aus den schönen alten Göttinger Tagen, aus den düsteren Zeiten seiner Gefangenschaft in Sowjetkerkern oder aus jenen Jahren zu erzählen, in denen er und andere seiner Kollegen im Dritten Reich darüber debattiert hatten, wie man den Mißbrauch der großen Atomentdeckung verhindern könnte.
Nie werde ich diese nächtliche Unterhaltung in einem Laboratorium der Berner Universität vergessen. Immer wieder unterbrach der Gelehrte das Gespräch, denn er mußte ein im Nebenraum tickendes Meßgerät (mit dessen Hilfe er den Urangehalt des Alpengranits untersuchte) in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Wir tranken in Laborflaschen gebrauten Kaffee, und je weiter die Nacht fortschritt, desto klarer wurde es mir: kein Roman konnte die tatsächliche, durch Aussagen und Dokumente belegbare Tragödie der Atomforscher an Bedeutsamkeit, Eindringlichkeit und Spannung übertreffen. Als ich Houtermans verließ, wußte ich, daß ich die Elemente meines Buches nicht in meiner Phantasie finden würde, sondern nur durch genaueste Befragung aller noch erreichbaren Menschen, die jenes für unsere Zeit so kennzeichnende Drama gelebt hatten.
Allerdings war es leichter, diesen Entschluß zu fassen, als ihn zu verwirklichen. Es gab zwar viele, beinahe zu viele Berichte über die wissenschaftliche und technische Geschichte der Atomentwicklung, aber kaum etwas Gedrucktes über die menschlichen und moralischen Probleme dieses Vorganges. So mußte ich noch viel stärker als geplant auf mündliche Aussagen gründen. Manche der Atomforscher, die ich um eine Unterredung bat, stimmten sofort zu, andere machten Schwierigkeiten. Nun habe ich eine für einen Reporter hinderliche Eigenschaft: es fällt mir schwer, mich aufzudrängen, denn ich hasse es, wichtigen Leuten auch nur einen Teil ihrer kostbaren Zeit zu rauben. Dennoch – hier mußten diese Hemmungen vergessen werden. Die Aufgabe war es wert.
So bin ich einem meiner «Helden» buchstäblich durch ein halbes Dutzend Länder Europas nachgereist, und jedesmal wies er mich ab. Schließlich habe ich ihn dann doch während einer Physikerkonferenz in Amerika ausführlich sprechen können. Mein Glück war, daß gerade ein besonders langweiliges Referat gehalten wurde. Da wählte der große Mann das kleinere Übel: er zog es vor, mit mir spazierenzugehen, und zeigte sich dann so aufgeschlossen, wie ich es nie zuvor erhofft hätte.
Drei Widerstände waren es, die ich in fast allen diesen Unterhaltungen zu überwinden hatte. Erstens die Befürchtung des Befragten, durch seine Äußerungen einen oder mehrere seiner noch lebenden Kollegen zu verletzen. Joliot-Curies enger Mitarbeiter Kowarski brachte diese Befürchtung in besonders zugespitzter Form vor. Er meinte lachend: «Wenn ich Ihnen erzählen sollte, was wirklich geschah, müßten Sie mir erst eine Million Dollar auf einer Bank hinterlegen. Denn dann wäre ich gezwungen, mich nach Erscheinen Ihres Buches für den Rest meines Lebens aus meinem Berufskreis zurückzuziehen und zu privatisieren.» Da erwies es sich nun als Vorteil, daß ich nicht Physiker, sondern nur Chronist war, der ohne Rücksicht auf Berufskollegen oder Behörden alles aufschreiben durfte, was er in Erfahrung gebracht hatte.
Auch konnte ich den Zögernden zusichern, daß ich, wenn sie es wünschten, die Quelle meiner Informationen nicht preisgeben würde.
Ein zweiter Einwand, den ich hörte, war der, daß ich als jemand, der selbst der «Familie der Atomphysiker» nicht angehörte, unmöglich ihre wahre Geschichte erfassen könnte. Das mochte am Anfang meiner Recherchen wirklich so sein. Je weiter ich aber in die Materie eindrang, desto klarer wurden mir die persönlichen und historischen Bezogenheiten dieser Menschen, ja, es stellte sich heraus, daß ich schließlich mehr Übersicht über den Gesamtablauf dieses Schicksals einer besonders wichtigen und einflußreichen Gruppe besaß als die meisten einzelnen, die mir ihre Erlebnisse und Ansichten anvertrauten. Denn sie hatten ja – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen – nur den eigenen Abschnitt des Geschehens sehen können, während der Chronist aus seiner Kenntnis zahlloser Einzelheiten die Verknüpfung der Ergebnisse und ihre, den Handelnden selbst meist unbekannte, wechselseitige Einwirkung aufeinander übersah. Oft blieb es daher nicht nur bei der einen Unterhaltung mit den Befragten. Ich mußte, geleitet durch die Angaben eines Zweiten und Dritten, wieder zu meinem ersten Unterredner zurück, um Klarheit über gewisse Punkte zu erhalten, die er selbst aus seiner mangelnden Kenntnis des Gesamtbildes für unwichtig gehalten und daher gar nicht erwähnt hatte.
Eine dritte Schwierigkeit, der ich begegnete, war die bei zahlreichen Wissenschaftlern vorherrschende Einstellung, die private, die menschliche Geschichte der Wissenschaftler sei doch eigentlich unwichtig. Was zähle, sei nur ihre objektive Leistung. Hier zeigte sich eine Haltung, die recht eigentlich viele der in diesem Buche beschriebenen Gewissensqualen und Tragödien heraufbeschworen hat. Der Wissenschaftler, der meint, daß er – oder seine Kollegen – nichts anderes sei als ein «Werkzeug der Erkenntnis», dessen persönlicher Charakter, dessen Ambitionen, Hoffnungen und Zweifel «nichts bedeuteten», denkt in Wahrheit unwissenschaftlich. Denn er ignoriert einen wichtigen, vielleicht den ausschlaggebenden Teil des wissenschaftlichen Experimentes, nämlich sich selbst, oder glaubt, ihn willkürlich ausschalten zu können.
Nur durch diese künstliche, erzwungene und unnatürliche Loslösung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit von der Wirklichkeit des einzelnen Menschen konnten ja überhaupt Monstren wie die Atom- und Wasserstoffbomben entstehen. Für immer wird meinem Gedächtnis das Bild jenes genialen Mathematikers eingebrannt bleiben, den ich bei meinem letzten Besuch in Los Alamos im Jahre 1956 auf der Straße spazierengehen sah. Auf seinem Gesicht stand ein Lächeln von beinahe engelhafter Schönheit. Man konnte denken, er habe den inneren Blick auf eine Welt der Harmonien gerichtet. In Wahrheit aber hatte er, wie ich später von ihm hörte, über ein mathematisches Problem nachgedacht, dessen Lösung für die Herstellung eines neuen Typs der «Höllenbombe» unerläßlich war.
Es stellte sich dann bei unserer Unterhaltung heraus, daß der Forscher selbst noch nie einer Versuchsexplosion der von ihm mit ausgeheckten Bomben beigewohnt hatte. Niemals hatte er Hiroshima oder Nagasaki besucht, obwohl man ihn dazu eingeladen hatte. Ja, sogar die Bilder der dort angerichteten Zerstörungen wollte er nicht sehen. Für ihn war Kernwaffenforschung nur höhere Mathematik geblieben, unbefleckt von Blut, Vergiftung und Verwesung. Denn «all das» – so meinte er – ginge ihn doch eigentlich nichts an.
Viele Forscher denken heute nicht mehr so. Sie wissen, daß sie nicht nur «Gehirne», sondern ganze Menschen mit ihren Schwächen, ihrer Größe und ihrer Verantwortung sind. Dieser großen Gewissenskrise in ihrer Entstehung, im Versuch ihrer Meisterung nachzuforschen und sie dann trotz vieler einander widersprechender Aussagen so wahrheitsgetreu wie möglich aufzuschreiben, das war mein Bemühen. Das weite Echo, das mein Buch in den vielen Ländern, wo es erschien, auslöste, scheint anzuzeigen, daß die menschlichen Schicksale der Forscher, als der großen Umgestalter unserer Zeit, nicht weniger interessieren als die Beschreibung ihrer Leistungen. «Denn die Wissenschaftler sind die von Tragik umwitterten Könige unserer Zeit», schrieb mir ein Leser. «Hätte Shakespeare den ‹Hamlet› in unserem Jahrzehnt geschrieben, er würde ihn nicht als Prinzen, sondern als Atomforscher auf die Bühne gebracht haben.»
Die Zeit der Wandlungen
1
Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, so erzählt man, erschien Ernest Rutherford, der damals bereits berühmte Atomforscher, ausnahmsweise einmal nicht zu einer Sitzung der britischen Sachverständigenkommission, die über neue Methoden zur Abwehr feindlicher U-Boote zu beraten hatte. Als er später wegen seines Ausbleibens getadelt wurde, brach der robuste Neuseeländer in seiner ungenierten Art aus:
«Talk softly, please, sachte bitte! Ich war gerade an Experimenten, die vermuten lassen, daß das Atom durch menschlichen Eingriff zertrümmert werden kann. Sollte sich das als richtig herausstellen, dann ist diese Entdeckung viel wichtiger als euer ganzer Krieg.»
Im Juni 1919, dem gleichen Monat, als man versuchte, in Versailles (und anderen Pariser Vororten) durch Friedensverträge einen Schlußstrich unter die vier blutigen Kriegsjahre zu ziehen, veröffentlichte Rutherford im «Philosophical Magazine» Arbeiten über seine Versuche und zeigte überzeugend, daß ihm die Verwirklichung eines alten Menschheitstraumes gelungen war. Durch Bombardierung mit Alphapartikelchen hatte er ein Element in ein anderes verwandelt.
Die «transmutatio materiae», nach der die Alchimisten so lange gesucht hatten, war nun Tatsache. Diese Vorläufer der modernen Naturwissenschaft dachten aber aus ihrer das Ganze umfassenden Weltsicht nicht nur an die materiellen, sondern auch an die sittlichen Folgen eines solchen Unternehmens. «Verweigert den Mächtigen und ihren Kriegsleuten den Zutritt zu euren Arbeitsstätten», warnten sie kommende Forschergenerationen, «denn sie mißbrauchen das heilige Geheimnis im Dienste der Macht.»
In Rutherfords berühmten Mitteilungen über die Verwandlung des Stickstoffatoms findet sich keine ähnliche Bemerkung. Das hätte im zwanzigsten Jahrhundert auch gegen jede geltende Regel verstoßen. Der Naturwissenschaftler unserer Tage soll nicht über die «Nebenwirkungen» seiner Entdeckungen philosophieren – auch wenn seine Arbeiten im «Philosophical Magazine» erscheinen. So wird es gehalten, seit die wissenschaftlichen Akademien im siebzehnten Jahrhundert festlegten, daß in ihren Sitzungen keine Debatten über politische, moralische oder theologische Probleme stattfinden dürften.
Tatsächlich aber war die Isolation der Naturforschung schon 1919 nur noch eine «Arbeitshypothese». Gerade dieser eben zu Ende gegangene Krieg hatte mit seiner durch die Anwendung naturwissenschaftlicher Entdeckungen möglich gewordenen Waffentechnik die schicksalhaften Zusammenhänge zwischen den «weltfernen» Laboratorien und der blutigen Wirklichkeit des Schlachtfeldes nur allzu deutlich aufgezeigt.
Auch in Rutherfords Werkstatt hatte der Krieg rauh hineingegriffen. Seine «boys», wie er die ihm wie einem Vater zugetanen Assistenten und Studenten nannte, waren fast alle zum Kriegsdienst eingezogen worden, und Moseley, der begabteste seiner Mitarbeiter, war schon 1915 bei den Dardanellen gefallen. Sogar seine Radiumquelle, mit der er alle seine Atomversuche machte, sollte ihm beschlagnahmt werden, denn sie war – Ironie des Schicksals – «enemy alien property» («Feindgut»). Vor Kriegsbeginn hatte nämlich das Radium-Institut in Wien dem Kollegen Rutherford 250 Milligramm der kostbaren Substanz geliehen, eine Geste, die den Österreichern vor 1914 leichtfiel, denn die einzigen ergiebigen Uranerzlager Europas im böhmischen Joachimsthal gehörten damals noch zur k.u.k. Doppelmonarchie. Rutherford erkannte die Konfiskation dieses Radiums durch seine Regierung niemals an. Es genügte ihm auch keineswegs, daß ihm die englischen Verwalter das wertvolle Metall weiter zur vorübergehenden Verwendung überließen. Der für seine Unbeugsamkeit und Prinzipienstärke bekannte Gelehrte bestand darauf, diese persönliche Leihgabe seiner wissenschaftlichen Freunde an der Donau nach Ende der Feindseligkeiten selbst zurückzugeben oder aber käuflich von ihnen erwerben zu dürfen. Und Rutherfords Festigkeit gegenüber den Behörden drang durch. Am 14. April 1921 konnte er endlich an seinen langjährigen Kollegen Stefan Meyer im inflationsgeplagten Wien schreiben:
«Ich war sehr beunruhigt über Ihre Mitteilung, die Finanzen des Radium-Instituts in Wien betreffend, und habe mich eifrig darum bemüht, Gelder zu beschaffen, mit denen ich um jeden Preis die kleine Radiummenge kaufen könnte, die mir von der Wiener Akademie so großzügig geliehen wurde. Sie ist mir bei meinen Forschungen von großer Hilfe gewesen.»
Meyer teilte mit, der Weltmarktpreis für Radium sei im Augenblick «monströs hoch», aber das schreckte Rutherford nicht ab. Er trieb viele hundert Pfund auf, mit deren Hilfe das Wiener Radium-Institut über die schlimmsten Jahre der Geldentwertung hinwegkam.
2
Selbst während des Krieges war Rutherford über neutrale Länder mit seinen Schülern und Freunden in Deutschland und Österreich-Ungarn wenigstens brieflich in Verbindung geblieben. Besonders zwischen ihm und seinem alten und treuen Assistenten Hans Geiger, dem Erfinder des später unentbehrlich werdenden «Geiger-Zählers» zur Messung der unsichtbaren Radioaktivität, wurden über die Fronten hinweg mehrfach Lebenszeichen ausgetauscht. Die internationale «Familie der Physiker» hatte, so gut es nur ging, zusammengehalten, besser jedenfalls als die Literaten und Geisteswissenschaftler, die einander mit gehässigen Manifesten bombardierten. Menschen, die vor dem Kriege oft jahrelang brieflich oder Seite an Seite im Laboratorium zusammengearbeitet hatten, konnten niemals auf einen Befehl von oben «Feinde» werden. Wo immer es ging, halfen sie einander. So machten es seine deutschen Lehrer Nernst und Rubens dem bei Kriegsbeginn im Lager Ruhleben bei Berlin internierten James Chadwick – einem engen Mitarbeiter Rutherfords und späteren Nobelpreisträger – möglich, sich dort ein kleines Laboratorium einzurichten, wo er, zusammen mit anderen Gefangenen, viele interessante Experimente unternahm. Im Mai 1918, als die furchtbaren Offensiven in Nordfrankreich täglich zahlreiche englische und deutsche Menschenleben forderten, schrieb Chadwick an seinen Meister Rutherford:
«Wir arbeiten jetzt … über die Bildung von Kohlenstoffen durch Lichtbestrahlung … Während der letzten Monate habe ich Rubens, Nernst und Warburg besucht. Sie waren außerordentlich entgegenkommend und boten an, uns zu leihen, was sie nur könnten. Tatsächlich haben uns alle möglichen Leute Instrumente geliehen.»
Kaum waren die Grenzen nicht mehr so dicht geschlossen, da nahmen die Physiker der ganzen Welt sofort wieder Kontakt miteinander auf, um sich gegenseitig mitzuteilen, welche Fortschritte ihre Arbeiten während der Kriegsjahre gemacht hatten. Nicht nur die gewöhnliche Post, auch der Telegrammdienst mußte bei der schnellstmöglichen Wiederaufnahme des Erfahrungsaustausches mithelfen. Die Kopenhagener Telegrafistinnen hatten es oft schwer, die ihnen völlig unverständlichen Botschaften voller mathematischer Formeln aus dem Institut von Professor Niels Bohr nach England, Frankreich, Holland, Deutschland, den USA und Japan korrekt durchzugeben.
Drei Hauptanziehungspunkte gab es damals auf der Landkarte der Atomforschung: Cambridge, von wo aus Rutherford wie ein bärbeißiger, leicht erzürnbarer König über das von ihm zuerst erschlossene Land der kleinsten Dimensionen regierte, Kopenhagen, das durch den Mund des weisen Niels Bohr Gesetze für dieses bestürzend neue und rätselhafte Territorium des Mikrokosmos erließ, und Göttingen, dessen Triumvirat Max Born, James Franck und David Hilbert sofort alles in Frage stellte, was man gerade in England neu entdeckt und in Dänemark richtig erklärt zu haben glaubte.
Bald schon genügte der schriftliche Verkehr nicht mehr, um Klärung über die vielen faszinierenden Probleme der atomaren Welt zu erlangen. So begann nun die Epoche der Kongresse und Konferenzen. Bohr brauchte nur wissen zu lassen, er werde in Göttingen eine Woche lang über seine Arbeiten während der Kriegsjahre sprechen, und schon reiste jeder Physiker, der es nur irgend ermöglichen konnte, zu diesen «Bohr-Festspielen». Sogar aus Ländern, wo man vor dem Weltkrieg entweder keine oder nur unbedeutende physikalische Forschungsarbeit geleistet hatte, kamen jetzt Nachrichten von interessanten Versuchen und Resultaten: Indien und Japan, die Vereinigten Staaten und das revolutionäre Rußland strebten nach wissenschaftlichem Erfahrungsaustausch. Am eifrigsten fast bemühte sich damals die Sowjetunion um Kontakte mit Naturforschern des Westens. Der bolschewistische Staat wollte nicht nur, daß seine Wissenschaftler von «draußen» lernten, sondern sorgte dafür, daß ihre eigenen Veröffentlichungen ins Englische, Französische und Deutsche übersetzt wurden. Auf dem Gebiet der Forschung gab es selbst für diesen Diktaturstaat zu jener Zeit noch keine Geheimhaltung oder Zensur.
Ein berühmter Physiker meinte in jenen Tagen, es gehe in seiner Berufswelt zu wie in einem Ameisenhaufen. Ein jeder laufe mit seinem gerade gefundenen Stückchen Erkenntnis aufgeregt zu einer schadhaften Stelle, kaum aber habe er sich umgedreht, so trage es der nächste schon wieder davon. Planck, Einstein, die Curies, Rutherford und Bohr hatten nacheinander das noch bei der Jahrhundertwende schön übersichtlich und stabil erscheinende Gebäude der Physik so schwer erschüttert, daß der humorvolle und als Interpret der modernen Richtung wohl erfolgreichste Lehrer dieser Generation, der in München dozierende Arnold Sommerfeld, meinte, am besten solle man neugierige Studenten vor dem Eintritt in dieses Studium folgendermaßen warnen:
«Achtung, Einsturzgefahr! Wegen radikalen Umbaus vorübergehend geschlossen!»
Rutherford behauptete allerdings kühn, an all dem Wirrwarr seien nicht die experimentellen, sondern nur die theoretischen Physiker schuld: «Die tragen ihre Schwänze zu hoch», knurrte er. «Wir praktischen Physiker müssen sie wieder herunterziehen.»
3
Was war denn eigentlich geschehen? Die von Nachkriegswehen geschüttelte Welt fand mitten in ihren Revolutionen und Inflationen kaum die Zeit, die Geduld oder vielleicht einfach nicht die Kraft, die tiefste aller Umwälzungen, die bedeutsamste aller Abwertungen zu begreifen: den tiefen Wandel des Weltbildes. Planck hatte die seit Jahrtausenden als selbstverständlich geltende Behauptung erschüttert, daß die Natur keine Sprünge mache, Einstein hatte die als feste Größen angesehenen «Tatsachen» Raum und Zeit für relativ erklärt und Materie als «festgefrorene» Energie erkannt, die Curies, Rutherford und Bohr aber zeigten nun, daß das Unteilbare teilbar, daß das Feste, wenn man ganz genau hinsah, nicht stabil, sondern in ständiger Bewegung und Veränderung war.
Eigentlich hätten die Alpha-Kugeln des Professors Rutherford schon damals nicht nur die Stickstoffatome, sondern auch die seelische Sicherheit der Menschen erschüttern und seit vielen Jahren vergessene Weltuntergangsängste freilegen müssen. Aber all das schien damals noch fern von der mit den einfachen menschlichen Sinnen wahrnehmbaren Tageswirklichkeit zu sein. Was die Physiker mit ihren komplizierten Instrumenten festzustellen oder mit ihren noch komplizierteren Rechnereien über die «wahre Natur» unserer Welt zu erfahren glaubten, war, wie man noch allgemein annahm, nur ihre Sache. Übrigens schienen sie ja selbst keine nahen praktischen Folgen von ihren Entdeckungen zu erwarten. Rutherford hatte ausdrücklich versichert, er glaube, die Welt werde die Auswertung der in den Atomen schlummernden Energie nie erleben (ein Irrtum, an dem er bis zu seinem Tode im Jahre 1937 festhielt).
«Wir leben sozusagen auf einer Insel von Schießbaumwolle», schrieb 1921 der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Walter Nernst, als er versuchte, die neuesten Ergebnisse der Forschung Rutherfords einer größeren Öffentlichkeit verständlich zu machen. Aber zur Beruhigung hängte er gleich einen Nebensatz an: «… für die wir Gott sei Dank das anzündende Streichholz noch nicht gefunden haben.»
Weshalb sollte man sich da Sorgen machen?
Die Physiker allerdings machten sich doch Sorgen. Und zwar vorläufig noch weniger um die Welt, als um ihre eigene Wissenschaft, in der nun fast nichts mehr im alten Sinne «stimmte». Gerade darum aber tauchte jetzt soviel Neues, Erstaunliches, in der Sicht früherer Jahrhunderte nie Gesehenes auf.
Das also war die wundersame und aufregende Epoche, von der einer ihrer jüngsten Teilnehmer, der Amerikaner J. Robert Oppenheimer, später schrieb:
«Was wir unter Atomphysik verstehen, was wir die Quantentheorie der Atomsysteme nennen, hatte um die Jahrhundertwende seinen Anfang genommen und seine Krönung und Ausgestaltung während der zwanziger Jahre erfahren. Es war eine heroische Zeit. Was sie brachte, war nicht die Schöpfung eines einzigen Mannes, sondern entsprang der Zusammenarbeit vieler Wissenschaftler aus vielen Ländern, wenn auch der wunderbare, feine kritische Geist von Niels Bohr das Werk von Anfang bis zu Ende lenkte, zusammenhielt und schließlich verwandelte. Es war eine Zeit geduldiger Arbeit in den Laboratorien, entscheidender Experimente und kühner Versuche, vieler falscher Anfänge und vieler unhaltbarer Annahmen. Es war eine Zeit tiefschürfender Briefwechsel und eiliger Konferenzen, des Debattierens, der Kritik und brillanter mathematischer Improvisationen. Für alle Beteiligten war es eine schöpferische Zeit. Ihre neuen Erkenntnisse erfüllten sie zugleich mit Schrecken und Begeisterung.»
Ein anderer Zeuge jener Jahre, der große deutsche Physiker Pascual Jordan, erinnerte sich:
«Alle waren erfüllt von fast atemberaubender Spannung. Das Eis war gebrochen … Immer deutlicher trat zutage, daß man hier auf eine ganz unerahnte tiefere Schicht der Naturgeheimnisse gestoßen war, daß ganz neue, über alle physikalischen Vorstellungen hinausgehende Gedankengänge erforderlich wurden, wenn man die sich hier zuspitzenden Widersprüche (die erst später als scheinbare Widersprüche erkannt wurden) auflösen wollte.»
Die schönen Jahre
1
Die ungeheure, nur noch mit der kopernikanischen Wende vergleichbare Wandlung des naturwissenschaftlichen Weltbildes ging wie alle wirklich großen geistigen Umwälzungen von Orten aus, in denen eine tiefe äußere Ruhe herrschte. Im Idyll ist die folgenreichste Revolution dieses Jahrhunderts geboren worden: in einem romantischen Park Kopenhagens, einer stillen Seitenstraße Berns, am Rande der Insel Helgoland, in Cambridge zwischen Wiese und schattigem Fluß, im Münchner Hofgarten, im Umkreis der Pariser Panthéons, auf dem sanften Zürichberg und dem von hohen Laubbäumen umrauschten ehemaligen Befestigungswall Göttingens.
Göttingen war in den zwanziger Jahren der eigentliche Knotenpunkt des regen geistigen Verkehrs der Physiker. Hierher kamen interessante Gäste von anderen Universitäten, besonders in den Sommermonaten, so häufig, daß der für seinen scharfen Witz bekannte holländische Physiker Ehrenfest meinte:
«Wir sollten uns eigentlich in der Hochsaison dem Andrang unserer auswärtigen Kollegen durch ‹Besuchsflucht-Besuche› bei anderen Hochschulen entziehen.»
Göttingen war zwischen 1920 und 1930 noch fast genauso verträumt und biedermeierlich gemütlich wie im vorhergehenden Jahrhundert. Zwar gab es gerade hier schon seit 1908 die erste deutsche Versuchsanstalt für «Motor- und Luftschiffahrt» und seit dem Weltkrieg den ersten großen Windkanal Europas für aerodynamische Versuche. Aber diese Laboratorien prägten das Gesicht der Stadt nicht, denn sie lagen fast alle jenseits des alten Stadtwalls. Die Fachwerkhäuser mit ihren vom Rauch vieler, vieler Jahre gebeizten, kunstvoll geschnitzten Balken, der hohe Turm der gotischen Jacobikirche, die spitzwegisch von Klematis und Glyzinien umrankten Professorenhäuser an der Wilhelm-Weber-Straße, die verräucherten Studentenkneipen, das klassizistisch heitere Aulagebäude mit seinen weißen, goldverzierten Säulen strömten etwas Altväterisch-Beruhigendes aus, das sich auch über den großen Krieg hinweg in die neue Zeit gerettet hatte.
Sogar das Horn des Nachtwächters blies noch viele Jahre lang die Tage zur Ruhe, deren Ablauf sich schon nach dem Nauener Zeitzeichen im Radio richtete. Wohl wurden gerade hier hinter den roten Backsteinmauern wilhelminisch häßlicher Gebäude von der «Fakultät Schmieröl» unter Leitung des genialen Ingenieurs Prandtl die modernsten Motorentypen aller Art entworfen, aber die Göttinger selbst machten von solchen lärmenden Erfindungen weit weniger Gebrauch als die Bewohner der meisten anderen deutschen Städte.
In Göttingen pflegte man noch zu Fuß zu gehen, denn die Entfernungen innerhalb der Stadt waren so klein, daß es sich kaum gelohnt hätte, ins Auto oder auf das Motorrad zu steigen. Erst nach dem Weltkrieg bürgerte sich unter Studenten und Professoren das Fahrrad ein, eine Neuerung, die aber durchaus nicht allgemein Beifall fand. Denn hatten nicht gerade die geruhsamen Promenaden vor und nach den Vorlesungen oft wichtige Anregungen ergeben, hatten nicht Zufallsbegegnungen an einer Straßenecke oder beim Spaziergang am romantischen Stadtwall oft mehr für den Ideenaustausch bewirkt als umständlich einberufene Seminarien oder Kommissionssitzungen?
Geistiger und örtlicher Mittelpunkt der Stadt blieb auch nach 1918 die ehrwürdige Georgia-Augusta-Universität. Ja, sie war es nach dem Zusammenbruch der alten staatlichen Ordnung mehr denn je. Auf die Herren Dekane und Professoren ging jetzt etwas von der bis zur Devotion gehenden Hochachtung über, die man zuvor im Kaiserreich den höheren Staatsbeamten und Offizieren gezollt hatte. Die Medaillen, die sie erhielten, die Preise, Diplome und Mitgliedschaften in auswärtigen wissenschaftlichen Gesellschaften, die ihnen zuerkannt wurden, ersetzten im Bewußtsein einer stolzen Stadtbürgerschaft die Ordenspatente und Titelverleihungen der «guten alten Zeit».
Diese Hochachtung wurde in kleinerem Maß auch schon den werdenden Akademikern gezollt. Wenn die Studenten, besonders in den ersten geistig hochgespannten Nachkriegsjahren, bis spät in die Nacht auf der Straße standen und diskutierten, wurde ihnen das ebensowenig verübelt wie die gelegentlich lärmende Heimkehr aus den Kneipen. Seit Generationen gewohnt, daß Studenten Schulden machten (sie aber schließlich doch immer irgendwie bezahlten), erwiesen sich die Zimmervermieterinnen in den Pensionen am Friedländer Weg, am Nikolausburger Weg oder am Düsteren Eichenweg oft bis zur Grenze der Selbstaufopferung geduldig.
Da tauchte zum Beispiel einmal ein angehender junger Physiker, der seit langem seine Rechnung nicht bezahlt hatte, vor der Ladentür einer renommierten Buchhandlung auf, einen flugs von fahrenden Leuten zu diesem Zweck ausgeliehenen Tanzbären am Seil hinter sich herziehend. Als er das brave Tier scheinheilig zur «Abzahlung» anbot, verlor der an Kummer gewöhnte Buchhändler durchaus nicht seinen Humor, sondern erkannte lachend an, daß doch eigentlich er der an der Nase Herumgeführte sei.
Wie Fürsten wurden die in den Ruhestand versetzten Professoren behandelt. Ihnen war die Verehrung aller gewiß. Wenn sie auch nicht mehr Vorlesungen hielten, so nahmen sie dennoch weiter lebhaften und tätigen Anteil am geistigen Leben der Stadt. Sie blieben Mitglieder und oft Vorsitzende der wissenschaftlichen Vereinigungen, und man reservierte ihnen die besten Plätze, wenn Vortragende von auswärts zu Besuch kamen. Machten die alten Herren ihre gemächlichen Spaziergänge, wobei einige von ihnen durch Straßen wandern konnten, die schon bei Lebzeiten ihren Namen trugen, dann wurden sie auf Schritt und Tritt ehrfürchtig gegrüßt und wohl auch um Rat gefragt. Dort bereitete vielleicht gerade ein jüngerer Kollege am offenen Fenster seines Studierzimmers die nächste Vorlesung vor, da saß ein junger, eben von einer anderen Universität hierher berufener Privatdozent auf einer Bank und schrieb weltverloren seine Gedanken in ein Heft. Wissenschaft und Erkenntnis schritten stetig vorwärts, und keine äußere Störung schien ihnen etwas anhaben zu können.
Nie zuvor und vielleicht nie wieder konnten sich Akademiker so sehr für die eigentlichen Spitzen der Gesellschaft halten wie hier im Göttingen der «schönen Jahre». Im Ratskeller stand ein alter Studentenspruch: «Extra Gottingam non est vita», und es mußte manchem Akademiker, der hier lernte, lehrte oder seinen Lebensabend verbrachte, scheinen, als bestätigte sich diese Behauptung täglich neu.
2
Große Philologen, Philosophen, Theologen, Biologen und Juristen hatten dazu beigetragen, der «Georgia Augusta» einen weltweiten Namen zu verschaffen, aber ihren eigentlichen Ruhm verdankte die Göttinger Universität vor allem ihren Mathematikern. Carl Friedrich Gauß hatte hier bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gelehrt und Göttingen zum Mittelpunkt der abstraktesten aller Wissenschaften gemacht. Ab 1886 saß eine Persönlichkeit auf diesem berühmten Lehrstuhl, die nicht nur als Denker, sondern vor allem als großzügiger, unermüdlicher und einfallsreicher Organisator diesen Ruf gefestigt, vielleicht noch vergrößert hatte: Felix Klein.
Fast dreißig Jahre, von 1886 bis 1913, hat Klein in Göttingen gewirkt, ein hoher, aufrechter Mann mit durchdringendem Blick und leuchtenden Augen, der «etwas Königliches an sich hatte», so schildert ihn die Tochter des Mathematikers Carl Runge. Klein hatte stets darauf gedrängt, daß die Mathematik mehr Kontakt mit dem praktischen Leben haben müsse. Er faßte sie als die eigentliche Königin der Wissenschaften auf, ohne deren Hilfe die Naturforschung nicht weiter in die geheimnisvolle Schöpfung vordringen könne, die selbst aber ohne die bei Entdeckungen neu auftauchenden Probleme stagnieren müsse.
Klein hatte den eigentlichen Anstoß zur Gründung oder zum weiteren Ausbau zahlreicher astronomischer, physikalischer, technischer, mechanischer Institute in Göttingen gegeben, um die herum allmählich noch eine ganze Privatindustrie zur Herstellung von wissenschaftlichen Meßgeräten, optischen Instrumenten, feinmechanischen Apparaturen entstand. So war das altmodische Städtchen zur Wiege modernster Technik geworden.
Es ist aber bezeichnend für die früher noch herrschende Großzügigkeit, daß Klein nicht zögerte, ihm geistig durchaus entgegengesetzte Mathematiker wie Hilbert und Minkowski nach Göttingen zu rufen, denen jedes Spezialistentum und auch nur die Bemühungen um eine praktische Verwertung der Mathematik völlig fremd war. Hilberts souveräner, ganz auf den Wesenskern der Dinge gerichteter Geist hatte nämlich für die «Techniker» nur Verachtung übrig. Als er ausnahmsweise einmal an Stelle des kranken Felix Klein die Studenten des Mathematischen Seminars nach Hannover zu einem der von Klein eingerichteten jährlichen Ingenieurtreffen mitnahm, wurde ihm vorher eingebleut, er müsse aber eine versöhnliche Rede halten und gegen die Vorstellung sprechen, daß Wissenschaft und Technik einander feindlich seien. Hilbert erinnerte sich dieser Weisung auch wirklich und erklärte bei der Tagung in dem ihm eigenen, etwas schnarrenden ostpreußischen Dialekt:
«Man hört eine Menge darüber, daß zwischen Wissenschaft und Ingenieuren Feindschaft herrsche. Ich glaube nicht, daß das wahr ist. Ich bin sogar ganz sicher, daß es falsch ist. Es kann ja auch gar nicht stimmen. Die beiden haben nämlich überhaupt nichts miteinander zu tun.»
Solche Anekdoten über den bis zur Schroffheit offenen Hilbert zirkulierten zu Dutzenden in Göttingen. Man nahm ihm seine ironischen Bosheiten und gutgezielten Sticheleien nicht übel. Aus ihnen sprach die gleiche kompromißlose Ehrlichkeit, mit der er als Mathematiker auch seine Wissenschaft anging. Sie erlaubte es ihm, ohne jede Rücksicht auf geistige «Konventionen», immer wieder zu ganz ungewöhnlichen Auffassungen vorzustoßen. Mit Recht zogen Hilberts Vorlesungen Studenten aus der ganzen Welt an. Denn wenn er unter dem riesigen, oberhalb seines Pultes angebrachten Rechenschieber stand und die noch ungelösten Probleme der Mathematik aufwarf, dann hatte jeder Zuhörer den Eindruck, er nehme unmittelbar an der Erschließung neuer Erkenntnisse teil. Der Hörer verließ den Kollegsaal nicht mit längst erwiesenen toten Faktoren, sondern mit lebendigen Fragen, die sein Denken weiter beschäftigen mußten.
Nur von der Lösung eines Problems hielt sich Hilbert absichtlich zurück, obwohl er damit ein kleines Vermögen, nämlich hunderttausend Goldmark, hätte gewinnen können. Das war die Summe, die ein Darmstädter Privatgelehrter in seinem Letzten Willen für jeden ausgesetzt hatte, der den Beweis eines seit dem siebzehnten Jahrhundert ungelösten mathematischen Problems, des sogenannten Fermatschen Satzes, erbringen könnte. Solange nämlich keine richtige Lösung eintraf, war die zu diesem Zwecke gegründete Stiftung berechtigt, die Zinsen nach freiem Ermessen zu verausgaben. Sie wurden nun jährlich dazu benutzt, große Mathematiker und Physiker zu Vortragszyklen nach Göttingen einzuladen. Henry Poincaré, H.A. Lorentz, Arnold Sommerfeld, Planck, Debye, Nernst, Niels Bohr und der Russe Smoluchowski befanden sich unter den Gästen, die auf diese Weise nach Göttingen kamen und unschätzbare Anregungen gaben. «Ein Glück, daß wohl nur ich diese Nuß knacken kann», pflegte Hilbert zu sagen, wenn er als Vorsitzender der Preiskommission wieder einmal die jährlich aus Laien- und Fachkreisen eingelaufenen Lösungsversuche durchgesehen und als ungenügend beurteilt hatte. «Aber ich werde mich hüten, das Huhn zu töten, das uns so schöne goldene Eier legt.»
Jeden Donnerstag um Punkt drei Uhr pflegten sich die vier Ordinarien des Mathematischen Instituts, Klein, Runge, Minkowski und Hilbert, in der offenen Gartenhalle des Hilbertschen Hauses zu treffen. Hier stand halb im Freien eine große schwarze Wandtafel, auf der Hilbert meist bis zum letzten Augenblick geschrieben hatte, wie seine kreidigen Rockärmel bezeugten. Oft setzte an Ort und Stelle sofort das Gespräch um eine neue Formelreihe ein. Es wurde weitergeführt, während man bei jedem Wind und Wetter durch Wald und offene Äcker zu dem hochgelegenen Gasthaus «Kehr» kletterte. Bei einer Tasse Kaffee diskutierte das illustre Mathematiker-Quartett dann all die kleinen und großen Fragen des persönlichen Lebens, der geliebten Universität, der weiten Welt, und immer wieder mischte sich in ihr ernstes, oft bis in höchste Höhen der Erkenntnismöglichkeit vorstoßendes Gespräch ein lautes Lachen, das Trost und Entspannung schenkte, sobald der Geist an scheinbar unüberwindliche Grenzen geraten war.
3
Eine der vielen folgenreichen Neueinrichtungen, die Felix Kleins organisatorische Erfindungsgabe Göttingen beschert hatte, war das mathematische Lesezimmer im Auditorienhaus. Hier waren nicht nur die wichtigsten mathematischen und physikalischen Zeitschriften aus aller Welt nebst einer die gleichen Gebiete umfassenden Handbücherei zu finden, sondern auch Zusammenfassungen, gelegentlich sogar Stenogramme der laufenden Vorlesungen. Dozenten und Studenten, die den Schlüssel zu beiden Räumen besaßen, konnten so in aller Ruhe zwischen einzelnen Kollegs arbeiten und – was häufig noch wichtiger war – im Vorzimmer, wo die strenge Schweigepflicht nicht befolgt werden mußte, über das debattieren, was sie gerade in den letzten wissenschaftlichen Journalen gelesen hatten. Seit die moderne Naturforschung in Bewegung geraten war und mit Hilfe der Mathematik einen Ausdruck für ihre widerspruchsvollen Erkenntnisse suchte, hörten die Diskussionen zwischen Physikern und Mathematikern nicht mehr auf. Mit seiner üblichen Kratzbürstigkeit hatte Hilbert erklärt: «Aber nein doch – die Physik ist für die Physiker ja eigentlich zu schwer.»
Bei diesem negativen Urteil ließ er es aber nicht bewenden. Mit der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit wandte sich Hilbert nun der «gedanklich notleidenden» Physik zu und versuchte, ihr «mathematische Hilfestellung» zu leisten.
Es war wohl Hilberts Einfluß, der im Jahre 1921 die Berufung eines der begabtesten theoretischen Physiker der «neuen Schule» nach Göttingen durchsetzte. Max Born, damals gerade achtunddreißig Jahre alt, war an der «Georgia Augusta» kein Unbekannter. 1907 hatte dieser Sohn eines bekannten Breslauer Biologen als einer der brillantesten Schüler des Mathematischen Instituts hier mit einer preisgekrönten Arbeit promoviert. Seine weiteren Lehr- und Wanderjahre führten ihn dann nach Cambridge, Breslau, Berlin und Frankfurt. Mit seinem Einzug in das von außen unsagbar häßliche Gebäude des Zweiten Physikalischen Instituts an der Bunsenstraße – es sah aus wie eine preußische Reiterkaserne – begann die kurze, aber unendlich fruchtbare Blütezeit der Göttinger Atomphysik.
Ein kleiner bürokratischer Irrtum, eine jener Listen des Schicksals, die so viel bewirken können, half Born bald nach seiner Ankunft die Voraussetzungen für diese große Zeit entscheidend zu verbessern. Zwar gab es in Göttingen schon eine Professur, die der experimentellen Physik gewidmet war, aber deren Inhaber, Professor Pohl, ging fast völlig in seiner Lehrtätigkeit auf und hatte darum viel zuwenig Zeit für Forschungsarbeit, wie sie Born vorschwebte. Der neue Chef entdeckte nun aber in den Akten, daß im Etat außerdem noch eine bisher nie besetzte zweite Professur für sein Institut vorgesehen war. Dies sei der Irrtum eines Beamten, ein Schreibfehler, weiter nichts, hieß es. Aber Born gab sich nicht geschlagen, sondern bestand auf seinem Schein. So konnte er die Berufung von James Franck nach Göttingen durchsetzen, der bereits damals durch seine experimentellen Entdeckungen (darunter der Versuch, der ihm später den Nobelpreis brachte) bekannt geworden war.
So fand sich in Göttingen seit 1921 mit Hilbert, Born und Franck ein Trio von hohen Begabungen, unermüdlichem Fleiß und einer geradezu religiösen Leidenschaft für die neue Naturschau zusammen. Jeder dieser drei Männer war grundverschieden. Born war wohl der weltgewandteste, der zugänglichste und beweglichste von ihnen, eine so vielseitige Begabung, daß er vermutlich auch ein ausgezeichneter Pianist oder Schriftsteller geworden wäre. Sein vermögender Vater hatte ihm vor Beginn seines Studiums geraten: «Hör doch erst einmal alles an, bevor du dich entscheidest.» So belegte der junge Mann in seinen ersten Semestern an der Universität Breslau gleichzeitig Vorlesungen über Recht, Literatur, Psychologie, Volkswirtschaft und Astronomie. Am meisten fühlte er sich zur Himmelskunde hingezogen, und zwar angeblich vor allem deshalb, weil ihm das Gebäude, in dem die Vorlesungen über die Sternenwelt stattfanden, am besten gefiel.
Franck, wie Born aus einer seit langem in Deutschland ansässigen jüdischen Familie stammend, konnte seine Hamburger Herkunft nicht verleugnen. Bei aller Herzlichkeit und Wärme, die seine Schüler an ihm liebten, hielt er doch stets Abstand zu seinen Mitmenschen. Er blieb immer der Hamburger Patriziersohn. «Ein vornehmer Mann», pflegte man damals von ihm zu sagen. Rückschauend haben ihn später seine Mitarbeiter einen Heiligen genannt. Das bezog sich nicht nur auf Francks große Güte, sondern auch auf seine beinahe religiöse Begeisterung für die Physik. Nur wer sich ihr ganz verschreibe, sogar von ihr träume, könne auf Erleuchtung hoffen, pflegte er seinen Schülern zu sagen. Und über seine eigenen Eingebungen sprach er wie ein mittelalterlicher Mystiker:
«Ich kann spüren, daß ein neuer Gedanke wirklich wichtig ist, wenn mich dabei plötzlich ein Gefühl tiefen Schreckens ergreift.»
4
Es gibt in fast jeder Epoche ein Gebiet menschlichen Denkens und Schaffens, das die Begabten besonders anzieht. In der einen drängen die unruhigen, nach Neuem strebenden Geister besonders zur Architektur, in anderen zur Malerei oder Musik, zur Theologie oder Philosophie. Plötzlich, und niemand könnte sagen wie, spüren die Aufgeschlossensten, wo gerade der Boden neu aufgebrochen wird, und drängen dorthin, wo sie hoffen können, nicht nur Epigonen zu bleiben, sondern Mitbegründer und Meister zu werden.
Eine solche Anziehungskraft besaß die Atomphysik in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Zu ihr stießen philosophisch begabte Geister und künstlerisch Veranlagte, politische Köpfe, denen die Tagespolitik zu konfus schien, und Abenteurer, die auf dem bis in die fernsten Kontinente erforschten Erdball nichts mehr zu erobern fanden. Im Studium des Unsichtbaren und Allerkleinsten war noch Hoffnung auf Offenbarungen, hier konnte man noch neuen Gesetzen auf die Spur kommen und jenes mit Furcht gemischte Entzücken spüren, etwas gedacht zu haben, was niemand vorher je dachte, gesehen zu haben, was niemand zuvor je sah.
Da in der Atomforschung alles so neu und unsicher war, standen Lehrer und Schüler einander viel näher als in anderen Disziplinen. Erfahrung und Wissen galten hier nicht viel. Alte und Junge wurden auf dieser Reise ins Innere der Materie zu Kameraden, gleich stolz auf ein gemeinsam erkämpftes Stückchen Erkenntnis, gleich bescheiden und gleich ratlos vor dem Undurchdringlichen.
So konnte es geschehen, daß James Franck, der zu dieser Zeit schon den Nobelpreis für Physik besaß, sich, als er in einer schwierigen Rechnung steckenblieb, von der schwarzen Tafel abwandte und einen seiner Hörer fragte: «Wissen Sie da vielleicht weiter?» Die Professoren teilten den Studenten ihre Irrwege und Zweifel freimütig mit, sie hielten sie auf dem laufenden über ihre wissenschaftliche Privatkorrespondenz, in der sie ungelöste Probleme mit auswärtigen Kollegen diskutierten, und regten die jugendlichen Mitarbeiter an, Erklärungen zu finden, wo sie, die Älteren, vorläufig versagt hatten.
Ein Höhepunkt jeder Semesterwoche war das von Born, Franck und Hilbert «gratis et privatissime» im Institut abgehaltene «Seminar über die Materie». Es wurde beinahe traditionell mit der gespielt naiven Frage Hilberts eröffnet: «Also, meine Herren, nun sachen Sie mir doch mal, was is denn das eijentlich, eijn Atom?» Jedesmal unternahm ein anderer Student, es dem Herrn Professor zu erklären. Immer wieder ging man das Problem neu an, versuchte man eine andere Lösung. Wenn aber eines der jungen «Genies» anfing, sich in esoterische Höhen komplizierter mathematischer Erklärungen zu flüchten, pflegte ihn Hilbert in seinem breitesten Ostpreußisch zu unterbrechen. «Das verstehe ich doch nich, junger Mann. Nun erklären Sie mir das alles noch mal.» So wurde jeder gezwungen, sich so klar wie möglich auszudrücken und, statt mit allzu kühnen Gedankensprüngen über Abgründe der Erkenntnis zu eilen, solide Brücken zu bauen.
Es ging in diesen Debatten immer mehr um tiefste erkenntnistheoretische Fragen. War durch die Entdeckungen der Atomphysik die Zweiheit zwischen dem beobachtenden Menschen und der Welt, die er beobachtete, aufgehoben worden? Gab es also keine wirkliche Trennung mehr zwischen Subjekt und Objekt? War es möglich, zwei sich gegenseitig ausschließende Aussagen über die gleiche Sache dennoch von einem höheren Standpunkt aus beide als richtig anzusehen? Durfte man es wagen, die enge Verknüpfung von Ursache und Wirkung als Grundlage der Physik aufzugeben? Konnte es dann aber überhaupt noch Naturgesetze geben? Ließen sich überhaupt noch schlüssige wissenschaftliche Voraussagen machen?
Fragen, Fragen und nochmals Fragen, über die man endlos diskutieren konnte und zu denen jeder etwas zu sagen hatte. Im Wintersemester 1926 tat sich in diesen Diskussionen ein schmaler, etwas kränklich aussehender amerikanischer Student hervor, der sogar in diesem Kreis der Hochbegabten auffiel. Manchmal konnte er, ohne ein Ende zu finden, ganze Abhandlungen fließend aus dem Stegreif improvisieren, so daß neben ihm kaum ein anderer zu Wort kam. Zuerst hörte man dem «Neuen» fasziniert zu, aber allmählich erweckte seine allzu große Redelust und Redegabe den Ärger und vielleicht auch den Neid mancher Kommilitonen. Sie machten eine schriftliche Eingabe an einen der Professoren und baten, man möge dem «Wunderkind» einen Dämpfer aufsetzen. Sein Name sollte nicht ganz zwanzig Jahre später weltbekannt werden: J. Robert Oppenheimer, den die Zeitungen im August 1945 der Öffentlichkeit erstmals als den «Vater der Atombombe» vorstellten.
5
Oppenheimer war einer der vielen jungen Amerikaner, die in jenen Jahren nach der Alten Welt kamen, um hier Physik zu studieren. Sie nannten sich gelegentlich «die umgekehrten Columbus-Ritter», denn sie waren in die entgegengesetzte Richtung gereist, wie einst der italienische Seefahrer und seine Begleiter, um einen «neuen Kontinent» zu entdecken. Von ihm kehrten sie in ihr Land, wo man damals noch «altmodisch Physik» lehrte, mit unglaublicher Kunde und märchenhaften Entdeckungen zurück, die, gleich dem Gold der spanischen Seefahrer im fünfzehnten Jahrhundert, ihrer Heimat großen, aber zwiespältigen Gewinn bringen sollten.
Fast alle diese jungen Amerikaner kamen reichversehen mit Stipendien nach Europa. Zu ihnen gesellten sich auch «ältere Semester», Dozenten, die ihr traditionell alle sieben Jahre gewährtes «sabbatical year» – ein freies Studienjahr bei vollem Gehalt – als Lernende im Gedankenaustausch mit ihren europäischen Kollegen zu verbringen pflegten.
Diese «wissenschaftlichen Touristen» von der anderen Seite des Atlantik brachten Devisen in die durch den Weltkrieg verarmten europäischen Universitätsstädte und zogen später oft noch weiteres Dollarkapital nach. Denn wenn die amerikanischen Akademiker erst einmal in ihre Heimat zurückgekehrt waren, plädierten sie bei philanthropischen Stiftungen oft erfolgreich für ihre jeweilige europäische «Alma mater».
Besonders die deutschen wissenschaftlichen Institute haben von dieser amerikanischen Hilfe damals größten Nutzen gezogen. Was hätte ein Mann wie Geheimrat Sommerfeld in München ohne die gelegentlichen Aufbesserungen seines spärlichen Etats durch die Rockefeller Foundation getan? Reiste damals Wickliff Rose, der Mann, der die Gelder aus dem Erbe des verstorbenen Ölmagnaten verteilte, durch Europa, so empfingen ihn die Universitäten wie einen Potentaten.
Für Göttingen hatten die amerikanischen Mathematiker und Physiker eine besondere Vorliebe. Hier wirkte schon vor dem Ersten Weltkrieg ihr berühmter Physiker Charles Michelson ein Semester lang als Gastprofessor. Hier hatten einst Millikan und Langmuir, die «großen alten Männer» der amerikanischen Physik und Chemie, studiert.
In den zwanziger Jahren waren oft ein Dutzend und mehr Amerikaner an der naturwissenschaftlichen Fakultät der «Georgia Augusta» eingeschrieben, sie brachten ein wenig von der unbeschwerten Atmosphäre des amerikanischen «Campus» nach Göttingen. Ihre jährlichen «Thanksgiving-Dinners» – das unvergeßliche, bei dem K.T. Compton präsidierte, fand 1926 statt – waren allgemein beliebt. Die Amerikaner zeigten den deutschen Kollegen, wie man Truthahn und Mais ißt, sie lernten von ihnen dafür Biertrinken, Singen und Wandern. Fast alle durch die Entwicklung der Atomenergie später bekannt gewordenen Amerikaner sind zwischen 1924 und 1932 irgendwann einmal in Göttingen gewesen. Da waren Condon, der sich lebhaft über den mangelnden Komfort der Göttinger «Buden» beklagte, der blitzgescheite Norbert Wiener, der immer nachdenkliche Brode, der bescheidene Richtmyer, der heitere Pauling (ein Sommerfeld-Schüler, der oft von München hergereist kam) und eben jener verblüffende «Oppie», der in Göttingen nicht nur seinen physikalischen Studien nachgehen konnte, sondern auch seinen philosophischen, philologischen und literarischen Liebhabereien. Besonders hat er sich damals in die Lektüre des «Inferno» vertieft und in langen abendlichen Spaziergängen entlang der Eisenbahnschienen des Güterbahnhofs mit seinen Studienfreunden darüber debattiert, weshalb Dante wohl «die ewige Suche» in der Hölle statt im Paradies angesiedelt habe.
Eines Abends nahm der sonst so schweigsame Engländer Dirac den Kollegen Oppenheimer beiseite und sagte zu ihm mit sanftem Vorwurf: «Ich höre, Sie schreiben neben Ihrem Physikstudium Gedichte. Wie können Sie das nur beides nebeneinander tun? In der Wissenschaft versucht man etwas, das niemand zuvor wußte, auf eine Weise zu sagen, die jeder versteht. In der Dichtung verhält es sich doch gerade umgekehrt!»
Oppenheimer und Dirac wohnten beide in einer schönen großen Granitvilla am Beginn der Geismarer Landstraße, die gegenüber dem Astronomischen Observatorium lag, wo einst Carl Friedrich Gauß gearbeitet hatte. Dieses Haus gehörte dem Arzt Dr. Cario, dessen Sohn Günther Physiker war und sich als einer der Assistenten Francks auf eine schöne Karriere vorbereitete. Es war durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn in Göttingen gutgestellte Familien auswärtige Studenten als «paying guests» in ihr Heim aufnahmen. Sie brachten die große weite Welt in die provinzielle «gute Stube» und empfingen dafür etwas von jener bürgerlichen Geborgenheit, die sie zuerst belächelten, dann schätzten und später oft genug zurückersehnten. Aus solchen Beziehungen zwischen Vermietern und Untermietern entstanden meist langanhaltende Freundschaften und nicht selten – Ehen. Überraschend viele Professorenfrauen in fünf Erdteilen stammen aus dem kleinen Göttingen.
Durch das Leben in der Familie haben die in Göttingen studierenden Ausländer meist sehr schnell Deutsch gelernt und oft sogar schon während ihrer Studienzeit Aufsätze in deutscher Sprache für wissenschaftliche Zeitschriften verfaßt. Natürlich gab es auch die üblichen kleinen Mißverständnisse, die dann reichlich Stoff zum Lachen boten. Eine gewisse Berühmtheit hat das Abenteuer des jungen englischen Astro-Physikers Robertson erlangt, der einen Auslandsbrief, ehe er ihn abschickte, noch schnell auf sein exaktes Gewicht prüfen wollte und, atemlos in ein Geschäft stürzend, fragte: «Fräulein, haben Sie eine Wiege? Ich möchte etwas wagen.» Als ihn das Mädchen hinter dem Ladentisch mit rotem Kopf anschaute, verbesserte er sich bestürzt: «Pardon me, wollte sagen, haben Sie eine Waage? Ich möchte etwas wiegen.»
Nie befreunden konnten sich die amerikanischen Studenten mit den an deutschen Universitäten üblichen bürokratischen Formalitäten. Über sie stolperte auch Oppenheimer. Als er nämlich im Frühjahr 1927 seine Zulassung zur Doktorprüfung beantragte, wurde zur Überraschung aller das Gesuch vom preußischen Kultusministerium, dem die Universität Göttingen unterstand, rundweg abgelehnt. Eine Anfrage des Dekans der Naturwissenschaftlichen Fakultät brachte aus Berlin folgende Antwort des Ministerialrats v.Rottenburg:
«Der Herr Oppenheimer hat seinerzeit ein ganz unzureichendes Gesuch eingereicht. Es war selbstverständlich, daß das Ministerium dieses Gesuch ablehnen mußte.»
Anscheinend hatte «Oppie» vergessen, seinem Antrag um Aufnahme an die «Georgia Augusta» vorschriftsmäßig einen ausführlichen Lebenslauf beizulegen. Er war deshalb niemals immatrikuliert worden, hatte also aktenmäßig bisher gar nicht zur Universität gehört.
Die Professoren des künftigen «Vaters der Atombombe» mußten sich nun mit Bittbriefen an Rektorat und Ministerium ins Zeug legen, Max Born setzte sich für Oppenheimer mit der Begründung ein, die von ihm eingereichte Doktorarbeit sei so hervorragend, daß er sie in einer von ihm herausgegebenen Göttinger Dissertationen-Reihe veröffentlichen wolle. Daß der amerikanische Doktorand nicht ein weiteres Semester in Göttingen warten könne, um dann «ordnungsgemäß» sein Examen zu machen, wurde den Behörden gegenüber in einem Gesuch um nachträgliche Immatrikulation folgendermaßen motiviert:
«Wirtschaftliche Gründe machen es Herrn Oppenheimer unmöglich, länger als bis zum Schluß des Sommersemesters in Göttingen zu bleiben.»
Entsprach dieses Argument den Tatsachen? Oppenheimer war der Sohn eines New Yorker Geschäftsmannes, der im Alter von siebzehn Jahren aus Deutschland nach den USA ausgewandert und dort reich geworden war. An Geld hat es «Oppie» damals weniger gemangelt als an Geduld. Ein weiteres Göttinger Semester mußte er wohl als verlorene Zeit ansehen. In diesen Jahren aber wurden solche kleinen Notlügen glücklicherweise noch nicht von staatlichen Untersuchungskommissionen überprüft, und das Gesuch ging daher anstandslos durch. So konnte Robert Oppenheimer am Nachmittag des 11. Mai 1927 in die mündliche Prüfung «steigen». Er bestand sie in allen Fächern (ausgenommen Physikalische Chemie) mit den Prädikaten «ausgezeichnet» oder «sehr gut». Über seine schriftliche Doktorarbeit gab Max Born das Urteil ab, es handle sich dabei um eine Leistung von hohem wissenschaftlichem Rang, die weit über dem Durchschnitt der Dissertationen stehe. Als Kritik fügte er lediglich hinzu: «Der einzige Mangel der Arbeit besteht darin, daß sie schwer lesbar ist. Doch kommt dieser Formfehler gegen den Inhalt so wenig in Betracht, daß ich das Prädikat ‹Mit Auszeichnung› beantrage.»
6
Im Göttingen der schönen Jahre konnte man auch ohne Stipendium oder fetten Monatsscheck auskommen. Der russische Mathematiker Schnirelmann brachte außer seiner Zahnbürste nur den Sonderdruck seiner neuesten Arbeit über die Primzahlen mit. Aber Landau, der Göttinger Mathematiker, hatte bereits eine Vorlesung über den «Schnirelmannschen Satz» gehalten, und so war der junge Gelehrte, der in recht abgerissenem Zustand angekommen war, anständig gekleidet, bald in der berühmten Physikerpension Wunderlich untergebracht und verköstigt. Außerdem bekam er noch monatlich von seinem anonymen Mäzen eine kleine Summe Taschengeld per Postanweisung. Mit hängenden Schnürsenkeln sah man ihn nun oft langsam die «Weender», Göttingens Hauptstraße, hinuntergehen, den Blick wie immer abwesend auf ferne Harmonien und Formenspiele gerichtet.
Der bekannte Theatermann Kurt Hirschfeld, der damals in Göttingen studierte, erzählt, wie seltsam ihm diese jungen Mathematiker und Physiker erschienen. Einmal sah er, wie ein Mitglied des Bornschen «Kinder»-Seminars in seiner Traumverlorenheit stolperte und der Länge nach hinfiel. Als er hinzueilte und ihn aufheben wollte, wehrte der noch am Boden Liegende energisch ab: «Lassen Sie mich doch! Ich bin beschäftigt!» Anscheinend war ihm gerade eine neue «geniale Lösung» eingefallen. Fritz Houtermans, heute wohlbestallter Physikprofessor an einer Schweizer Universität, berichtet, wie er einmal mitten in der Nacht durch Klopfen ans Fenster seiner ebenerdigen «Bude» am Nikolausburger Weg geweckt wurde. Ein Kommilitone verlangte dringend Einlaß. Er hatte eben eine «großartige Idee» gehabt, die, wie er meinte, soundso viele bisher ungelöste Widersprüche der neuen Theorien mit einem Schlag aufklären würde. Weit entfernt davon, den Ruhestörer hinauszuwerfen, öffnete ihm der aus dem Schlaf Gerissene, sobald er nur in Hausschuhe und Schlafrock geschlüpft war, und die beiden rechneten bis zum Morgengrauen an den neuaufgestellten Gleichungen.
Daß solche plötzlichen «neuen Einfälle» blutjungen Menschen hohe Geltung in den internationalen Fachkreisen, ja in einzelnen Fällen fast über Nacht Weltruhm brachten, war in jenen aufregenden Jahren nichts Ungewöhnliches. Da war zum Beispiel Werner Heisenberg. 1921 hatte ihn sein Lehrer Arnold Sommerfeld aus München zum ersten Male mit nach Göttingen zu den «Bohr-Festspielen» genommen, und der Neunzehnjährige, weit davon entfernt, dem großen Mann aus Kopenhagen nur ehrfürchtig zuzuhören, kreuzte mit ihm auf langen Spaziergängen zum Rohns und auf den Hainberg die Klingen. In diesen Gesprächen, die ihn begeisterten, hat er sich endgültig für die Physik entschieden. Schon begann sein Name als Mitarbeiter in einer Veröffentlichung Sommerfelds aufzutauchen. Mit dreiundzwanzig Jahren war er Assistent Borns, mit vierundzwanzig Dozent für theoretische Physik in Kopenhagen, mit sechsundzwanzig ordentlicher Professor in Leipzig. Kaum zweiunddreißig Jahre alt, erhielt Heisenberg den Nobelpreis für grundlegend wichtige theoretische Arbeiten, die er schon sechs Jahre zuvor veröffentlicht hatte, in einem Alter also, in dem Mediziner und Juristen gewöhnlich gerade erst ihr Studium abschließen.
Einer seiner nächsten Freunde erinnert sich an die Göttinger Zeit Heisenbergs: «Er sah damals sogar noch ‹grüner› aus, als er wirklich war, denn als Anhänger der Jugendbewegung, deren sittlicher Idealismus ihn begeisterte, trug er auch im Mannesalter oft noch halsfreie Hemden und kurze Wanderhosen. Er hielt sich stets für ein Glückskind, und er war wirklich eines. Große geistige Leistungen wie seine Erkenntnis des ‹Unschärfeprinzips› oder die Grundideen der ‹Matrizenrechnung›, die er dann mit Hilfe Borns und seines noch um ein paar Monate jüngeren Kommilitonen Pascual Jordan entwickelte, fielen ihm anscheinend wie von selbst zu. Wer Heisenberg erst später kennengelernt hat, als infolge des politischen Umsturzes Sorgen und Zweifel an ihm zehrten, weiß nicht, wie strahlend er einmal war. Seine revolutionäre Quantenmechanik brachte er 1925 aus Helgoland mit. Dort kletterte er auf den roten Felsen herum, las Goethes ‹West-Östlichen Divan› und arbeitete zwischendurch an seinen Gedanken in einer Art von geistigem Rausch. Geschlafen hat er, glaube ich, in diesen glückhaften Pfingstferien so gut wie gar nicht.»