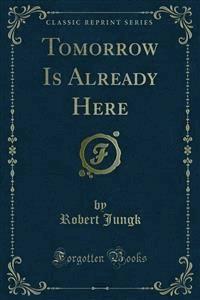9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der 6. August 1945 bleibt in die Geschichte der Menschen eingebrannt. Die erste Atombombe, die an diesem Tag auf Hiroshima fiel, hat Zerstörungen hinterlassen, die auch heute noch nicht getilgt sind, Zerstörungen an den Körpern und Seelen der Überlebenden. Ihren Schicksalen ist Robert Jungk nachgegangen. «Ich kam», schreibt er, «als Reporter, aber je länger ich mich mit dieser Story beschäftigte, um so klarer wurde mir, daß ich nicht außerhalb und über ihr stand, sondern ein Teil von ihr war.» Im Januar 1980 reist der engagierte Kernkraftgegner Jungk ein zweites Mal nach Hiroshima, gut zwanzig Jahre nach seinem ersten Besuch. Er knüpft neue Kontakte, frischt alte auf und folgt seinen früheren Recherchen. Was er im Anschluß an diese zweite Reise der ersten Fassung von «Strahlen aus der Asche» anfügt, vervollständigt sein Dokument vom Schicksal einer Stadt und ihrer Menschen und gibt Aufschluß über Hiroshima – eine Generation danach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Robert Jungk
Strahlen aus der Asche
Über Robert Jungk
Über dieses Buch
Der 6. August 1945 bleibt in die Geschichte der Menschen eingebrannt. Die erste Atombombe, die an diesem Tag auf Hiroshima fiel, hat Zerstörungen hinterlassen, die auch heute noch nicht getilgt sind, Zerstörungen an den Körpern und Seelen der Überlebenden. Ihren Schicksalen ist Robert Jungk nachgegangen. «Ich kam», schreibt er, «als Reporter, aber je länger ich mich mit dieser Story beschäftigte, um so klarer wurde mir, daß ich nicht außerhalb und über ihr stand, sondern ein Teil von ihr war.»
Inhaltsübersicht
Den Einzelgängern,
die es noch wagen,
Mensch zu sein.
«Il leur a fallu se forger un art de vivre par temps
de catastrophe, pour naître une seconde fois,
et lutter ensuite, à visage découvert, contre
l’instinct de mort à l’oeuvre notre histoire.»
«Sie waren gezwungen, sich eine Lebenskunst für
Katastrophenzeiten zu schmieden, um ein zweites
Mal geboren zu werden und dann mit offenem Visier
gegen das instinktive Todesverlangen anzukämpfen,
das in unserer Geschichte am Werk ist.»
Albert Camus
Rede anläßlich der Entgegennahme des Nobelpreises
Die Personen, die in diesem Bericht vorkommen, sind authentisch und werden mit ihren eigenen Namen erwähnt.
Einige von ihnen haben durch Tagebücher, Erinnerungen und mündliche Mitteilungen selbst zu diesen Aufzeichnungen beigetragen.
Die Warnung (1980)
1
Als ich Chefredakteur Hiraoka von «Chugoku Shimbun», der größten Lokalzeitung Hiroshimas, fragte, welches Ereignis seine Leser in der Nachkriegszeit wohl am meisten beschäftigt habe, antwortete er ohne Zögern: «Der Aufstieg der ‹Karpfen›, unserer Baseballmannschaft, vom letzten auf den ersten Platz der Nationalliga.»
Daß diese Aussage wahrscheinlich zutrifft, haben mir fast alle meine Bekannten und Freunde, die in der ersten durch eine Atombombe zerstörten Großstadt der Welt leben, bestätigt. Von jenem schrecklichen 6. August 1945 wird in der wiederaufgebauten Industriemetropole öffentlich heutzutage wenig gesprochen. Am Jahrestag des Ereignisses, das eine neue Ära der Geschichte einleitete, versammeln sich ein paar tausend Menschen im «Friedenspark», hören sich Reden an und lassen Friedenstauben flattern. Dann gehen sie auseinander, und das Alltagsleben nimmt wieder seinen Lauf.
«Die Phantasie ist eine der am schwächsten entwickelten menschlichen Fähigkeiten. Die stärkste ist die Fähigkeit des Vergessenkönnens.» Mit diesen Worten beendete Philip Noel-Baker, ehemaliger britischer Minister und Friedensnobelpreisträger, im August 1977 seine Ansprache vor einem internationalen Kongreß, der sich mit den Schäden und Nachwirkungen der nuklearen Vernichtung beschäftigte. Hiroshima hätte ein Mahnmal sein sollen. Es wurde zu einem Schulbeispiel der Verdrängung. Beunruhigen sollte es und verbreitete statt dessen durch seinen eindrucksvollen materiellen Wiederaufbau falsche Hoffnung. Das «Nie wieder!», das die Zeugen und Zeitgenossen der Katastrophe verkündeten, ist einem resignierten oder gar aggressiven «Vielleicht morgen schon» gewichen.
Allein in Japan wurden nach Aufhebung des von den Alliierten verhängten Veröffentlichungsverbotes der ersten Nachkriegsjahre Tausende von Gedichten, persönlichen Erfahrungsberichten, Fotos, Filmen, Essays, Romanen, Zeichnungen und Bildern veröffentlicht, die das atomare Grauen wiedergeben und weitergeben wollten. Es fanden zahllose öffentliche Veranstaltungen und gewaltige Demonstrationen in aller Welt gegen nukleare Aufrüstung und Bedrohung statt.
War all das vergebens? Als ich diese Zweifelsfrage in Hiroshima mit «hibakushas» (Überlebenden), den seelisch und körperlich bis heute von «diesem Tag» Gezeichneten, zu Beginn der achtziger Jahre diskutierte, sagte einer von ihnen: «Alle Menschen auf diesem Planeten sind doch heutzutage ‹hibakushas› – die meisten wissen es nur noch nicht. Ihre physischen Abwehrkräfte sind weltweit durch die von den Atombombentests und der Atomindustrie freigesetzte radioaktive Strahlung angegriffen. Noch tiefer sind sie seelisch getroffen, denn sie können die Angst vor ‹neuen Hiroshimas› zwar verdrängen, aber nicht wirklich loswerden, solange es noch nukleare Waffen und nukleare Energieerzeugung gibt.»
Der Bekämpfung dieser tiefsitzenden Befürchtungen widmen sich in allen industriellen Staaten sowohl staatliche wie private Stellen, die über beträchtliche Mittel verfügen. In Japan wird diese Propaganda besonders intensiv betrieben. Um die Wirkungen der populären Bildgeschichten-Serie «Hadashi no Gen»[1] aufzuheben, die in der weitverbreitetsten «Comics»-Zeitschrift «Shukan Shonen Jampa» von den Abenteuern und Leiden eines Siebenjährigen im verwüsteten Hiroshima erzählte, wurden von der Elektroindustrie Millionen fröhlicher Bilderbücher verschenkt, die «das Atom» als den «guten Geist des Fortschritts» darstellen. Am 26. Oktober jeden Jahres begeht Nippon den «Atom-Tag», und die Regierung läßt überall im Lande Plakate anschlagen, auf denen bildhübsche Mädchen und rührende Liebespaare verkünden, daß ihre Sicherheit und ihr Glück vom «energiespendenden Atom» abhingen.
Tatsächlich ist das Inselreich heute das Land mit den zweitmeisten Atommeilern in der Welt. Während in den USA der Bau von Wiederaufarbeitungs-Anlagen, die das Bombenmaterial Plutonium herstellen würden, vorläufig verschoben wurde, sind die japanischen Großindustriellen eifrig dabei, in Tokai ein solches Werk mit französischer Hilfe zu bauen und hoffen, Spitzenreiter des «Plutonium-Zeitalters» zu werden. Daß sie dann auch einmal ohne Schwierigkeit eigene Atombomben herstellen könnten, gehört mit zu dem «großen Plan», der die führende Industriemacht Nippon wieder zur beherrschenden Militärmacht Asiens machen soll.
Erst ziemlich spät haben die lange Zeit unter sich zerstrittenen Atomwaffengegner in Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Tokio und anderen japanischen Städten begriffen, daß der Protest gegen die Bomben zum Kampf gegen die «nukes», die Anlagen der «friedlichen» Atomindustrie, ausgeweitet werden muß. In Hiroshima, wo sich der Hauptsitz der «Chugoku Electric Power Co.» befindet, einer Firma, die ihr Kernkraftwerk hundert Kilometer entfernt von Hiroshima in Shimane bauen muß, weil sie ein solches Projekt den Bewohnern ihrer Heimatstadt nicht – oder noch nicht – zumuten kann, haben jugendliche Atomgegner durch einen tagelangen Sitzstreik erreicht, daß ihnen die bis dahin geheimgehaltenen Notstandspläne für den Katastrophenfall ausgeliefert wurden. Sie konnten nun mit eigenen Augen lesen, daß eine Evakuierung der Bevölkerung erst erfolgen soll, wenn die Strahlung die gleiche Intensität erreicht haben sollte, die 1945 im Abstand von nur 1500 Metern vom Explosionszentrum der Bombe vorhanden war.
Durch den wachsenden Widerstand gegen den Ausbau der Atomenergie mit seinen möglichen und wahrscheinlichen Rückwirkungen auf die Atomrüstung gewinnt Hiroshima nicht nur in Japan, sondern in der ganzen Welt erneut beispielhafte Bedeutung. Denn an den über 300000 Menschen, die nach beinahe vier Jahrzehnten immer noch an den Folgen der verhältnismäßig schwachen Strahlung dieser einen «primitiven» Bombe leiden, werden die zerstörerischen Langzeitwirkungen der nuklearen Spaltprodukte nach und nach deutlich. Schädigungen, die sich bei Arbeitern in unlängst errichteten Atomanlagen oder bei Nachbarn von Reaktoren und Wiederaufarbeitungs-Fabriken erst in fünfzehn, zwanzig oder noch mehr Jahren zeigen dürften, treten jetzt bereits sicht- und überprüfbar bei fast all den unfreiwilligen «Versuchspersonen» auf, die entweder am 6. August 1945 in Hiroshima waren oder die Stadt in den darauffolgenden Tagen besuchten, um dort nach Vermißten zu fahnden. Jeder dieser Kranken, Kränkelnden, frühzeitig Gealterten oder Siechenden ist eine deutlich wahrnehmbare Warnung vor Schäden, die sich vorläufig noch unsichtbar bei fast all den Menschen entwickeln, die, oft ohne ihr Wissen, großen Mengen angeblich «völlig unschädlicher» Spaltprodukte in der Luft oder Nahrung ausgesetzt werden.
Wer seinen Blick von diesen Unglücklichen nicht abwendet, sondern in ihren Leiden ein Signal erkennt, das nicht übersehen und überhört werden darf, gibt ihrem an sich sinnlosen Opfer nachträglich doch noch einen Sinn. Hajima Yukimune, ein Sprecher der Überlebenden von Hiroshima, hat das sehr eindrucksvoll klargemacht. Er forderte unlängst alle, besonders aber die schwerkranken und alten «hibakushas» auf, in Worten oder Bildern ihre Erlebnisse während und nach dem Schicksalstag im August 1945 zu beschreiben, um damit all jenen, die heutzutage leichtfertig über die Unverzichtbarkeit von Atomenergie und die Unvermeidlichkeit von Atomkriegen sprechen, ein Testament ihrer Leiden zu hinterlassen. Obwohl diese Aufforderung von manchen Betroffenen als «herzlos» verurteilt wurde, fand sie doch ein großes Echo. Als Yukimune diese Zeugnisse einer in Hiroshima tagenden Weltkonferenz vorlegte, verglich er den Leidensweg der «hibakushas» mit dem Opfertod Christi: «Sie haben im Angesicht des Todes ihre tragischen und schmerzlichen Erfahrungen offenbart, in der Hoffnung, die Menschheit zu retten.»
Nun wird vermutlich nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung diese erschütternden Aussagen kennenlernen. Und viel kleiner dürfte die Zahl derjenigen sein, die, bewegt durch solche Erfahrungen, die Möglichkeit haben, auf die Überlebenskrise der Erdbewohner tatsächlich Einfluß zu nehmen. Dennoch gehen diese Mitteilungen über die durch Menschenschuld verursachte Extremsituation des Atombombardements und seiner Folgen als Spurenelemente ins Bewußtsein der Zeitgenossen ein und tragen dazu bei, daß sogar die Mächtigen zögern, wenn es um atomare Entscheidungen geht.
Am jahrzehntelangen heimtückischen Fortwirken der ersten Atomkatastrophe, die nun bereits die Kinder der Überlebenden quält und deren Belastung nach den Gesetzen der Genetik noch an deren Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden dürfte, läßt sich erkennen, daß nukleares Unglück sich grundsätzlich von allen anderen Fehlhandlungen unterscheidet: es kann nicht vergessen werden, auch wenn man es vergessen will.
2
«Ich habe viele traurige Erinnerungen an meine Kindheit … Seit meinem dritten Lebensmonat kränkle ich. Ich durfte nicht zur Tanzschule gehen. Kurz vor der ersten Aufführung unserer Klasse wurde mir verboten mitzumachen. Vom Sportunterricht wurde ich dispensiert. Bei Schulausflügen ins Gebirge mußte ich zu Hause bleiben. Ich fühlte mich stets allen anderen entfremdet. Wenn ich mich zufällig einmal verletzte, bildete sich sofort ein kleines wulstiges ‹Keloid› (wie bei den Atomüberlebenden). Sogar wenn es sich nur um einen kleinen Einstich handelte. Meine beiden kleinen Finger sind zu kurz. Darum kann ich nicht richtig Klavier spielen oder tippen. Manchmal verkrampfen sie sich plötzlich. Es ist mir unangenehm, jemandem die Hand zu geben, weil ich befürchte, der andere könnte merken, daß etwas mit meinen Fingern nicht in Ordnung ist. Meine Ohren sind deformiert, mein Leib oft aufgebläht. Woher stammt das alles? Ich weiß es nicht. Vielleicht von den Genen meiner Eltern?»
Die Schreiberin dieses Briefes, ein anrührend schönes Mädchen von etwa Mitte Zwanzig, traf ich im Haus von Doktor Tomin Harada, der sich seit langem der Überlebenden und ihrer Kinder besonders annimmt. Sie heißt Fusako Ueno und ist ein Schützling von Mary McMillan, einer weißhaarigen englischen Quäkerin, die ich bereits ein Vierteljahrhundert zuvor in Hiroshima als Protektorin meines Freundes, des Tagelöhners Ishiro Kawamoto, kennengelernt hatte. «Fusako hat’s gleich zweimal getroffen», erzählte die Missionarin, «nicht nur sind beide Eltern strahlengeschädigt, sie ist außerdem noch ein ‹Morinaga-Fall›. Da ihre Mutter sie nicht an die Brust nehmen konnte, wurde sie mit Milchpulver der bekannten Firma Morinaga ernährt, die auch heute noch ihre ‹gesunde Nahrung für gesunde Babies› anpreist. In dieser Säuglingsnahrung wurden später Spuren von Arsenik gefunden. Möglicherweise kommen Fusakos Beschwerden von daher und gar nicht von den genetischen Folgen der Strahlung.»
Fräulein Ueno gehört zur zweiten Generation der Atomopfer. Sie kam zwar erst Jahre nach dem Bombardement auf die Welt, aber beide Elternteile waren an «jenem Tag» unweit des Epizentrums beschäftigt. Der Vater als Soldat am Bahnhof und die Mutter als Krankenschwester in einem der Spitäler. «Wenn ich als Kind Genaueres darüber wissen wollte, bekam ich keine Antwort», sagte mir die junge Japanerin. «Das war tabu. Nur manchmal, wenn sie hörten, daß wieder einmal ein ‹hibakusha› frühzeitig gestorben und seine Leiche von den Amerikanern zur Autopsie abgeholt worden sei, brach meine Mutter ihr Schweigen und mahnte uns: ‹Wenn ich einmal sterbe, werdet ihr meine Leiche nicht der ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission) ausliefern. Was wir durchgemacht haben, wird doch niemand begreifen. Nur diejenigen, die damals dabei waren.›»
Wenn es heute keine wirklich eindeutigen und überzeugenden Resultate der nun seit über dreißig Jahre dauernden Forschungsarbeiten über die Folgen des Bombenabwurfs gibt, so liegt das nicht zuletzt daran, daß viele der «hibakushas» ähnlich denken und handeln wie diese frühere Krankenschwester. Sie wollen sich nicht als «Versuchskaninchen» benutzen lassen. Schon gar nicht von jenen, die, wie sie meinen, an solchen Erkenntnissen nur deshalb interessiert sind, weil sie die Risiken von Atomkrieg und Atomenergie für ihre militärischen und wirtschaftlichen Pläne genauer einkalkulieren wollen.
Daß dies in der Tat ein wichtiges Motiv der amerikanischen Forscher ist, läßt sich aus ihren eigenen Veröffentlichungen schließen. So schrieben G.W. Beebe und H.B. Hamilton in einem Aufsatz für die Sondernummer der in Japan erscheinenden englischsprachigen Fachzeitschrift «Journal of Radiation Research» (1975), weitere intensive wissenschaftliche Untersuchungen in Hiroshima und Nagasaki über Wirkungen der atomaren Strahlung auf Menschen seien wünschenswert, weil «künftiger Energiebedarf zu einem Großteil durch die Nutzung von Atomenergie gedeckt werden müsse». Tierversuche könnten aber keine klare Auskunft über die zulässigen Strahlendosen für menschliche Wesen geben.
Während die entschiedene Zunahme der Krebsraten durch somatische, das heißt unmittelbare körperliche Bestrahlung auch von den anfänglich beschönigenden Mitarbeitern der amerikanischen Forschungsstelle in Hiroshima jetzt nicht mehr abgestritten wird, betonen sie doch immer wieder, daß genetische (also ererbte) Folgen bisher in keinem nennenswerten Maße konstatiert werden konnten. Das widerspricht jedoch allen Pflanzen- und Tierversuchen, die selten bei der zweiten, häufiger jedoch bei den späteren Generationen deutliche Schäden zutage förderten. Selbst Beebe und Hamilton geben zu, daß die Tatsache, bei Menschen seien noch keine negativen Wirkungen beobachtet worden wie bei Fruchtfliegen und Mäusen, sich aus der Unvollkommenheit der bisherigen Untersuchungen erklären lasse. Die bisher genutzten Ermittlungsmethoden seien noch nicht präzise genug und die Zahl der untersuchten Personen nicht groß genug gewesen. Die vier führenden japanischen Fachleute auf diesem Gebiet (Kusano, Ljima, Ishida und Shohno) warnen sogar ausdrücklich davor, bezüglich der Erbschäden zu früh falschen Optimismus zu verbreiten (wie die Befürworter der Kernenergie es tun). In einem gemeinsamen Bericht über die «Medizinischen Wirkungen der Atombomben» (1977) betonen sie ausdrücklich: «Das bisherige Ausbleiben genetischer Auswirkungen bei den Nachkommen der Überlebenden kann noch nicht bedeuten, daß der mutagene Effekt der ionisierenden Strahlung für Menschen nicht existiert.»
Entsprechen die bisherigen in Hiroshima benutzten Untersuchungsmethoden aber wenigstens dem besten verfügbaren Wissensstand? Das bezweifeln kritische Forscher wie zum Beispiel die amerikanische Ordensschwester Rosalie Bertell, Leiterin einer anerkannten biologischen Forschungsstelle in Buffalo. Im Oktober 1979 nach ihrer Rückkehr aus Hiroshima machte sie folgende Beobachtungen: «Es ist nicht möglich, die Strahlenanfälligkeit der zweiten Generation von japanischen A-Bomben-Überlebenden richtig einzuschätzen ohne Zugang zu grundlegenden Daten. Die milderen Mutationseffekte in dieser Bevölkerung sind nicht gemessen worden. Es ist nicht vernünftig, die Entscheidung, ob die Ungeborenen gefährdet werden, auf Forschungsberichte zu stützen, die erst nach vorheriger Siebung von den US-Militärbehörden veröffentlicht werden, wissenschaftliche Arbeiten, die sich auf eine ungeeignete und verstümmelte Datenbasis stützen, auf eine Recherche, die nur die ungefähren Sterblichkeitsraten und die schweren genetischen Erkrankungen der Nachkommen der den Strahlen ausgesetzten Japaner berücksichtigt.»
Sister Rosalie verlangt daher eine viel umfassendere Untersuchung der Nachkommen von Bombenopfern unter internationaler Beteiligung und Aufsicht. Nur so werde man zu glaubhaften Ergebnissen kommen können. Die ABCC hat sich 1975 umbenannt und umorganisiert, weil sie den ihr anhängenden Ruf der Parteilichkeit abstreifen wollte. Aber diese neugegründete «Radiation Effects Research Foundation» wird von der Bevölkerung Hiroshimas und vor allem von den «hibakushas» mit dem gleichen Mißtrauen wie bisher betrachtet. Nicht zuletzt deswegen, weil die konkreten persönlichen Erfahrungen der Bevölkerung mit den kranken Menschen der angeblich nicht geschädigten zweiten Generation den allzu vorsichtigen und gezielt beruhigenden Feststellungen der Wissenschaftler so deutlich widersprechen.
3
«Wirst du morgen noch leben?» («Kimi wa Asu Ikiru ka»), so heißt der Titel einer Sammlung von Aufsätzen und Erlebnisberichten, die Söhne und Töchter von Atomgeschädigten im Jahre 1972 veröffentlichten. Sie wollten damit die ihnen immer wieder versagte Anerkennung als späte Opfer der Bombe erreichen. Unter dem Sammelnamen «hibaku nisei» hat sich diese jüngere Generation der «hibakushas» zusammengefunden. Einige von ihnen erlebten den «Pikadon» und die schweren Jahre danach als Kinder, andere sind «in utero»-Fälle, deren Mütter mit ihnen schwanger gingen, als das Unheil zuschlug, und schließlich sind dabei auch junge Mädchen und junge Männer, die wie Fusako Ueno erst Jahre nach der Katastrophe von Strahlengeschädigten gezeugt wurden.
Wie sie fühlen und was sie fürchten hat mir Fusako geschildert: «Ich habe Genetik und Physik studiert. Die Lehrer wurden meine guten Freunde. Aber meine dringendsten Fragen beantworteten sie dennoch nicht. Zum Beispiel Professor Naomi Shono, der das Buch ‹Strahlung und die Atombombe› geschrieben hat. Davon handelte auch seine Vorlesung. Ich fragte ihn nachher über meine Mutter aus, die sich weigert, zum Arzt zu gehen, obwohl sie leidend ist, weil sie Angst vor dem hat, was er bei ihr finden könnte. Und ich wollte auch wissen, ob ich genetisch belastet sei. Aber er gab mir nie eine klare Antwort. Je mehr ich über die Wirkungen der Bombe erfahre, um so unsicherer werde ich. Die Leute beruhigen mich und sagen, ich sei doch lange nach dem Bombardement zur Welt gekommen. Aber ich quäle mich trotzdem mit Zweifeln. Wie sehen meine Erbzellen aus? Sind nicht vielleicht einige Gene in meinem Körper verkrüppelt? Ich habe Angst, zu heiraten und ein Kind auszutragen.»
Eines der Argumente der amerikanischen Ärzte und Biologen gegen eine umfassendere und häufigere Untersuchung der Überlebenden und ihrer Kinder stützt sich auf die an sich zutreffende Beobachtung, daß dadurch die «Neurotisierung» der Überlebenden und ihrer Nachkommen unvermeidlich gesteigert werde. Aber läßt sich dieser seelische Nebeneffekt überhaupt vermeiden? Sind Gerüchte und Vermutungen nicht noch belastender? Es genügt ja nicht, denen, die «dabei» waren, und ihren Nachkommen zu versichern, daß «nur zehn Prozent» von ihnen unter den Folgen der Bombe zu leiden haben würden, wenn – wie jedermann weiß – über 300000 Menschen als «hibakusha» anerkannt werden mußten und nicht ein einziger von ihnen als wirklich gesund gelten kann; sie alle haben nicht nur unter den biologischen, sondern auch den soziologischen und psychologischen Folgen der plötzlichen Vernichtung ihrer Stadt, ihrer Familie, ihres Freundeskreises gelitten und leiden weiter.
Äußerlich scheint Hiroshima vergessen zu haben, aber es gibt – abgesehen von den vielen Neuankömmlingen – dennoch keine Familie, in der nicht auch heute noch fast Tag für Tag über das Unheil gesprochen wird, das ein einziger Fliegerangriff über alle brachte. Das hat mir der Soziologe Professor Yuzaki versichert, der sich bemüht, die gesellschaftlichen und seelischen Folgen des Bombardements zu untersuchen. Einige Leidenswege haben für alle, auch für diejenigen, die nicht oder noch nicht – das «noch nicht» verdüstert jede Aussicht – das Schlimmste durchmachen mußten, exemplarische Bedeutung gewonnen. So wurde zum Märtyrer der «hibaku nisei» ein Knabe namens Fumiki Nagoya, der im August 1960 zur Welt kam und spätes Opfer eines Krieges werden mußte, der fünfzehn Jahre vor seiner Geburt beendet worden war. Kurz vor seinem fünften Geburtstag erkrankte der Kleine an Leukämie. Durch Bluttransfusionen wurde er am Leben gehalten und konnte sogar für kurze Zeit in die Schule gehen. «Fumi» lernte dort schreiben und malen, so daß er später als Bettlägeriger ein Tagebuch führen konnte. Im Februar 1968 ist dieser junge «hibaku nisei» gestorben. Die Eltern, die alle Phasen dieses zu kurzen Lebens aufgezeichnet hatten, veröffentlichten 1968 ihren Bericht über diese Passion unter dem Titel: «Ich wollte leben. Der Tod eines ‹hibaku-nisei›» («Hibaku Nisei Fumiki-chan no Shi»). Der Eindruck, den dieses von einem großen Verlag in Tokio veröffentlichte Buch machte, war so groß, daß daraufhin die Probleme der «zweiten Generation» von «hibakushas» erstmals in ganz Japan diskutiert wurde. Aber erst im Februar 1980 entschloß sich das Gesundheitsministerium der japanischen Regierung endlich, alle Nachkommen von Atombombenopfern ärztlich untersuchen zu lassen. Ihre Zahl wird inzwischen auf 240000 geschätzt.
Fast zwölf Jahre nach Kriegsende hat es gedauert, bis das japanische Parlament und die Regierung endlich die Existenz und die Hilfsbedürftigkeit der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki überhaupt zur Kenntnis nahmen. Aber selbst dann hatten diejenigen, die von den Folgen des Bombardements körperlich und seelisch betroffen waren, große Schwierigkeiten, als Kriegsopfer anerkannt zu werden. Zwar erhielten 364261 Personen das «Gesundheitsbuch für A-Bomben-Geschädigte», aber bis zum März 1976 sind nur 1,2 Prozent tatsächlich in die Kategorie Vollpatienten aufgenommen worden.
Unter dem Druck der öffentlichen Meinung wurden die Bedingungen für die Wiedergutmachung zwar nach und nach etwas verbessert, die Hilfeleistung der Behörden wird jedoch immer noch von so vielen Vorschriften und Prüfungen abhängig gemacht, daß bis heute erst ein kleiner Teil der Leidenden eine gebührende Unterstützung erhält. Sie müssen zum Beispiel genau nachweisen, daß sie sich am 6. August 1945 (oder in den zwei darauffolgenden Wochen) nicht weiter als zwei Kilometer entfernt vom «Epizentrum», dem Ort der Bombenexplosion, aufgehalten haben. Diese Tatsache muß aber von mindestens zwei Zeugen bestätigt werden. Wie schwer, wenn nicht sogar ganz unmöglich es ist, sich solche Beglaubigungen zu verschaffen, wußten diejenigen, die derartige Vorschriften erließen, im voraus. Sie erreichten damit, was sie wohl auch angestrebt hatten: ein Großteil derer, die Anspruch auf Hilfe hätten, muß darauf verzichten.
Immer wieder erscheinen in Zeitungsannoncen und auf dem Fernsehschirm Aufforderungen von zurückgewiesenen Antragstellern, man möge sich doch an sie erinnern und ihnen beistehen. Nur selten hat jemand Fotos von sich und seiner Familie aus der Hölle von damals retten können. Woran sollen sich dann die gesuchten Zeugen nach Jahrzehnten halten? Es ist gar nicht zu vermeiden, daß es da zu Hunderten, wenn nicht Tausenden Gefälligkeitsaussagen kommt. Mancher humane Beamte drückt ein Auge zu. Aber es gibt natürlich auch die «Korrekten» und die «Scharfen». Sie behandeln die Antragsteller und ihre Zeugen nur zu oft als potentielle Betrüger. Hält man den Bürokraten das vor, so verteidigen sie sich, es würden sich sonst Schwindler auf Kosten derer bereichern, die wirklich Anspruch hätten.
In der Tat tauchen in der Skandalchronik von Nachkriegs-Hiroshima Fälle von «Unterstützungsbetrug» regelmäßig auf. Besonders mit einer Affäre – es handelte sich um einen städtischen Kontrollbeamten namens Yoshio Tanimoto, der sich jahrelang mit kleinen Summen bestechen ließ und dafür Gefälligkeitszertifikate ausfertigte – beschäftigten sich Lokalpresse und Lokalrundfunk so lange und so ausführlich, daß die Organisationen der «hibakushas» schließlich gereizt zum Gegenangriff übergingen. Sie protestierten gegen das ganze würdelose Prüfungsverfahren, das sie zu Recht als unerträgliche Demütigung bezeichneten und verlangten, daß es abgeschafft werde. Ihre Argumente: Selbst, wenn dann hier und da einmal etwas zuviel gezahlt würde, wäre das doch fast gar nichts im Vergleich zu den Milliarden, die von der Regierung bei der Wiederaufrüstung verschwendet würden.
Alle diese Beschwerden führten lediglich zu Versprechungen, man werde in Zukunft den Genehmigungsvorgang erleichtern, Zusagen, die bald wieder vergessen wurden. Genauso war schon zuvor der Versuch der «hibakushas» gescheitert, sich mit Hilfe der Gerichte Genugtuung zu verschaffen. Fünf Überlebende, die von ihren Organisationen ausgewählt worden waren, reichten 1963 beim Bezirksgericht Tokio Klage gegen die Vereinigten Staaten ein mit dem Ziel, ausreichende Entschädigungen zugesprochen zu bekommen. Zwar entschieden die Richter, daß der Einsatz einer Waffe, deren Wirkungen ungleich zerstörerischer und folgenreicher gewesen sei als jeder anderen, gegen das Völkerrecht verstoßen habe. Sie sahen sich aber nicht imstande, daraus durchsetzbare Ansprüche abzuleiten.
Noch schwerer als die japanischen «hibakushas» hatten es ihre koreanischen Leidensgefährten. Als die Bombe fiel, befanden sich schätzungsweise 50000 Koreaner in und um Hiroshima. Sie hatten meist für die Rüstungsindustrie und das Militär geschuftet. Oft waren sie gegen ihren Willen von den japanischen Machthabern, die Korea wie eine Kolonie behandelten, unter Sklavenbedingungen zu den schwersten Arbeiten gepreßt worden. Auch koreanische Frauen und Mädchen kamen bei dem Atomangriff um. Man hatte sie gezwungen, in den Soldaten- und Seemannsbordellen der Garnisonsstadt zu «dienen». Nach der Katastrophe, bei der vermutlich 30000 bis 35000 dieser Zwangsarbeiter getötet wurden, blieben die überlebenden Koreaner sich völlig selbst überlassen. Von den anderen, die davongekommen waren, wurden sie nach wie vor diskriminiert. Die alten rassischen Vorurteile waren nicht einmal durch das gemeinsam Erlittene beseitigt worden. Die Koreaner versuchten, wenn es ging, ihre Identität zu verbergen. Viele sprachen kaum oder gar kein Koreanisch mehr und hatten sich ganz an japanische Sitten angepaßt. Aber ein solches Versteckspiel war riskant, und so kehrten die meisten dieser Atomopfer schließlich nach Süd- oder Nordkorea zurück. Etwa 4000 koreanische «hibakushas» siedelten sich bei der Stadt Kyong Sang do an, die in der Region Hapchon liegt, und nannten ihre neue Heimat «Hiroshima in Korea». Aber «zu Hause» verstand man nicht, was sie durchgemacht hatten und weshalb so viele von ihnen krank oder kaum arbeitsfähig waren. In einem Bericht über diese doppelt Getroffenen, den die Reporterin Park Su Pok für ein Hilfskomitee verfaßte, heißt es: «Sie fühlen sich völlig isoliert und minderwertig. Wenn sie sprechen wollen, versteht man sie in dieser abgelegenen Berggegend nicht. Sie vegetieren dahin: stumm und taub.»
Zahlreiche der koreanischen Überlebenden haben sich dann heimlich ohne Visum doch wieder ins Land ihrer Unterdrücker eingeschlichen und versucht, sich dort illegal durchzuschlagen. Das Motiv der meisten war, in Hiroshima oder Nagasaki ärztliche Hilfe für ihr Leiden zu erhalten. Wurden sie aber denunziert und erwischt, dann deportierte man sie. Einige dieser Unglücklichen sind so bis zu sechs- und siebenmal aus Japan ausgewiesen worden.
Erst nach und nach entwickelte sich bei einigen Japanern eine Solidaritätsbewegung für die koreanischen «hibakushas». Sie wurde in Hiroshima vor allem von Ishiro Kawamoto ins Leben gerufen, der sich in den ersten Jahren nach der Katastrophe als erster der damals noch völlig beistandslosen Strahlenkranken angenommen hatte.
Über Hiroshima hinaus erregte der Fall des illegal zurückgekehrten koreanischen «hibakusha» Son Jin Took Aufsehen. Mit Unterstützung einer Hilfsorganisation konnte er vor Gericht gegen seine Ausweisung Einspruch erheben und verlangen, daß er den gleichen Status erhalte wie die japanischen Atomgeschädigten. Das Gericht von Fukuoka gab seiner Klage statt. Die japanische Regierung jedoch erkannte die Entscheidung nicht an und legte Berufung ein.
Dieses unmenschliche Vorgehen der Zentralbehörde entsprach durchaus einer Politik systematischer Verdrängung der «unglücklichen Ereignisse», die mit dem Sieg der Alliierten und der folgenden Kapitulation Großjapans zusammenhingen. Nicht nur hat sich die herrschende liberale Partei und die von ihr dominierte Regierung geweigert, ein Weißbuch über Hiroshima und Nagasaki zu veröffentlichen, sondern es wurde darüber hinaus sorgsam darauf geachtet, daß die neuen Verbündeten Japans im gemeinsamen Streben nach Entwicklung weltbeherrschender industrieller Produktion nicht durch das Kainsmal Hiroshima verschreckt würden.
Die japanischen Bemühungen, das Furchtbare der Vergangenheit offiziell nicht mehr zu beachten und möglichst zu verschweigen, gingen so weit, daß zu Anfang der siebziger Jahre der regierende Bürgermeister Yamada alles unternahm, um eine in Hiroshima geplante Ausstellung über die nazistischen Gaskammern und die Massenmorde von Auschwitz zu verhindern. Diese Erinnerung an den «Holocaust» hätte in dem gleichen «Friedens-Museum» ihren ständigen Platz finden sollen, wo Trümmer, Fotos, Filme und Schriften vom Inferno des «Pikadon» zeugen. Aber Yamada meinte, eine solche Geste könne vielleicht die Behörden und Bewohner von Hiroshimas deutscher Partnerstadt Hannover verstimmen.
Die aus Polen nach Hiroshima geschickten Zeugnisse des Grauens lagern daher heute noch in einem dunklen Schuppen in der über eine Stunde von Hiroshima entfernten Ortschaft Kurose. Nur die Urnen mit der Asche von Naziopfern fanden nach monatelangen bürokratischen Streitereien über den Ort, an dem man sie begraben dürfe, im Mai 1973 endlich einen Platz auf dem Friedhof des buddhistischen Mitakiji-Tempels, zu dessen Gärten sich August 1945 viele Schwerverletzte und Sterbende gerettet hatten. So ruhen nun dort im Tode vereint die Opfer der beiden größten Untaten des Zweiten Weltkrieges.
4
Im Februar 1980 besuchte ich mit dem Anwalt Dr. Fujita aus Osaka, der sich seit Jahren für die Rechte der Atomgeschädigten und der Minderheiten in Japan einsetzt, die Fischer von Ikata, die seit zehn Jahren gegen den allmächtigen Staat und die mit ihm verbundene Atomindustrie um die Erhaltung ihrer Fischgründe kämpfen. Sie haben am Ufer des Pazifiks unweit des Bauplatzes, auf dem das riesige Kernkraftwerk entsteht, eine kleine Holzhütte errichtet. Hier halten tags wie nachts Freiwillige eine ständige Mahnwache.
Umtost von einem wilden Wintersturm hatten wir, etwa dreißig Menschen, Frauen, Kinder, junge und alte Männer, eng gedrängt in dieser Baracke zusammengesessen, als ein etwa Dreißigjähriger, der bisher noch kein einziges Wort geäußert hatte, etwas aussprach, was alle schockierte: «Ich bin eigentlich dankbar für die Bombe.»
Gedrängt, zu erklären, warum er mit dieser empörenden Behauptung komme, versuchte er zu sagen, man müsse in der Tat froh sein, wenn eine schleichende Krankheit offen und weithin sichtbar ausbreche, denn erst dann beginne man sie wirklich energisch zu bekämpfen. Die Atombombe sei ein Alarmsignal gewesen, durch das die Menschheit endlich erkennen sollte, daß die große Vernichtung eine unvermeidliche Folge von zahllosen vorhergehenden alltäglichen Akten der Zerstörung sein mußte.
Es war, wie ich später erfuhr, ein Landarzt, der so sprach. Er gehörte zu «Jishu Koza», einer Volksbewegung, die seit Anfang der siebziger Jahre in ganz Japan gegen die Umweltverschmutzung und Lebensgefährdung durch die wuchernde Großindustrie kämpft. Sie hat in der Tat durch das Fanal von Hiroshima und den scheinbar vergeblichen Kampf der «hibakushas» ihre ersten Impulse empfangen. Unter der geistigen Führung von Jun Ui, einem Urbanisten, der über die Machtabhängigkeit der Technik und ihre Folgen schon nachdachte und schrieb, als die meisten seiner Universitätskollegen noch eifrige Befürworter eines blinden Fortschritts waren, haben die Aktionen der japanischen Umweltverteidiger von Jahr zu Jahr an Umfang und Entschiedenheit zugenommen. Die Bauern von Narita, die durch ihren Widerstand jahrelang mit Hilfe von Studenten und Bürgern die Inbetriebnahme des neuen Flughafens von Tokio verhinderten, die Bewohner der Küstenstadt Minamata, die durch die Besetzung der Chisso-Kunststoff-Fabrik das ganze Land auf die Verkrüppelungen verursachende chemische Verschmutzung ihrer Bucht aufmerksam machten, die Fischer von Mutsu, die dem lecken Atomschiff Mutsu Maru durch eine Barriere von hunderten bemannten Booten den Eintritt in ihren Hafen versperrten – sie alle wären kaum denkbar ohne die vorhergehende Warnung von Hiroshima.
Manches andere, was Gutwillige versuchten, um nach dem großen Schock einen Lernprozeß einzuleiten, gelang dagegen nur halb. So hatten die Lehrer der Präfektur Hiroshimas sich seit Kriegsende eifrig bemüht, ein eigenes Fach «Friedenserziehung» einzuführen, das im Curriculum aller japanischen Schulen seinen Platz finden sollte. Aber die Zentralregierung und die ihr unterstellten Behörden verstanden es, die Kapitel über Atomrüstung und Kriegsgefahren ebenso wie Schilderungen der Wirkungen nuklearer Waffen aus späteren Auflagen der Schulbücher wieder herauszunehmen. 1969 schrieben die Lehrer von Hiroshima einen offenen Brief an das Erziehungsministerium und protestierten gegen diese Zensur des Lehrmaterials. Sie konnten erreichen, daß die sechs führenden Schulbuchverleger in ihren späteren Veröffentlichungen das tabuisierte Thema «Atombombe» wieder erwähnen konnten. Allerdings in so vorsichtiger und verharmloster Form, daß in Hiroshima und Nagasaki, wo die Kinder von ihren Verwandten mehr über die schreckliche Wahrheit erfahren hatten, daraufhin eigene Schulbücher geschrieben wurden, in denen man die Schrecken des Nuklearkrieges in Wort und Bild ohne Rücksichten darstellte.
Auch die Hoffnungen, Hiroshima zu einem Zentrum der Friedensforschung zu machen, sind bisher kaum in Erfüllung gegangen. Zwar existiert das 1970 gegründete Universitätsinstitut für Friedensstudien, aber es verfügt nur über sehr spärliche Mittel und wird eher geduldet als wirksam unterstützt. Als ich einen der Mitarbeiter fragte, warum das so sei, reagierte er bitter: «Wissen Sie denn nicht, daß Frieden eine gefährliche Angelegenheit ist? Zumindest für viele von denen, die heute das Sagen haben.»
5
Als ich das hier vorliegende Buch über das Nachkriegsschicksal der Menschen und der Stadt Hiroshima vor über zwanzig Jahren abschloß, war der «Kalte Krieg» voll im Gange. In England hatten die Ostermärsche gegen das Atomwettrüsten Hunderttausende auf die Straßen gebracht. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Bewegung «Kampf dem Atomtod» noch von der SPD gefördert, die sich später von ihr abwandte. Schon damals hielten nicht wenige Zeitgenossen, die sich als besonders illusionslos einschätzten, den dritten Weltkrieg für unvermeidlich und den Widerstand der Atomwaffengegner für sinnlos. Dennoch ist es dann in den sechziger Jahren zur unerwarteten Entspannung gekommen, eine Entwicklung, an deren Zustandekommen der weltweite Protest unzähliger einzelner, die sicht- und hörbar gegen «neue Hiroshimas» Stellung nahmen, sicher nicht unbeteiligt war.
Zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, ist die Gefahr atomarer Vernichtungskriege wieder viel näher gerückt. Nur will sie diesmal kaum jemand mehr wirklich ganz ernst nehmen, weil uns frühere Erfahrungen «abgebrüht» gemacht haben. Dabei ist die Lage heute eigentlich viel kritischer als damals, und es geschieht zuwenig, um ihre weitere Verschlechterung zu verhindern.
Die größte Sorge bereitet denen, die sich die Mühe nehmen, die atomare Gefahr nicht als ‹undenkbar› zu verdrängen, die Tatsache, daß durch den ständigen jährlichen Zuwachs und die Weiterverbreitung der zivilen Atomindustrie auch die Weiterverbreitung von Atomwaffen gefördert wird. Denn alle Bemühungen, die heimliche und vertragswidrige Abzweigung oder den Diebstahl von «special nuclear material» aus Reaktoren, Wiederaufarbeitungsanlagen, Fabriken zur Herstellung nuklearer Brennstäbe und Atomtransporten zu verhindern, können niemals hundertprozentige Sicherheit garantieren. Neue Reaktortypen wie die Schnellen Brüter, die Mengen des für potenteste Massenvernichtungsmittel verwendbaren Plutoniums erzeugen, neue Verfahren, wie die erleichterte Anreicherung von Uran durch tragbare Laser, sowie die Tatsache, daß immer mehr Menschen in immer mehr Ländern der Erde ausgebildet werden, sich mit der Atomtechnik vertraut zu machen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, daß es vielleicht schon bald irgendwo zum unkontrollierbaren Bau und Einsatz von Atombomben kommen könnte. Das «Gleichgewicht des Schreckens», auf dem der «kalte Friede» des Atomzeitalters bisher beruhte, ist jetzt bereits potentiell erschüttert und wird es in wenigen Jahren auch tatsächlich sein.
Dazu kommt, daß die Angst vor Atomkriegen und ihren Folgen gegenwärtig nicht mehr so groß zu sein scheint wie in den Jahren, als Hiroshima und Nagasaki noch nicht erzählte, sondern gegenwärtige, miterlebte Geschichte waren. Im Februar 1980 trafen sich in der amerikanischen Universitätsstadt Cambridge 650 Ärzte, um darüber zu sprechen, wie man den Menschen der jüngeren Generation klarmachen könnte, welche furchtbaren Folgen auch nur ein einziger Atomangriff nach sich ziehen würde; eine Aktion, die manche Zeitgenossen schon wieder als «schnelle Lösung» zur «Klärung unerträglicher Situationen» empfehlen. Doktor James Muller, ein Professor der «Harvard Medical School», faßte diesen Erfahrungsaustausch seiner Kollegen so zusammen: «Wir Ärzte wissen, wie ein verstrahlter Patient aussieht. Darum wollen wir den Menschen in den USA und der Sowjetunion erzählen, wie Hunderttausende solcher Atomopfer aussehen würden.»
Es ist die Absicht der amerikanischen Ärztevereinigung, von nun an jedes Jahr mit ihren sowjetischen Kollegen eine gemeinsame Konferenz über die vermutlichen Folgen des Einsatzes von Wasserstoff- und Neutronensprengköpfen abzuhalten. Japanische Mediziner sollen «als Vertreter des einzigen Landes, das Atomangriffe über sich ergehen lassem mußte», hinzugezogen werden. «Es ist unsere Absicht», sagte Muller in einem Gespräch mit Michael Getler von der «Washington Post», «die weiteste Öffentlichkeit auf die Konsequenzen des Wettrüstens und des Atomkriegs sehr eindrücklich aufmerksam zu machen und damit in die Verhandlungen über Rüstungskontrolle ein neues Element einzubringen.»
Dieses «neue Element» wäre der niemals endende Widerstand der Bürger aller Länder. Ihnen muß allmählich klarwerden, daß die «atomare Gefahr» vor allem deshalb mit keiner anderen der bisher bekannten Unfalls- oder Kriegsgefahren zu vergleichen ist, weil sie nicht wiedergutzumachende Schäden nach sich zieht.
Das traurige Schicksal der Dahinsiechenden von Hiroshima, von denen mancher heute meint, er hätte ein besseres Los gezogen, wenn er sofort beim Bombenangriff vom 6. August 1945 umgekommen wäre, ist ein Menetekel, das den Vergeßlichen, den Gleichgültigen und all denen, die leichtfertig von «unverzichtbaren Risiken» sprechen, immer wieder vorgehalten werden muß.
Leere und Chaos (1945)
Das Buch
1
Auf die Spur von Kazuo M. hat mich der Gefängnispfarrer Yoshiharu Tamai geführt, der in dem schmalbrüstigen Hause Ichome Ohtemachi 33, nur wenige Schritte vom einstigen Explosionszentrum der Atombombe entfernt, wohnt und dort auch, sooft ihm sein anstrengender Dienst Zeit dazu übrigläßt, in einem weiß getünchten, peinlich sauberen Betraum Gottesdienst hält.
Dieser in selbstgewählter Armut lebende Geistliche steht bei seinen Mitbürgern im Rufe, daß sich ihm die Seelen der Verschlossenen und Verschwiegenen öffneten. Deshalb hatte mein Freund und Dolmetscher Willie Togashi, der mich auf meinen Wegen durch Hiroshima begleitete, auch gemeint, bei Reverend Tamai würde wahrscheinlich Antwort auf eine Frage zu finden sein, die ich bisher vergeblich gestellt hatte, auf die Frage nämlich, welche Spuren die Katastrophe von Hiroshima im Gemüt der Überlebenden hinterlassen habe.
Wir stiegen die enge Treppe zum Arbeitsraum des Pfarrers hinauf. Kaum hatte er aus dem Munde des Übersetzers von meinem Wunsch erfahren, da kramte er bereits in einer Briefmappe und zog ein längliches, schon etwas vergilbtes Schreiben aus dem Jahre 1955 heraus, das er nun vor uns auf dem aus weiß lackierten Kistendeckeln zusammengebastelten «Tisch» aufblätterte.
«Der Brief kommt aus dem Ortsgefängnis», erklärte Tamai, «aber der Schreiber wollte wohl nicht, daß man das gleich bemerkte. Deshalb hat er als Absender nicht den Namen der Strafanstalt, sondern nur Straße und Hausnummer seiner ‹Wohnung› angegeben.»
Den ersten Teil des Briefes, in dem sich der Verfasser für seine verspätete Antwort damit entschuldigte, daß er wie alle anderen Sträflinge vorübergehend an einer ansteckenden Augenkrankheit gelitten habe, übersetzte Togashi fast fließend herunter. Dann aber stockte er mit einem Male.
«Was ist denn, Willie?» fragte ich.
Er lachte etwas verlegen und sagte: «Nicht sehr freundlich, was er da schreibt …»
«Wem gegenüber?»
«Nun ja, genaugenommen wendet er sich an Mrs. Roosevelt.»
«Was hat er denn mit Mrs. Roosevelt zu tun?»
«Sie muß, als er diesen Brief schrieb, gerade in Hiroshima zu Besuch gewesen sein. Ich erinnere mich selbst noch, daß sie uns ziemlich umständlich klarzumachen suchte, weshalb die Amerikaner die Atombombe geworfen hätten.»
Ich bestand darauf, daß Togashi – so peinlich es ihm auch sein mochte – den Brief weiterübersetzte. Wie alle «Westler», die nach Hiroshima kommen, war ich überrascht, daß die schwer getroffene Bevölkerung alle Haßgefühle scheinbar so schnell überwunden hatte. Aber war diese Haltung echt? Nun würde ich endlich einen Blick hinter den «Vorhang der Höflichkeit» tun dürfen.
«Eigentlich sind es nur ein paar Gedichte», erklärte Willie. Er wollte den unangenehmen Eindruck von vornherein abschwächen. «Zuerst fragte Kazuo M. – so heißt der Absender – den Pfarrer, was ‹Dreieinigkeit› bedeute. Und dann, nun ja dann», der Übersetzer holte Atem, «dann zitiert er einige kurze Gedichte, für die er in irgendeinem Gefangenenwettbewerb einen Preis erhalten hat. Also bitte, da ist eines von ihnen:
‹Der große Wolkenpilz hat mich verschlungen.
Blicken Sie nicht fort, Mrs. Roosevelt:
In seinem Dunkel lieg’ ich lebenslang.›
Soll ich weiterlesen?»
«Weiter!»
«Im nächsten Vers spricht er von einem Freund Yasuji, der an ‹jenem Tag› mit Fluchworten auf den Lippen umkam. Dann noch ein Vierzeiler an Mrs. Roosevelt. Er fragt sie höhnisch, ob die Ruinen von Hiroshima wohl als Wegweiser zum Frieden gedacht gewesen seien. Und hier … ich glaube, hier steht das, wonach Sie eigentlich suchen:
‹Nicht auf der Haut nur
Schwären Narben,
Tiefer ging die Herzenswunde.
Wird sie je heilen?›»
«Ja», bemerkte Pfarrer Tamai dazu, «vom ‹Keloid des Herzens› – Keloide heißen, wie Sie ja wissen, die großen wulstigen Brandmale, die einigen Überlebenden bis heute geblieben sind – davon hat Kazuo oft mit mir gesprochen. Seiner Ansicht nach wäre er ohne die tiefe seelische Wunde, die er am Tage des ‹Pikadon› und in der unmittelbar darauffolgenden Zeit erlitt, nie das geworden, was er nun einmal ist: ein Mörder. Und zwar – es hat keinen Sinn, sich da etwas vorzumachen – ein gemeiner Raubmörder.»
2
Der etwa Dreißigjährige, der mir einige Tage später im Büro von Herrn Kawasaki, dem Erziehungsdirektor des Gefängnisses von Hiroshima, gegenübersaß, machte auf mich durchaus nicht den Eindruck eines zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten Schwerverbrechers. In glatter blauer Anstaltsuniform, den edlen kahlgeschorenen Kopf etwas gesenkt, glich er eher einem Mönch, der hinter Mauern Zuflucht vor einer ihn bedrängenden Welt gefunden hat.
Schon beim Eintritt des Sträflings in das mit westlichen Plüschmöbeln ausgestattete Wartezimmer war mir die Intelligenz und Empfindsamkeit seines Gesichtsausdrucks aufgefallen. Das für einen Japaner ungewöhnlich lebhafte Mienenspiel konnte ich während des folgenden Gesprächs besonders gut beobachten, weil ich den Sinn der japanischen Worte zunächst nicht verstand und daher versuchte, aus Mimik und Geste schon etwas vom Inhalt der Erzählung zu erraten, bevor noch der Dolmetscher das Gesagte zu übersetzen begonnen hatte.
Kazuo M. lebte zu jenem Zeitpunkt bereits seit nahezu sieben Jahren hinter Gefängnismauern. Es war mir, als habe er alle diese Zeit darauf gewartet, endlich jemandem sein Herz ausschütten zu können, und da er von den Ereignissen sprechen durfte, die ihn schließlich hierher in diesen düsteren Bau geführt hatten, packte ihn sichtlich tiefe Erregung. Jedesmal aber, wenn der Interpret sich von dem Sträfling abwandte, um mir seine Worte zu vermitteln und dann gleich meine nächste Frage aufzunehmen, konnte ich beobachten, wie M. sich während der kurzen Wartezeit bemühte, seine Fassung wiederzugewinnen, und auf seinem Gesicht, das eben noch von Haß, Zorn, Abscheu oder Scham aufgewühlt gewesen war, allmählich ein vom Willen erzwungener und daher nicht ganz überzeugender Ausdruck der Ruhe, des Friedens, der Gelassenheit aufleuchtete.
Ich erwähne diesen persönlichen Eindruck deshalb, weil er mir zum ersten Male vor Augen führte, was ich später aus den Aufzeichnungen, Briefen, Tagebüchern und schriftlichen Fragebeantwortungen des Kazuo M. viel deutlicher erfahren durfte: hier versuchte ein Mensch mit allen seinen Kräften, ja geradezu verzweifelt, sich selbst und das, was ihm begegnete, zu bewältigen. Er erhob sich, setzte an zum schnurgeraden Lauf, mußte zusammenstoßen, stürzen, quälte sich abermals empor, glaubte bezwingen zu können, wurde bezwungen, erhob sich abermals …
Er hat mich oft an jenes nackte, haar- und augenlose Pferd erinnert, das so viele Überlebende während der ersten Tage nach der Katastrophe in den Ruinenstraßen von Hiroshima gesehen haben wollen. Mit seinem langen, von Blutschorf befleckten Schädel rannte es gegen die wenigen noch stehenden Wände und Mauern, stolperte immer wieder, irrte in unregelmäßigem Hufschlag, bald die schnaubenden Nüstern hocherhoben, bald in schleppendem Trauertrab weiter durch die Stadt auf der Suche nach einem Stall, den es nicht mehr finden durfte. Manche sagten, man solle das Tier erschießen, weil es in seiner Blindheit einem der am Straßenrande liegenden Kranken einen tödlichen Tritt versetzt hatte. Aber niemand hatte damals die Kraft, das zu tun. Es ist ganz unbekannt, wie die Mähre endete und wohin sie schließlich verschwand.
3
Neun Tage nach dem Untergang von Hiroshima hatte Kazuo M., eben selbst erst der Vernichtung entgangen, mutwillig das einzige zerstört, was ihm von seinen Habseligkeiten übriggeblieben war.
Er vollzog diese Handlung ruhig, feierlich, mit fast zeremonieller Gebärde, doch muß sein schönes ovales Gesicht damals schon jenen Ausdruck düsteren Hasses getragen haben, den später fast jeder, der Kazuo M. einmal begegnete, an ihm beobachtet haben will.
Das Opfer jenes ersten vorbedachten «Mordes» – so hat man den Akt nachträglich deuten wollen – war ein Buch. Und zwar ein ganz gewöhnliches Lesebuch der Mittelschule, wie es damals alle Schüler der dritten Klasse in ganz Japan besitzen mußten.
Der Vierzehnjährige hatte den Band einige Tage nach der großen Katastrophe beim Durchwühlen der Trümmer des Elternhauses entdeckt, und, als er ihm aus einem schon zur Hälfte verbrannten Rucksack entgegengefallen war, mit übertriebenem Freudenschrei an die Brust gedrückt, ganz als habe er soeben einen schon totgeglaubten, nun aber doch auf wunderbare Weise geretteten Kameraden wiedergefunden. Kazuo M. kannte viele Gedichte, Sprüche, ja sogar ganze Prosastellen des Lesebuches auswendig. Während der schrecklichen letzten Stunden hatte er einiges davon beschwörend vor sich hingesagt, aber erst jetzt, als er diesen in kräftigen grüngesprenkelten Einbanddeckeln bewahrten Schatz schwarz auf weiß wiedergefunden hatte, fühlte er sich versichert, daß es jenseits des wüsten Albtraumes der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit wirklich einmal vollendete Form und reine Gesittung gegeben haben mußte.
Bücher und Bilder, Schreibpinsel und Malstifte waren seit jeher des Knaben beste Freunde und Spielgefährten gewesen. Das empfindsame, in sich gekehrte Kind war seinen Altersgefährten ausgewichen. Nur Yasuji, sein einziger Freund, hatte etwas von dem eigentlichen Leben seines Kameraden in der schwebenden Welt der Dichter und Künstler geahnt.
Aus dem Kreis der Worte und Zeichen war Kazuo gerissen worden, als Japans Kriegsherren in einem letzten, schon aussichtslosen Bemühen Halbwüchsige mobilisiert und in den Dienst der Rüstung gepreßt hatten. Er war der Buchhaltung der Mitsubishi-Werft zugeteilt worden, die etwa eine Stunde Straßenbahnfahrt von der elterlichen Wohnung entfernt lag.
Bis hierher in den Vorort Furue, kilometerweit vom Explosionszentrum «jener Bombe», hatte die Riesenpratze des Luftdrucks gegriffen und in Sekundenschnelle alles umgestürzt, was ihr im Wege war. Nie mehr vergaß Kazuo das grelle, wie von einer gewaltig großen blitzblanken Säbelklinge reflektierte Licht, das dumpfe Geräusch in der Ferne, «Do … dooo», das, näher kommend, sich in ein scharf kratzendes, schließlich kreischendes «Jiii … inn» verwandelte und ihm das Trommelfell durchbohren wollte, bevor ihn etwas mit tausendfachem Paukenschlag «Gwann!» in bodenlose Tiefe warf: PIKA (Blitz), DON (Donner). Dann, wie eine Traumerscheinung, das papierweiße Gesicht von Fräulein Shimomuro.
Sie kommt eilig und streberhaft wie immer, ein Kontoblatt in der Hand, aus dem Büro des Chefs in das große Arbeitszimmer der Buchhaltung getippelt. Bleibt mit einem ärgerlichen Ausdruck stehen, als sei sie ungehalten über die heillose Unordnung, die da herrscht: die wirbelnden weißen Blätter, die ausgehängten Telefone, die Rinnsale von schwarzer und roter Schreibtusche. Doch als sie nun umkehren will, fällt sie mitten in der Drehung mit einem nicht mehr zu unterdrückenden Schmerzensschrei jäh vornüber: ein großer, wie die Schwanzflosse eines Fisches geschnittener Glassplitter hat ihr den Rücken durchbohrt, nagelt sie an den Boden, zittert mit einem hohen, seltsam zarten Ton nach.
Die Schnelligkeit, mit der sich die Blutlache um sie bildet. Wie die Hände bläulich werden. Das sinnlose Hin- und Hergerenne der anderen Sekretärinnen, ihre fliegenden, schwarzen Haare, die Blutflecken und Schmutzspritzer auf ihren sonst so untadeligen weißen Blusen.
«Kacho-san, helfen Sie ihr doch! Tun Sie doch etwas! Sonst stirbt sie», hat Kazuo, alle Höflichkeitsregeln mißachtend, dem Vorgesetzten zugeschrien; aber der sonst so energische Mann lehnt regungslos an seinem umgestürzten Schreibtisch, kann noch immer nicht begreifen, versucht nicht einmal das Blut, das aus seiner tiefen Stirnwunde ins Gesicht sickert, zu stillen.
Der Junge, selbst noch ganz benommen, aber anscheinend unverletzt, ist aufgesprungen und versucht den bösen gläsernen Zacken auszureißen. Er zerschneidet sich dabei die Hände, gleitet ab, faßt nochmals mit einem Stoffetzen zu, den er um die vibrierende «Flosse» wickelt, und zieht nun mit aller Kraft.
Die Glasscherbe bricht ihm unter den wunden Fingern. Und immer noch steckt sie mindestens zu einem Drittel in der Wunde. Die violetten Lippen von Fräulein Sakata schnappen wie Kiemen zitternd nach Luft. Dann geht ein Zucken und Klirren durch den kleinen Körper. Sie ist tot.
4
Noch jahrelang wagte Kazuo M. nicht, an die Erinnerung des Furchtbaren zu rühren, das er auf dem Wege von den Mitsubishi-Werken durch die von Panik erfüllte Stadt erleben mußte.
Irgendwie hatte er schließlich in das Viertel am Fuße des Hijiyama-Hügels, wo er wohnte, zurückgefunden, auf den Armen die entblößte Leiche seiner Schulkameradin Sumiko, die sich ihm, schwerverletzt, irgendwann auf dem Wege durch die Hölle angeschlossen hatte. Irgendwie brachte er noch die Kraft auf, sie zu verbrennen und zu bestatten, irgendwie lebte es ihn weiter durch die folgenden Tage. Auch seine Eltern und seine jüngere Schwester Hideko waren dem Unheil auf wunderbare Weise entronnen. Man aß kalten, zu Kugeln gedrehten Reis, der von fliegenden Notkantinen verteilt wurde, man schlief in einem ehemaligen Luftschutzunterstand, einem lichtlosen Höhlenstollen, man tat wie abwesend viele Handgriffe, ging zahllose wirre Wege. Die Haare fielen aus, Übelkeit und Schüttelfrost machten einen zittern. Nur nicht an die Wunde tief dort drinnen denken, die unsagbare Erlebnisse geschlagen hatten. Schlafen, schlafen, schlafen!
Fotoreporter Haruo Hiyoshi von Hiroshimas bedeutender Lokalzeitung «Chugoku Shimbun» ist damals mit seiner Kamera kreuz und quer durch die verwüstete Stadt gezogen, aber auf den Auslöser drückte er nur ganz selten. «Ich schämte mich, im Bilde festzuhalten, was meine Augen da sehen mußten», hat er mir später erklärt.
Hätte er seine edle Scheu nur überwunden! Der Nachwelt wäre dann eine zutreffendere Vorstellung von der Wirkung der «neuen Waffe» vermittelt worden, als es jene vielverbreiteten Fotos vermögen, die das Hiroshima nach der Katastrophe fast immer als menschenleere Trümmerwüste zeigen. Denn es war kein schneller, kein totaler Tod, kein Massenherzschlag, kein plötzliches Ende mit Schrecken, dem diese Stadt verfiel. Solch gnadenvoll geschwindes Auslöschen, wie es selbst gemeinen Verbrechern zuteil wird, ist den Männern, Frauen und Kindern von Hiroshima nicht gewährt worden. Sie waren zu qualvoller Agonie, zu Verstümmelung, zu endlosem Siechtum verurteilt. Nein, Hiroshima war während der ersten Stunden und auch noch Tage «danach» kein stiller Friedhof, nicht stumme Anklage nur, wie es die irreführenden Ruinenbilder vermuten lassen, sondern eine Stätte hunderttausendfacher Bewegung, millionenfacher Marter, morgens, mittags, abends erfüllt von Geheul, Geschrei, Gewimmer und verstümmeltem Gewimmel. Alle, die noch laufen, gehen, humpeln oder auch nur kriechen konnten, suchten nach irgend etwas: nach ein paar Tropfen Wasser, nach etwas Nahrung, nach Medizin, nach einem Arzt, nach den jämmerlichen Resten ihrer Habe, nach einem Unterschlupf. Und nach den Unzähligen, die nun nicht mehr leiden mußten, nach den Toten.
Selbst in den endlosen Nächten, im bläulichen Widerschein der von Aufräumungsmannschaften militärisch exakt aufgeschichteten Leichenhaufen hörte dies wimmernde, hilflose Hasten nicht auf.
5
Am Morgen des 15. August fuhren «Ansager-Teams» von Militärpolizisten durch das riesige Trümmerfeld und gaben bekannt: «Alle herhören! Heute mittag wird der Kaiser in eigener Person über den Rundfunk eine wichtige Botschaft verlesen. Wer imstande ist, sich fortzubewegen, soll zum Lautsprecher am Bahnhof kommen.»
Kazuo M. fühlte sich zwar sehr schwach, aber er schleppte sich dennoch zum Bahnhof, um dabei zu sein. Denn wie viele andere glaubte er, der Tenno werde eine Siegesbotschaft verkünden. Ein paar hundert Menschen, in Fetzen gehüllt, verwundet, siech, auf Stöcke oder Krücken gestützt, waren auf dem Platz vor der Bahnhofsruine zusammengekommen.
Aus dem Lautsprecher drang zuerst nur ein Geprassel von Nebengeräuschen. Als endlich die leise Stimme des Kaisers ertönte, klang sie zittrig, ja weinerlich: «Ertragt das Unerträgliche …»
Was bedeutete das? Keiner der Zuhörer hatte genau erfaßt, was eigentlich gesagt worden war. Lag es an der schlechten Übertragung, an der für den einfachen Mann schwerverständlichen Hofsprache? Oder nur daran, daß die Sinne sich sträubten, die für unmöglich gehaltene Weisung aufzunehmen?
Der spätere Bürgermeister von Hiroshima, Shinzo Hamai, der die Ansprache im zerstörten Rathaus hörte, erinnert sich: «Vielleicht lag es an der Batterie, vielleicht am Radioapparat selbst, aber die Sendung war völlig unverständlich. Nachher fragte ich einen Beamten, worum es sich eigentlich gehandelt habe. Und er sagte lakonisch: ‹Scheint, als hätten wir den Krieg verloren.› Ich konnte es einfach nicht glauben.»
Diejenigen, die am Platz vor dem Bahnhof gelauscht hatten, schlugen alle Zweifel schnell in den Wind. Ein Teil der Menge stemmte ein Lagerhaus der Station auf, um sich an den dort aufgehobenen Vorräten von Reiswein zu betrinken. Andere brachen in Tränen aus, manche schlugen verzweifelt mit ihren verbrannten Fäusten auf den versengten Boden ein. Die meisten aber schleppten sich stumm und schicksalsergeben wieder davon.
Kazuo M. gehörte zu denen, für die das Entsetzliche der letzten Zeit erst durch jene Worte Wirklichkeit wurde. Neun Tage lang hatte er sich getröstet, der böse Traum werde vorübergehen. Nun erst gestanden auch Herz und Verstand ein, was die Augen schon längst begriffen hatten: Die Welt von gestern, die Welt seines Lesebuches, gab es nicht mehr. Das war der Augenblick, da ihn plötzlich mit zwingender Gewalt die Vorstellung packte, er müsse dieses Buch «hinrichten». Nicht ein einziges Schriftzeichen sollte «ungestraft» davonkommen. Jedes und jedes von ihnen wollte er zerstückeln und unkenntlich machen. Wenn so etwas wie das, was ihm an «jenem Tage» begegnet war, überhaupt hatte geschehen können, geschehen dürfen, dann waren alle diese Worte hier in dem geliebten Lesebuch Lüge. Was war nach alledem noch Denken, was Wissen wert? Was galten jetzt noch Sitte, Rang, Gesetz? Laut schrie er es in die große Leere hinaus: «Otanawabaku!» – «Alle Menschen sind Dummköpfe!»
Hunderte und Hunderte von Schriftzeichen. Wie viele man in ein so schmales Buch pressen konnte! Einen Augenblick lang ließ Kazuo die Hände sinken, plötzlich von der Sinn- und Aussichtslosigkeit seines Unterfangens überwältigt. Da hörte er aus einer nahen Höhlenwohnung des Hijiyama-Hügels das spitze, hilflose «Itai, itai! Tut weh, tut weh!» eines kleinen Mädchens, und das erinnerte ihn wieder an die kleine Sumiko, die er durch die brennende Stadt geschleppt hatte.
Tod allen Worten! Zugrunde gehen sollten sie! Die weißen Fetzen tanzten über die verbrannte Erde wie ein Schneefall, der sich in den glühenden August verirrt hatte. Der Jüngling sprang auf, um ihnen nachzulaufen. Er stieß dabei wild verrückte Schreie aus.
Die Atomwüste
1
Es gibt Sandwüsten, Steinwüsten, Eiswüsten. Hiroshima aber, oder genauer gesagt: der Platz, an dem sich Hiroshima einmal befunden hatte, war Ende August 1945 eine neue, eine besondere, erstmalige Art von Einöde: eine Atomwüste, vom «homo sapiens» geschaffen, unter ihrer schwarzgrauen Oberfläche noch die Spuren seiner Tätigkeit, die jammervollen Überreste seiner Gattung bergend.
Nach und nach hatten die Überlebenden und Zehntausende, die von auswärts gekommen waren, um in den Trümmern nach Verwandten und Bekannten zu wühlen, sich aus dem inneren «Todeszirkel» der Bombe zwei, drei, ja bis zu vier Kilometer im Umkreis vom Punkt ihrer stärksten Wirkung zurückgezogen. Dieser böse, vielfach gezackte desolate Fleck lag nun verlassen von allem Leben da, eingesprengt in das grünwuchernde Mündungsgebiet des siebenarmigen Flusses Ohta, auf dessen Wassern noch immer mit jeder Ebbe und Flut, gefallenen Blättern gleich, Leichen stromauf, stromab trieben: die Männer seltsamerweise auf dem Rücken, die Frauen auf dem Bauche schwimmend.
Nur ein paar verwegene Kerle wagten sich in dieses Niemandsland. Sie gruben in den Trümmern nach verschütteten Dingen, die sie vielleicht zu Geld machen konnten.
Es waren Grüppchen von drei bis vier Leuten, die bei diesen Streifzügen zusammenarbeiteten, und sie entwickelten bald eine hervorragende Kenntnis des Terrains. Ihr Hauptaugenmerk richtete sich auf Metall, da jede Art von Schrott nach den jahrelangen Sammelaktionen und Beschlagnahmen der metallhungrigen Behörden in Japan nun Seltenheitswert besaß. Ganz besonders waren sie aber darauf aus, unter Asche und rußigen Balken die früheren Badezimmer auszumachen. Denn mancher Haushalt hatte sich durch den Krieg hindurch seinen «guemonburo» retten können, eine tiefe kupferne Sitzbadewanne, die nun fast ihr Gewicht in Gold wert war.
Ein anderer Erforscher dieser Wildnis war ein schlanker, schnurrbärtiger und bebrillter Mann, der einen ganz und gar nicht zu seiner Militärkappe und den martialischen Wickelgamaschen passenden weißen Labormantel trug. Auch er sammelte eifrig und kehrte am Ende des Tages mit vollem Rucksack und prallem Brotbeutel zu seiner Familie im Fischerdorf Kuba zurück. Wenn er dann aber die Beute auf dem «tatami» seines Hauses ausleerte, befand sich darunter kaum etwas, das man hätte verkaufen können. Es waren einfach Steine aller Arten und Größen.
Professor Shogo Nagaoka war ein bekannter Geologe der Universität Hiroshima, und insofern ist an der Tatsache, daß er wieder einmal wie gewohnt mit der Spitzhacke auf die Suche nach Fossilien, Mineralien, Petrefakten ging, eigentlich gar nichts Besonderes. Nur schürfte er diesmal nicht auf irgendeinem jungfräulichen Stückchen Erde, sondern klopfte geduldig einen Boden ab, auf dem sich nur ein paar Tage zuvor noch das Zentrum einer Großstadt befunden hatte.