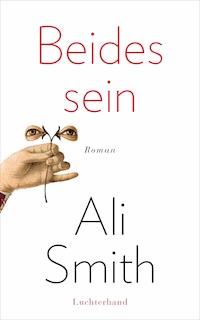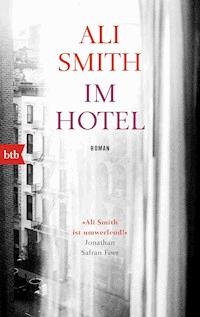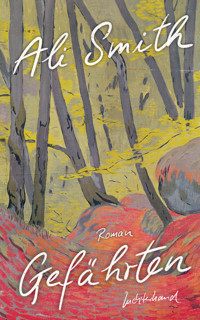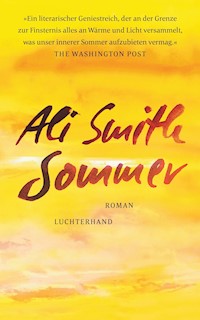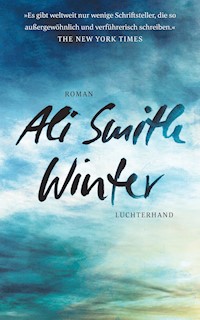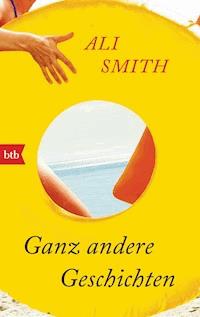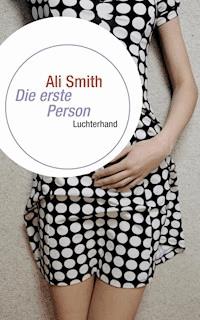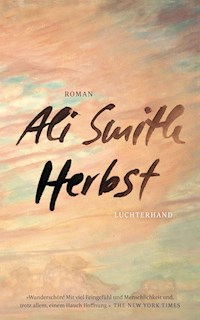
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Im Herbst 2016 ist Daniel ein Jahrhundert alt. Elisabeth, Anfang 30, kennt ihn von früher, der Nachbar hat sie als Kind mit der Kunst bekannt gemacht. Jetzt besucht sie ihn im Altersheim, liest ihm Bücher vor und fragt sich, was die Zukunft bringen mag. Denn England hat einen historischen Sommer hinter sich, die Nation ist gespalten, Angst macht sich breit. Der erste Roman aus Ali Smiths Jahreszeitenquartett erzählt von einer Welt, die immer abgeschotteter und exklusiver wird, über das Wesen von Reichtum und Wert, über die Bedeutung der Ernte. Und er erzählt vom Altern, von der Zeit und von der Liebe. Von uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Sammlungen
Ähnliche
Ali Smith
Herbst
Roman
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz
Luchterhand
Zum Buch:
Im Herbst 2016 ist Daniel ein Jahrhundert alt. Elisabeth, Anfang 30, kennt ihn von früher, der Nachbar hat sie als Kind mit der Kunst bekannt gemacht. Jetzt besucht sie ihn im Altersheim, liest ihm Bücher vor und fragt sich, was die Zukunft bringen mag. Denn England hat einen historischen Sommer hinter sich, die Nation ist gespalten, Angst macht sich breit. Ali Smiths neuer Roman ist eine Meditation über eine Welt, die immer abgeschotteter und exklusiver wird, über das Wesen von Reichtum und Wert, über die Bedeutung der Ernte. Und er erzählt vom Altern, von der Zeit und von der Liebe. Von uns.
Dieses faszinierende erste Buch aus Ali Smiths Jahreszeitenquartett nimmt unsere eigene Zeit ins Visier, so spielerisch wie geistreich. Wer sind wir? Woraus sind wir gemacht? Shakespeare’scher Witz, Keats’sche Melancholie und die schrille Energie der Pop-Art aus den 1960ern: Die Jahrhunderte werfen einen Blick auf die Art, wie wir unsere eigene Geschichte schreiben.
»Eine wunderschöne, ergreifende Sinfonie aus Erinnerungen, Träumen und flüchtigen Wirklichkeiten.« The Guardian
»Es fällt einem kaum ein anderer zeitgenössischer Schriftsteller ein, der so genial darin ist, das Gewöhnliche und das Wunderbare zu vereinen.« Observer
»Die herausragende Momentaufnahme eines Landes – im Grunde einer Welt – im Würgegriff einer furchterregenden Spirale aus Intoleranz, Angst und Misstrauen … Smith ist auf dem absoluten Gipfel ihres Könnens.« The National
»Der erste ernsthafte Brexit-Roman.« Financial Times
Zur Autorin:
Ali Smith wurde 1962 in Inverness in Schottland geboren und lebt in Cambridge. Sie hat mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und wurde 2015 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. Ihr Roman »Beides sein« wurde 2014 ausgezeichnet mit dem Costa Novel Award, dem Saltire Society Literary Book of the Year Award, dem Goldsmiths Prize und 2015 mit dem Baileys Women’s Prize for Fiction. Mit »Herbst«, dem ersten Band ihres Jahreszeitenquartetts, kam die Autorin 2017 zum vierten Mal auf die Shortlist des Man Booker Prize und eroberte zahlreiche Besten- und Bestsellerlisten in England und in Amerika.
Zur Übersetzerin:
Silvia Morawetz, mehrfach mit Stipendien ausgezeichnete Übersetzerin, hat u. a. Anne Sexton, Joyce Carol Oates, James Kelman, Paul Harding und Steven Bloom ins Deutsche übertragen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Autumn bei Hamish Hamilton, einem Imprint von Penguin Books Ltd., Penguin Random House Ltd., London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2016 Ali Smith
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Der Verlag konnte nicht alle Rechteinhaber ausfindig machen.
Berechtigte Ansprüche mögen bitte dem Verlag gemeldet werden.
Umschlaggestaltung: buxdesign | MünchenCovermotiv: © Getty Images/Heritage Images/Hulton Fine Art Collection/Boris Michaylovich Kustodiev (Ausschnitt)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22296-3V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Gilli Bush-Baileybis nächste Woche
und für Sarah MargaretHardy Wood
Frühling werd’ euch schon erneuert,
Wann der Herbst kaum eingescheuert!
William Shakespeare
Beim derzeitigen Tempo der Bodenerosion
hat Großbritannien noch 100 Ernten vor sich.
Guardian, 20. Juli 2016
Grün wie das Gras lagen wir im Korn, in der Sonne
Ossie Clark
Wenn ich hier mit dir glücklich werden soll –
wie kurz ist das längste Leben.
John Keats
Zerlegt mich sacht
W. S. Graham
Eins
Es war die schlechteste, es war die schlechteste aller Zeiten. Wieder. Das ist das Dumme bei allem. Es zerbricht, das war immer so und wird immer so sein; das liegt in der Natur der Dinge. Ein alter, alter Mann wird also an einem Ufer angespült. Er sieht aus wie ein schlaffer Fußball aus Leder mit geplatzten Nähten, wie sie vor hundert Jahren getreten wurden. Die See war rau. Sie hat ihm das Hemd vom Rücken gehoben; nackt wie am Tage meiner Geburt, geht es ihm durch den Kopf, den er im Nacken bewegt, allerdings unter Schmerzen. Also Kopf ruhig halten. Was hat er da im Mund, Kies? Es ist Sand, er hat ihn unter der Zunge, spürt ihn, hört es knirschen, wenn die Zähne aufeinanderreiben, das Sandlied singen: zermahlen zu Staub so fein, mehr wird am Ende nicht sein, mit mir unter dir fällst du weich, ich glitzer in der Sonne, Wind trägt mich davon, die Post in die Flasche, die Flasche ins Meer, wie Spreu weht’s mich umher, mein Korn ist schwer zu ernten
zu ernten
die Worte versickern. Er ist müde. Sand im Mund und in den Augen, die letzten Körnchen im Hals der Sanduhr.
Daniel Gluck, dein Glück ist versiegt.
Er hebt das verklebte Lid. Aber –
auf Sand und Steinen setzt Daniel sich auf
− ist er das? wirklich? das? der Tod?
Er schirmt die Augen ab. Sehr grell.
Von der Sonne beschienen. Trotzdem schrecklich kalt.
Er ist auf einem steinigen Sandstrand, der Wind ausgesprochen scharf, die Sonne scheint, das schon, wärmt aber nicht. Noch dazu ist er nackt. Kein Wunder, dass er friert. Er sieht an sich herunter. Sein Körper ist noch der alte, die kaputten Knie.
Er hatte gedacht, dass der Tod den Menschen herausdestilliert, die faulige Fäule abzieht, bis alles wolkenhell ist.
Das Ich, das dir am Ufer letztlich bleibt, ist anscheinend das, mit dem du auch gingst.
Wenn ich das gewusst hätte, denkt Daniel, hätte ich dafür gesorgt, dass ich mit zwanzig, fünfundzwanzig den Abgang mache.
Nur die Guten.
Oder (denkt er, die Hand vor dem Gesicht, damit niemand, falls ihn wer sieht, Anstoß nimmt, wenn er herausfischt, was er in der Nase hat, oder nachsieht, was es ist – Sand, sehr schön im Einzelnen, im immer wieder anderen Farbverlauf sogar der pulverisierten Welt, dann reibt er ihn sich von den Fingerspitzen) das ist mein herausdestilliertes Ich. Falls ja, ist der Tod eine traurige Enttäuschung.
Danke für die Einladung, Tod. Bitte entschuldige, aber ich muss zurück, ins Leben.
Er steht auf. Das tut nicht weh, nicht sehr.
Wohlan.
Nach Hause. Wo entlang?
Er dreht sich um hundertachtzig Grad. Meer, Uferlinie, Sand, Steine. Hohes Gras, Dünen. Dahinter flaches Land. Danach Bäume, eine Baumreihe, und dann weiter rundherum zurück zum Meer.
Das Meer ist seltsam und ruhig.
Dann fällt ihm plötzlich auf, dass er heute ungewöhnlich gut sieht.
Ich meine, ich sehe nicht nur diese Baumreihe, ich sehe nicht nur den Baum, ich sehe nicht nur das Blatt an dem Baum. Ich sehe den Stiel, der das Blatt mit dem Baum verbindet.
Er erkennt die gefüllte Samenkapsel an der Spitze jedes beliebigen Grashalms drüben auf den Dünen, fast so, als sähe er durch ein Zoomobjektiv. Und hat er gerade auf seine Hand geguckt und nicht bloß die Hand gesehen, ganz genau, und nicht bloß einen Streifen Sand an der Handkante, sondern mehrere einzelne Sandkörner, so deutlich, dass er ihre Ränder erkennt, und das (die Hand geht hinauf zur Stirn) ohne Brille?
Tja.
Er reibt sich den Sand von den Beinen und Armen, von der Brust und von den Händen. Schaut dem Flug der Sandkörner zu, die von ihm weg durch die Luft stäuben. Greift nach unten, füllt die Hand mit Sand. Sieh dir das an. So viele.
Refrain:
Wie viele Welten hält man in der Hand.
In einer Handvoll Sand.
(Wiederholen.)
Er spreizt die Finger. Der Sand rieselt zu Boden.
Jetzt, da er auf den Beinen ist, hat er Hunger. Kann man Hunger haben und tot sein? Aber immer, all die hungrigen Geister, die Menschenherzen und -hirne verspeisen. Er vollendet den Kreis und schaut wieder aufs Meer. Über fünfzig Jahre war er auf keinem Boot, und das war nicht mal ein richtiges Boot, sondern eine Bar, schrecklich, ein neumodischer Partyschuppen auf dem Fluss. Er setzt sich wieder in den Sand und auf die Steine, aber die Knochen in seinem, er will keinen unflätigen Ausdruck verwenden, weiter hinten am Ufer ist ein Mädchen, tun ihm weh, tun ihm weh wie, er will keinen unflätigen Ausdruck verwenden –
Ein Mädchen?
Ja, im Kreise anderer Mädchen, die alle zusammen einen wiegenden Tanz tanzen, der aussieht wie im alten Griechenland. Die Mädchen sind ziemlich nahe. Kommen näher.
Das wird nicht gehen. Die Nacktheit.
Dann sieht er mit seinen neuen Augen noch einmal da hinunter, wo eben noch sein alter Körper war, und weiß, er ist tot, muss tot sein, ist es mit Sicherheit, denn sein Körper sieht anders aus als beim letzten Blick an sich hinab, besser, ganz passabel eigentlich für einen Körper. Er kommt ihm auch bekannt vor, ziemlich genau wie sein Körper früher, als er jung war.
Ein Mädchen ist in der Nähe. Mehrere. Angst und Scham durchströmen ihn süß.
Er sprintet in das lange Dünengras (er kann rennen, richtig rennen!), schiebt den Kopf um ein Grasbüschel und vergewissert sich, dass niemand ihn sehen kann und niemand kommt, springt auf und rennt weiter (wieder! nicht mal außer Atem) über das ebene Stück zu den Bäumen.
Die Bäume bieten ihm Deckung.
Sie bieten ihm vielleicht sogar etwas, womit er sich bedecken kann. Aber pure Freude! Er hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt: fühlen. Sogar den Gedanken an das eigene nackte Ich in räumlicher Nähe zur Schönheit eines anderen zu fühlen.
Dort ist ein kleines Wäldchen. Er schlüpft hinein. Perfekt, der Boden im Schatten, ein Laubteppich, die gefallenen Blätter unter seinen (hübschen, jungen) Füßen sind trocken und fest, und an den tiefen Ästen auch noch massenhaft hellgrüne Blätter, und schau, das Haar auf seinem Körper ist überall an den Armen wieder dunkelschwarz, genauso von der Brust bis zur Leiste, wo es dicht ist, ah, nicht bloß das Haar, alles schwillt, schau.
Ist ja himmlisch.
Vor allem möchte er niemanden brüskieren.
Er kann sich hier ein Lager herrichten. Kann hierbleiben, bis er wieder Land sieht. Vielleicht was anzieht. (Wortspiele, die Währung des kleinen Mannes; armer alter John Keats, na ja, arm schon, alt nicht unbedingt. Ein Herbstdichter, Italien im Winter, nur Tage vor seinem Tod spielte er noch mit Wörtern, als gäb’s kein Morgen. Armer Kerl. Es gab kein Morgen.) Er kann die Blätter über sich häufen, damit er es nachts warm hat, falls es so etwas wie Nacht gibt, wenn man tot ist, und sollte das Mädchen, sollten die Mädchen noch näher kommen, häuft er die Blätter einen Meter hoch über sich aus Schicklichkeit.
Anstand.
Er hatte vergessen, dass es auch eine körperliche Seite hat, wenn man andere nicht brüskieren will. Süß durchströmt ihn nun das Gefühl der Anständigkeit, überraschenderweise so, wie man sich das Trinken von Nektar vorstellt. Der Schnabel des Kolibris senkt sich in die Korolle. So köstlich! So süß! Was reimt sich auf Nektar? Er wird sich aus Blättern einen grünen Anzug machen, und – kaum gedacht, hat er eine Nadel und goldfarbenes Zeug zum Einfädeln auf einer kleinen Spule in der Hand, schau an. Er ist tot. Muss es sein. Vielleicht ist es gar nicht übel, tot zu sein. Schwer unterschätzt in der modernen westlichen Welt. Jemand müsste es denen mal sagen. Jemand müsste ihnen Bescheid geben. Jemand müsste hingeschickt werden, müsste zurückstrampeln, wo immer das ist. Hektar. Kommissar Lapidar. Sonderbar. Storchenpaar. Sie gebar im Januar. Reservoir.
Er pflückt ein grünes Blatt von dem Ast neben seinem Kopf. Pflückt noch eines. Legt sie Rand an Rand zusammen. Näht sie mit, wie heißt das, Vorstich? Languettenstich? zusammen. Schau an. Er kann nähen. Das konnte er im Leben nicht. Der Tod. Voller Überraschungen. Er hebt eine Schicht Laub an. Setzt sich, legt Blätter mit passenden Rändern zusammen und näht. Erinnerst du dich, die Postkarte, die er in den Achtzigern an einem Stand mitten in Paris gekauft hat, die mit dem kleinen Mädchen in einem Park? Sie sah aus, als wäre sie in totes Laub gehüllt, ein Schwarzweißfoto, kurz nach Kriegsende entstanden: das Kind von hinten, in das Laub gehüllt, stand in dem Park und schaute sich verwehte Blätter und die Bäume an. Es war ein trauriges und zugleich faszinierendes Foto. Irgendetwas an dem Kind plus totes Laub, entsetzlich verkehrt, ein bisschen so, als trüge die Kleine Lumpen am Leib. Andererseits waren die Lumpen keine Lumpen. Es war Laub, deshalb war es auch ein Bild über Magie und Verwandlung. Und wieder andererseits, ein Bild, kurz nach Kriegsende, zu einer Zeit, in der ein Kind, das bloß im Laub spielte, auf den ersten Blick aussehen konnte wie ein Kind, das abgeholt und ausgelöscht worden war (ein schmerzlicher Gedanke)
oder auch ein nachatomares Kind, das Laub, das an ihm hängt, sähe aus wie abgefetzte Haut, wie seitlich baumelnde Lumpen, als wäre Haut nichts als Laub.
Es war also fesselnd auch im Sinn von ergreifend, das Foto, wie ein Foto von dem, der dich ergreifen wird, der dich abholt und in die andere Welt bringt. Ein Blinzeln des Kameraauges (der Name des Fotografen will ihm partout nicht einfallen), und dieses Kind im Blätterkleid wurde alles das: traurig, entsetzlich, wunderschön, lustig, erschreckend, dunkel, hell, bezaubernd, Märchen, Sage, Wahrheit. Die banalere Wahrheit war, dass er die Postkarte (Boubat! das war der Fotograf) gekauft hatte, als er die Stadt der Liebe mit einer Frau besuchte, deren Liebe er sich wieder mal erhoffte, was sich nicht erfüllte, natürlich nicht, eine Frau von Mitte vierzig und ein Mann von Ende sechzig, na, sei ehrlich, fast siebzig, und geliebt hat er sie ja auch nicht. Nicht aufrichtig. Ein Fall von prinzipieller Unverträglichkeit, keine Altersfrage, denn ihn hatte das Wilde auf einem Gemälde von Dubuffet im Centre Pompidou so aufgewühlt, dass er die Schuhe auszog und davor niederkniete, um ihm seinen Respekt zu erweisen, und die Frau, ihr Name war Sophie Irgendwas, hatte sich geschämt und sagte im Taxi zum Flughafen zu ihm, er sei zu alt dafür, in einer Kunstgalerie, sogar in einer modernen, die Schuhe auszuziehen.
Genau genommen weiß er von ihr bloß noch, dass er ihr eine Postkarte geschickt hatte, die er hinterher gern selber behalten hätte.
Auf die Rückseite hatte er geschrieben: Herzliche Grüße von einem alten Kind.
Er sucht ständig nach diesem Bild.
Er hat es nie wieder gesehen.
Er hat immer bedauert, es nicht behalten zu haben.
Bedauern, wenn du tot bist? Eine Vergangenheit, wenn du tot bist? Gibt es kein Entrinnen aus dem Ramschladen des eigenen Ichs?
Er schaut von dem Wäldchen auf den Rand des Lands, des Meeres.
Na, wo immer ich hier gelandet sein mag, ich verdanke ihm diesen todschicken grünen Mantel.
Er schlüpft hinein. Der Mantel passt wie angegossen, riecht grün und frisch. Er gäbe einen guten Schneider ab. Hat etwas gemacht, etwas aus sich gemacht. Seine Mutter wäre endlich mal zufrieden.
O Gott. Gibt es nach dem Tod noch eine Mutter?
Er ist ein Kind und liest Kastanien vom Boden unter den Bäumen auf. Er zerteilt die stachlige hellgrüne Schale und löst sie, braun glänzend, von der wächsernen Innenhaut. Füllt sie in seine Mütze. Bringt sie zu seiner Mutter. Sie ist da drüben mit dem neuen Baby.
Sei nicht albern, Daniel. Sie kann die nicht essen. Die isst niemand, nicht mal Pferde, viel zu bitter.
Daniel Gluck, sieben Jahre alt, in den guten Sachen, die zu haben er sich glücklich schätzen soll in einer Welt, in der so viele so wenig haben, schaut auf die Rosskastanien, mit denen er seine gute Mütze schmutzig gemacht hat und deren glänzendes Braun nun stumpf wird.
Bittere Erinnerungen, sogar wenn man tot ist.
Sehr deprimierend.
Mach dir nichts draus. Nur Mut.
Er ist auf den Beinen, sieht wieder manierlich aus. Er sieht sich um, entdeckt große Steine und zwei Stecken von ganz brauchbarer Länge, mit denen er den Eingang zu seinem Wäldchen kennzeichnet, damit er ihn wiederfindet.
In seinem leuchtend grünen Mantel tritt er aus den Bäumen, durchquert die Ebene und geht zurück zum Ufer.
Und das Meer? Ruhig, wie Meer im Traum.
Das Mädchen? Nirgends zu sehen. Die anderen, die im Kreis um sie tanzten? Weg. Allerdings hat es am Ufer jemanden angespült. Daniel geht nachschauen. Ist er das?
Nein. Es ist ein Toter.
Gleich neben diesem Toten liegt ein zweiter toter Mensch. Und dahinter noch einer und noch einer.
Daniel verfolgt die dunkle Linie der von der Flut ans Ufer gespülten Toten.
Manche Leichen sind die noch sehr kleiner Kinder. Daniel hockt sich neben einen aufgetriebenen Mann, der ein Kind, einen Säugling im Grunde, unter seiner Jacke hat, der Mund des Kindes offen, Wasser schwappt heraus, der Kopf ruht tot auf der aufgeblähten Brust des Mannes.
Weiter oben am Strand sind noch mehr. Es sind Menschen wie die am Ufer, aber sie leben. Sie sitzen unter Sonnenschirmen. In einiger Entfernung von dem Ufer mit den Toten machen sie Urlaub.
Von einem Bildschirm schallt Musik. Dort arbeitet jemand an einem Computer. Ein anderer sitzt im Schatten und liest auf einem kleinen Display. Unter demselben Sonnenschirm schlummert ein Dritter, ein Vierter reibt sich die Schultern und Arme mit Sonnencreme ein.
Ein vor Lachen kreischendes Kind rennt ins Wasser und wieder raus, wenn die größeren Wellen kommen.
Daniel Gluck sieht vom Tod zum Leben und dann wieder zum Tod.
Die Traurigkeit der Welt.
Noch auf der Welt, eindeutig.
Er sieht an seinem Laubmantel hinab, immer noch grün.
Streckt einen wundersamerweise noch immer jungen Arm vor.
Ewig währt er nicht, der Traum.
Daniel greift nach einem Blatt am Saum seines Mantels. Hält es ganz fest. Das nimmt er mit, wenn er kann. Beweis dafür, wo er gewesen ist.
Was soll er sonst mitbringen?
Wie ging der Refrain noch mal?
Wie viele Welten
Eine Handvoll Sand
Es ist ein Mittwoch, kurz nach Mittsommer. ElisabethDemand – zweiunddreißig Jahre alt, geringfügig beschäftigte Aushilfsdozentin an einer Universität in London, lebt den Traum, wie ihre Mutter sagt, und das stimmt auch, wenn es ein Traum ist, dass man keine Arbeitsplatzgarantie hat, fast alles, was man sonst machen könnte, zu kostspielig ist und man noch in derselben Wohnung zur Miete wohnt, in der man schon vor über zehn Jahren als Student hockte – ist in die Stadt unweit des Dorfs, in dem ihre Mutter jetzt lebt, gefahren, wo sie den Antrag für ihren neuen Pass im Check-&-Send-Verfahren auf dem Hauptpostamt abgeben will.
Die Bearbeitung wird durch diesen Service offenbar beschleunigt. Das heißt, der neue Pass kann in der Hälfte der Zeit ausgestellt werden, wenn man seinen ausgefüllten Antrag, den alten Pass und die neuen Fotos mitbringt und wenn ein dazu befugter Postamtsamtmann den Antrag mit einem zusammen durchgeht, bevor er an die Passbehörde geschickt wird.
Der Wartemarkenspender teilt ihr eine Marke mit der Nummer 233 für Schalterservice zu. Viel ist nicht los auf dieser Post, abgesehen von der bis auf die Straße reichenden Schlange verärgerter Kunden an der Selbstbedienungswaage, für die es keinen Markenspender gibt. Elisabeths Nummer ist aber noch so weit von den Nummern entfernt, die auf den Tafeln über den Köpfen aller als Nächster Kunde (156, 157, 158) angezeigt werden, außerdem dauert es so lange, bis die zwei einsamen Angestellten hinter den zwölf Schaltern die Kunden mit vermutlich Nummer 154 und 155 bedient haben (Elisabeth ist seit zwanzig Minuten hier, und es sind immer noch dieselben zwei Kunden), dass sie das Postamt verlässt, die Grünfläche überquert und in die Antiquariatsbuchhandlung in der Bernard Street geht.
Als sie zehn Minuten später wiederkommt, stehen immer noch nur die zwei einsamen Angestellten hinter den Schaltern. Auf den Tafeln werden aber jetzt als Nächster Kunde für den Schalterdienst die Nummern 284, 285 und 286 angezeigt.
Elisabeth drückt den Knopf am Spender und zieht eine neue Marke (365). Sie setzt sich auf die runde kommunale Sitzgarnitur in der Mitte des Raums. Irgendetwas ist in ihrem Unterbau kaputt, denn als Elisabeth sich niederlässt, knackt es, und der neben ihr sitzende Kunde schnellt ruckartig zwei Fingerbreit in die Luft. Dann setzt sich der Kunde um, der Sitz knackt, und Elisabeth sackt ruckartig zwei Fingerbreit nach unten.
Durch die Fenster sieht sie auf der anderen Straßenseite das herrschaftliche städtische Gebäude, das früher einmal das Amt der Hauptpost war. Heute beherbergt es eine Zeile von Designer-Kettenläden. Parfum. Bekleidung. Kosmetik. Sie lässt den Blick wieder durch den Raum schweifen. Auf der kommunalen Sitzgarnitur sitzen fast noch genau dieselben Kunden wie beim ersten Mal, als sie ihre Nummer zog. Elisabeth schlägt das Buch in ihrer Hand auf. Schöne neue Welt. Erstes Kapitel. Ein grauer, gerade mal vierunddreißigstöckiger Klotz. Über dem Hauptportal der Hinweis: CITY-BRÜTERUNDKONDITIONIERUNGSCENTERLONDON und auf einem Wappen der Wahlspruch des Weltstaats: KOLLEKTIVITÄT, IDENTITÄT, STABILITÄT. Einunddreiviertel Stunden später, sie ist schon ziemlich weit in dem Buch, sind die meisten Kunden um sie herum immer noch dieselben, starren weiter ins Leere, lassen ab und zu das Möbel knacken. Keiner unterhält sich mit einem anderen. In der ganzen Zeit, die sie hier ist, hat kein Mensch auch nur ein Wort zu ihr gesagt. Das Einzige, was sich verändert, ist die Windung der Schlange vor der Selbstbedienungswaage. Ab und zu durchquert jemand den Raum und sieht sich die Gedenkmünzen an, die auf einer Schautafel hinter Plexiglas ausgestellt sind. Es gibt ein Set, sieht Elisabeth schon von hier, zum Jubiläum von Shakespeares Geburts- oder Todestag. Auf einer Münze ist ein Schädel. Also wohl Todestag.
Elisabeth schaut wieder in ihr Buch, und zufällig wird auf der Seite, auf der sie gerade ist, Shakespeare zitiert. »O schöne neue Welt!« Miranda kündete von der Möglichkeit des Schönen, der Möglichkeit, selbst den Alptraum in etwas Gutes und Edles zu verwandeln. »O schöne neue Welt!« Es war eine Aufforderung, ein Auftrag. Von dem Buch aufzublicken und die Gedenkmünzen genau in dem Moment zu erspähen, in dem sich das Buch Shakespeare zur Seite stellt – das ist doch mal was. Sie rutscht auf ihrem Platz herum und lässt aus Versehen das Möbel knacken. Die Frau neben ihr schnellt ein wenig in die Höhe, gibt aber nicht zu erkennen, dass sie es gemerkt hat oder auch nur merken wollte.
Auf so unkommunikativen kommunalen Sitzmöbeln zu sitzen ist eigenartig.
Es gibt hier jedoch niemanden, dem Elisabeth einen vielsagenden Blick zuwerfen, geschweige denn mitteilen könnte, was ihr gerade zu dem Buch und den Münzen durch den Kopf gegangen ist.
Es ist sowieso einer jener Zufälle, die im Fernsehen und in Büchern etwas bedeuten könnten, im wirklichen Leben aber bedeutungslos sind. Was würde man aus Anlass von Shakespeares Geburtstag auf einer Gedenkmünze abbilden? O schöne neue Welt. Das wäre gut. Es wäre ein bisschen so, wie es wohl ist, geboren zu werden. Falls sich irgendjemand an seine Geburt erinnern kann.
Die Anzeige meldet 334.
Hallo, sagt Elisabeth gut vierzig Minuten später zu dem Mann hinter dem Schalter.
Die Anzahl der Tage eines Jahres, sagt der Mann.
Wie bitte?, sagt Elisabeth.
365, die Nummer.
Ich habe fast ein ganzes Buch ausgelesen, während ich heute Vormittag hier gewartet habe, sagt Elisabeth. Und dabei ist mir eingefallen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, hier Bücher vorrätig zu haben, damit die Leute, die lange warten müssen, in der Zeit ein bisschen lesen können, wenn sie wollen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine kleine Bibliothek aufzustellen oder einzurichten?
Komisch, dass Sie das sagen, sagt der Mann. Die meisten Kunden kommen gar nicht wegen Postdienstleistungen. Seit die Bücherei geschlossen wurde, kommen sie hierher, wenn es regnet oder überhaupt sehr ungemütlich ist.
Elisabeth blickt zurück zu der Bank, auf der sie gesessen hat. Auf dem Platz, von dem sie gerade aufgestanden ist, sitzt jetzt eine sehr junge Frau, die einen Säugling stillt.
Jedenfalls vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich hoffe, wir haben sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit beantwortet, sagt der Mann gerade.
Er will schon den Knopf neben sich drücken und Nummer 366 an den Schalter rufen.
Nein!, sagt Elisabeth.
Der Mann krümmt sich. Er hat offenbar einen Scherz gemacht; seine Schultern heben und senken sich, aus dem Mann kommt aber kein Laut heraus. Es ist wie Lachen, aber auch wie die Parodie von Lachen und gleichzeitig fast so, als hätte er gerade einen Asthmaanfall. Vielleicht darf man hinter dem Schalter der Hauptpost nicht laut herausplatzen vor Lachen.
Ich bin nur einmal in der Woche hier, sagt Elisabeth. Wenn Sie das gemacht hätten, hätte ich nächste Woche wiederkommen müssen.
Der Mann wirft einen Blick auf ihr Check-&-Send-Formular.
Das werden Sie eventuell sowieso machen müssen, sagt er. In neun von zehn Fällen stellt sich nämlich heraus, dass irgendetwas nicht vorschriftsmäßig ist.
Sehr witzig, sagt Elisabeth.
Ich mache keine Scherze, sagt der Mann. Bei Passdokumenten gibt es nichts zu lachen.
Der Mann leert den Umschlag mit all ihren Papieren auf seiner Seite der Trennwand aus.
Bevor wir uns damit befassen, sagt er, muss ich Sie darauf hinweisen, dass eine Gebühr von £ 9,75 fällig wird, wenn ich jetzt fortfahre und Ihr Check-&-Send-Formular prüfe. Das heißt, die £ 9,75 sind heute zu entrichten. Und sollte aus irgendeinem Grund irgendetwas nicht den Vorschriften entsprechen, kostet es Sie heute trotzdem £ 9,75, und Sie müssen die Gebühr bei mir in jedem Fall entrichten, auch wenn wir die Unterlagen wegen irgendeiner Unkorrektheit nicht abschicken können.
Ist klar, sagt Elisabeth.
Aber. Es geht noch weiter, sagt der Mann. Sollte irgendetwas nicht den Vorschriften entsprechen, Sie die verlangten £ 9,75 heute zahlen und das Detail, das nicht den Vorschriften entspricht, korrigieren und innerhalb eines Monats wiederbringen, wird die Gebühr von £ 9,75 nicht noch einmal fällig, vorausgesetzt, Sie können Ihren Kassenbeleg vorweisen. Wenn Sie die Unterlagen allerdings nach einem Monat oder ohne Kassenbeleg wiederbringen, werden Ihnen noch einmal £ 9,75 für einen neuen Check-&-Send-Service berechnet.
Kapiert, sagt Elisabeth.
Sie sind sich sicher, dass Sie heute trotzdem mit Check-&-Send fortfahren wollen?, sagt der Mann.
Mhm, sagt Elisabeth.
Könnten Sie bitte laut und deutlich ja sagen, statt nur so ein unbestimmtes Bestätigungsgeräusch von sich zu geben?, sagt der Mann.
Mhm, sagt Elisabeth. Ja.
Obwohl Sie die Gebühr entrichten müssen, auch wenn das Check & Send heute keinen Erfolg hat?
Allmählich hoffe ich das sogar, sagt Elisabeth. Es gibt ein paar alte Klassiker, die ich noch nicht gelesen habe.
Sie halten sich wohl für sehr witzig?, sagt der Mann. Soll ich Ihnen ein Reklamationsformular holen, das Sie beim Warten ausfüllen können? In dem Fall müssen Sie den Schalter aber verlassen, solange ich jemand anderen bediene, und da ich kurz vor meiner Mittagspause bin, büßen Sie den Platz direkt im Anschluss ein und müssen eine neue Wartemarke am Automaten ziehen und warten, bis Sie dran sind.
Ich habe absolut nicht die Absicht, mich über irgendetwas zu beschweren, sagt Elisabeth.
Der Mann blickt auf ihr ausgefülltes Formular.
Ihr Nachname lautet wirklich Demand, ja?, sagt er. Wie fordern?
Mhm, sagt Elisabeth, ich meine ja.
Ein Name, dem Sie vollauf gerecht werden. Wie wir bereits festgestellt haben.
Äh, sagt Elisabeth.
War nur ein Scherz.
Seine Schultern hüpfen auf und nieder.
Und Sie sind sich sicher, dass Sie Ihren Vornamen richtig geschrieben haben?
Ja.
Das ist nicht die übliche Schreibweise, sagt der Mann. Die übliche Schreibweise ist die mit einem z. Meines Wissens.
Meiner schreibt sich mit s, sagt Elisabeth.
Komische Schreibung, sagt der Mann.
Es ist mein Name.
Bei Ausländern wird er gewöhnlich so geschrieben, nicht?, sagt der Mann.
Er blättert den abgelaufenen Pass durch.
Hier steht aber, Sie sind britische Staatsbürgerin, sagt er.
Bin ich auch, sagt Elisabeth.
Dieselbe Schreibung, das s und alles, sagt er.
Erstaunlich, sagt Elisabeth.
Nicht sarkastisch werden, sagt der Mann.
Jetzt vergleicht er das Foto im alten Pass mit dem Bogen neuer Automatenfotos, den Elisabeth mitgebracht hat.
Erkennbar, sagt er. Gerade noch. (Schulterhüpfen.) Und das ist bloß die Veränderung von zweiundzwanzig zu zweiunddreißig. Warten Sie mal, bis Sie den Unterschied sehen, wenn Sie in zehn Jahren wegen eines neuen Passes wieder hierherkommen. (Schulterhüpfen.)
Er vergleicht die Zahlen, die sie in das Formular eingetragen hat, mit denen im abgelaufenen Pass.
Wollen Sie verreisen?, sagt er.
Vielleicht, sagt Elisabeth. Bloß für alle Fälle.