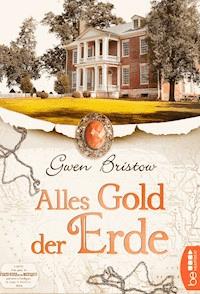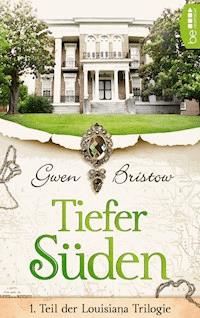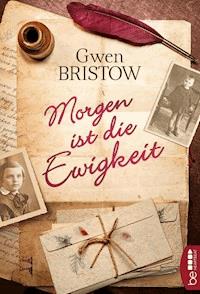
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Einen erfolgreichen Mann, gesunde Kinder, eine gesicherte Existenz - all das besitzt Elisabeth, und mehr hat sie vom Leben nie verlangt. Und dennoch gibt es Dinge, die Schatten auf ihr Leben werfen. Denn Elisabeth war schon einmal glücklich. Damals - als sie noch sehr jung und sehr verliebt war. Doch der Mann ihres Herzens kehrte aus dem Ersten Weltkrieg nie heim und trotz allem kann Elisabeth ihn nicht vergessen. Nun befindet sich ihr Land wieder im Krieg und jetzt ist es ihr Sohn, den Elisabeth gehen lassen muss. Zu dieser schweren Zeit tritt ein mysteriöser Fremder in ihr Leben. Ein Mann, der ihr so seltsam vertraut erscheint, dass sich Elisabeth ihm offenbart und ihm alles erzählt - auch die dunkelsten Geheimnisses ihres Herzens ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Einen erfolgreichen Mann, gesunde Kinder, eine gesicherte Existenz – all das besitzt Elisabeth, und mehr hat sie vom Leben nie verlangt.
Und dennoch gibt es Dinge, die Schatten auf ihr Leben werfen. Denn Elisabeth war schon einmal glücklich. Damals – als sie noch sehr jung und sehr verliebt war. Doch der Mann ihres Herzens kehrte aus dem Ersten Weltkrieg nie heim und trotz allem kann Elisabeth ihn nicht vergessen.
Nun befindet sich ihr Land wieder im Krieg und jetzt ist es ihr Sohn, den Elisabeth gehen lassen muss.
Zu dieser schweren Zeit tritt ein mysteriöser Fremder in ihr Leben. Ein Mann, der ihr so seltsam vertraut erscheint, dass sich Elisabeth ihm offenbart und ihm alles erzählt – auch die dunkelsten Geheimnisse ihres Herzens …
Über die Autorin
Gwen Bristow wurde am 16. September 1903 als Tochter eines Pastors in Marion, South Carolina/USA geboren. Sie besuchte die Pulitzer School für Journalismus und arbeitete als Reporterin. 1929 veröffentlichte sie ihren ersten Roman und wurde durch ihre Südstaaten-Romane weltbekannt. Sie starb 1980.
GWEN BRISTOW
MORGEN ISTDIE EWIGKEIT
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Utta Danella
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Mohrbooks AG Literary Agency, Zürich
Titel der Originalausgabe »Tomorrow is forever«
Copyright © 1943 by Gwen Bristow
Copyright der deutschen Erstausgabe © 1990 im Heyne Verlag
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Istomina Olena | Nejron Photo | Jules_Kitano | Arkadia
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6477-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
I
Elizabeth blickte über die Kaffeetasse hinweg ihren Mann liebevoll an. »Fühlst du dich besser, Spratt?«
Er lachte. »Ja. Wenn ich mit dir gesprochen habe, ist mir immer wohler. Es war lieb von dir, alles stehen und liegen zu lassen und den ganzen Weg hierher zu fahren, nur um mir zuzuhören.«
»Du weißt, ich tue es gern«, sagte Elizabeth. »Es ist mir geradezu ein Vergnügen, ein Papierkorb zu sein, in den du alle deine Sorgen hineinwerfen kannst.«
»Wenn du es so nennen willst«, sagte Spratt. »Aber wie du es auch nennst, auf jeden Fall bist du da, wenn ich dich brauche.«
Sie lächelten sich zärtlich an. Sie hatten das schon hundertmal erlebt in den vergangenen zwanzig Jahren, auch schon in der Zeit, ehe Spratt leitender Produzent in den Vertex-Studios geworden war. Es war immer das Gleiche mit nur geringfügigen Variationen – ein Film, der einfach nicht werden wollte; Schauspieler, die mit dem Kameramann Krach bekamen; Drehbuchautoren, die nicht schreiben konnten; Regisseure, die das ganze Team durcheinanderbrachten; unerwartete Ausgaben, die das Budget zu sprengen drohten; überschrittene Termine, die alle Pläne über den Haufen warfen, und dann folgte eines Tages Spratts verzweifelter Griff zum Telefon. »Elizabeth, wenn ich nicht sofort aus diesem Irrenhaus herauskomme und mit einem vernünftigen Menschen rede, werde ich verrückt. Kannst du nicht zum Lunch hereinkommen, damit ich mit dir sprechen kann?«
Sie kam immer. Seit das Benzin rationiert war, hatte sie sich angewöhnt, stets ein paar Coupons in Reserve zu haben und lieber ihre Einkäufe mit dem Fahrrad zu besorgen, damit sie zum Studio fahren konnte, wenn Spratt sie rief. Sie konnte ihn selten ernsthaft beraten, denn natürlich verstand er sein Geschäft besser als sie, aber es genügte, dass sie ihm zuhörte, verständnisvoll, anteilnehmend, und ihn vielleicht einmal auf die humorvolle Seite der Sache hinwies. Außerdem konnte er sicher sein, dass sie über alles schwieg, was er ihr berichtete.
Sie brachte alles mit, was er brauchte, um sich zu entspannen und die Dinge in einem freundlicheren Licht zu sehen.
Spratt meinte: »Nachdem ich jetzt alles vom Herzen habe, sieht die Welt schon wieder anders aus. Übrigens, dieser neue deutsche Autor scheint mir eine große Hilfe zu werden. Das ist ein kluger Mann.«
»Kann er denn englische Dialoge schreiben?«
»Oh doch. Manchmal hat er ein wenig komische Ausdrücke, aber das können die anderen dann verbessern. Er ist seit zwei oder drei Jahren im Lande. Erst im New Yorker Büro und jetzt hier. Ich habe ihm das Skript zu lesen gegeben, und er kommt heute Nachmittag, damit wir darüber sprechen. Eine harte Story. Es sind ein paar Szenen über Mutterschaft darin, also die können sehr gut werden, wenn man's richtig macht, oder aber auch schauderhaft, wenn man den Ton nicht trifft.«
Elizabeth nahm einen Schluck Kaffee und sagte dann mit amüsiertem Lächeln: »Erwarte bloß von mir auf diesem Gebiet keine Anregungen, mein Lieber. Wenn du romantische Töne über Mutterschaft brauchst, dann frage am besten einen Mann, der niemals Windeln waschen musste.«
»Von Romantik ist keine Rede«, antwortete Spratt, »ganz im Gegenteil. Aber du könntest …«
»Ich kann gar nichts. Mir fehlt jedwede Fantasie, und die Wirklichkeit könnt ihr in euren Filmen doch nicht brauchen.«
Spratt lachte ein wenig. »Es stimmt, du hast nie gelernt, worauf es beim Filmemachen wirklich ankommt. Aber wenigstens kannst du mich gelegentlich davon ablenken, das ist auch schon allerhand wert.«
»Hoffen wir also auf den deutschen Autor. – Oh, guten Tag, Mrs. Famsworth.« Elizabeth zauberte ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht, als sie Spratts verzweifelte Miene sah. O Gott, womit habe ich das verdient, besagte sein Ausdruck ungefähr, als die voluminöse Gestalt der Lady auf sie zugesegelt kam. Widerstrebend erhob er sich und versuchte, seinen Ärger über die Unterbrechung nicht merken zu lassen.
Mrs. Farnsworth deckte sie gleich mit einem Redeschwall zu und meinte, sie müssten unbedingt zu ihrer Party kommen, die sie zum Wohle der griechischen Kriegshilfe geben würde. »Aber setzen Sie sich doch wieder, Mr. Herlong. Ich werde mich einen Moment zu Ihnen setzen, um Ihnen alles zu erzählen«, rief sie und breitete sich über einen leeren Stuhl aus, der unglücklicherweise am Tisch stand. Spratt ließ sich also wieder nieder und erklärte sogleich, dass er leider, leider am Abend der Party würde arbeiten müssen.
»Oh! Wollen Sie denn nichts tun für den Krieg? Wollen Sie denn gar nichts tun?«, rief Mrs. Famsworth emphatisch und übersah geflissentlich, dass beide, Elizabeth und Spratt, die silbernen Knöpfe trugen, die auswiesen, dass sie bereits dreimal Blut gespendet hatten.
»Es tut mir leid, Mrs. Famsworth«, antwortete Spratt. »Ich sehe ein, die griechische Kriegshilfe verdient jede Beachtung. Nebenbei gesagt, ich habe auch bereits dafür einen Betrag gezeichnet. Es ist also nicht nötig, dass ich eine Party mitmache, um meine Hilfsbereitschaft zu beweisen.«
»Darum geht es ja nicht«, beharrte die Dame, »es handelt sich darum, dass Ihre Gegenwart der Sache nützen würde. Wir brauchen prominente Persönlichkeiten, verstehen Sie? Und es wird eine großartige Party, ich habe einen erstklassigen Bartender, bekannte Künstler werden für Unterhaltung sorgen …« Sie machte eine erwartungsvolle Pause.
»Warum geben Sie nicht einfach der Kriegshilfe all das Geld, das dies kosten wird, die Getränke, meine ich, und die Gagen der Künstler und so?«, fragte Elizabeth. Sie wusste, es war eine überflüssige Frage. Aber sie brachte es nicht fertig, immer so höflich wie Spratt zu sein gegenüber solchen Quälgeistern.
Leicht verärgert rief Mrs. Famsworth: »Aber Sie verstehen nicht!« Und Elizabeth dachte: Das stimmt. Sie hatte kein Verständnis für Leute, die sich zum Wohle der hungernden Griechen betrinken mussten.
Ehe sie antworten konnte, sagte Spratt verbindlich: »Wirklich, Mrs. Famsworth, so leid es mir tut, ich kann wirklich nicht kommen. Wir stehen kurz vor dem Beginn neuer Dreharbeiten, und ich muss zurzeit oft bis spätabends im Studio bleiben. Aber es wäre mir eine Freude, wenn ich …«, er zog seine Brieftasche heraus, »nun, sagen wir zwanzig Dollar der Sammlung beifügen könnte.«
»Oh, danke, vielen Dank. Mr. Herlong, wie reizend von Ihnen«, rief sie und nahm rasch die Banknote entgegen. »Ich wusste ja, dass Sie die Notwendigkeit unserer Hilfe einsehen. Und sollte es sich einrichten lassen, dass Sie an dem Abend früher fertig werden, dann erwarte ich Sie beide bestimmt. Und könnten Sie nicht auch Ihren Sohn mitbringen? So ein reizender Junge. Wir brauchen unbedingt ein paar junge Männer als Tänzer. Es ist so schwierig heutzutage mit den jungen Männern. Und wenn sie erst mal eingezogen sind, ist es nie sicher, ob sie auch kommen können. Außerdem«, sie senkte die Stimme, »es ist so eine Sache mit den jungen Soldaten, nicht wahr? Wenn man sie in den Organisationen trifft, dann geht das schon in Ordnung. Aber man überlegt sich doch, wen man zu sich nach Hause einlädt, nicht wahr? Könnten Sie Ihren Jungen nicht mitbringen?«
»Ich fürchte, Dick ist noch ein bisschen jung für solch eine Party«, wehrte Elizabeth ab. »Er ist erst siebzehn. Und er muss früh aufstehen, weil er ja in die Vorlesung muss.«
»Erst siebzehn? Wirklich? Er sieht älter aus. Vermutlich weil er so groß ist. Ich hab mich schon gewundert, wieso er noch nicht eingezogen ist. Lernt er denn noch? Kommt einem ganz sinnlos vor, nachdem er ja doch bald Soldat werden muss. Wo studiert er denn?«
Geduldig berichtete Elizabeth, dass Dick sich in diesem Herbst an der Universität von Kalifornien in Los Angeles eingeschrieben hatte.
»Oh! Dort?«, sagte die Dicke schleppend. »Gefällt es ihm denn da?«
»Ja. Warum nicht? Er geht gern hin. Warum sollte es ihm nicht gefallen?«
»Na ja, ich weiß nicht. Sicher, es ist eine gute Schule, kein Zweifel, aber«, Mrs. Farnsworth zögerte, »ich weiß nicht … was heutzutage dort so alles studiert … sicher, es sind nette Jungen und Mädchen dabei, aber doch auch viel … halten Sie es für richtig, dass er mit all diesen Leuten zusammenkommt?«
»Was für Leute denn?«, fragte Elizabeth. »In jeder Gemeinschaft gibt es schließlich nette und weniger nette Menschen.«
»Schon, aber die Uni von Los Angeles, nein, wissen Sie, all diese Neger dort, und dann«, jetzt flüsterte die Gute fast, »ich hab mir sagen lassen, es wimmelt dort geradezu von Juden. Und was die Farbigen betrifft, ich habe gehört, sie verlangen von den weißen Studenten, dass man sie, nun ja, ganz gleichberechtigt behandelt. Sie bestehen auf demokratischen Grundsätzen und … na ja.« Der Satz blieb unvollendet in der Luft hängen.
Damit war sie glücklich an einem Punkt angekommen, an dem es Spratt geraten schien, das Gespräch abzubrechen. Er konnte nicht dafür garantieren, ob es ihm möglich sein würde, weiterhin die Formen gesellschaftlicher Höflichkeit zu wahren. »Um ehrlich zu sein, Mrs. Famsworth«, sagte er betont, »ich würde es nicht gern sehen, wenn mein Sohn sich schämen würde, mit Leuten umzugehen, die Gott sich nicht geschämt hat zu erschaffen. – Es tut mir leid, wir müssen jetzt gehen. Ich muss zu meiner Arbeit zurück.« Er stand auf.
»Wenn es unbedingt sein muss«, lächelte die Dicke. »Es war soo nett, Sie zu treffen. Und vergessen Sie die Party nicht. Auf Wiedersehen, Mrs. Herlong. Ist es nicht schön, dass unsere Männer jetzt im gleichen Studio arbeiten? Ich hoffe, wir werden in Zukunft recht oft zusammenkommen.«
Beinahe hätte Elizabeth geantwortet: »Nicht, wenn ich es verhindern kann«, aber sie lächelte und sagte, ja, das hoffe sie auch, und nein, sie könne leider nicht mit Mrs. Famsworth zur Stadt zurückfahren, denn sie hätte Spratt im Studio abgeholt und müsse ihn auch dort wieder abliefern. Dann endlich gelang es ihnen zu flüchten.
»Lieber Himmel!«, seufzte Spratt, als er in den Wagen stieg. »Gibt's denn so was noch? Habe ich denn nicht schon genug auf dem Hals, dass mir diese Idiotin auch noch über den Weg laufen muss?«
Elizabeth schob sich hinter das Steuerrad. »Als du sagtest, du würdest nicht gern sehen, dass dein Sohn sich schämt, mit Leuten umzugehen, die Gott sich nicht geschämt hat zu erschaffen, da dachte ich, ganz stimmt das nicht. Wir würden es gar nicht gern sehen, wenn er mit einer Gans wie dieser Frau umgehen würde. In dieser Stadt laufen wirklich eine ganze Menge Schwachsinnige herum. Wie ist eigentlich ihr Mann?«
»Ein tüchtiger Mann, sehr fleißig. Wahrscheinlich ist das ihr Verdienst. Er wird sich lieber zu Tode arbeiten, als nach Hause zu gehen, was man verstehen kann.«
»Geschieht ihm recht, warum hat er sie geheiratet«, meinte Elizabeth.
»Sicher war sie ganz hübsch und niedlich, als sie achtzehn war. Und jetzt bekommt er sie nicht los. Denn tugendhaft ist sie bestimmt. Zwanzig Dollar hat's mich auch gekostet.«
»Es ist nicht weggeworfen, falls die Griechen es bekommen.«
»Die werden davon nichts sehen«, sagte Spratt. »Sie wird Whisky für ihre Party kaufen. Weißt du nicht, wie es bei diesen Wohltätigkeitspartys zugeht? Von den Spenden werden die Kosten des Abends bestritten, und nur falls was übrig bleibt, gelangt es dahin, wofür das Ganze bestimmt war.«
Elizabeth lachte. »Vergiss es, Spratt. Zwanzig Dollar war es wert, sie loszuwerden. Übrigens, Tante Grace war genauso eine Type. Ich hoffe, sie hat im Jenseits Gelegenheit, ab und zu eine kleine Kampagne zu starten. Vielleicht kämpft sie gerade jetzt dafür, dass die untergeordneten Engel einen helleren Heiligenschein bekommen? Wie ist es mit diesem Film? Hast du den Ärger vergessen?«
»Ja. Trotz der alten Schreckschraube.« Er grinste zu ihr hinüber, während sie konzentriert den Wagen durch den Mittagsverkehr lavierte. »Kann sein, ich brauche mal ab und zu eine Begegnung mit solch einem Monstrum, damit ich umso deutlicher sehe, was ich für ein Glück gehabt habe.«
»Das ist ein reichlich kurioses Kompliment, aber immerhin, schönen Dank. Ich werde dafür den Daumen drücken, dass dein Emigrant gute Einfälle hat.«
»Ich denke, eigentlich ja. Er ist wirklich gescheit. Du musst ihn kennenlernen.«
»Bring ihn doch mal zum Abendessen mit.«
»Das könnte ich in den nächsten Tagen tun. Ich denke, dass der arme Kessler eine kleine Aufheiterung gebrauchen könnte. Er ist eine traurige Erscheinung. Er kann kaum laufen und hat nur eine Hand.«
»Wie schrecklich. Haben die Nazis das getan?«
»Ich weiß nicht. Schon möglich. Er spricht nicht davon. Aber er wird ganz grün im Gesicht, wenn nur jemand die Nazis erwähnt. Na, auf jeden Fall hat er gute Ideen. Ich hoffe, heute wird ihm auch etwas einfallen.« Er wandte sich ihr zu und sagte herzlich: »Und dir danke ich, dass du gekommen bist.«
»Du weißt, ich tu's gern.«
Sie blickte kurz zu ihm hinüber mit dem kleinen kameradschaftlichen Lächeln, das er so liebte. Er lächelte zurück. Elizabeth schaute wieder auf die Straße. Sie sagte: »Uns geht's ganz gut, nicht?«
»Ja. Trotz Krieg und Fleischrationierung und verschiedener anderer Übel. Elizabeth?«
»Ja?«
»Du machst dir keine Sorgen wegen Dick, nicht wahr?«
»Ich versuche, nicht daran zu denken«, erwiderte sie kurz.
»Das brauchst du auch nicht. Erst wenn er achtzehn ist, und das dauert noch ein Jahr.«
»Noch ein Jahr, ja.«
»Du darfst nicht vergessen, Elizabeth, er hat eine schöne Jugend gehabt. Und er ist ein gutes Kind gewesen. Aber wir können nicht erwarten, dass er für immer bei uns bleibt. Außerdem – dieser Krieg hat einen Sinn.«
»Ja, ich weiß«, sagte sie leise. »Aber trotzdem – ich kann mir nicht vormachen und dir auch nicht, dass es mich nicht belastet. Ich wünschte, Cherry wäre die Älteste, dann wären beide Jungen in Sicherheit. Ich bin feige, nicht wahr? Ich habe auch ein schönes Leben gehabt, und einer der Hauptgründe dafür ist, dass ich zufällig in den Vereinigten Staaten geboren bin. Es wäre nicht mehr als recht und billig, dass ich meinem Land dafür danken möchte. Aber – ich kann nicht mehr tun, als versuchen, wenn es so weit sein wird, keine dumme, heulende Mutter zu sein. Aber du weißt, wie mir zumute ist.«
»Natürlich weiß ich es. Es geht mir ja selber so. Aber wir können es vielleicht so sehen: Nichts, was wir hergeben müssen, um diesen Krieg zu gewinnen, kann mit dem verglichen werden, was wir aufgeben müssten, wenn wir verlieren. Vergiss das nicht.«
»Nein. Ich denke auch nicht sehr viel daran, Spratt. Ich will einfach nicht. Noch ist es nicht notwendig. Wenn es so weit sein wird, dann werde ich damit fertigwerden.«
»Gut«, sagte Spratt, »eines Tages wird es geschehen. Dann werden wir es gemeinsam tragen.«
Sie fuhren an der hohen Mauer entlang, die das Studiogelände umgab. Vor dem Tor stoppte sie und wartete, bis der Pförtner öffnete.
Der Mann schaute in den Wagen und sagte: »Oh, Mr. Herlong. Wie geht's?«
»Danke, Kennedy«, erwiderte Spratt. »Und wie geht's Ihrer Kleinen?«
»Wieder alles in Ordnung. War nur eine Erkältung. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Tag, Mrs. Herlong. Alles in Ordnung?«
»Bestens, danke«, erwiderte Elizabeth und fuhr wieder an. Sie fuhren durch die Hauptstraße des Geländes, bogen dann links ab, passierten die vielen kleinen Bungalows, in denen sich die Büros befanden, und hielten schließlich vor einem, an dessen Tür in großen Buchstaben »R. Spratt Herlong« zu lesen war.
Spratt stieg aus, blieb auf dem Kies stehen und betrachtete Elizabeth einen Moment nachdenklich. In seinem Blick lag Anerkennung. Er hatte graue Augen, die kalt und prüfend sein konnten, doch wenn, wie jetzt, ein warmes Gefühl sie erfüllte, hatten sie eine Farbe wie das sanfte Grau von Olivenblättern. Da war Elizabeth, eine gepflegte, lebendige Frau, schlank und hübsch, in ihrem dunkelgrünen Herbstkostüm und dem Nerzjäckchen darüber. Das Haar wohlfrisiert, das Gesicht schmal und gut geschnitten, mit klarer, gesunder Haut, ihre Hände in braunen Lederhandschuhen lagen ruhig auf dem Steuerrad. Spratt lächelte. Er sah jedes Detail, genau wie er im Studio bei der Arbeit alles sah. Er nickte zufrieden. »Nicht schlecht«, sagte er, »für ein kleines Mädchen aus Tulsa in Oklahoma.«
Elizabeth lachte. »Kommst du zum Essen nach Hause?«
»Ich denke schon. Warum fragst du?«
»Es wird ein bisschen lebhaft sein. Dick und Cherry haben ein paar Freunde da.«
»Was, um Gottes willen, wirst du ihnen denn zu essen geben?«
»Ich habe Glück gehabt. Ich habe ein Stück Rindslende bekommen. Und Garnelen als ersten Gang.«
»Großartig. Ich werde da sein. Kann sein, es wird ein bisschen später, falls Kessler eine Idee hat, die wir besprechen müssen.«
»Gut. Aber die Kinder werden Hunger haben. Wir essen um halb acht, ob du da bist oder nicht. In Ordnung?«
»Ja. Und jetzt muss ich gehen.«
Er winkte ihr zu, und Elizabeth wartete, bis er im Bungalow verschwunden war. Dann wendete sie den Wagen, fuhr zurück zum Tor und machte sich auf den Heimweg nach Beverly Hills.
Es war ein sonniger Oktobertag. Die Sonne blitzte im Lack der vielen Wagen, die ihr entgegenkamen. Alle waren beschäftigt, alle hatten es eilig, Leben und Bewegung erfüllte die Stadt. Es gefiel Elizabeth. Das Gespräch mit Spratt hatte ihre Verärgerung über Mrs. Farnsworth vergessen lassen. Es gab immer solche Leute, und sie waren es nicht wert, dass man sie beachtete. Meist gelang es, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und traf man doch einmal mit ihnen zusammen, dann musste man es so betrachten, wie Spratt gesagt hatte: Man musste glücklich und dankbar sein, dass man Menschen hatte, mit denen man leben konnte. So einen Menschen wie Spratt. Mit ihm war gut auszukommen; der Erfolg stieg ihm nicht zu Kopf, und er war keiner von den Männern, die das Leben ihrer Frau schwierig gestalteten, wenn sie Karriere machten.
Zwanzig Jahre, dachte Elizabeth, und ihr wurde warm ums Herz, zwanzig Jahre, und ich habe ihn jeden Tag lieber. Das ist allerhand, wenn man bedenkt, was Hollywood aus manchen Ehen macht.
Für Elizabeth bedeutete der Begriff Ehe viel, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst in ihren Ehen viel Glück gefunden hatte. Sie war das zweite Mal verheiratet, ihre erste Ehe hatte nicht lange gedauert, aber sie war sehr glücklich gewesen. Eine Granate bei Château-Thierry im Jahre 1918 war das Ende gewesen. Seltsam, wenn man heute darüber nachdachte. Damals glaubte sie, sie könne nicht weiterleben. Sie war zwanzig Jahre alt, und sie wusste nicht, dass sie eines Tages Spratt treffen würde. Von ihrem ersten Mann hatte sie keine Kinder gehabt, und es war also nichts übrig geblieben, was sie an jene Zeit band. Nur die Erinnerung. Und jetzt – das Gedenken an Château-Thierry war nicht zuletzt ein Grund, dass sie tiefe Angst empfand, wenn sie daran dachte, wie bald ihr Sohn fortgehen würde. Das war etwas, was Spratt nicht empfinden konnte. Er liebte Dick nicht weniger als sie, aber er hatte das bittere Opfer nicht bringen müssen, das der Krieg von ihr gefordert hatte. Und auch wenn Spratt ein Realist war, er weigerte sich einfach, daran zu denken, dass Dick fallen könnte. Sie dachte immer daran. Sie wollte nicht, aber sie musste daran denken. Es konnte geschehen. Genau wie es damals geschehen war. Eines Tages würde Dick achtzehn Jahre alt sein, und dann lag es nicht in ihrer Macht, ihn zurückzuhalten. Es war schrecklich – und es war trotzdem notwendig. Der Kampf galt dem Bösen in der Welt, und darum musste er gekämpft werden. Denn das Böse musste besiegt werden, oder eine Welt würde bleiben, in der Dick nicht leben konnte. Ich habe noch ein Jahr lang Zeit, sagte sich Elizabeth zum tausendsten Mal. Bis dahin kann viel geschehen. Energisch schob sie die trüben Gedanken beiseite. Noch war Dick siebzehn, und alles war gut, sie hatte alles, was sie sich wünschen konnte eine glückliche Ehe, drei Kinder und ausgefüllte Tage.
Es ist ein gutes Leben, dachte sie, ein wunderbares Leben. Ich bin sehr dankbar dafür.
Die Berge standen braun vor dem hellen Himmel, durstig nach dem Regen des Winters. Aus dem Canyon kam der erste Duft des wilden Salbeis. An den Abhängen dörrten kahle, trockene Bäume, die ihre Äste verlangend in den klaren Himmel reckten. Aber der Frühling würde kommen, wie grüner Samt würde das Gras auf den Hügeln leuchten, purpurn der wilde Mohn, goldene Lupinenfelder dazwischen und die toten Bäume von Blüten und Blättern bedeckt.
Beiderseits der Straße, halb verdeckt zwischen Büschen und Bäumen, eingebettet in Gärten, die auch jetzt noch blühten, lagen die Häuser an dieser Straße. Der Wind, der über die Gärten wehte, brachte den Duft der Blumen, der sich mit dem Benzin- und Gummigeruch der Straße vermischte. Die Passstraße wand sich siegreich durch den Canyon. Immer wieder, obwohl sie die Strecke fast täglich fuhr, bewunderte Elizabeth die Macht des Menschengeistes, die diese wilde Gegend gebändigt hatte. Manchmal wünschte sie sich, sie wäre damals hier gewesen, in jenen Tagen, als die Pioniere nach Kalifornien kamen und zum Kampf gegen das wilde Land antraten, wie die Ritter einer alten Legende, die mit dem Schwert in der bloßen Faust mit dem Drachen kämpften, der einen unermesslichen Schatz bewachte. Immer wenn sie die gewaltigen Berge sah, die das Land umschlossen, dachte sie, ob es wohl je ein anderes Land gegeben habe, dessen Reichtum von solch unüberwindlich scheinendem Wall gehütet worden war. Als wenn die Natur selbst die Hand erhoben hätte: Dies Land, dies soll nicht euer werden.
Ein Land hinter ungeheuren Bergen, ein Land ohne Regen, ohne Wasser, in dem man nur verzagen und verdursten konnte, um schließlich zu sagen: Es ist unmöglich. Aber sie hatten wohl dieses Wort nicht gekannt, sie hatten das Land erobert. Nicht mit dem Schwert, mit Maschinen, mit Mathematik, mit dem klugen Verstand. Elizabeth verstand wenig von Technik. Sie hätte nicht zu sagen vermocht, wie es geschafft worden war. Aber sie erkannte, dass es geschafft worden war, und bewunderte den Sieg.
Als sie die Höhe des Passes erreicht hatte und Meilen und Meilen über das Land blicken konnte, das ihr Land war, als sie den wilden Duft, gemischt aus Staub und Salbei, aus Benzin und Eukalyptus roch, als sie das Singen des Windes in der Schlucht hörte, da überkam sie wieder das herrliche Gefühl, das sie immer auf der Höhe des Passes empfand: welches Glück es bedeutete, Amerikaner zu sein.
Es war ein Zufall der Geburt, gewiss, aber es machte sie zu einem Teil der Zukunft. Dies war die Welt von morgen, in der sie lebte. Und es bedeutete mehr als die glorreichste Vergangenheit. Wenn man das begriff, dann war der Anblick des Aquädukts von Los Angeles weit erregender, konnte einen weit mehr entzücken als der Anblick eines Schlosses oder einer Kathedrale des Mittelalters.
Es gab Leute, die sahen es nicht so. Aber sie konnten ja gehen und irgendwo zwischen feuchten Steinen leben, in einer Kultur, die alt und müde war, wo es unmöglich war, eine neue Wasserleitung zu legen, bloß weil eine alte Ruine im Wege stand. Und was kam dabei heraus, wenn man an den alten Dingen festhielt? Krieg und Terror und Hass. Denn die Welt wandelte sich. Und wer den Wandel nicht mitmachte, der wurde vernichtet. Die Zukunft war stärker, sie brachte das Alte zum Fallen. Sogar er, der das Barbarentum vergangener Zeiten wieder einführen wollte, musste einen anderen Namen dafür finden, er nannte es eine neue Ordnung, aber es war weder Ordnung noch war es neu. Warum begriffen die Deutschen und die Japaner nicht, dass die Entwicklung der Menschheit andere Wege ging, auf denen ihre Brutalitäten keinen Platz mehr fanden? Warum schlossen sie sich dieser neuen Welt der Wissenschaft nicht an, die die Menschen gesund machte und ihr Leben lebenswerter? Und wenn einer das Mittelalter noch so sehr liebte, es war nun mal vorbei. War Vergangenheit.
Hier war die neue Welt, hier war die wirkliche Welt. Es war Kalifornien, wo man Autostraßen über unwegsame Gebirge baute, wo man die Wüste bewässerte, bis sie Frucht trug, genügend Frucht, um das halbe verhungerte Europa zu füttern, wenn ihre Unterseeboote die Nahrung nur hineinlassen würden. Es war so dumm, so sinnlos alles.
Ein großes Transportflugzeug brummte wie eine schwerfällige Fliege über dem Rand eines Kliffs. Elizabeth warf einen flüchtigen Blick hinauf. Vermutlich würde ich mir das Genick brechen, wenn ich ein Flugzeug führen würde, dachte sie. Ob es wohl schwierig war? Ob sie es lernen könnte? Ihr Wagen rollte bergabwärts. Aber ich würde mir lieber das Genick brechen und hätte Spaß am Leben gehabt, als einen heilen, aber steifen Hals in ein langweiliges Leben zu retten. Abgesehen davon habe ich kein langweiliges Leben – sie hatte den Fuß auf der Bremse und lenkte den Wagen behutsam um die Kurven –, ein Haushalt mit drei Kindern und einen Filmproduzenten als Ehemann ist keineswegs ein Ruhesitz.
Die Straße senkte sich, und vor ihr lag die blühende Ebene von Beverly Hills. Nun kam Elizabeth nach Hause. Wie schön das Haus war, leuchtend in der Sonne. Es war nicht aufwändig, aber groß und komfortabel, es war gepflegt und ordentlich, aber nicht tot und langweilig, man sah, dass mehrere Menschen darin lebten. Der Gärtner arbeitete bei den Chrysanthemen und hatte währenddessen den Rasensprenger angedreht. Drei Reihen mit jeweils sechs Fontänen drehten sich über dem Gras. Wie ein Schleier, in dem sich die Regenbogenfarben brachen, tanzte der feuchte Nebel in der Sonne. Aus dem zurückliegenden Teil des Gartens hörte Elizabeth frohe junge Stimmen und das Plätschern im Swimmingpool. Die Kinder waren da und ihre Gäste offenbar auch.
In der Einfahrt hielt sie an, um kurz mit dem Gärtner zu sprechen. Dann sah sie Brian, ihren Jüngsten, elf Jahre alt, der mit seinem Fahrrad aufkreuzte.
»Wo fährst du hin, Brian?«
»Pfadfindertreffen.« Er blickte erwartungsvoll hinaus auf die Straße. »Peter wollte mich abholen. Er sagte, er würde draußen auf mich warten. Eigentlich müsste er schon da sein.«
»Schön«, sagte Elizabeth. Beinahe hätte sie hinzugefügt: Sei vorsichtig bei dem Verkehr, aber sie verschluckte die Bemerkung gerade noch. Brian war ein so sicherer Radfahrer, wie sie eine sichere Autofahrerin war. Es wäre albern, ihn immer mit überflüssigen Mahnungen zu behelligen. Er blickte von der Straße zurück wieder zu ihr. »Mutter, kann ich bei Peter zum Essen bleiben?«
»Hat er dich eingeladen?«
»Noch nicht. Aber ich gehe nachher mit zu ihm, um seine Lepidoptera anzusehen« – das Wort war schwer auszusprechen gewesen –, »und dann wird er mich vielleicht einladen, meine ich. Wenn er es tut, kann ich dann bleiben?«
»Nur wenn seine Mutter dich einlädt«, sagte sie nachdrücklich, »du darfst nicht so oft bei anderen Jungen zum Essen bleiben, Brian. Es sei denn, du wirst richtig eingeladen. Wenn Mrs. Stern sagt, du sollst bleiben, da sag lieber, sie soll mich erst anrufen.«
»Wenn Mrs. Stern dich anruft, kann ich dann dort bleiben?«
»Du wirst nicht sagen, dass du bleiben willst, ehe sie gesagt hat, du sollst?«
»Nein, bestimmt nicht. Ich verspreche es.«
»Gut dann. Aber sie soll mich anrufen.«
»Okay«, sagte Brian zufrieden. »Oh, da ist er! Hei, Peter!« Er schwang sich auf sein Rad und war verschwunden.
Wie eilig sie es haben, dachte Elizabeth, als sie den beiden Jungen nachsah, die in Windeseile die Straße entlangradelten. Alles, was sie tun, ist furchtbar wichtig. Ich wünschte, das Leben wäre immer so. Ach, Unsinn. Ich wünsche es gar nicht. Es ist lächerlich, sentimental über die Kindheit nachzudenken. Wie schrecklich wäre es, wenn man sechzig Jahre lang Kind bliebe. Das Leben ist immer wichtig, ganz egal, wie alt man ist.
Sie startete und fuhr zur Garage an der Rückfront des Hauses. Die Kinder sahen sie nicht gleich, so trat sie auf die Bremse und blieb sitzen. Ihre beiden, Dick und Cherry, waren am Bassin mit ihren Freunden. Da war ein langbeiniges Mädchen namens Julia Rayford, das Dick seltsamerweise für eine große Schönheit hielt. Elizabeth konnte davon nichts entdecken, nur dass das Mädchen gesund und frisch und lebendig war. Aber es war ganz gut, dass Dick Julia so bewunderte, sie war ein nettes Mädchen und außerdem Cherrys beste Freundin, und dadurch verstanden sich alle gut. Cherry ihrerseits war ein bezauberndes Geschöpf: Die dichte schwarze Lockenmähne, eine süße Figur, schon ganz weiblich; der kleine Bikini, der nass an dem Persönchen klebte, enthüllte die zarten Hüften und die runden kleinen Brüste mehr, als dass er sie verbarg. Elizabeth dachte: Lieber Himmel, man hätte mich, verhaftet, wenn ich in ihrem Alter so zum Baden gegangen wäre. So gut wie nackt, aber sie ist hinreißend.
Da Cherry seine Schwester war, ließen ihre Reize Dick völlig kalt. Doch es war offensichtlich, dass man das von dem vierten Teilnehmer der Party nicht behaupten konnte. Es war ein Schulfreund von Dick, mit Namen Herbert Clarendon Whittier, allgemein bekannt unter dem Namen Pudge.
Pudge war dabei, den Limonenbaum zu schütteln, und Cherry krabbelte eifrig umher, um die Früchte einzusammeln. Dick stand in großer Pose auf dem Sprungbrett, bereit, eine große Vorstellung zu geben, um seiner kleinen Freundin zu imponieren. Julia saß, die Füße im Wasser, am Rand des Bassins und blickte zu ihm auf.
Was für ein hübscher, gesunder Junge, dachte Elizabeth beim Anblick ihres Sohnes, und wie gut er gewachsen ist. Er sah schon mehr aus wie ein Mann als wie ein Junge. Sie musste plötzlich daran denken, wie klein und zart und winzig er gewesen war, als sie ihn im Arm trug, er roch süß und warm nach Babypuder.
So ist es, dachte sie. Seltsam und ganz natürlich. So war es immer, seit Tausenden und Tausenden von Jahren. Es ist nur so seltsam, wenn es einem selber passiert. Noch ein paar Jahre, und er wird irgend so ein kleines Ding wie diese Julia Rayford heiraten, und sie wird ein Kind bekommen, und er wird sich darüberbeugen mit genau dem gleichen erstaunten Gesicht, das Spratt hatte, als er Dick zum ersten Mal sah. Wenn es ein Junge wird, werden sie ihn Richard Spratt Herlong III nennen, und wenn es ein Mädchen wird, werden sie sämtliche Namen zwischen Amaryllis und Zillach erörtern und sich schließlich auf irgendeinen prosaischen Namen einigen, so einen wie meinen.
Ich werde versuchen, eine nette Großmutter zu sein, und wir werden alle sehr aufgeregt sein, so als ob es noch nie Ähnliches auf der Welt gegeben hätte. Vorher allerdings müssen wir den Krieg hinter uns bringen. Oh, warum können so ein paar machtbesessene Scheusale die Welt in so viel Unglück stürzen? Jungen, wie mein Dick – ach, ich will nicht daran denken. Er denkt überhaupt nicht daran. Oder – tut er es doch?
Sie erinnerte sich an den Tag von Pearl Harbour. Sie fand Dick lauschend vor dem Radio, vorgebeugt, einen Ausdruck von Entsetzen in seinem jungen Gesicht, der sie, betäubt vor Schrecken, wie sie selber war, um die letzte Fassung brachte. Er hatte sie angesehen und zwischen den Zähnen hervorgestoßen: »Diese verdammten gelben Bastarde!«
Solch einen Ausdruck hatte sie nie von ihm gehört, und als er ihr hilfloses Gesicht sah, grinste er entschuldigend und fügte hinzu: »Ich kenne noch üblere Worte, und es ist mir ganz danach, sie auszusprechen. Also wenn du sie nicht hören willst, dann geh lieber hinaus in den Garten zu Vater. Dort ist ja noch ein Apparat.«
Was Elizabeth erstaunte, waren nicht nur die Worte, sondern die wütende Vehemenz, mit der er sprach. Das erste Mal war Dick nicht mehr ihr lieber, vergnügter kleiner Junge. Die Nachrichten über Pearl Harbour hatten ihn ganz plötzlich zu einem fremden Erwachsenen gemacht.
Sie ging wirklich hinaus in den Garten und erzählte Spratt, was der Junge gesagt hatte. Doch Spratt erwiderte kurz: »Ich verstehe, was er fühlt.«
»Ich auch«, sagte Elizabeth. »Ich habe ja auch nichts dazu gesagt.«
Eine Weile lauschten sie schweigend der aufgeregten Stimme aus dem Lautsprecher. Und plötzlich, als würde es ihr jetzt erst richtig klar, rief Elizabeth erschrocken aus: »Spratt! Wir haben Krieg. Das bedeutet … weißt du, was es bedeutet? Es ist – Dick. Schon bald.«
Und Spratt sagte: »Ja. Ich weiß es.«
Eine eisige Kälte kroch über ihren Rücken, und dann dachte sie, an diesem Tage das erste Mal: Noch nicht. Ich brauche jetzt noch nicht daran zu denken.
Wie Dick wohl heute darüber dachte? Sie hatte keine Ahnung. Er sprach gelegentlich davon, in selbstverständlichem Ton, dass er einrücken würde, wenn er in das Alter kam. Aber es schien ihm weniger wichtig zu sein als seine Schulangelegenheiten. Doch wenn man siebzehn ist, scheint einem ein Jahr eine endlos lange Zeit zu sein.
Dick federte in den Knien, löste sich vom Sprungbrett, überschlug sich zweimal im Flug und glitt so gerade ins Wasser, dass es kaum einen Spritzer gab. Er tauchte rechtzeitig genug auf, um Julias begeisterten Ausruf zu hören: »Dick, das war prima. Meinst du, ich könnte es auch so lernen?«
Pudge war der Erste, der Elizabeth sah. Er rief: »Guten Tag, Mrs. Herlong«, und die anderen wandten sich um und winkten ihr zu. Elizabeth winkte zurück und fuhr den Wagen in die Garage. Dann ging sie über den Rasen, um die Kinder zu begrüßen.
»Hallo, wie geht's euch? Cherry, um Himmels willen, was hast du denn mit all diesen Limonen vor?«
»Ich wollte Limonade machen«, sagte Cherry, und Pudge fügte hinzu: »Sie haben doch nichts dagegen?«
»Natürlich nicht, aber das reicht für ein ganzes Fass. Sammle die anderen zusammen, Cherry, und bring sie hinein. Wir können sie gut verwenden.«
»Ich werde Eis holen«, meinte Dick und kletterte aus dem Wasser. Er nahm ein Handtuch und trocknete damit seine braunen Beine. »Ich tropfe noch ein bisschen, aber ich gehe nur in die Küche«, versprach er Elizabeth, ehe sie mit Einwänden kam.
»Na schön«, sagte sie und wandte sich zum Haus. Über die Veranda, die über die ganze Rückfront des Hauses lief, kam sie in den lang gestreckten Vorraum, den die Kinder als Spiel- und Arbeitszimmer benützten. An der Wand war ein Berg alter Magazine aufgestapelt, staubig und verblichen sahen sie aus, als hätten sie jahrelang auf einem Dachboden gelegen. Wo in aller Welt hatten sie das her, und was wollten sie damit?
Die Tür, die in die Küche führte, wurde aufgestoßen, und Dick streckte den Kopf herein.
»Möchtest du auch ein Glas Limonade, Mutter?«
»Doch, gern.«
»Dann musst du in die Küche kommen. Oder darf ich auf den Teppich?«
»Ich komme schon«, sagte sie und folgte ihm. Dick und Cherry brachten ein Tablett mit Gläsern und Eisschalen. Von ihren Badeanzügen tropfte es nass aufs Linoleum, und die Köchin machte ein vorwurfsvolles Gesicht.
»Was wollt ihr denn mit den alten Zeitungen?«, fragte Elizabeth, nachdem sie ein Glas genommen hatte.
»Das sind unsere«, antwortete Cherry. »Das heißt, sie gehören Julia. Sie hat sie auf dem Boden zu Hause gefunden, und wir wollen uns ein paar Anregungen daraus holen. Wir sollen nämlich einen Aufsatz über die Entwicklung der Mode im zwanzigsten Jahrhundert schreiben.«
»Ach so«, sagte Elizabeth. »Bringt sie bloß nicht ins Wohnzimmer. Sie sind ja furchtbar staubig.«
»Nein, nein«, sagte Cherry und verschwand mit dem Limonadenkrug nach draußen. Dick hatte inzwischen eine Dose mit Keksen gefunden.
»Können wir die haben, Mutter?«
»Bitte sehr, nimm sie mit.«
»Danke«, sagte er und folgte Cherry in den Garten. Elizabeth sprach kurz mit der Köchin wegen des Abendessens und ging dann hinauf in den ersten Stock. Sie warf einen flüchtigen Blick in Spratts Zimmer. Alles war in bester Ordnung – Zigaretten in der Dose, Streichhölzer und Aschenbecher daneben, ›Time‹ und ›Newsweek‹ auf dem Tisch, außerdem ein paar Romane, die von Agenturen zur Ansicht eingeschickt worden waren. Ein Notizbuch, in das Spratt seine Bemerkungen dazu kritzelte, lag dabei. Sie überprüfte die Bleistifte, ob sie auch spitz waren, zog vorsorglich den Vorhang zu, denn die Sonne würde den Teppich ausbleichen, und schließlich ging sie durch die Verbindungstür in ihr eigenes Zimmer.
Das war ihr Lieblingsplatz im Haus. Sosehr sie ihre Familie liebte, manchmal hatte sie das Bedürfnis, allein zu sein. Und dies war der einzige Platz, wo sie wirklich ungestört blieb. Ein ruhiger, geschmackvoll eingerichteter Raum – das Bett mit einer blauen Decke versehen, der Toilettentisch mit Dosen und Parfümflaschen, an beiden Seiten lange Leuchten, in einer Ecke stand ihr Radio, damit sie ohne Störung die Programme hören konnte, die sie liebte. In der anderen Ecke standen der Schreibtisch und der Papierkorb. Spratt nannte diese Ecke ihr Büro, denn hier schrieb sie Briefe, sammelte die Rechnungen und schrieb die Schecks aus, führte sorgfältig ihr Haushaltsbuch. Vor dem Fenster stand eine Couch, und auf dem Tischchen daneben lag das Buch, in dem sie jeweils las, ihre Zigaretten, ein Kalender, ein Notizbuch und ihr eigenes Telefon. Obwohl das Fenster meistens offen war, hielt sich im Raum ein leiser Duft, gemischt aus ihren Cremes und Lotions und dem Parfüm, das sie benutzte. Immer wenn Elizabeth diesen Raum betrat, entspannte sie sich, fühlte sich ganz und gar zu Hause.
Sie nahm ein langes Bad, bürstete ausdauernd ihr Haar und zog sich dann für das Dinner an – ein zartes, schwingendes Gewand aus weißem Satin, ein Hausgewand für die Gastgeberin. Spratt hatte es ihr zum Geburtstag geschenkt, und als Elizabeth sich im Spiegel betrachtete, gefiel sie sich außerordentlich gut. Das kleidete sie. Selbst würde man sich so ein aufwändiges Gebilde niemals kaufen. Aber es war hübsch, es geschenkt zu bekommen. Und auch sonst, nicht nur das Kleid. Elizabeth drehte sich zufrieden vor dem Spiegel. Sie pflegte immer sehr sorgfältig ihr Gesicht und ihr Haar, und ihre Figur war die eines jungen Mädchens. Es war kein Zufall, dass Spratt ihr mit Vorliebe schöne Kleider schenkte. Als Filmproduzent hatte er ein sicheres Auge für die Erscheinung einer Frau. Er würde ihr diese Kleider nicht mitbringen, wenn er nicht wüsste, dass sie sie zu tragen verstand.
Sie drehte das Radio an und lauschte eine Weile. Zuerst beklagte sich eine traurige Stimme darüber, dass die Blumen im Garten der Liebe so rasch verwelkten, dann empfahl man ihr ein Mittel gegen schlechte Verdauung, und dann wollte eine energische Stimme wissen, was sie gegen die Schmerzen in ihrem Kreuz tue. Elizabeth zog eine kleine Grimasse und brachte das Ding wieder zum Schweigen. Besser, sie las ein wenig, bis es Zeit wurde, hinunterzugehen und die Cocktails zu bereiten.
Sie streckte sich auf der Couch aus und schlug die Seite auf, wo sie die Lektüre unterbrochen hatte.
Das Buch war spannend, und sie zog unmutig die Brauen hoch, als das Telefon sie nach einiger Zeit störte. Dieser Apparat war nicht mit den anderen im Hause verbunden, man konnte direkt wählen, jedoch nur ihre besten Freunde kannten die Nummer. Also war der Anruf bestimmt für sie. Sie legte das Buch zur Seite und griff nach dem Hörer. Es war Spratt.
»Elizabeth, haben wir morgen Abend Gäste?«
»Nein. Willst du jemanden mitbringen?«
»Kessler. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er hat ein paar gute Einfälle, und ich würde sehr gern morgen Abend mit ihm darüber in Ruhe reden. Es wäre gut, wenn sonst niemand käme.«
»Gut. Sag ihm also, morgen Abend um halb acht. Hat er schon Hollywooder Magengeschwüre, oder kann er alles essen?«
»Er kann alles essen, so weit ich weiß, aber denke bitte daran, dass er nur eine Hand hat. Mach irgendetwas, was er leicht essen kann.«
»Oh ja, das hatte ich vergessen. Vielleicht erst eine Suppe und dann Hühnerpastete, was meinst du? Da braucht er kein Messer.«
»Hört sich gut an.«
»Und noch etwas, Spratt, hat er eine Frau oder irgend so was, die wir mit einladen müssen?«
»Eine Frau hat er nicht – aber, fällt mir gerade ein, eine Tochter hat er erwähnt. Ich weiß aber nicht, wie alt sie ist. Vielleicht kann ich das noch erfahren. Auf alle Fälle könnte Dick zu Hause bleiben und sich um das Mädchen kümmern. Damit ich Kessler nach dem Essen für mich habe.«
»Ach, du lieber Himmel«, seufzte Elizabeth, »kann sie wenigstens Englisch?«
»Keine Ahnung.« Spratt lachte leise. »Sag Dick, mein Herz blutet für ihn, aber das ist nun mal die Art und Weise, wie ich das Geld verdiene, um meine Familie zu ernähren, und er muss sich darum eben mal opfern.«
»Lass dein Herz lieber um meinetwillen bluten, denn ich muss ihm diese Neuigkeiten schonend beibringen. Hoffentlich ist sie wenigstens hübsch.«
»Hoffen wir das Beste. Und nun muss ich gehen, drei Leute warten auf mich. Wiedersehen, Liebes.«
Elizabeth angelte nach ihrem Notizbuch und vermerkte das Wichtigste für den morgigen Abend. Ihr machte es nichts aus, Spratts Kollegen und Geschäftsfreunde zu empfangen. Aber Dick würde meutern. Wenn das Mädchen genügend Englisch verstand, konnte er ja in ein Kino mit ihr gehen. Hatte Spratt nicht gesagt, Kessler sei seit zwei oder drei Jahren im Lande? Also würden die Sprachkenntnisse wohl ausreichen. Und vielleicht war sie sogar hübsch. Dann war ja alles in bester Ordnung.
Müßig blätterte sie eine Weile im Kalender. Was für ein Datum hatte man eigentlich, Sonntag, Montag, Dienstag – heute war Montag. Für morgen war sie beim Friseur angemeldet. Sie kritzelte ›Kessler zum Dinner 7.30‹ auf die Seite, hielt plötzlich inne und erstarrte. Jetzt erst hatte sie das Datum richtig erfasst. Dieser Tag –
Sie legte den Kalender nieder, als habe sie sich verbrannt, schob ihn beiseite, damit er ihr aus den Augen kam. Aber das nützte nichts mehr. Sie hatte es vor Augen, unverrückbar und nie zu vergessen. 6. Oktober 1942. Und auch als sie die Augen mit den Händen verdeckte, war es zu spät. Schon hatten sich die Zahlen verschoben. Schon stand ein anderes Datum vor ihr. 6. Oktober 1918.
Sie war glücklidh. Sie lebte ein erfülltes, reiches Leben mit Spratt und den Kindern. Nichts fehlte ihr. Und doch – immer wieder kam eine schwarze Stunde der Verzweiflung. Immer wieder versank sie in vergangenem Gram. Als sei der Schmerz, den sie empfunden hatte, niemals ganz auszulöschen.
Nie zu vergessen, nie zu überwinden.
6. Oktober 1942
6. Oktober 1918
Vierundzwanzig Jahre.
II
Sie hatte den Tag nicht vergessen, nicht in all den Jahren, die vergangen waren. Und nichts, was seitdem geschehen war, konnte ihn aus ihrem Gedächtnis löschen. Es war etwa um diese Stunde am Nachmittag gewesen, die Herbstsonne kam durch die offene Haustür, erhellte den Flur und ließ das gelbe Telegramm, das sie in der Hand hielt, aufleuchten: »... und bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen … Sergeant Arthur Kittredge … gefallen …«
Nein. Ärgerlich versuchte sie, sich aus dem Bann zu befreien. Es lag nicht der geringste Grund vor, sich von dem lang vergangenen Schmerz quälen zu lassen. Sie hatte ihn bekämpft. Und besiegt. Schon vor Jahren. Und ein neues Leben aufgebaut, nachdem es ihr gelungen war, die Vergangenheit zu besiegen. Sie war eine vernünftige Frau und eine glückliche dazu, und es gab nicht den geringsten Grund dafür, warum es immer wieder eine Stunde gab wie diese, in der die alte Pein sie überfiel und ein zitterndes Nervenbündel aus ihr machte, wehrlos und ausgeliefert, so wie jetzt, als sie hier auf der Couch lag, die Augen mit den Händen bedeckend und verzweifelt die Finger gegen die Schläfen pressend, als müsse es ihr so gelingen, diesen jähen Anfall von Schmerz zum Schweigen zu bringen. Aber es half alles nichts. Vernunftgründe halfen nie, sie wusste es schon. Sie hätte ebenso gut mit dem nackten Willen gegen ein Erdbeben ankämpfen können wie gegen diese Wiedergeburt jener entsetzlichen Stunden, als das Furchtbare geschehen war. Oft schon hatte sie gedacht, es würde nicht wiederkommen, diesmal sei es das letzte Mal gewesen. Es verging ein Jahr, oder auch zwei oder drei, und dann auf einmal, aus irgendeinem nebensächlichen Grund, überfiel es sie wieder. Und dann war alles wieder da. Es gab kein Entkommen. Es war, als sei es heute geschehen und nicht vor so langer Zeit.
Ja, so ein Tag war es gewesen, ein kühler, heller Herbsttag, die Blätter an den Bäumen waren schon verfärbt, rot und golden, vor den Häusern in Tulsa flatterten Fahnen im Wind. Elizabeth hatte den Tag im Lager des Roten Kreuzes verbracht, Bandagen aufgerollt, und war nach Hause gekommen, ihren Strickbeutel am Arm. Es war so wenig, was sie tun konnte. Aber wenn es helfen würde, den Krieg zu gewinnen, dass sie Kilometer von Bandagen aufrollte und Sweater strickte, dann wollte sie es gern und unermüdlich tun. Alles wollte sie tun, was mithelfen würde, den Krieg zu verkürzen, und sei es um fünf Minuten, wenn Arthur um diese fünf Minuten früher bei ihr sein würde. Für diese fünf Minuten würde sie all die Jahre hingeben, die sie ohne ihn verbringen musste.
Als sie die Stufen zum Haus hinauflief, sang sie leise vor sich hin. Ein törichtes Lied, aber jedermann sang es damals. »Ich möchte gern den Kaiser sehen, mit einer Lilie in der Hand.« Das kleine Haus lag still in der Sonne, schien sie erfreut willkommen zu heißen. Ein Jahr lang hatte sie hier mit Arthur gewohnt, ehe er Soldat wurde. Jetzt wohnte eine Freundin bei ihr, die während des Krieges bei einer Telefongesellschaft arbeitete.
Als sie die Tür öffnete, folgte ihr die Sonne fröhlich ins Haus. Sie warf den Strickbeutel auf einen Stuhl und schaute eilig nach dem Tisch, wo das Mädchen immer die Post hinlegte. Arthur schrieb häufig, aber die Schiffe von Frankreich kamen nicht regelmäßig, manchmal bekam sie wochenlang keine Nachricht von ihm, dann wieder erwarteten sie gleich mehrere Briefe. Er schrieb wundervolle Briefe. Sie waren heiter und gelassen, trotz all dem Blut und Schmutz der Schützengräben, in denen er lebte. Er schrieb nichts davon, nichts von dem Schrecken des Krieges, dafür schilderte er ausführlich jedes noch so kleine heitere oder amüsante Erlebnis, das ihm widerfahren war, kleine Begebenheiten, die er beobachtet hatte, und nur dann wurde der Ton ernster, wenn er davon sprach, wie sehr er sie vermisste. Einmal hatte sie ihm geschrieben, der Krieg könne doch nicht so harmlos sein, wie er ihn darstelle, und er hatte geantwortet: »Bitte, Elizabeth, verlange nicht von mir, dass ich Dir schreibe, was wirklich geschieht. Wenn ich an Dich schreibe, kann ich es für eine kleine Weile vergessen. Nimm mir dies nicht. Ich liebe Dich so sehr. Hast Du eigentlich keine neuen Bilder von Dir?« Sie schickte ihm Bilder und fragte nie mehr nach dem, was er nicht berichten wollte.
Heute lagen keine Briefe auf dem Tisch, nur ein Telegramm. Sie wunderte sich flüchtig, wer ihr denn eine so dringende Mitteilung zu machen hatte, dass ein Brief nicht genügte, nahm das Telegramm in die Hand und schlitzte es auf. Dann sah sie, es kam vom Kriegsministerium. Die Nachricht war nur kurz. Man teilte ihr mit, dass Arthur tot sei. Nicht, wie es geschehen war noch wo. Dass er an den Wunden gestorben war, die er bei Château-Thierry erhalten hatte, erfuhr sie später durch einen Brief des Roten Kreuzes.
Doch nicht einmal das wenige, was in dem Telegramm stand, wurde ihr klar. Sie stand still, blickte auf das Stück Papier in ihrer Hand, und aller Selbsterhaltungstrieb, der in ihr war, wehrte sich dagegen, zu verstehen. Sie faltete das Telegramm sorgsam zusammen und steckte es in ihre Tasche. Dann rückte sie eine Vase mit Blumen gerade und strich mit ordnender Hand über das Tischtuch. Dann betrachtete sie eine Weile das Titelbild eines Magazins, das dort lag, fand ein Flöckchen Staub auf einem Sessel und wischte es mit der Hand weg. Schließlich nahm sie ihren Strickbeutel und ging langsam die Treppe hinauf in das Schlafzimmer. Die Fenster waren weit geöffnet, und die Sonne füllte den Raum bis in den letzten Winkel. »Wir müssen ein Haus finden«, hatte Arthur gesagt, »wo wir das Schlafzimmer nach Westen legen können. Ich sehe nicht ein, warum man sich den ganzen Sommer lang um vier oder fünf wecken lassen soll. Wenn wir wirklich mal in aller Herrgottsfrühe aufstehen müssen, können wir ja einen Wecker stellen. Aber wenn wir schlafen können, warum sollen wir dann nicht?« Der Gedanke war neu für Elizabeth, aber er leuchtete ihr sofort ein. Arthur hatte vollkommen recht. Es war überhaupt erstaunlich, wie viel Gedanken er sich über die Wohnungsfrage machte. Dabei hatte er keine Ahnung von Architektur. Er war Chemiker und arbeitete bei einer Ölfirma.