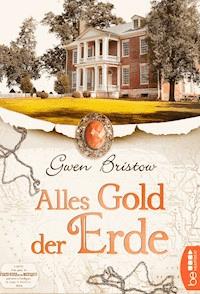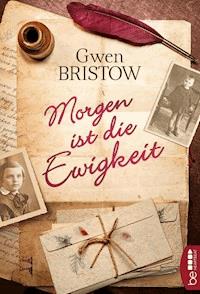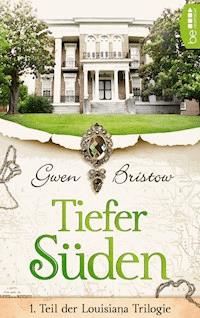
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Louisiana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der erste Teil der Louisiana- Trilogie beginnt mit dem Schicksal von Judith Sheramy und Philip Larne im Jahre 1772. Judiths Vater wurde für seine Verdienste im Kolonialkrieg ein Stück Land im "tiefen Süden", in Louisiana, zugeteilt und die Sheramys wollen hier ein neues Leben beginnen. Auf der Überfahrt trifft Judith auf Philip Larne, einen jungen Abenteurer aus Süd- Carolina und verliebt sich in ihn. Gegen den Willen ihrer Eltern heiratet Judith den jungen Mann und folgt ihm als seine Frau auf eine Indigopflanzung. Für beide beginnt nun der Kampf gegen die Natur, das unerbittliche Tropenklima und die Armut. In unmittelbarer Nachbarschaft hingegen bauen sich Judiths Eltern und ihr Bruder Caleb ihr Gut Silberwald auf und bringen es zu Wohlstand und Ruhm. Fortan kreuzen sich die Wege der beiden Familien stetig und die gesellschaftliche Kluft wird immer größer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Der erste Teil der Louisiana-Trilogie beginnt im Jahre 1772 mit der Geschichte von Judith Sheramy und Philip Larne. Judiths Vater hat für seine Teilnahme am Kolonialkrieg vom englischen König ein Stück Land im »tiefen Süden«, in der Provinz Louisiana, geschenkt bekommen. Auf der Überfahrt lernt Judith den jungen Philip kennen, verliebt sich in ihn und heiratet ihn gegen den Willen ihrer Eltern. Sie folgt ihm auf seine Indigopflanzung, wo beide in einer primitiven Blockhütte den Kampf gegen den Urwald und das feuchtheiße Tropenklima aufnehmen.
Gleichzeitig bauen die Sheramys in der Nachbarschaft ihr Gut Silberwald auf. Fortan kreuzen sich die Wege der beiden Familien immer wieder und die gesellschaftliche Kluft wird stetig größer …
Über die Autorin
Gwen Bristow wurde am 16. September 1903 als Tochter eines Pastors in Marion, South Carolina/USA geboren. Sie besuchte die Pulitzer School für Journalismus und arbeitete als Reporterin. 1929 veröffentlichte sie ihren ersten Roman und wurde durch ihre Südstaaten-Romane weltbekannt. Sie starb 1980.
Gwen Bristow
Tiefer Süden
1. Teil der Louisiana Trilogie
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Karl S. Döhring
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Mohrbooks AG Literary Agency, Zürich
Titel der Originalausgabe »Deep Summer«
Copyright © 1937 by Gwen Bristow
Copyright der deutschen Erstausgabe © 1949 by Franz-Schneekluth-Verlag, Darmstadt
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: allegro | Marzolino | Davor Ratkovic | sniegirova mariia | Aphichart | MaxxDamage
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2773-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
ERSTER TEIL
1.
Die späte Abendsonne warf seidigen Glanz auf die Wellen des Flusses. Am Ufer drangen ihre Strahlen wie goldne Speere durch die Zweige der immergrünen Eichen, und in dem lang herabhängenden graugrünen Spanischen Moos raunte der Wind wie ein leiser Unterton zu den lauten Rufen der Bootsleute.
Während die Männer das Flachboot festmachten, lehnte Judith sich über den Seitenrand und wusch einige Tücher und ein Paar braungelber Nankinghosen ihres Vaters aus. Es war schwer, Kleider im Fluss zu säubern. Wie eifrig man auch reiben mochte, immer hatten sie einen gelblichen Schein, wenn sie getrocknet waren. Welche Erleichterung würde es doch sein, wenn diese lange Reise endlich vorüber wäre und sie sich wieder wie zivilisierte Menschen angesiedelt hätten. Wie wundervoll würde es sein, wieder einen Brunnen mit klarem Wasser und einen großen Herd zum Kochen zu haben!
Die Männer banden das Boot mit Stricken an einem Baum fest, und Judiths Bruder machte sich daran, ein Feuer am Ufer zu entzünden. Ihr Vater schickte die Leute dann fort, um nach Wild Ausschau zu halten.
Das Boot tanzte in der Strömung leicht auf und ab. Judith breitete die Tücher und die Hose auf dem Deck aus, damit sie trocknen sollten, und machte sich selbst zum Abendessen fertig. Sie kämmte das Haar durch, das goldbraun und widerspenstig war wie der Strom, und nachdem sie die Zöpfe aufgesteckt hatte, band sie ein frisches Tuch um die Schultern. Ihre Mutter war schon mit dem Dreifuß an Land gegangen. Judith nahm die Kochtöpfe und folgte ihr.
Die Männer hatten gedörrten Mais, Bohnen und in Streifen geschnittenes getrocknetes Wild ans Ufer gebracht. Judith mischte Mais und Bohnen und schüttete Wasser dazu. Als sie den Topf auf den Dreifuß stellte, hörte sie vom Fluss her eine Stimme.
»Guten Abend, meine Reisegefährten!«
Sie erschrak ein wenig und schaute auf. Ein anderes Flachboot näherte sich der Biegung, und während die fremden Bootsleute es die Strömung hinunterstießen, winkte der Eigentümer nach dem Ufer. Er war groß und breitschultrig. Die Sonne hatte sein frisches Gesicht gebräunt bis auf eine Stelle, an der eine Narbe wie eine schmale weiße Linie über seine linke Wange lief. Er trug einen Rock aus weinroter Atlasseide und Silberschnallen an den Knien und den Schuhen, und seine seidenen Strümpfe schimmerten im Sonnenlicht. Judith starrte ihn verwundert an. Sie hatten während ihrer Fahrt den Mississippi herunter andere Siedler getroffen, aber noch keinen, der in so vornehmer Kleidung reiste wie dieser Mann.
»Guten Abend!«, rief Judiths Vater vom Ufer zurück und verbeugte sich höflich, aber ein wenig nachlässig. Allem Anschein nach hielt er nicht viel von einem Mann, der in so herausfordernd eleganter Aufmachung in die Wildnis hinauszog.
Der Fremde kam darüber nicht in Verlegenheit. Er grinste nur. Sein langes Haar, das mit einem schwarzen Seidenband zurückgehalten wurde, leuchtete in der Sonne rotgolden auf.
»Wollen Sie sich in Louisiana niederlassen?«, rief er.
»Ja.«
»Gut. Ich auch. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Philip Larne zu Ihren Diensten.«
»Meine Empfehlungen, Mr. Larne. Mein Name ist Mark Sheramy. Dies sind meine Frau, mein Sohn Caleb und meine Tochter Judith.«
»Darf ich Ihnen allen meine Hochachtung ausdrücken? Ich nehme an, dass wir uns wiedertreffen werden.«
Mark Sheramy verneigte sich wieder. Der junge Mr. Larne berührte die Stirn, als ob er den Hut abnehmen wollte, aber da er keinen trug, machte die Bewegung den Eindruck, als ob er die anderen freundlich entließe. Sein Flachboot hatte die Biegung des Stromes erreicht, wo ein Dickicht von Schilf weit ins Wasser vorsprang. Mr. Larne sah jetzt Judith an und lächelte. Sein Blick wich nicht von ihr, bis sein Boot hinter dem Gestrüpp am Ufer verschwand.
Judith fühlte, dass ihr ein Schauer über den Rücken lief. Unruhig sah sie zu ihren Eltern hinüber, ob sie diese unverfrorene Aufmerksamkeit beobachtet hätten. Aber ihr Vater legte Holzscheite aufs Feuer, und ihre Mutter war eifrig damit beschäftigt, die Waldhühner zu rupfen und vorzubereiten, die von den Bootsleuten im Walde geschossen worden waren. Judith holte einen Topf Wasser und fragte sich, ob Mr. Larne sie wohl so angesehen hatte, weil er sie für schön hielt.
Sie war fünfzehn und alt genug, um hübsch aussehen zu wollen. Aber ihr Vater sagte, sie wäre noch zu jung, als dass sie Schmuck tragen könnte, und da sie niemals einen Spiegel gesehen hatte, der größer war als eine Hand, konnte sie sich kaum ein Urteil über ihre äußere Erscheinung bilden. Sie wusste, dass ihre Augen eine bräunlich goldene Farbe hatten wie ihr Haar und dass ihre Haut rein, wenn auch zu stark von der Sonne gebräunt war. Wenn sie aber auf ihr graues Baumwollkleid und das einfache Schultertuch sah, wollte sie kaum glauben, dass ein vornehmer Herr in Seide und Silber sie bewundernd anschauen könnte. Missbilligend betrachtete sie die nussbraunen Anzüge, die Caleb und ihr Vater trugen. Daheim in Connecticut hatten sie sehr ordentlich und sauber ausgesehen. Aber zu Hause kleideten sich alle anständigen Farmer in dieser Art und machten nur eine Ausnahme, wenn sie zu einer Versammlung oder an Feiertagen zum Markt ritten. Woher mochte Mr. Larne nur kommen?
»Mutter«, sagte sie plötzlich.
Mrs. Sheramy sah von ihren Waldhühnern auf. »Ja, mein Kind?«
»Dieser Mr. Larne reist – so ganz allein. Vielleicht hat er uns nur angesprochen, weil er sich einsam fühlt. Er hat sein Boot an der anderen Seite des Dickichts am Ufer festgemacht. Wäre es nicht nett, wenn wir ihn zum Abendessen einladen würden?«
»Ja – vielleicht«, erwiderte Mrs. Sheramy nach kurzem Zögern. Dann wandte sie sich an ihren Mann. »Wie denkst du darüber, Mark?«
Er lehnte sich auf sein Gewehr.
»Ich weiß nicht recht«, entgegnete er langsam. »Mir kommt es nicht so vor, als ob er gute Gesellschaft für uns wäre.«
»Aber Vater!«, rief Judith. »Er sieht doch wie ein Lord aus!«
Mark lächelte leicht. »Eher wie ein eleganter Taugenichts! Ich kenne diese Art Menschen. Die treiben sich in den Kolonien herum und machen sparsamen Leuten wie uns, die sich ein neues Heim gründen wollen und in der Furcht Gottes leben, nur Unannehmlichkeiten.«
Judith steckte den Löffel in das Gericht aus Bohnen und Mais. »Es ist wirklich unchristlich von dir, dass du so schlecht über einen Mann denkst, nur weil er fein angezogen ist.«
»Judith!«, sagte ihr Vater.
»Es tut mir leid.« Sie biss sich auf die Lippe, aber dann war sie freudig erstaunt, als sie hörte, was ihre Mutter sprach.
»Immerhin, Mark, wenn der arme Mann den ganzen Fluss herunter nur die Kost dieser rauen Bootsleute gehabt hat, muss er sich nach einer Mahlzeit sehnen, die eine Frau zubereitet hat. Warum sollen wir ihn nicht zum Essen einladen?«
Mark zuckte die Schultern.
»Nun gut. Geh hinüber, Judith, und lade ihn ein.«
»Jawohl, Vater.« Sie machte sich sofort auf und bahnte sich einen Weg durch das Schilfrohr. Die Sonne stand schon tief, aber als Judith die Halme beiseitebog, glänzten sie noch schwach in den letzten Strahlen auf. Jenseits des Dickichts blieb das Mädchen stehen. Plötzlich wurde sie ängstlich und scheu. Philip Larne saß auf einer gebogenen Baumwurzel. Er hatte das Gewehr quer über die Knie gelegt und hielt nach Wildenten Ausschau, während seine Bootsleute ein Feuer anzündeten. Judith hatte das Gefühl, dass sie die Zunge nicht mehr bewegen konnte. Dieser Mann gehörte einer Welt an, die sie nicht kannte, und ihn zum Abendessen einzuladen, erschien ihr wie ein großes Kunststück. Dazu musste man die Gewandtheit besitzen, die man sich nur bei Hofe oder im Ballsaal aneignen konnte. Sie hätte sich lautlos wieder fortgestohlen, wenn er sie nicht gerade in dem Augenblick bemerkt hätte. Sofort sprang er auf und lehnte sein Gewehr gegen einen Baum.
»Oh, die entzückende junge Dame, die ich eben kennengelernt habe!«, begrüßte er sie.
Dann trat er näher und küsste ihr die Hand. Das hatte vorher noch niemand getan. Verwirrt und verlegen machte sie einen Knicks.
»Ich – ich bitte Sie um Verzeihung, aber meine Mutter – meine Mutter schickt ihre besten Empfehlungen – und möchte wissen, ob Sie heute mit uns zu Abend essen wollen.«
Philip Larnes blaue Augen musterten sie von oben bis unten, und obwohl er liebenswürdig antwortete, spielte doch ein belustigtes Lächeln um seine Lippen.
»Ich fühle mich sehr geehrt, Madame.«
»Dann – dann wollen Sie also kommen, Mr. Larne?«, fragte sie befangen, während sie langsam nach dem Dickicht zurückging.
Er lachte. »Warten Sie doch einen Augenblick!«, rief er und fasste sie am Arm, damit sie nicht fortlaufen konnte. »Sie zittern ja, Miss Sheramy! Halten Sie mich denn für einen Indianer, der Ihnen den Skalp rauben will?«
»Nein – natürlich nicht – aber –« Sie zögerte. Er sprach jedoch so herzlich und freundlich, dass sie auch lachte, bevor sie es selbst wusste. »Ich bin nicht sehr an Fremde gewöhnt«, gestand sie.
»Dann ist es aber hohe Zeit, dass sich das ändert. Sie ziehen doch in ein ganz neues Land! Kommen Sie her, setzen Sie sich und plaudern Sie ein wenig mit mir.«
Judith trat einen Schritt zurück. »Aber ich dachte, Sie wollten mit mir kommen!«
»Das würde ich zu gerne tun. Aber –« Die letzten Sonnenstrahlen fielen auf seine rotseidenen Schultern, während er sich umwandte und einen Blick nach dem Fluss warf, wo sein Boot angebunden war. Es war größer als die meisten Flachboote, nahezu achtzehn Meter lang, und hatte ein schmales Deck und eine sehr große Kabine, deren kleine Fenster dicht geschlossen waren. Er musste wohl viele Haushaltungsgegenstände mit sich führen, dass er so viel Platz brauchte, um sie unterzubringen. Das war sonderbar, denn man konnte doch kaum erwarten, dass ein Mann sich Hausgeräte anschaffte, ehe er wirklich einen Haushalt hatte. Allem Anschein nach hatte er keine Familie auf seinem Flachboot. »Ich kann mein Fahrzeug nicht unbewacht zurücklassen«, erklärte er ihr.
»Aber Ihre Bootsleute können doch aufpassen!«, wandte sie ein. »Die haben auch Gewehre!«
Er zwinkerte ihr zu. »Sie sind treu und ergeben, solange ich sie beaufsichtige. Aber ich würde keiner Bootsmannschaft trauen, wenn es sich um eine kostbare Ladung handelt.«
»Eine kostbare Ladung?«, wiederholte sie. »Dann sind Sie also ein Kaufmann? Sie bringen Ihre Waren den Strom hinunter?«
Er zuckte leicht zusammen, und der Griff seiner Finger wurde härter. »Was sollte ich denn Ihrer Meinung nach auf dem Boot haben?«
»Nun – Pflüge und Stühle und Spinnräder, so wie wir«, antwortete sie überrascht. Aber als er sie nicht losließ, wurde sie ärgerlich. »Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht«, sagte sie kurz, »und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nicht wie ein Polizist am Arm packten!«
»Verzeihen Sie mir! Ich hatte ganz vergessen, dass ich Ihren Arm hielt.« Er lächelte sie an, als er sie freigab. »Ich muss allerdings gestehen, dass ich weder einen Pflug noch einen Stuhl oder ein Spinnrad besitze. Ich habe nur –« Er zögerte eine Sekunde. Dann fügte er hinzu: »Ware.«
Judith senkte beschämt den Blick, weil sie ihn so grob angefahren hatte. Aber sie wunderte sich trotzdem über seine ausweichende Antwort. Warum hatte er nicht einfach gesagt: »Flachs« oder »Whisky« oder was es sonst sein mochte?
Eifrig und mit gewinnender Liebenswürdigkeit sprach er weiter. »Ich darf mein Boot nicht allein lassen. Aber ich habe mich so einsam gefühlt auf diesem endlosen Strom – warum wollen Sie nicht bleiben und mit mir zusammen zu Abend essen?« Er nahm ihre Hand und zog sie zum Feuer hin. »Ja, Sie müssen bleiben.«
»Aber das kann ich doch nicht!« Sie blieb auf halbem Wege stehen. »Was in aller Welt sollte ich meinem Vater sagen?«
»Sagen Sie ihm«, Philip lachte, »sagen Sie ihm, dass ich Ihnen Kuchen aus Honig und Reismehl angeboten habe, und Apfelsinen mit einer Soße aus Sirup und Zimt und getrocknete Feigen von der Gullahküste –«
Ohne dass Judith wusste, wie es gekommen war, saß sie auf der krummen Baumwurzel. »Die Gullahküste – wo in aller Welt ist die denn?«
»An der unteren Grenze von South Carolina.«
»Kommen Sie von dort?«
Er nickte, streckte sich zu ihren Füßen im Gras aus und stützte den Kopf auf einen Ellbogen.
»Und Sie? Aus Neuengland?«
»Ja, aus Connecticut. Woher wussten Sie das?«
»Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass Ihre Augen die Farbe von Champagner haben?«, sagte er, statt ihr Antwort zu geben.
Judith fühlte, dass sie rot wurde. »Nein, niemand hat so etwas gesagt. Was ist denn Champagner?«
»Schäumender Wein, den sie in Frankreich machen.«
»Waren Sie in Frankreich?«, fragte sie erstaunt.
»Ja. Trinkt man denn in Connecticut keinen Champagner?«
»Ich weiß es nicht. In unserer Gegend jedenfalls nicht. Waren Sie noch nie in Connecticut?«
»Kurze Zeit war ich einmal dort. Während des Krieges zwischen den Franzosen und den Indianern.«
»Ach, waren Sie auch im Krieg?«, rief sie dankbar. Sie freute sich, dass er ein Soldat des Königs gewesen war. Nun würde ihr Vater vielleicht besser über ihn denken, denn Mark war auch im Kriege gewesen.
»Natürlich«, erwiderte Philip. »Ich habe unter General Braddock und dem jungen Mr. Washington von Virginia gedient.« Es lag ein heiterer Ton in seiner Stimme.
»Dann kommen Sie also mit einem königlichen Landbrief herunter?«, fragte sie, beglückt, dass er ein verantwortungsbewusster Bürger und nicht ein eleganter Tunichtgut war, wie ihr Vater dachte.
Er lachte laut auf. »Selbstverständlich! Wollen Sie das Schreiben sehen?«
Er zog ein großes, versiegeltes Dokument aus seinem gekräuselten Hemd. Darin wurde allen, die es wissen wollten, bekannt gegeben, dass Seine Majestät König Georg III. seinem Untertanen Philip Larne als Belohnung für dessen Dienste im Kolonialkrieg gegen die Franzosen dreitausend Acker auf dem östlichen Ufer des Mississippistromes in dem Lande Louisiana in der Unterprovinz Westflorida schenkte, die durch den Friedensvertrag an England abgetreten worden war. Ausgefertigt durch die Abgesandten des Königs in der Stadt Charleston in der Kolonie Südkarolina am 12. Januar im Jahr der Gnade 1772.
Sie gab ihm den Bogen zurück.
»Ja, mein Vater hat auch einen solchen Landbrief. Er wartete noch lange nach dem Kriege, bis er sich darum bewarb, weil er Neuengland nicht verlassen wollte.«
Philip setzte sich auf und legte die Arme um die Knie.
»Ich wundere mich auch, dass er seinen Wohnsitz verlassen hat. Er sieht nicht aus wie ein Mann, der gerne umherzieht.«
»Das tut er auch nicht. Aber drei Jahre hintereinander hatten wir Missernten, und im letzten Winter war es so bitter kalt, dass die Hälfte unserer Kühe umkam. Und alle Leute in unserer Gegend sprachen über die neue englische Niederlassung in Louisiana. Männer, die nicht im Kriege gewesen waren, sagten meinem Vater, sie beneideten ihn, weil er hier freies Land erhalten würde. Er bekam auch einen Brief von Mr. Walter Purcell, einem jungen Mann, der unseren Ort vor fünf Jahren verlassen hatte und auch im Besitz eines königlichen Landbriefes war. Der schrieb ihm, Louisiana wäre ein so fruchtbares Land, dass man in den besten Gegenden vier Ernten im Jahr erzielen könnte.«
»Glauben Sie, dass Ihnen das Land gefallen wird?«, fragte Philip lächelnd.
»Ich – ich denke schon«, erwiderte sie, aber ihre Worte klangen unsicher und zweifelnd. Ihr Blick schweifte über den Wald und den trägen Fluss, dessen kleine Wellen im letzten Abendlicht rötlich erschienen. »Aber es ist so sonderbar fremd hier. Fast kommt es mir verzaubert vor mit all den Palmen und dem Spanischen Moos, das von den Bäumen niederhängt. Und das Land ist so flach. Vielleicht geht es Ihnen anders«, fügte sie scheu hinzu. »Sie sind ein weit gereister Mann. Aber ich – ich bin niemals aus unserem Ort hinausgekommen, bis wir im letzten Winter von dort fortzogen.«
»Und Sie dachten, die ganze Welt sähe so aus wie Neuengland?«, fragte Philip freundlich.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich eigentlich dachte. Aber jetzt weiß ich es besser. Ich fühle –«
»Was fühlen Sie?«, fragte er, als sie zögerte.
»Es ist mir, als ob ich viel älter wäre seit unserer Abreise. Hatten Sie nicht dasselbe Gefühl, als Sie nach Frankreich gingen?«
Philip lachte leicht, und sie erschrak über sich selbst, dass sie so zutraulich zu einem Fremden sprach. Aber er hatte so interessiert zugehört. Nun kniete Philip vor ihr und legte seine Hände auf die ihren.
»Sie sind das lieblichste Kind, das ich je in meinem Leben sah. Aber in Wirklichkeit sind Sie doch gar kein Kind mehr?«
»Ich bin fünfzehn. Vater nennt mich immer noch ein Kind.«
»Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie sind eine äußerst bezaubernde junge Dame.«
Sie hielt den Atem an.
»Hat Ihnen das noch nie ein anderer Mann gesagt?«
Judith schaute auf seine Hände nieder, die auf den ihren ruhten. Es war plötzlich so dunkel geworden, dass sie seine Finger kaum noch sehen konnte.
»Sie werden mich für ein schrecklich einfältiges Landmädchen halten, aber ich bin noch nie in meinem Leben mit einem jungen Mann allein gewesen.«
»Um Himmels willen«, sagte Philip leise.
»Und ich bin davon überzeugt, dass mein Vater gleich kommen und mich hinüberholen wird. Deshalb ist es besser, wenn ich jetzt –«
Ein heiseres Bellen ertönte aus dem Wald.
Es war nur kurz und klang schrecklich. Judith sprang mit einem Schrei auf. Philip griff nach seinem Gewehr. Die Bootsleute ließen die Kochtöpfe fallen, packten ihre Flinten und stürzten in das Dickicht. Judith sah dort zwei Augen, die aus dem Dunkel unter den Bäumen aufglühten. Sie schimmerten grünlich und leuchteten wie die einer Katze, nur waren sie viel größer und schienen einem Gespenst zu gehören, das keinen Körper hatte. Ein Schuss fiel, dem sofort ein zweiter folgte. Die Augen verschwanden. Sie fühlte, dass Philip den Arm um ihre Schultern legte.
»Fürchten Sie sich nicht! Es ist alles in Ordnung!«, sagte er.
»Was – was war das?«, fragte sie entsetzt.
»Ein Panther. Die Leute werden sich um ihn kümmern.«
»Sind Sie auch sicher, dass das Tier tot ist?«
»Ja, bestimmt«, versicherte er. Aber sie hörte nicht, was er sonst noch sagte. Erschreckt drehte sie sich nach dem Fluss um, wo sich neuer Lärm erhob.
In dem Boot war es plötzlich lebendig geworden. Aus der Kabine drangen laute Rufe und klatschende Geräusche, als ob wilde Tiere unruhig geworden wären und die Wände ihres Käfigs sprengen wollten.
»Bleiben Sie, wo Sie sind!«, rief Philip und eilte zum Boot. Aber sie lief hinter ihm her, da sie sich fürchtete, allein zurückzubleiben. Er sprang auf das Deck und riss eins der kleinen Fenster auf. Sie sah im Innern starke Holzstangen und ein schwaches Licht im Hintergrund.
Philip brüllte durch das Gitter und verlangte Ruhe. Als sie ihn erreichte, schlug er heftig den Fensterladen zu, aber doch nicht schnell genug, als dass sie nicht noch einen Blick ins Innere hätte werfen können. Betroffen stieß sie einen Schrei aus, als sie sah, woraus die Ladung bestand.
Er wandte sich zu ihr um. Sie standen so dicht nebeneinander, dass sie seinen Gesichtsausdruck erkennen konnte. Er lächelte herausfordernd und doch auch wieder beruhigend.
»Sind Sie so erstaunt, dass ich mit Sklaven handle?«
Sie drehte die Enden ihres Tuches ineinander.
»Nein, eigentlich nicht«, erwiderte sie unsicher. »Wir haben schon verschiedene Sklavenhändler auf dem Fluss gesehen.«
Aber sie wandte sich nach der Laufplanke, die von dem Deck ans Ufer führte. Er folgte ihr und fasste sie an der Schulter.
»Warum gehen Sie denn dann sofort? Gibt es denn in Connecticut keine Sklaven?«
Sie blieb stehen. »Doch, natürlich gibt es dort Sklaven. Nicht viele – sie sind im Winter nicht zu gebrauchen – wir haben niemals welche gehabt.« Sie war immer noch verwirrt. Andere Sklavenhändler, die sie beobachtet hatte, hielten ihre Schwarzen nicht so abgesperrt. Mit diesem großen Boot stimmte etwas nicht. Im nächsten Augenblick erkannte sie mit Schrecken, was es war.
Sie zuckte zurück. »Lassen Sie mich gehen!«, rief sie. »Sie sind ein Schmuggler – ein Pirat – lassen Sie mich fort!«
Er lachte über diesen heftigen Ausbruch. »Sehe ich denn wirklich wie ein Pirat aus?«
»Ich weiß nicht, wie solche Seeräuber aussehen, aber hätten Sie die Sklaven nicht gestohlen, so hätten Sie Kaufbriefe, und wenn Sie die besäßen, wären Sie nicht so darauf bedacht, dass niemand sieht, was Sie auf Ihrem Boot haben. Lassen Sie mich gehen, sage ich Ihnen!«
Sie begann zu weinen. Sie hatte schon haarsträubende Geschichten von Schmugglern auf dem Mississippi gehört, die anderen die Kehle durchschnitten, nur um ihnen die Bootsladung zu rauben. Aber eigentlich weinte sie nicht, weil sie sich fürchtete, sondern weil sie sich bitter enttäuscht fühlte. Er war so nett und liebenswürdig gewesen.
»Seien Sie doch nicht unvernünftig«, sagte Philip.
Aber Judith bedeckte das Gesicht mit den Händen und schluchzte hilflos. Plötzlich hörte sie die Stimme ihres Vaters vom Ufer.
»Judith! Mr. Larne! Was für Schüsse waren das?«
Sie trat einen Schritt zurück und drückte sich gegen die Wand der Kabine, während sie die Augen mit ihrem Tuch trocknete. Philip ging zum Ufer hinunter.
»Es tut mir leid, dass Sie gestört wurden, Mr. Sheramy«, hörte sie ihn sagen. Er sprach so ruhig, als ob nichts geschehen sei, und doch hatte er sich eben selbst als Verbrecher entlarvt. »Meine Leute haben nur einen Panther erlegt. Die junge Dame hat sich gefürchtet und ist auf das Boot gelaufen. Einen Augenblick, ich werde ihr herunterhelfen.«
Er kam zu ihr zurück, und während er ihren Arm nahm, sagte er laut: »Es ist jetzt sicher für Sie, Miss Sheramy. Sie können mit Ihrem Vater durch das Gebüsch zurückgehen.« Aber als sie nach der Planke gingen, fügte er leise hinzu: »Hören Sie auf zu weinen, Sie kleiner Dickkopf! Wollen Sie denn, dass ich gehängt werde?«
Judith blieb stehen. In der Dunkelheit konnte sie die Gestalt ihres Vaters am Ufer nur undeutlich erkennen, aber Philip fühlte sie wirklich und warm neben sich. Sie schaute auf, und er lächelte wieder, leicht spöttisch und doch so zärtlich.
»Ich weine nicht«, flüsterte sie. »Und ich werde auch nichts sagen. Das verspreche ich.«
»Ich danke Ihnen.« Philips Stimme klang so leise, dass Judith sie kaum hören konnte.
Es blieb keine Zeit, noch mehr zu sagen. Er führte sie zu der Stelle, wo ihr Vater wartete, und verneigte sich tief.
»Bringen Sie Ihrer Frau meine besten Empfehlungen und Komplimente und sagen Sie ihr, wie leid es mir tut, dass ich Ihre Einladung nicht annehmen kann. Die Schwierigkeiten der Reise machen es unmöglich. Gute Nacht!«
Er drückte Judiths Hand schnell, bevor er sie losließ.
Die Sonne spiegelte sich in dem goldglänzenden Strom, und auf beiden Ufern zogen sich üppig blühende Orangenhaine hin. Es sah aus, als ob meilenweit weiße Spitzen über die Bäume gebreitet wären. Ein Duft von schwerer Süße hing über dem Land.
Judith saß neben Philip am Ufer und lauschte auf seine Worte. Seit ihrer ersten Unterhaltung waren sieben Tage vergangen, und immer fand Philip eine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, wenn die Boote haltgemacht hatten. Zuerst hatte sie ihm gesagt, dass sie mit einem Sklavenschmuggler nicht reden wollte, aber es war schwer, ihm etwas abzuschlagen, wenn er mit seinem bezaubernden Lächeln darum bat. Sie hatte ein böses Gewissen, aber sie hörte ihm begeistert zu.
»... Und dann kletterte Bonylegs immer höher den Mast hinauf. Er hatte ein blankes Messer zwischen den Zähnen und zwei Pistolen im Gürtel, und ich dachte, es wäre um mich geschehen. Jetzt noch kann ich dieses Messer sehen, das auf beiden Seiten scharf geschliffen war, und die Zahnlücke über der Schneide –«
»Ja – und was geschah dann?«
»Ich verfeuerte meine letzte Kugel, Judith, und die Hand des Herrn lenkte den Schuss direkt in die Brust meines Feindes, denn meine eigene Hand zitterte so sehr, dass ich kaum die Pistole halten konnte. Und Bonylegs fiel herunter wie eine Sternschnuppe!«
»Wie Luzifer!«, rief sie.
»Wer?«
»Luzifer – in der Bibel.«
»Ach ja – natürlich. – Nachher wurden wir mit der Schiffsbesatzung bald fertig. Nun hatten wir sein Schiff erobert. Es war voll von Sklaven, Seidenballen und Silber, das er von englischen Schiffen geraubt hatte –«
»Was haben Sie mit den Leuten gemacht?«, fragte sie atemlos.
»Die haben wir selbstverständlich mitgenommen, liebe Judith. Und es ist mein Anteil an den Sklaven und Schätzen, die ich in dem Boot den Strom hinunterbringe.«
»Aber Philip«, widersprach sie entsetzt, »die gehören doch nicht Ihnen!«
»Nun gut, liebe Judith, aber Bonylegs gehörten sie auch nicht.« Er lachte leise. »Wir schafften ihn beiseite und befreiten das Meer von einem bösen Seeräuber. Glauben Sie nicht, dass wir dafür eine Belohnung verdienten?«
»Aber gibt es denn nicht ein Gesetz über Piratenschiffe? Ich weiß doch, dass die Beute an den königlichen Gouverneur abgeliefert werden muss und dass er eine Belohnung dafür gibt.«
»Möglich. Davon weiß ich nichts«, antwortete er belustigt. »Aber der königliche Gouverneur hat nicht die Gefahr ausgestanden, dass Bonylegs ihm den Dolch zwischen die Rippen stoßen konnte. Verstehen Sie denn nicht?«, rief er. »Ich wollte nach Louisiana, aber ich konnte doch nicht nur mit meinen beiden Händen hierherkommen und allein das Dickicht abholzen!«
»Ich – nein, ich verstehe es wohl nicht«, gab Judith zweifelnd zu. Sie erhob sich und hielt die Schürze zusammen, in der sie Brennholz gesammelt hatte. »Meine Leute werden mich vermissen, Philip, ich muss jetzt gehen.«
»Warum laden Sie mich denn nicht noch einmal zum Essen ein?« Philip stand auch auf. »Wenn ich es vorher wüsste, würde ich mein Boot in eurer Nähe verankern, und wir könnten beide Fahrzeuge im Auge behalten, während wir essen.«
»Ja –« Sie schälte ein Stück Rinde von einem Zweig ab. »Ich fürchte, mein Vater hält nicht viel von Ihnen, Philip. Er sagte meiner Mutter, sie sollte Sie nicht wieder einladen. Er – er meinte, dass Sie keinen guten Einfluss auf Caleb und mich hätten.«
Philip lachte. »Einen so starrsinnigen jungen Mann wie Ihren Bruder könnte ich wohl kaum beeinflussen. Und was Sie betrifft, meine liebe Judith –«
»Ich muss jetzt wirklich gehen«, erwiderte sie hastig und eilte durch das Gebüsch davon.
Während sie das Feuer schürte, dachte sie an Philips letzte Worte. Ach ja, er hatte großen Einfluss auf sie – gefährlichen Einfluss. Sie kümmerte sich nicht um die Wünsche ihres Vaters und lauschte heimlich den Geschichten, die Philip ihr von Plünderungen, Raub und blutigen Abenteuern erzählte. Und sie empfand immer weniger Abscheu davor. Wenn ihr noch vor einer Woche jemand gesagt hätte, dass sie sich von einem so schlechten Menschen bezaubern ließe! Obwohl Philip ihr wahrscheinlich noch lange nicht alles von seiner schrecklichen Vergangenheit berichtet hatte, wusste sie bereits, dass er einen sündigen Charakter hatte und sich weder um den Segen des Himmels noch um die Verdammnis der Hölle kümmerte. Aber sie sagte nichts dagegen und ermahnte ihn nicht zum Guten, denn wenn sie bei ihm war, vergaß sie, dass Männer und Frauen nur auf der Erde lebten, um ihre unsterbliche Seele auf die Ewigkeit vorzubereiten. Sie vergaß alles und sah nur, wie schön er trotz der langen Narbe im Gesicht aussah und wie einsam und trostlos ihr Leben gewesen war, bevor sie ihn getroffen hatte.
Judith nahm das Wildbret vom Feuer und rief den Männern zu, dass das Essen fertig wäre. Ihr Vater füllte seine Schale und winkte das Mädchen zu sich.
»Hast du vor Kurzem mit Mr. Larne gesprochen?«, fragte er, als sie auf dem Gras saß.
Sie senkte den Blick. »Ja, Vater.«
»Ich dachte, ich hätte eure Stimmen gehört«, fuhr Mark ernst fort. »Judith, du darfst ihm nicht erlauben, dass er mit dir spricht, wenn du allein bist. Wir wissen nichts von ihm.«
»Doch, Vater, wir wissen etwas«, widersprach sie. »Ich meine – er hat mir erzählt, dass sein Vater eine Reispflanzung an der Küste von Karolina hatte.«
Mark zuckte die Schultern. »Die Leute dort sind eine leichtfertige Gesellschaft, soviel ich gehört habe. Sie lesen atheistische französische Bücher und glauben nicht an das Wort Gottes.«
»Er hat mir doch aber gesagt, dass er in England zur Schule ging«, verteidigte ihn Judith. »Und später haben sie ihn nach Paris geschickt, damit er lernen sollte, wie man sich höflich unterhält –«
»Hm. Junge Leute lernen in Paris wahrscheinlich noch ein gut Teil mehr, als sich höflich zu unterhalten.«
»Aber Mark!«, mischte sich Mrs. Sheramy ein. »Das Kind ist doch erst fünfzehn Jahre alt!«
Er antwortete nicht darauf, und sie aßen schweigend weiter. Judith beobachtete die glitzernden Wellen auf dem Strom und überlegte, was ihr Vater wohl gemeint haben mochte. Sie wusste es nicht, wenn er nicht noch etwas anderes über die gotteslästerlichen Bücher hatte sagen wollen.
Als die Bootsleute ihre Mahlzeit beendet hatten, ging sie zu einer flachen Stelle am Ufer, wo der Fluss eine kleine Bucht bildete, und wusch die Schüsseln aus. Als sie die Gefäße ins Wasser steckte, fiel etwas Kaltes auf ihren Nacken und rutschte dann in ihr Tuch.
Der Topf entglitt ihrer Hand und fiel klatschend ins Wasser. In dem Gebüsch dicht neben ihr stand Philip und lächelte sie mutwillig und herausfordernd an. »Es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.« Er bückte sich schnell, um den Topf aus dem Wasser zu retten.
Judith richtete sich auf und ließ sich auf die Fersen nieder, während sie die Hände verschränkte.
»Bitte, gehen Sie fort. Mein Vater hat gesagt, ich soll nicht mit Ihnen sprechen.«
»Das dachte ich mir schon.« Er setzte sich kühn und ruhig neben sie.
Judith warf einen Blick über die Schulter, aber das Gebüsch verdeckte sie, sodass die anderen sie nicht sehen konnten. »Was haben Sie in mein Tuch fallen lassen?«, fragte sie und schämte sich, weil es zwischen ihren Brüsten verborgen lag.
»Ein kleines Geschenk, das ich Ihnen geben wollte, seit ich Sie zum ersten Mal sah. Betrachten Sie es doch einmal, ob es Ihnen gefällt.«
Sie zog die dünne goldene Kette, die mit Edelsteinen besetzt war, aus dem Ausschnitt. »Ach, Philip«, rief sie, »wie schön! Was ist das?«
»Es sind Topase. Ich habe außer Ihnen noch keine Frau gesehen, die topasfarbene Augen hat.«
Judith sah, wie die Steine im Sonnenlicht aufglühten. Sie konnte es kaum glauben, dass ihre Augen so golden strahlen sollten wie diese Steine. Aber dann fühlte sie plötzlich schwere Gewissensbisse.
»Philip, haben Sie das auch ehrlich erworben?«
»Ich fürchte, nein, wenn Sie mich genau danach fragen«, entgegnete er lachend. »Aber deshalb ist der Schmuck nicht weniger schön. Bitte, nehmen Sie ihn an, Judith! Ich werde nie wieder ein Schiff ausrauben, solange ich lebe. Ich will ein ebenso ehrlicher Farmer und Pflanzer werden, wie nur jemals einer nach Louisiana kam.«
Plötzlich zog er sie so fest an sich, dass es schmerzte, und bedeckte ihre Lippen mit Küssen. Judith hatte früher manchmal darüber nachgedacht, wie es sein müsste, von einem Mann geküsst zu werden. Sie hatte immer geglaubt, es müsste sehr peinlich sein. Aber jetzt empfand sie es als das Schönste und Herrlichste, was sie je erlebt hatte. Nachdem sie sich diesem Gefühl einen Augenblick überlassen hatte, stieß sie ihn von sich.
»Tu das nicht!«, rief sie. »Du bist ein Seeräuber – ein Dieb – ein Mörder –«
Philip wich zurück, als ob er sie nicht wieder anrühren wollte. Er lächelte nicht mehr belustigt, sondern sehr zärtlich und liebevoll. »Ja, das stimmt wohl. Aber du wirst nie wieder jemand finden, der dich so heiß liebt wie ich.«
Tränen traten in ihre Augen.
»Du liebes Mädchen«, sagte er, nahm ihre Hände in die seinen und ließ die Topaskette in ihre Finger gleiten. »Liebst du mich denn nicht auch?«, fragte er leise.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte sie gebrochen. »Ich weiß nur das eine – wenn ich es tue, ist es Sünde. Du hast so viel Schreckliches getan — du musst alle Zehn Gebote gebrochen haben –«
»Ja, jedes einzelne«, entgegnete er sofort. »Und ich will sie wieder alle zehn brechen um deinetwillen, oder ich will sie um deinetwillen halten, was bedeutend schwerer ist. Darf ich dir nicht einmal alles von Anfang an erzählen, Judith?«
Sie setzten sich nebeneinander ins Gras. Wenn Gott einen so schönen und herrlichen Menschen wie Philip Larne erschaffen konnte und ihn später zur Hölle verdammte, wäre das eine üble Verschwendung, dachte Judith.
»Liebste Judith, ich möchte dich doch heiraten. Es ist sonderbar – ich habe nie geglaubt, dass ich einmal den Wunsch haben könnte, jemand zu heiraten. Darf ich fortfahren?«
Sie nickte.
Philip legte den Arm um die Knie.
»Judith, ich bin ein nichtsnutziger jüngerer Sohn. Aber wenn man ein nachgeborener Sohn an der Gullahküste ist, kann man kaum etwas anderes sein als nichtsnutzig. Man kann entweder Geistlicher, Offizier oder Richter werden, und wenn einem das alles nicht gefällt, ist man zur Untätigkeit verdammt. Solange ich zurückdenken kann, wollte ich Pflanzer werden, aber die große Farm ging auf meinen älteren Bruder über. Nach dem Tode meines Vaters hatte ich stets Streit mit meinem Bruder. Da ich nichts zu tun hatte, trank ich viel und spielte auch mehr, als gut war, sodass alle Leute sich über mich ärgerten. Schließlich kaufte er mir eine Offiziersstelle in der Armee und schickte mich fort, damit ich gegen die Franzosen kämpfen sollte.«
Judith sah auf den Strom hinaus. Das Wasser war dunkelgelb wie die Topase, die sie in der Hand hielt.
»Zuerst gefiel mir der Krieg«, fuhr Philip fort, »aber mit der Zeit wurde mir auch das langweilig, und als die Feindseligkeiten zu Ende gingen und der Friede geschlossen wurde, kehrte ich nach Karolina zurück. Eines Abends trank ich zu viel, geriet mit einem Vetter über ein Mädchen in Streit, das uns im Grunde nicht das Geringste anging, und am nächsten Tage duellierten wir uns. Er schlug mir mit seinem Rapier eine Wunde ins Gesicht –«
»Was, du hast die Narbe im Duell erhalten?«, fragte sie vorwurfsvoll.
»Ja, liebes Kind, und wenn ich ihn nur im Gesicht verwundet hätte, wäre ich vermutlich jetzt nicht hier auf dem Fluss. Aber leider muss ich gestehen, dass ich ihm mit einem scharfen Hieb von unten herauf den Leib aufschlitzte.«
»Philip!«
»Drei Tage später starb er unter den größten Schmerzen, und ich musste das Land verlassen. Als ich daher hörte, dass König Georg die Soldaten belohnte, die gegen die Franzosen gekämpft hatten, und ihnen Land in Louisiana schenkte, bat ich um meinen Anteil. Meine Felder liegen auf den Höhen von Dalroy.«
»Was? Dort liegt auch das Land meines Vaters!«
»Dann sind wir beide glücklich. Es ist bestes Land. Aber was nützte mir das alles? Ich konnte doch nicht nach Louisiana gehen ohne Pflüge, Sklaven oder Geld, um mir Schwarze zu kaufen?«
»Und so hast du –« Sie schwieg und sah ihn fragend an.
»So habe ich mich aufgemacht und mir beschafft, was ich brauchte. Ich nahm es von den Schiffen, die den älteren Söhnen an der Küste von Karolina Güter brachten. Sie hatten sie zwar gekauft, aber sie brauchten sie nicht. Schließlich eroberten wir Bonylegs’ Schiff mit seinen Schätzen, und darauf verließ ich die See. Ich habe alles gestohlen, was ich besitze, aber es ist im Ganzen nur so viel, wie mein väterliches Erbe ausmachen würde, wenn ich der Älteste gewesen wäre.« Er beugte sich vor und schaute sie forschend an. »Glaubst du, dass ich hoffnungslos schlecht bin, Judith?«
Sie stützte die Stirn in die Hand. »Ich weiß es nicht! Ich dachte immer, dass die Menschen ihre Pflicht an dem Platz tun sollten, den ihnen Gott gegeben hat. Aber ich bin jetzt ganz verwirrt.«
»Sieh einmal her.« Philip breitete eine Landkarte auf seinen Knien aus. Die Seidenspitze seines Ärmels bedeckte Neuengland, während er mit dem Finger auf Louisiana zeigte. »Hier ist der Strom, und hier – vier Tagesreisen von Neuorleans – liegen die Dalroy-Höhen. Dreitausend Acker von dem reichsten Land in diesem Erdteil warten auf dich und mich. Welch eine herrliche Heimat werden wir haben! Orangenhaine und Indigofelder! Und unsere Pflanzung wird Ardeith heißen – den ganzen Weg habe ich darüber nachgedacht, wie ich sie nennen soll. Wie gefällt dir der Name?«
»Er ist schön«, erwiderte Judith. Sie erinnerte sich nur noch schwach an ihre unsterbliche Seele.
»Wir werden ein Herrenhaus bauen«, fuhr Philip fort, »und hinter den Wirtschaftsgebäuden wird ein Sklavendorf liegen. Wir wollen Ton zu unserem Haus verwenden und die Zypressenlatten mit dem grauen Spanischen Moos verkleiden. Solche Wände aus Ton sind dauerhafter als Holz und halten auch die Hitze ab. Von den Negern lassen wir eine Allee von Eichbäumen pflanzen, die zu unserem Tor führt. Bevor wir alt sind, werden sich die Zweige ausbreiten, und die Bäume werden so groß sein wie die hier im Walde, und lange Schleier von Spanischem Moos werden an den Ästen hängen. Wenn wir darunter hinreiten, wird es unsere Schultern streifen. Du wirst eine große Dame sein, Judith, und wir wollen eine Familie gründen, du und ich, und nach hundert Jahren werden unsere Nachkommen, die auf Ardeith herrschen, sich mit Stolz an uns erinnern, die zusammen den großen Strom herunterkamen und sich hier niederließen.«
Judith stand langsam auf und presste die Hände auf die Brust. Ihr Blick schweifte über die Orangenbäume und die kleinen Dschungelpalmen. Sie schaute auf die dunklen Granatbäume und den verführerischen Strom, als ob sie das alles zum ersten Mal in ihrem Leben sähe. Aber dann legte sie in einer abwehrenden Bewegung die Hände über die Augen. Sie sah auch das kleine weiße Haus zwischen den Maisfeldern, und sie sah sich selbst als kleines Mädchen auf der Schwelle an einem Streifen sticken, auf dem vorgezeichnet stand: »Allmächtiger Gott, sieh mich, Judith Sheramy, 4. Juli 1768.« Drei Buchstaben musste sie jeden Morgen in rotem Kreuzstich sticken, bevor sie draußen spielen durfte.
Sie erinnerte sich auch an das grausame Naturspiel der furchtbaren Stürme, an die wilde Schönheit der Bäume, die sich wie mit schwarzer Tinte gezeichnet von dem gelblichen Himmel abhoben. Plötzlich stieg ein tiefes Heimweh in ihr auf. Sie wusste, dass sie nie wieder ein Schneetreiben oder armlange Eiszapfen sehen würde, die von der Dachtraufe herabhingen. Sie würde auch nie wieder in der Kirche hören, wie der Pfarrer den Dankgottesdienst abhielt, wenn ein kalter Frühling im April schüchtern seinen Einzug in das Hügelland hielt. Langsam nahm sie die Hände von den Augen und sah Philip an. Und wie von weither hörte sie die Worte des königlichen Gouverneurs, dass die Soldaten des Königs ein anderes Neuengland am großen Strom gründen sollten.
Philip, der sie genau beobachtet hatte, schien ihre Gedanken zu verstehen. Er nahm ihre Hände in die seinen und trat dicht zu ihr. »Wenn die Bootsleute recht haben«, sagte er schlicht, »kommen wir morgen zu einem Hafen, den die Engländer New Richmond und die Franzosen Baton Rouge nennen. Dein Vater wird dort mehrere Tage lang rasten, um seinen Bootsleuten Ruhe zu gönnen. Ich hatte das auch vor, aber jetzt werde ich es nicht tun. Ich fahre so schnell wie möglich nach Dalroy hinunter, und wenn du dann ankommst, werde ich dich finden.«
»Ja«, erwiderte sie zitternd.
»Aber bis dahin«, fuhr er zärtlich fort, »wirst du mit deiner Familie zusammen sein und kannst über all das nachdenken.«
»Ja«, sagte sie wieder.
»Du Liebes!« Philip zog sie an sich, und diesmal machte sie nicht einmal den Versuch, Widerstand zu leisten. Sie legte die Arme um ihn und schmiegte sich an ihn. Eine Welle von Dankbarkeit und Verehrung kam über sie, sodass sie alles vergaß. Philip liebte sie! Wie lange sie sich umschlungen hielten, wusste sie nicht, aber plötzlich packte eine raue Hand sie an der Schulter und riss sie zurück. Sie taumelte und wäre beinahe gefallen. Als sie das Gleichgewicht wiederfand, sah sie, dass ihr Vater wütend auf Philip einsprach. Schnell steckte sie die Kette mit den Topasen in den Ausschnitt.
»Sehr wohl, Mr. Sheramy. Aber ich habe ihr nichts zuleide getan«, entgegnete Philip.
Mark hatte das Gewehr in der Hand und zum Anschlag bereit.
»Mr. Larne«, sagte er, während er die Lippen kaum öffnete, »wenn Sie meine Tochter noch einmal anrühren, schieße ich Sie nieder.«
Philip verneigte sich. »Mr. Sheramy, es war schon seit einiger Zeit meine Absicht, Sie um die Erlaubnis zu bitten, Ihre Tochter zu heiraten. Ich hoffe, Sie geben mir die Ehre, meinen Wunsch zu gewähren.« Er lächelte zu Judith hinüber, als ob er ihr Mut einflößen und versichern wollte, dass es nicht auf die Antwort ihres Vaters ankäme.
Judith fühlte die kalte Kette auf ihrer Brust, als ihr Vater heftig erwiderte:
»Unter keinen Umständen gebe ich meine Einwilligung zu einer solchen Heirat, Mr. Larne. Guten Abend.«
»Guten Abend«, erwiderte Philip und ging durch das Gehölz fort.
Mark trat zu Judith und legte den Arm um sie. »Komm mit, Kind«, sagte er liebevoll. Er schien nicht böse auf sie zu sein, er war nur ernst und traurig. Sie fühlte sich viel schuldbewusster, als wenn er ihr Vorwürfe gemacht hätte. Schweigend gingen sie nebeneinanderher, bis sie das Lagerfeuer sehen konnten. »Möchtest du einen Augenblick hierbleiben, bevor wir zu den anderen gehen?«, fragte er.
»Ja, Vater.« Judiths Stimme versagte, und sie begann zu schluchzen. Er setzte sich auf einen umgefallenen Baumstamm, zog sie zu sich nieder, hielt sie wie ein Kind und streichelte ihr Haar. Nach einiger Zeit fasste sie sich wieder.
»Warum hast du gesagt, dass du ihn niederschießen würdest?«, fragte sie.
»Weil ich das tun werde, wenn er dich noch einmal anfasst.« Nach einer Pause fügte Mark hinzu: »Ich habe dich zu lieb, Judith, um dich einem solchen Mann zu geben.«
»Einem solchen Mann?«, wiederholte sie aufsässig. »Er hat d i r doch noch gar nichts von sich erzählt!«
»Das braucht er auch nicht zu tun. Mein liebes Kind, siehst du denn nicht, dass er ein gottloser, leichtsinniger, unzuverlässiger Mensch ist? Er würde dich vernachlässigen in seinem Hang nach Vergnügen und Zerstreuung, anstatt dich zu beschützen und für dich zu sorgen. Nein, Judith. Du wirst ihn nicht wiedersehen.«
Ihre Hand umklammerte einen abgebrochenen Ast, der aus dem Baumstamm vorragte. »Er sagt, dass er mich sehr liebt, Vater.«
»Vertraue mir, Kind.« Langsam fuhr er mit der Hand auf der Rinde des Baumes entlang, bis sie auf der ihren ruhte. »Du würdest mit einem solchen Mann sehr unglücklich werden, viel unglücklicher, als ich dir jemals sagen kann. Du bist noch zu jung, um das zu verstehen. Wenn ein tüchtiger junger Mann kommt und um deine Hand anhält, werde ich mich ebenso freuen wie du. Es ist mein Wunsch, dass du heiratest, aber du sollst einen guten Mann haben, Judith.«
Sie schwieg. Noch vor einer Woche hätte sie es nicht für möglich gehalten, dass ein Mädchen es wagen könnte, die Worte seines Vaters anzuzweifeln. Aber in diesen letzten sieben Tagen hatte Philip alle ihre Grundsätze erschüttert, obwohl die Begriffe, die er ihr beigebracht hatte, noch so neu waren, dass ihr die Worte fehlten, um sie zu erklären.
»Eine Heirat ist nicht die Stillung eines plötzlichen leidenschaftlichen Wunsches, Judith. Die Ehe ist ein heiliges Sakrament und dauert das ganze Leben.«
»Ja, Vater«, erwiderte sie. Und weil er so bekümmert schien, fügte sie hinzu: »Ich möchte immer das Rechte tun, Vater.«
»Das weiß ich.« Er drückte ihre Hand.
Caleb rief sie. Die Leute machten das Boot los, denn am Nachmittag wollten sie weiterfahren.
»Was habt ihr beide denn so lange im Walde gemacht?«, fragte Mrs. Sheramy, als sie in die Nähe des Feuers kamen.
»Nur ein wenig geplaudert«, entgegnete Mark. »Wir müssen jetzt aufbrechen, damit wir morgen nach Baton Rouge kommen.«
Erst als sie unterwegs waren, fiel Judith ein, dass sie zwei gute Kochtöpfe bei der kleinen Bucht am Ufer zurückgelassen hatte. Ihre Mutter schimpfte wegen dieser Nachlässigkeit. Aber Mark meinte: »Du musst nicht so streng mit ihr sein, Catherine. Man kann mehr Hoffnung auf sie setzen als auf die meisten jungen Mädchen in ihrem Alter.«
Judith ging fort und ließ sich auf dem Deck nieder. Sie beobachtete Philips Boot, das in weitem Vorsprung den einzelnen Biegungen des Stromes folgte. Allem Anschein nach hatte ihr Vater die Absicht, nichts mehr über Philip zu sagen. Er nahm es als selbstverständlich an, dass sie ihm gehorchen würde, wie sie es bisher immer getan hatte.
Ein Kanu von Illinois kam an ihnen vorbei. Die Händler sangen ein lustiges französisches Lied, während sie schnell dahinruderten. Ein Eingeborenenkanu folgte ihnen, das mit Perlen und Decken beladen war. Es wurde von Indianern gerudert, die es schweigend und geschickt durch die Wellen der Strömung lenkten. Nach einer Weile hörte sie, dass ihr Vater die Grüße eines anderen Bootes erwiderte, das der Familie St. Clair von Pennsylvania gehörte. Wieder konnte sie Philips Boot sehen, das sich inzwischen noch weiter von ihnen entfernt hatte. Er hielt sein Wort und fuhr den Strom hinunter, so schnell er nur konnte.
Judith legte die Hände um die Knie und lehnte sich gegen die Wand der Kabine. Es kam nicht darauf an, was ihr Vater sagte oder tat, Philip würde sie doch finden. Und was sollte sie ihm dann sagen? Sie sehnte sich so sehr nach ihm! Der Gedanke, dass er heute Abend nicht am Landungsplatz sein würde, wenn sie ihr Boot festmachten, gab ihr ein Gefühl von Leere und Einsamkeit. Sie wünschte, dass er dort wäre und ihr von Piratenschlachten oder Zweikämpfen oder irgendwelchen anderen Abenteuern erzählte, über die er gern plaudern wollte. Er sollte ihr wieder sagen, dass er sie liebte, und sie fest in die Arme schließen, ohne dass sie gestört wurden. Ein neues unsagbares Verlangen nach ihm war über sie gekommen. Es erfüllte sie ganz, wenn sie es auch nicht verstehen konnte. Wieder dachte sie darüber nach, was es sein mochte, das die Männer von den Frauen wollten. Es war etwas Schönes oder Schreckliches oder vielleicht beides. Seltsam, obwohl sie so wenig davon ahnte, glaubte sie doch, es müsste etwas Schönes sein, da sie nun wusste, dass Philip Larne es von ihr haben wollte.
Am liebsten hätte sie geweint. Dieses müßige Herumsitzen war nicht gut. Man sollte immer etwas Nützliches tun – oder war das vielleicht auch nur eine der Lebensregeln aus Neuengland, die hier am sonnigen Strom keine Geltung mehr hatten?
Sie ging in die Kabine, holte ein Tuch heraus und säumte es. Wie mausgrau und hässlich nahmen sich doch ihre Kleider gegen Philips blau- und rotseidene Gewänder aus! Und wie grau und farblos würde ihr ganzes Leben sein, wenn sie ihrem Vater gehorchte! Bis sie ein eigenes Haus bauten, würden sie die Gäste Walter Purcells sein. Er war der Sohn des ältesten Freundes ihres Vaters. Ein fleißiger, tüchtiger junger Mann mit allen Tugenden, die es nur gab. Judith verzog ironisch den Mund, während sie nähte. Sicher würde sein Haus blitzblank, aber nüchtern sein. Von ihr erwartete man, dass sie sich dort wie ein wohlgesittetes junges Mädchen benähme. In Häubchen und Schultertuch sollte sie am Spinnrad sitzen, bis ein anderer ordentlicher junger Mann in einem Barchentrock und Nankinghosen kam, ihr den Hof machte und sie schließlich als brave Ehefrau heimführte. Ach, das wollte sie nicht! Wozu hätte Gott dieses wunderbare Land hier geschaffen, wenn nicht für ausgelassene Fröhlichkeit, für lachendes Glück und für Männer wie Philip Larne!
*
Schließlich kamen sie zu den Höhen von Dalroy.
Unterhalb von Baton Rouge waren die Ufer niedrig gewesen und nur sanft angestiegen, aber plötzlich erhob sich das Ostufer zu beträchtlicher Höhe, und ein Landrücken hing wie ein vorspringendes Riff über dem Strom. An dem unteren Ende befand sich der Anlegeplatz. Die Sheramys sahen dort so viele Flachboote und Kanus, dass sie zuerst glaubten, ihre Bootsleute würden nicht landen können. Aber sie fanden doch noch eine Lücke und machten das Boot fest. Judith kletterte nach ihrem Vater an Land.
Sie standen zusammen auf der belebten Werft, während die Männer die Kisten ans Ufer trugen. Judith empfand plötzlich Furcht bei dem Gedanken, dass sie an diesem wilden Platz leben sollte. Es herrschte ein wirres Durcheinander. Bootsleute schrien und riefen, schwarze Neger rollten schwere Lasten über die Planken, Indianer begrüßten die einfahrenden Boote mit Gesang und fingen dann die Melonen und die kleinen Münzen auf, die ihnen von den Leuten aus den Fahrzeugen zugeworfen wurden. Eine Unmenge von Wagen, Lastkarren und mit Früchten beladenen Holzgestellen standen in einem unentwirrbaren Knäuel am Ufer. Das war die Stadt Dalroy in der Provinz Westflorida im Lande Louisiana. Die neue Heimat! Philip würde es hier gefallen. Er würde sie auslachen, weil sie sich fürchtete. Sie hielt nach ihm Ausschau, aber sie konnte nur Fremde und Warenballen sehen. Natürlich war er nicht hier. Er war weit hinten im Wald, und es mochte Tage dauern, bis er erfuhr, dass sie angekommen waren.
Plötzlich kam ein Mann auf sie zu. Er stieg über Kisten und Fässer und rief den Negern zu, dass sie ihm aus dem Wege gehen sollten. Judith erkannte zu ihrem größten Erstaunen in ihm den biederen Walter Purcell aus Connecticut. Aber wie hatte er sich verändert! Er war von der Sonne braun gebrannt wie ein Indianer, trug einen Rock aus apfelgrüner Atlasseide und hatte Silberschnallen an den Knien. Er rief ihnen zu, winkte und sprang schließlich über einen Lastkarren. Dann packte er Mark Sheramys Hand und hieß ihn freudig willkommen.
Judith trat einen Schritt zurück und starrte ihn an. Aber dann kam eine heimliche Freude über sie. Es war also wirklich wahr! Niemand konnte Neuengland nach Louisiana verpflanzen! Irgendwo auf dem Fluss fuhren alle über eine Grenzlinie, und Philip hatte von jeher auf diese Seite gehört.
Der Wagen fuhr auf einem holprigen Weg den Wald entlang. Ab und zu kamen sie an einem Indigofeld vorbei, in dessen Nähe ein Blockhaus oder manchmal auch ein ansehnliches Gebäude mit Wänden aus rotem Ton und Spanischem Moos stand. Schließlich erreichten sie Walter Purcells Grundstück. Lynhaven hieß die Farm, wie er ihnen sagte. Das rote Haus war groß und hell und durch einen Gang in zwei Hälften geteilt, an dessen beiden Seiten sich je fünf stattliche Räume befanden. Vor dem Eingang lag eine Holzveranda, die mit weißer Farbe gestrichen war. Mr. Purcell nannte sie eine Galerie, und als sie ihn fragten, erklärte er ihnen, dass die Kreolen dieses Wort dafür gebrauchten. In Louisiana waren viele Kreolenworte in die englische Sprache eingedrungen. Mark fragte etwas skeptisch, ob man viel mit den Kreolen zusammenkäme.
»Selbstverständlich«, erwiderte Mr. Purcell. Er selbst hatte eine Frau aus New Orleans geheiratet. »Sehr liebenswürdige, charmante Menschen, diese Kolonialfranzosen.«
Mehrere Neger eilten ihnen aus dem Hause entgegen, und während sie durcheinanderschwatzten, schrien und die Kisten abluden, trat ein schwarzhaariges Mädchen auf die Veranda heraus. In dem rotseidenen Kleid und mit den kleinen Locken, die auf ihrem Nacken tanzten, sah sie wie eine Puppe aus. Sie war so jung, dass Judith sie überrascht ansah, als Mr. Purcell sagte: »Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Gervaise, dies sind meine Freunde aus Connecticut.«
Gervaise lächelte und machte einen Knicks, während sie mit den kleinen Händen ihren Puffrock zurückhielt. »Sie sind uns herzlich willkommen.« Sie sprach mit einem weichen, fremdländischen Akzent und war so ruhig und selbstsicher, als ob das Eintreffen von vier Gästen etwas Alltägliches wäre.
»Seit einer Woche ist mein Mann jeden Tag zur Werft hinuntergefahren und hat nach Ihnen Ausschau gehalten.« Sie wies mit der Hand auf den Neger, der eine tiefe Verbeugung machte und die Tür offen hielt. »Bitte, treten Sie ein.«
Als Judith ihrer Mutter ins Innere folgte, warf sie einen Seitenblick auf Gervaise. Sie hatte noch niemals eine junge Dame gesehen, die so selbstbewusst und städtisch aussah, und sie hätte gern gewusst, ob Gervaise jeden Tag solche Locken und solche Kleider trug. Aber das musste die junge Frau wohl tun. Sie hatte unmöglich vorher wissen können, wann die Sheramys eintreffen würden, um sich zu ihren Ehren so zu kleiden.
»Walter«, wandte sich Gervaise an ihren Mann, »die Räume links hinten sind für Monsieur und Madame und den jungen Herrn bestimmt. Ich werde die junge Dame zu ihrem Zimmer führen.« Sie legte ihre Hand in die Judiths, blieb noch einen Augenblick stehen und gab einer Gruppe von Schwarzen Aufträge. Dabei sprach sie halb französisch, halb englisch. Dann brachte sie Judith in einen Raum, der Wände aus rotem Ton hatte. Die Fenster reichten bis zum Fußboden. Ein schmales, hohes Bett stand darin, über das ein Moskitonetz gespannt war. Eine junge Negerin, die Gervaise Titine nannte, folgte ihnen mit einem hölzernen Zuber und einem Krug heißen Wassers.
»Sie sind sehr freundlich zu uns«, sagte Judith scheu, als sie das Band ihres Sonnenhutes löste. »Hoffentlich machen wir Ihnen nicht zu viel Umstände.«
»Aber durchaus nicht.« Gervaise lachte ein wenig, als ob sie über diese Bemerkung erstaunt wäre. »Ich sehe es gern, wenn wir Gäste haben. Walter ist immer den halben Tag auf der Farm, und es ist so langweilig, wenn man nur Diener und ein Baby zur Gesellschaft hat.«
»Was, Sie haben schon ein Baby?«, rief Judith.
»Ja, ein kleines Mädchen. Babette heißt es. Warum sind Sie so erstaunt darüber?«
»Ach – Sie sehen selbst noch fast wie ein kleines Mädchen aus.«
Gervaise lachte wieder. »Sie meinen, weil ich so schmal und schlank bin? Aber ich bin schon siebzehn und seit drei Jahren verheiratet.« Sie legte die Hand auf die Türklinke. »Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ich will den Mädchen sagen, dass sie noch mehr Gedecke für das Abendessen auflegen. Sie können Titine alles sagen, was Sie haben wollen. Bitte, scheuen Sie sich nicht, Ihre Wünsche zu äußern. Wir möchten, dass Sie sich hier recht wohl fühlen.« Mit einem Knicks schloss sie die Tür. Judith blieb zurück und schaute ihr nach, während Titine die Kleiderkiste auspackte. Fast empfand sie Ehrfurcht vor Gervaise, die alles so bestimmt und selbstverständlich tat, als ob sie in ihrem Leben nie einen Augenblick der Verlegenheit gekannt hätte. Frauen wie sie musste Philip an der Gullahküste kennengelernt haben, Frauen, die es verstanden, mit Fremden umzugehen, Sklaven zu beaufsichtigen, wundervolle Kleider zu tragen und immer lächelnde Überlegenheit zu zeigen. Judith warf den Hut mit ungerechtfertigter Heftigkeit auf das Bett. Sie verstand sich nur gut darauf, Hammelfleischpasteten zu bereiten und Frostbeulen zu heilen, und sie hatte die Empfindung, dass sie eigentlich nicht hierhergehörte.
»Junge Miss fertig für Bad?«, fragte eine sanfte Stimme hinter ihr. Judith wandte sich um. Titine stand respektvoll neben der hölzernen Wanne. Sie war schlank und schwarz und trug zu dem blauen Kattunkleid ein gelbes Kopftuch.
»Ja«, erwiderte Judith, »sobald ich mich ausgezogen habe.«
Sie wünschte, Titine möchte das Zimmer verlassen, denn sie war nicht daran gewöhnt, sich vor Fremden auszukleiden. Aber die Schwarze trat näher, knöpfte Judiths Kleid auf und löste mit geschickten Fingern die Schleifen der Unterröcke. Judith zeigte ihr Erstaunen nicht. Offenbar war dies hierzulande Sitte, wenn es auch seltsam genug war, nackt vor einer Sklavin zu stehen und sich dann wie ein kleines Kind von ihr baden zu lassen. Aber nachdem sie den ersten Schrecken überwunden hatte, fand sie es doch sehr angenehm, wenn es auch nicht schicklich sein mochte. Sie hatte immer Mühe gehabt, sich den Rücken zu waschen. Ein hilfloses weibliches Wesen zu sein, war entschieden schön. Das musste Philip gemeint haben, als er sagte, er wollte sie zu einer großen Dame machen.
»Miss tragen dies hier zum Abendessen?«, fragte die Schwarze.
Sie hatte Judiths bestes Kleid in der Hand. Ihr Vater hatte gesagt, der blaue Musselin wäre zu zart, um ihn in die Wildnis mitzunehmen, aber neben dem eleganten Kleid von Gervaise wirkte er wie dickes, steifes Zeug.
»Ach ja«, sagte Judith. Sie sah, dass Titine frische Strümpfe und Wäsche wohlgeordnet auf dem Bett ausgebreitet hatte. Sie legte das blaue Kleid dazu, dann nahm sie ein Hemd auf, das Judith vor drei Tagen in einer kleinen Bucht am Strom gewaschen hatte. Gehorsam stieg Judith hinein und setzte sich auf einen Stuhl, während Titine die Strümpfe holte. Es war kaum zu begreifen, dass jemand anders ihr die Strümpfe anziehen konnte, da er sie von der falschen Seite überstreifen musste, aber Titine schien überzeugt zu sein, dass keine Frau dergleichen selbst fertigbrachte. Sie kniete vor ihr nieder und strich geschickt und schnell die Strümpfe über Judiths Füße.
Es war alles höchst sonderbar, aber es fiel überraschend leicht, sich daran zu gewöhnen.
Schließlich brachte Titine Brenneisen, eine Kerze in einem Drahtrahmen und einen roten Topf mit duftender Pomade. Sie legte die Eisen auf den Rahmen, um sie zu erhitzen, und kämmte Judiths Haar über Baumwollrollen hoch. Mit Pomade wurden kleine Locken gelegt, die in die Stirn hingen, mit den Eisen andere geformt, die in den Nacken fielen. Als alles fertig war, stellte Titine einen Spiegel auf die Kommode, und Judith drehte sich langsam um.
Der Spiegel war zwar nur schmal, aber lang, sodass sie sich bis zur halben Größe darin betrachten konnte. Sie hatte das Gefühl, als ob sie einen Korb auf dem Kopf balancierte, und ihr Korsett war so fest geschnürt, dass sie kaum atmen konnte, aber sie stieß doch einen kleinen Freudenruf aus, als sie ihr Spiegelbild sah. Niemand hatte ihr jemals gesagt, wie schön ihre Schultern geformt waren und was für eine schlanke Taille sie hatte. Sie sah fein, zart, zerbrechlich aus. Judith lehnte sich über die Kommode und konnte den Blick nicht abwenden. Jetzt glich sie den Frauen, an die Philip gewöhnt war. Wenn alles andere auch so leicht war wie dies –?
Es klopfte an der Tür, und Gervaise trat ein.
»Wollen wir ins Speisezimmer gehen, wenn Sie fertig sind?«, fragte sie. Dann hielt sie plötzlich inne. »Aber wie anders sehen Sie jetzt aus, nachdem Sie sich umgekleidet haben! Ist es nicht wirklich eine große Erleichterung, wenn man nach einer beschwerlichen Reise wieder zum zivilisierten Leben zurückkehren kann?«
»O ja«, erwiderte Judith.
Sie zögerte, sah noch einmal in den Spiegel und wandte dann Gervaise den Blick zu. Ob sie ihr wohl gestehen durfte, wie wenig sie an diese Bequemlichkeiten gewöhnt war, die Gervaise »zivilisiertes Leben« nannte? Aber sie fand nicht den Mut dazu.
Immerhin überlegte sie, ob sie nicht mit ihr über Philip sprechen sollte. Gervaise war auch jung und musste wissen, wie es war, wenn man sich verliebt hatte, denn sie war doch verheiratet!
Aber auch das tat Judith nicht. In diesem Haus erschien ihr alles romantisch – das Reisgericht und die Krabben, die sie aßen, die Diener, die auf leisen Sohlen über den Fußboden gingen, und der kleine Negerjunge, der den großen Fächer aus Putenfedern über dem Tisch bewegte. Gervaise war ruhig und sachlich, und Judith konnte sich kaum vorstellen, dass diese junge Frau aufregende Erfahrungen hinter sich hatte. Gervaise sprach nicht viel, wenn sie nicht gerade die Fragen von Mrs. Sheramy beantwortete, die etwas über die Haushaltsführung in Louisiana wissen wollte, und sie war zu ihrem Mann so höflich, als ob sie einander eben erst vorgestellt worden wären. Walter, Mark und Caleb sprachen über Ernten und das Geschäft auf der Werft. Der Vater machte keine Bemerkung über Judiths eng geschnürte Taille oder ihre ungewöhnliche Frisur. Daraus schloss sie, dass er in unbedeutenderen Dingen nachsichtig sein wollte, weil sie Philip aufgegeben hatte. Das hatte sie jedoch nicht versprochen, wie sie sich energisch sagte, obwohl sie erkannte, dass sie diese Frage allein entscheiden musste. Sie hatte keinen Menschen, dem sie sich anvertrauen konnte, und es war ihr, als ob sie von allen anderen abgeschieden wäre. Als es Zeit war, zu Bett zu gehen, atmete sie auf.