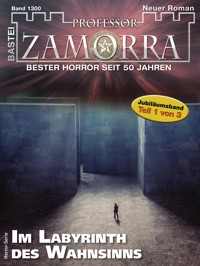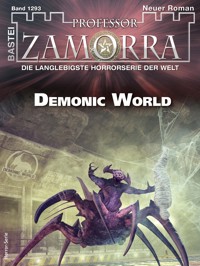1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Gardasee!
Das sind venezianische Paläste, Eisdielen und Uferpromenaden, Zitronen- und Olivenhaine, gutes Essen, Lebenslust und Leichtigkeit. Der Gardasee - noch immer ein Traum vieler Menschen.
Nur wenige wissen, dass er bis zum zwölften Jahrhundert einen anderen Namen trug. Denn der See, mitsamt seiner Schönheit, gehörte einst ... Benacus!
Einst?
Denn siehe, vielleicht kehrt er heute zurück ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Ähnliche
Inhalt
Cover
Benacus
Leserseite
Vorschau
Impressum
Benacus
von Thilo Schwichtenberg
Lago di Garda — der Gardasee!
Eingebettet in die Bergwelt Oberitaliens, im Süden umsäumt von Weinbergen, Pinien, Zypressen und Palmen, allzeit gesegnet mit Sonnenschein.
Der Gardasee: das sind venezianische Paläste, Eisdielen und Uferpromenaden, Zitronen- und Olivenhaine, gutes Essen, Lebenslust und Leichtigkeit. Nur wenige wissen, dass der Gardasee bis zum zwölften Jahrhundert einen anderen Namen trug. Denn der See, mitsamt seiner Schönheit, gehörte einst ... Benacus!
Einst? Denn siehe, vielleicht kehrt er heute zurück ...
In den Wolken
Eine flirrende, würde man genauer hinschauen vielleicht auch weiße, um nicht zu sagen reine Wolke umrundet nun schon seit längerer Zeit das Erde-Hölle-System.
Es mag scheinen, dass sie etwas sucht. Etwas ganz Bestimmtes. Oder hat sie es bereits gefunden? Oder ... sucht sie gar nicht, sondern beobachtet nur?
Nach vielen Äonen konnten hier, hauptsächlich im letzten Zeitalter, hohe Inter-Aktivitäten, um nicht zu sagen Schreie des Magischen Universums, vernommen werden. Und genau diese Inter-Aktivitäten sind es, die Einfluss auf das Magische Universum genommen haben. Überhaupt Einfluss auf die Ordnung.
Ordnung im Chaos muss sein, denn das Chaos wird erst durch die Ordnung sichtbar.
Erst durch Strukturen gewinnt das Chaos an Charakter. Diese Strukturen sind es, die das Chaos in all seiner Vielfalt erblühen lassen.
Hier, in diesem Ursprung, scheint die Ordnung unterbrochen, zumindest aber anders zu verlaufen. Die Frage lautet: Ist hier ein Eingriff nötig oder ist dies nur eine weitere Form der Ordnung? Fügt sich alles auf Umwegen?
Ist die Wolke hier fündig geworden? Oder vielleicht ... lässt sie sich doch nur treiben? Eine ganz normale, weiße, wenn auch reine Wolke eben. Hier oben, wo dem Menschen das Überleben nicht mehr möglich ist. Vielleicht ist es auch Tarnung, vielleicht ist sie bereits fündig geworden. Mehrfach fündig, hat einen Überblick erhalten, über dieses System. Über diese Ordnung.
Hat sie bereits Einfluss auf das Geschehen genommen? Mag sein, dass sie gerade recht kommt. Immerhin steht die Vollendung an. Die Vollendung, die Richtigwerdung, die Buße, welche die weiße Wolke am Anbeginn der Zeit, nach großer Enttäuschung, angefacht hat.
Es ist spannend, ob sich alles fügen wird. Fügen in einen der größeren Pläne. Fügen in eine Ordnung, die die Vielfalt des Chaos auch endlich hier, in diesem Teil des Multiversums, leuchten lässt.
Die Wolke zieht sich zusammen, senkt sich, dehnt sich, wird Nebel, geht tiefer, immer tiefer, denn sie hat gefunden.
Ein großer See, tief und kalt und klar. Im Norden umschlossen, behütet von mächtigen Bergen, im Süden sich mild in die Ebene erstreckend.
Kleine Schifferboote dümpeln auf dem See, ein paar Sportboote nutzen die bestehenden Winde. Ihre Segel so weiß, so rein.
Es verspricht ein wundervoller Morgen zu werden. Leise rascheln Palmenzweige und Zitronenblätter. Gülden färben sich die terrakottafarbenen Dächer der kleinen Orte. Da lugt auch schon die Sonne hinter den Bergen hervor. Der Nebel kräuselt sich über dem See, ja, es hat fast den Anschein, als wenn Seelen Tagesträume leben.
Scheinbar vom Wind angeschoben, wird träge der Nebel in Richtung des östlichen Ufers bewegt. Er drückt sich an Land, zieht über den Strand und verflüchtigt sich zielgerichtet in den Gassen des Ortes ...
Vor vielen Jahrhunderten
Er rannte durch die Nacht.
Die Sandalen längst verloren, spürte er unter den Fußsohlen Steine, Wurzeln, getrocknete Äste, Disteln und Brennnesseln. War es Wald? War es Feld? Oder ein steiniger Abhang? Egal! Er musste rennen, musste rechtzeitig ankommen.
Wie lange rannte er schon? Er wusste es nicht, konnte es nicht sagen. Vielleicht lief er schon ewig? Es schien allerdings, dass er dem Ziel einfach nicht näher kam.
War er das? Konnte seine Macht so weit ins Hinterland reichen?
Oder war es seine eigene Schuld, die ihn nicht vorwärts kommen ließ?
»Bruder!«, hörte er es hinter sich wehklagen, »so hilf mir doch!«
»Nein!«, keuchte er. Weder blieb er stehen noch drehte er sich um, »du kannst es nicht sein. Du bist tot!«
»Tot?«, echote es hinter ihm. »Sag, Bruder«, der Ton wurde kecker, lauernder, »wie bin ich gestorben?«
Ich war es, der dich hat sterben lassen! »Nein!« Er strauchelte, fing sich, rannte weiter. »Er war es, er hat dich ... gefressen!«
Die Stimme lachte, boshaft und gemein. Und verwehte. Gut so! Sie konnte es nicht sein!
»Nein?«, wisperte eine zweite Stimme, einem Windhauch gleich, um seine Ohren. »Aber mich hast du verraten. Weil du ... zu feige warst.«
»Ich begehe doch schon Sühne!«, schrie er mit Tränen in den Augen. »Ich sühne seit jenen Augenblicken!«
»Dann ist es gut«, das Echo der zweiten, tieferen Stimme, verwehte ebenfalls.
Befand er sich noch immer im Hinterland? Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen! Er musste jeden Augenblick den vertrauten Ort sehen, zumindest den See, wie er schwarz und ölig zwischen den Pinien und Zypressen hervorlugte.
Das Wasser des Bösen! Beschienen von einem vollen, leichenbleichen Mond.
Er strauchelte abermals, fing sich und rannte weiter. Die Kutte hinderte ihn beim Laufen. Er raffte sie etwas nach oben. Zweige peitschen ihm ins Gesicht. Wurzeln gruben Riefen in die Waden.
Er wollte alles wiedergutmachen!
Gutmachen? Du kannst nichts wiedergutmachen, wisperte es in ihm. Sie sind tot, du kannst sie nicht mehr zurückholen. Nie mehr.
»Aber ich muss ihn bannen, vernichten! Wenigstens das bin ich ihnen schuldig.«
Kam er zu spät?
Natürlich! Denn er besaß keinen Gegenzauber, keinen Bannspruch. Er war mit leeren Händen zurückgekehrt! Er war ... ein Taugenichts, war oftmals auf der Suche nach einer Antwort geflohen, sogar vor den eigenen Mitbrüdern. Sie verstanden ihn nicht! Sprachen allesamt, dass Gott alles sei und alles richtete. Auch Teufel. Da musste er, das Sandkorn, sich nicht einmischen.
Oder wenn er nicht gehen wollte und ihnen verzweifelt die leeren Hände entgegenstreckte, da kniffen sie die Augen leicht zusammen und bildeten ein Rund um ihn. War er, so zischten sie ihm fast schon feindlich zu, am Ende gar ein schwarzmagischer Zauberer? Wie hielt er es überhaupt mit der Zauberei? Lebte er gottesfürchtig?
Dabei glaubte er an Gott, so sehr. Denn Gott konnte nicht zulassen, was in der Heimat geschah. Er konnte nicht zulassen, dass an seiner statt ein Teufel, ein sogenannter schwarzer Gott, regierte, der niemanden neben sich duldete.
Der Tod seiner Schwester und seines Lieblingsoheims hatten ihm die Augen geöffnet! Er musste etwas tun, sonst waren sie alle verloren!
Am liebsten hätte er geschrien, die Hände im Dreck vergraben, mit dem Kopf gegen die Steine geschlagen. Er brachte nichts mit, nicht einmal Hoffnung. Er kam mit leeren Händen. Doch er musste ihn aufhalten. Er hatte es versprochen!
Da, die kleine Kirche aus Sandstein vor dem schwarzen Glitzern des Sees!
Das vertraute Gefühl von Heimat — warum wollte es sich nicht einstellen?
Er war da, war endlich wieder zu Hause. Er riss die Augen auf. Der Kirchturm schien zerstört, wie auch das Dach des Gotteshauses große Löcher aufwies. Als wenn jemand voller Hass und Wut mit einer gewaltigen Pranke wuchtig darauf eingeschlagen hatte.
Überall lagen verkrümmte Gestalten, Leichen! Vorsichtig trat er näher. Die Leiber glänzen im Mondlicht vor Feuchtigkeit. Die Menschen schienen allesamt ertrunken, vom Wasser erstickt, obwohl sie in den Gassen des Ortes lagen.
Er beugte sich hinab, drehte einen der Körper vorsichtig auf den Rücken. Sah die Schwester! Ihre Augen gebrochen. Er wendete sich ab. Und wurde am Oberarm umklammert. »Warum?«, blubberte sie und spuckte Wasser. »Warum hast du uns nicht errettet? Du bist schuld an unserem Tod, nicht er!«
Er riss sich los, fiel auf den Po, raffte sich mühsam auf und stieß fast gegen die dunkle Gestalt.
Sie war riesig. Ein Gigant, blauschwarz und voller Muskeln. Der Hals trug Kiemen, die Nase war gewaltig, wie die Schnauze eines Fisches und das Gebiss, die Zähne ...
»Da bist du ja!«, dröhnte der schwarze Gott und beugte sich leicht hinab. »Du kamst mit leeren Händen. Und doch füllst du jetzt meinen Bauch. Wie vordem deine Schwester und dein Oheim.« Da schoss der Kopf nach unten. Der Hals wurde länger und länger, dann war da nichts mehr. Es tat nicht einmal weh.
Schreiend erwachte Benedetto in der Zelle, tastete nach dem Kreuz, ergriff es und küsste es. Wieder und immer wieder. »So war das alles nicht gewesen!«, keuchte er verzweifelt.
Doch Oheim und Schwester ... blieben trotzdem tot.
Gardasee, unweit von Bardolino, 2023
Die Nacht brachte angenehmere Temperaturen mit sich. Der See spendete eine leichte Kühle, und noch immer roch es ein wenig nach Oleander, Geranie und Staub.
Die kleine Strandbar war nur indirekt beleuchtet. Glimmende Girlanden reichten vollständig aus, um Zapfhahn und Wechselgeld zu erkennen.
Im Hintergrund schwappten sanft die Wellen ans Ufer. Musik spielte leise, fast unaufdringlich.
Amando kippte den Inhalt des Glases in einem Zug hinunter.
Boah, auch der sechste Sambuca war noch immer scharf, da half auch die obligatorische Kaffeebohne nicht. Egal!
Der Mittzwanziger saß an der Bar. Allein. Natürlich allein. Erneut ließ er den Kopf hängen und seufzte in sich hinein. Am liebsten hätte er jedoch mit der Faust auf den Tresen gehauen. Wieder und immer wieder. Doch nicht einmal das durfte er.
Frauen! Man konnte weder mit ihnen noch ohne sie leben.
Mann, war das alles kompliziert. Ach was, es war Mist. Gottverdammter Mist!
»Noch einen?«, fragte mitfühlend der Barkeeper, ein junger Bengel, vielleicht noch nicht einmal volljährig. Zumindest besaß er etwas Flaum über der pickeligen Oberlippe.
Stumm schob ihm Amando das leere Glas zu.
»Probleme?«, bohrte der Barkeeper weiter.
Amando schüttelte den Kopf. Er brauchte jetzt keinen Therapeuten. Das alles war schon schlimm genug.
»Frauen, hm?«
Ließ der überhaupt nicht locker? Der war ja schlimmer als eine Toilettenfliege! Der Mittzwanziger knurrte. Vielleicht verstand der Bengel das.
Wenn nicht, nun, er war gerade in der richtigen Stimmung ihn über den Tresen zu ziehen.
»Schade, dass du nicht auf Männer stehst.«
Amandos Kopf ruckte hoch.
»Du gefällst mir.« Der Barkeeper zwinkerte verführerisch. »In einer halben Stunde habe ich Feierabend.«
Amando sprang wütend auf. Jetzt konnte er endlich Dampf ablassen, aber so was von! Der Barhocker fiel nach hinten, doch das klackende Geräusch blieb aus.
»He«, er wurde leicht am Arm gepackt. »Für wilde Bewegungen ist die Nacht doch viel zu sanft.«
Der Mittzwanziger drehte sich und konnte kaum glauben, was er sah. Hinter ihm standen zwei wunderschöne Damen in seinem Alter! Irrte er sich oder kannte er sie?
Beide waren schlank und blond und trugen die glatten langen Haare bis über die wohlgeformten Hüften.
»Komm«, die zwei — waren sie Schwestern? — hakten sich bei ihm links und rechts ein und zogen ihn an einen der äußeren Tische, ganz nah am Strand.
Sie bestellten drei Gläser Wasser. Der Inhalt schwappte sofort nach Erhalt in Richtung See.
»Und jetzt etwas Richtiges.« Die Kleinere der beiden lächelte verschwörerisch, zog einen Flachmann hervor und goss den Inhalt in die Gläser.
Sie prosteten sich zu.
»Ich bin Alina«, sprach die Kleine melodisch.
»Und ich Antonia«, die Größere.
Das war doch fast schon ein Singen?
»Amando«, sagte er völlig überrumpelt von den letzten Augenblicken.
Sie tranken.
Was auch immer es war, das Zeug schmeckte! Der Mittzwanziger nickte anerkennend.
Lächelnd schenkte Alina nach.
»Und nun erzähle doch mal.« Antonia stützte das Kinn auf die Handflächen und nickte ihm aufmunternd zu. »Was ist dir widerfahren?«
Ihre Schwester ging sogar noch einen Schritt weiter und streichelte seinen Oberarm. »Du musst wissen, dass wir supergute Zuhörer sein können.«
Eigentlich wollte Amando gar nicht erzählen. Zumindest nicht über sein Problem. Er wollte viel lieber mit den Damen völlig unbeschwert zusammensitzen. Ihre Gegenwart genießen, den Abend genießen, gemeinsam das Lokal verlassen — je eher, desto besser —und dann ... nun wer konnte jetzt schon wissen, was sich noch alles ergeben würde.
Aber irgendwie wollte er auch erzählen, jetzt, wo sie ihn so voller Nachdruck darum gebeten hatten.
Er erschrak. Hatten Antonias Augen gerade ... perlmuttfarben geleuchtet?
Verstört sah er genauer hin. Nein, ihre Augen leuchteten dunkel, wahrscheinlich waren sie braun.
»Hier, zur Entspannung.« Alina reichte ihm eine winzige Kugel.
Er betrachtete sie argwöhnisch. »Was ist das?«
Antonia lächelte. »Ein uraltes Hausmittel. Es dient zur Beruhigung der Sinne.« Ihre Stimme war wie Samt. So einschmeichelnd, so voller Wärme.
»Uralt. So so.« Er lachte etwas gekünstelt.
»Rein pflanzliche Basis. Das kauten schon unsere Urgroßmütter.« Alina legte sich eine Kugel auf die Zunge und reichte eine weitere an ihre Schwester weiter.
Amando zuckte mit der Schulter und schluckte den Krümel hinunter. Alkohol, Drogen, ach, jetzt war alles egal. Oder auch nicht. Vielleicht lief es mit den beiden gleich bestens. Er gestattete sich ein Grinsen.
Er spürte, wie die Kugel im Magen aufschlug.
Seltsam, so etwas spürte er? Es kitzelte, ganz so, als ... als würde sie sich entfalten?
»Wir hören.« Antonia nickte ihm aufmunternd zu.
Der Mittzwanziger verzog den Mund und wiegte den Kopf. »Bella«, sagte er und spürte, dass der Damm gebrochen war. Bald schon sprudelte es aus ihm heraus.
Nur am Rande bekam der junge Mann mit, dass ihn die beiden aufrichteten, sich bei ihm unterhakten und mit ihm über die Uferpromenade spazierten.
Er liebte Bella mit jeder Faser seines Körpers, mit jeder Lohe seines Geistes.
Er wusste, dass es nur sie sein konnte, mit der er sein Leben verbringen wollte.
Wusste es seit Kindertagen. Sie war es, immer nur sie.
Doch sie — ignorierte ihn. Er winkte ab. Seit Jahren schon verlachte sie ihn, machte sich über ihn lustig. Er sei anhänglich wie ein Dackel und aufdringlich wie eine Ochsenfliege. Wann würde er endlich begreifen, dass sie nicht zueinander passten?
Ja, sogar die Polizei hatte sie auf ihn gehetzt. Und nicht nur das. Sie hatte gerichtlich erwirkt, dass er sich ihr nicht einmal mehr nähern durfte!
Gerade heute war er wieder angemahnt worden. Ihm wurde sogar mit einer Gefängnisstrafe gedroht!
»Das ist echt schlimm«, sang Alina.
»Wie kann dir jemand nur so etwas Böses antun? Du bist lieb und intelligent und hübsch anzusehen. Ich kann nicht verstehen, dass Bella dich abweist«, zirpte Antonia.
Amando fühlte sich verstanden. Endlich verstanden!
»Bella sagt, ich lasse ihr keine Luft zum Atmen.«
»Was Bella sagt, ist falsch!« Antonia schüttelte entschieden den Kopf. »Sie hat es nicht einmal mit dir versucht. Nicht ein einziges Mal.«
»Nein«, hauchte er, »nicht ein einziges Mal.«
Etwas wuchs in seinem Inneren. War es Wärme? Hitze? Oder sogar Groll. Groll auf Bella? Oder sogar ... mehr als das?
»Das kann sie nicht mit dir machen! Bella ist keine Schönheit. Sie ist hässlich«, behauptete Alina.
»Hässlich und gemein«, vollendete die Schwester.
»Aber sie ist hübsch«, begehrte Amando auf. »Sie ist wunderschön.«
»Natürlich ist sie wunderschön.« Alina strich ihm über die Wange. »Das Böse ist immer schön. Hässlich ist sie jedoch von Innen.«
»Hässlich, verdorben, faulend«, vollendete die Schwester.
Der Mittzwanziger blieb stehen. »Ja, ja das stimmt. Bella ist nur äußerlich hübsch. Doch innerlich, ist sie eine Striga, eine Hexe!«
Sie hatten Bardolino verlassen. Die Uferpromenade war längst zu Ende. Jetzt liefen sie einen Pfad entlang.
»Wir haben eine Überraschung für dich!«, säuselte Antonia. »Da wirst du Augen machen.«
Amandos Herz schlug höher. Er sah sich schon in einer kleinen Bucht nur mit Alina und Antonia. Nur sie drei und Berührungen, Vereinigungen!
Was war schon Bella gegen die beiden? Nichts! Ein hässliches, dreckiges, halb vermodertes Strandtuch!
Und tatsächlich, sie steuerten auf eine kleine, vom Mondlicht mit mildem Glanz überzogene, Lichtung zu.
Doch Amando war viel zu wütend auf Bella, als dass er sich jetzt auf Alina und Antonia konzentrieren konnte.
Machte ihm Bella sogar hier das Leben schwer?
Er stockte. Ungläubig sah er auf das Bündel Mensch vor sich. »Bella?«
Die Angebetete lag gut verschnürt vor ihm. Sie war an Händen und Füßen gebunden. Ein Knebel steckte in ihrem Mund. Als sie Amando sah, glomm so etwas wie Hoffnung in ihr auf.
Panisch sah sie auf die beiden Schwestern, dann wieder flehentlich auf Amando.
In ihre blonden, schulterlangen Haare schienen vertrocknete und zerkrümelte Pflanzenblätter eingeflochten. Ein No-Go! Bellas Haare waren nie in Unordnung, denn sie legte sehr großen Wert auf ein exaktes Äußeres.
Auch das schwarze Top, natürlich ohne Träger, wies staubige Flecken auf.
Musste sie jetzt unbedingt hier liegen?!
»Du hast mir sogar diesen Abend versaut«, knurrte er. »Endlich habe ich zwei Menschen gefunden, die mich so akzeptieren, wie ich bin, und schon musst du dich dazwischenwerfen!« Er ballte die Fäuste. »Du bist dir zu fein für mich, aber andere willst du auch nicht an mich ranlassen.« Hasserfüllt sah er auf Bella.
Sie blinzelte erschrocken und versuchte vor ihm zurückzuweichen. Was ihr nicht gelang, war sie doch zusätzlich an einen Baum gefesselt.
»Schau«, flüsterte Antonia, »was ich für dich habe.« Sie hielt ihm ein blinkendes Messer hin.
»Jetzt kannst du dich bei ihr für alles revanchieren, was sie dir angetan hat.« Wie melodisch doch die Stimmen der Schwestern klangen.
Und ja, diese Wut in seinem Bauch, die war wie die Krone eines Baumes. Sie war zu klein für seinen Magen, sie wollte sich entfalten, wollte raus aus ihm!
Bella schüttelte den Kopf. Schweiß tropfte von der Stirn.
Amando ließ sich auf die Knie fallen. Jetzt war er Bella so nah! Und niemand war da, es ihm zu verwehren. Er sah auf das Messer.
So nah würde er nie mehr bei ihr sein. Nur dieses eine Mal noch.
»Sie hat dich verlacht. Ein ganzes Leben lang!«
Bella sah ängstlich zu Alina, dann auf das Messer, dann auf Amando.
»Sie hat dich nicht verdient, denn du bist etwas viel Besseres. Du bist äußerst wichtig im großen Spiel!«, sprach Antonia, die hinter Bella stand.
»Ja«, knurrte Amando, »du hast mich echt nicht verdient. Und wenn ich dich nicht bekommen kann ...« Er grinste. »Gleiches mit gleichem. Dann soll dich keiner bekommen.«
Übergangslos ließ er sich auf sie fallen.
Er spürte ihre feuchte, warme Haut. Spürte ihren weichen Körper. Er wollte sie küssen, liebkosen — und sah in gebrochene Augen.
Verdattert richtete er sich auf.
Da war nichts mehr zu machen. Bella war tot. In ihrem Herzen steckte das Messer.
»Was ... was habe ich getan?«, flüsterte er verdattert.
»Du hast sie umgebracht!« Alina und Antonia lächelten kurz. Dann wurden ihre Gesichter sehr ernst. »Du musst weg. Du musst verschwinden, untertauchen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Wir decken dich.«