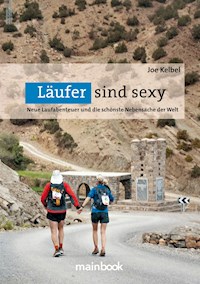Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In 70 Bildern und erlebnisreichen, spannenden, lustigen Texten erzählt Joe Kelbel von seinen Läufen aus aller Welt. Trainings- oder Ernährungspläne sind für Joe Kelbel tabu. Seitdem der Börsianer seinen Job und sein Geld verloren hat, genügen ihm zwei Füße, eine Pizza und ein Kasten Bier, um die Welt zu entdecken. Ob im Oman, in Kambodscha, in Bhutan, in der Sahara oder in Biel – Joe Kelbel ist stets mittendrin im Geschehen und so werden seine Läufe in aller Welt zu ganz besonderen Abenteuern. Frei von Behörden und Finanzamt liefert er uns mit diesem Buch einmalige Einblicke in Begegnungen zwischen Menschen, Natur und dem eigenen Willen, die kaum einen Euro kosten, aber den Spaß am Leben wecken. Running free!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joe Kelbel
100 km für ein Bier
Meine härtesten Ultra- und Trailrunning-Läufe in aller Welt
Impressum
© mainbook Verlag Frankfurt, 2016Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung: Anne FußBildrechte: Joe Kelbel
Weitere Titel: www.mainbook.de
ISBN 978394641301-1eISBN 978394641315-8
Titelmotiv: Jbel Zagora – nur noch 30 Kilometerdurch die Sahara bis zum ersten Bier
INHALT
Vorwort: „Du läufst doch vor was weg!“
Auf den Spuren der Sklavenkarawane – UTMES 2015
Sri Lanka: The Wild Elephant Trail, 210 km
Ultra Trail Atlas Toubkal (UTAT, 105 km, 6500 hm)
Deutschland: Braveheart Battle
Niemand hat die Absicht 100 Meilen zu laufen – Mauerweglauf Berlin
Kambodscha: The Ancient Khmer Path, 235 km
Bhutan: The Last Secret (210 km, 14.000 hm)
Österreich: Dirndltal Extrem, 111 km, 5000 hm – eine ganz heiße Nummer
Oman: Oman Desert Marathon (165 km)
Portugal: Peneda-Geres Trail (280 km, 17.000 hm) – Das Monster
Schweiz: CCC (Courmayeur Champex Chamonix) 100 km, 6000 hm
Marokko: Extremmarathon in Zagora – Silvester in der Sahara
Deutschland: Keufelskopf Ultra Trail – „Schmerz, Hunger und Durst sind Hysterie des Körpers!“
Schweiz: 100 km von Biel – Water-100 oder Water-loo?
Deutschland: Himmelswegelauf, Lauf der Heroen, 120 km
Deutschland: Broken Challenge – Hart. Kalt. Schön!
■ „Du läufst doch vor was weg!“
Wie oft habe ich diesen Satz von Kritikern gehört, aber das ist natürlich Quatsch. Mir ist es einfach zu langweilig, mich über den letzten Restaurantbesuch oder den Mörder im Tatort vom Sonntag zu unterhalten. Oder über die Bilder vom letzten Urlaub auf Malle: „Gugg ma, Mensch war Muddi da noch schlank!“
Liebe Leute! Ihr müsst heute, morgen und übermorgen Kerben in die Timeline schlagen, damit eure Kinder und Enkel von den wahren Abenteuern hören.
Ich habe so viel gesehen, so viel erlebt, bei meinen Läufen auf der ganzen Welt. Wenn ich meinen Enkeln von meinen Kerben erzählen werde, wird es kaum noch gedruckte Bücher geben und ein „Squeezy Beer Flavour“ wird fragende Blicke produzieren, also erzähle ich jetzt von dem, was über die Jahrtausende stabil bleibt: die Sehnsucht nach einem Bier!
Mittlerweile bin ich über 300 Marathons und Ultramarathons gelaufen, nicht schnell, nicht schön, aber mit sehr viel Lebensfreude.
Viel Spaß, Fernweh und den Wunsch nach Freiheit bei der Lektüre meiner Reiseberichte. Wer mehr will: Ich schreibe wöchentlich bei marathon4you.de und trailrunning.de
Euer Joe, laufend glücklich
■ Auf den Spuren der Sklavenkarawane – UTMES 2015
Eine Stunde südlich von Marrakesch werden die Insassen nervös, kramen Plastiktüten hervor, obwohl es schon zu spät ist. Die N9 durch den Hohen Atlas mit den schneebedeckten Bergen windet sich kurvenreich durch blanke Felsen, die die Römer einst wegen ihrer Gier nach Holz schufen. Vom Trockenfluss Oued Zat, der entlang der Straße verläuft, zweigten einst Bewässerungskanäle ab, doch letztes Jahr gab es brutale Überschwemmungen, jetzt ist alles fort und 40 Menschen tot. Ich liebe gefährliche Orte, besonders dann, wenn sie schwer erreichbar sind.
Mein Ziel ist die Sahara, die beginnt auf der anderen Seite des Hohen Atlas, hinter Ouarzazate am Pass Tizi-n-Tinififft mit der Mondlandschaft des Djebel Sarhro, der wie abrasierte Pfannekuchen aussieht. Dann kommt eine Landschaft mit sagenhaften Kontrasten: die 200 Meter breiten Palmenhaine des Draa-Flußes, Wüsten, Felsen, Kasbahs (Wehrburgen) und Ksour (Wehrdörfer) aus gestampftem Lehm. Der viele Regen der letzten Jahre nagt an den Bauwerken aus uralter Zeit, die Ornamente und Zinnen zerfließen.
Nach acht Stunden erreiche ich Zagora, nahe der Grenze zu Algerien, es ist eine ehemalige Karawanenstation auf dem Handelsweg von den Salzminen in Timbuktu bis ans Mittelmeer.
„Tombouctou 52 jours“ steht auf uralten Kacheln. Ein Dromedar schaffte pro Tag kaum eine Marathondistanz. Ich bin Läufer, schaffe weitaus mehr, bin hier, um den UTMES, den Ultra Trail Marathon Eco Sahara über 109 km und 1500 hm zu bezwingen.
Vermutlich entstand diese Karawanenstraße schon 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Im Gelände ist sie kaum erkennbar, sie ähnelt einem Wildwechsel, entstand aber durch Sklavenfüße. Nicht nur Sklaven und Salz, auch Gold, Edelsteine, Stoffe und Gewürze kamen über diesen Pfad, der östlich von Zagora den direkten Weg durch den Jbel Bani (Berg der Mauer) nimmt.
In Zagora sind die Brüder Mohamad und Lahcen Ahansal aufgewachsen. Einst war Zagora der Startort des Marathon des Sables, damals durften noch Kinder mitlaufen. Lahcen und Mohamad wurden so entdeckt, fanden Sponsoren, und können so bis heute am 3500 Euro teuren Rennen teilnehmen. Lahcen gewann den Wettkampf 10mal in Serie, Mohamad fünf mal, jetzt veranstalten sie Wüstenläufe wie den UTMES.
Die Nomadenfamilie Ahansal stammt eigentlich aus dem Hohen Atlas, aus dem Ort Zaouiat ahansal, dem Startort des Trans Atlas Marathons im Mai über 275 km. Vor über 100 Jahren wanderte die Familie 500 km Richtung Süden, immer der riesigen Flussoase des Draa-Flusses entlang.
Viele Berberfamilien wanderten zu dieser Zeit, als das Klima noch trockener war, entlang der 1100 km langen Flussoase und begannen mit der Landwirtschaft, machten durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem im Schutz hoher Lehmmauern den Sand fruchtbar.
Das Land gehörte damals „den Schwarzen“, wie mir Lahcen erklärt, den Nachfahren der Karawanenführer aus Mauretanien und Mali und der Tuareq. Die Berber verdienten durch die Landwirtschaft genug, um „den Schwarzen“ das Land abzukaufen. Für uns ein Glücksfall, denn der 109 Km Lauf UTMES, zu dem ich heute anreise, findet hauptsächlich auf dem Gebiet der Ait Atta statt, zu dem die Familie Ahansal gehört. Wir müssen allerdings auch fremdes Stammesgebiet durchqueren, und die mögen keine Streckenmarkierungen, weswegen dieser Lauf in der Nacht zu einem grausigen Abenteuer werden wird.
Hinter Zagora, die Sonne versinkt schon in einem vom Sandsturm getönten Farbenmeer aus sandigen Schleim, werden wir an der Straße rausgelassen.
Es geht nur noch zu Fuß weiter, unser Camp (Bivouac) liegt tief in den Dünen. Wir sind 22 Europäer, die meisten das erste Mal in der Wüste, und entsprechend aufgeregt, wer jetzt aber nicht den Mund hält, der bekommt Sand auf seine Kronen.
Ein Bivouac besteht aus mehreren, im Kreis angeordneten, mit Teppichen ausgelegten Zelten. Die Teppiche vibrieren im starken Wind, feiner Sand weht durch die Teppichtür.
Es ist jeden Abend dasselbe: Die Sahara ist noch heiß, die aufsteigende Luft saugt mit hoher Geschwindiglkeit Nachschub vom Hohen Atlas. Gewöhnlich ist der Spuk nach 2 Stunden vorbei.
Wir haben Matratzen, nicht diese Kamelmatten, auf denen ich sonst penne. Wir werden zwei Nächte vor und eine nach dem Lauf hier verbringen. Gegessen wird in einem Gemeinschaftszelt mit dem obligatorischen Bild des Königs, Mohamed VI., an der Zeltwand. Man sitzt auf dem Boden oder auf niedrigen Hockern. Ein kleines gemauertes Haus beinhaltet die Sanitäranlagen. Sind die Gruben voll, zieht man weiter. Strom wird mit Solarenergie erzeugt, das Wasser wird aus dem Oued el Feija gepumpt, der in einer Tiefe von 5 Metern vor sich hin sickert, er floss einst oberirdisch.
Am Folgetag wird die Pflichtausrüstung überprüft, das ärztliche Attest vorgelegt und immer wieder das Laufgepäck optimiert. Mit einem Teil der Startgelder kaufte Mohamad Dattelpalmensetzlinge, es ist nun unsere Aufgabe, diese schweren Dinger einzupflanzen. Sie haben einen knollenartigen Wurzelballen, etwa 7 kg, die unteren Blätter der Triebe sind zu Dornen umgewandelt, was die Arbeit nicht gerade erleichtert.
Vollmond, die Hunde teilen mit, wenn ein Schakal auftaucht. Mathes optimiert seinen Rucksack. Kaum ist er fertig, fangen Ursel und Ingo an, sich die sagenhaften Erlebnisse der noch nicht vergangenen Nacht auszutauschen. Heidi toppt das Ganze mit einem Wasserfall von Erlebnissen, die mit veganen Kochrezepten garniert sind und eine Frauenzeitschrift sprengen würden. Seit einer Stunde schüttelt sie eine Milchflasche, um irgendein Bircher Müsli herzustellen. Eine Nacht in der Wüste kann richtig entspannend sein.
Wir haben noch 2 dunkle Stunden bis zum Start. Als ich mich aus dem Zelt pelle, stehen die ersten Bekloppten in voller Laufmontur unter dem Startbogen, recken die Hände nach oben und grinsen wie Teletubbies in die Kamera. Ich geh erstmal kacken.
Früher dachte ich, die Einheimischen gehen beten, wenn sie mit einer Flasche Wasser in den Dünen verschwinden. Eigentlich leitet sich Toilette vom französischen Begriff für „Tuch“ ab, und nicht von „Wasser“. Jedenfalls sollten Marokkaner nur mit der rechten Hand essen, wenn man auf der mirhad war.
Zum marokkanischen Frühstück gibt es „la Vache qui rit“, einen Streichkäse, eine Erfindung aus dem ersten Weltkrieg, hieß damals: „Wachkyrie“, damit war „die deutsche Walküre“ gemeint, von der jeder französische Soldat träumte.
Ich habe Leberwurst dabei, von der Dicken, der Groben, die an der Ecke vom Grüneburgweg in der Metzgerei arbeitet, von der bekomme ich immer Leberwurst – und Albträume.
Mohamad kommt 30 Minuten zu spät, er hat jetzt alles markiert, meint er. Er spricht sehr gut deutsch. Die Berber lernen nach ihrer Muttersprache Tamazight erst Arabisch, dann Französisch. Berber haben ein extrem gutes linguistisches Erinnerungsvermögen, bringen sich Deutsch und Englisch selbst bei.
Start! Wie viele sind wir? Weiß nicht. Es gibt noch etwa 18 Marokkaner. Rachid Elmorabity und Samir Akdar dürften eigentlich jedem Läufer bekannt sein. Den Rest der Jungs aus Zagora kennt niemand, aber die sind richtig aufgeregt und fetzen nun nach vorne in die Dunkelheit.
Die Sanddünen sind relativ flach, man kann sie gut umlaufen. Links sind vergessene Felder, man muss auf die Plastikschläuche aufpasssen, die einst Melonen bewässerten. Von nachhaltigem Anbau hat man hier noch nichts gehört.
Im fahlen Schein der Stirnlampe leuchten Gebeine. Diese Skelette sind sehr alt, denn schon seit Jahrzenten führt man sterbende Dromedare auf die Müllhalde, von der dann nicht nur Düfte, sondern auch Plastiktüten wehen.
Die Wüstenebene Faiji ist relativ übersichtlich, am Rande des südlichen Riffgebirges verläuft die N12, ganz gut ausgebaut, führt sie direkt in die besetzte Westsahara, dort ist auch der einzige Übergang nach Algerien.
Die Sonne ist aufgegangen, es beginnt der Anstieg hinauf zum Jbel Bani, der sich auf einer länge von 100 Kilometern mit seinem Steilabfall präsentiert.
Offene Brunnenschächte zeugen von dem Versuch, hier Wasser zu finden, nur trockene Äste bedecken notdürftig die Löcher.
Auf dem Boden liegen Bitterkürbisse, Koloquienten, giftige Dinger, die zwar viel Wasser enthalten, aber ebenso ein drastisches Abführmittel für blutigen Durchfall mit Nierenversagen. Nach einem halben Kürbis zerplatzen dir die Schleimhäute des Darms. Allerdings, und das ist interessant: Nimmt man gleichzeitig Aktivkohle, gibt es keine Probleme. Haben wir nicht dabei, aber dafür ein Schlangenbiss-Set. Damit kann man Gift aus einer Wunde saugen. Schlangen sieht man zu dieser Jahreszeit nicht, nur Skorpione.
Die „Karawanenstraße“ ist hier relativ gut ausgebaut, kleine Mäuerchen sollen den Ziegen die Richtung weisen. Oben, auf dem langen Tafelberg angelangt, haben wir einen majestätischen Blick zurück in die Faijiwüste bis hin zum 50 km entfernten nördlichen Riffgebirge. Wir sind am Oum Laacher Guattara (1070 m), einem Pass, der durch das Bani Gebirge führt. Rechts oben auf dem Berg ist Lahcen Ahansal, der 10fache Seriengewinner des Marathon des Sables, geboren worden. Damals, vor geschätzten 30 Jahren, war die Gegend sehr viel trockener gewesen, und dort oben, in einem kleinen Tal, ist ein kleines Rinnsal, das die Familie mit dem nötigen Wasser versorgte. Man wartete damals 7 Tage, bevor man die Geburt eines Kindes bekannt gab, man wusste ja nie, machte dann Riesenparty. Lahcen heißt „Der Beste“.
Als die Kinder schulpflichtig wurden, meldete der Vater alle Kinder auf einmal bei den Behörden an, ohne genau zu wissen, wann sie geboren wurden. Mit 14 Jahren dürfen sich die Kinder einen Geburtstag aussuchen, die meisten bleiben beim 1. Januar, Lahcen wählte das Geburtsdatum seiner ersten Freundin.
Hier oben auf dem Pass ist es herrlich, mildes Klima, super klare Sonne und die Aussicht, nur noch 99 Kilometer laufen zu müssen, gibt mir gute Laune. Es ist der Mahassre, der „Fluss ohne Fluchtmöglichkeit“, der hier entspringt. Der Name ist eine knallharte Warnung!
Zunächst bleibt der Weg wasserfrei, aber im trockenen Fusslauf ist die Strecke nicht mehr zu finden. Neun Läufer waren vor mir, nun sind die Neun hinter mir. Ich kenne den Weg, steuere direkt auf die Oase Djabi zu (km 21), wo eine Wasserstation eingerichtet ist, alle Neune fetzen vorbei.
Der Jbel Bani wird von Tafelbergen dominiert
Auch mein Schatten wird mich verlassen
Bei km 80: Ich sehe Lichter
Zu siebt laufen wir ins Ziel. Links Rachid Elmorabity, 3-facher MdS-Gewinner, win der Mitte Mohamad Ahansal, 5-facher MdS-Gewinner
Der Brunnen in Djabi ist etwa 5 Meter tief, mit einem Ledereimer kann man Wasser schöpfen, es ist sauber, für uns gibt es aber sicherheitshalber Wasser aus Plastikflaschen.
Es beginnt ein traumhaftes Laufrevier, immer entlang des Mahassre. Glasklares Wasser, was sich auf einem seltsamen Fussbett sammelt: Auf weißem Granitboden entstand im Laufe der Jahrtausende eine Wellenstruktur, im Hintergrund sagenhafte Tafelberge, drei, vier Palmen gruppieren sich jeweils um ein Wasserloch, Frösche quaken und kleine Fische tummeln sich in den Pfützen. Interessanterweise gibt es hier Fischegel, kleine Parasiten, die genau wie die Fische den Sommer ohne Wasser überleben müssen.
Enorm große Felsbrocken zeugen von der einstigen Kraft dieses Flusses, es ist ein Ort, der zum Verweilen und Nachdenken einlädt.
Der See Amda n´oumssafi lädt mit seinem glasklaren Wasser zum Baden ein, doch die Wassertemperatur ist nur knapp über dem Gefrierpunkt.
Ich überhole eine Gruppe weiblicher Wanderer, eine sitzt auf einem Dromedar, schreit mir hinterher: „Joe! Bist du´s?“ Die Sahara lebt, man ist nirgends vor weiblicher Verfolgung sicher.
Es war wohl hier gewesen, als Heinrich Barth auf der Suche nach dem geheimnisvollen „Palast der Dämonen“ von der Route abkam. Heinrich Barth wurde auf Empfehlung Alexanders von Humboldt von London finanziert, um Timbuktu zu finden. Hier im Jebel Bani suchte er die Höhlen, in denen die Geister wohnen. Laut seinem Bericht hat er im Delirium „aman, aman! Wasser, Wasser“ gerufen, bis Nomaden ihn dort oben fanden.
Für uns geht es hinunter in das Flusstal, am steilen Ufer gibt es dicke Lagen von Ölschiefer, der die Wasseroberfläche bunt färbt, oben drüber eine dicke Lage Eisenerz. Wenige Meter weiter liegen graue, bröselige Schichten aus Phosphat. Die Zähne vieler Marokkaner sind nicht nur vom gezuckerten Tee schwarz geworden, auch phosphatreiches Wasser macht die Zähne schwarz. Marokko hat wegen des Teekonsums den höchsten Zuckerverbrauch und besitzt 70% der Phosphatvorkommen der Erde.
Nun müssen wir über den Jbelk Abbes, eine Abkürzung durch eine grausame schwarze Landschaft, deren Steine von viel, viel Wasser in grauer Vorzeit rundgeschliffen wurden.
Die winzige Nomadenfamilie aus 3 Generationen habe ich letztes Jahr kennengelernt, sie gehören zu dem Berberstamm Ait Atta, sprechen nur Tamazight, bieten uns guten, süßen Tee an, der meinen Zähnen hoffentlich nicht schaden wird. 34 km sind geschafft.
Die Bezeichnung „Berber“ kommt vom lateinischen Namen „Barbar“ für die Germanen, die während der Völkerwanderung die Straße von Gibraltar überquerten. Untersuchungen der Mitochondrien ergaben, dass es etwa 5000 Barbaren waren, die sich mit der hiesigen Bevölkerung vermischten. Es gibt Berber mit blauen Augen, und Kinder mit rotblonden Haaren.
Der Oued Naam (Trockenfluss des Vogel Strauß) ist eine trostlose Ebene mit glühenden Steinen. Die Sonne hat das Mangan an die Steinoberfläche gezogen und verdeckt die roten Markierungen. Man muss sich darauf konzentrieren, seine Füße vor den schmerzhaften Steinen zu schützen. Ein Abrutschen provoziert Blasen.
Elke und Edwin haben Probleme mit der stechenden Sonne, sie sitzen in der schattenlosen Gegend, schmieren sich mit Sonnenöl ein. Öl behindert die Temperaturregelung des Körpers. Besser ist lange Kleidung, oder die indigoblauen Gewänder der Wüstensöhne, Indigo filtert die schädlichen UV-Strahlen heraus.
Ich lasse die beiden zurück, laufe in die Dünenlandschaft von Bougarne.
Auf der Leeseite der Dünen spielen die lustigen, weiß-fluschigen Samenflocken des Sodomsapfel im Wind. Sie werden an dieser Düne wurzeln und Nachkommen produzieren.
Die grünlichweißen Sträucher des Sodomsapfel sind hochgiftig. Eigentlich stammen die Pflanzen aus dem südlichen Afrika, Menschen brachten die Pflanze hierher, um daraus Medizin zu machen. In den Sträuchern verirre ich mich, kann keine Markierung mehr entdecken, muss dringend meine Füße versorgen. Ein einsamer Akazienbaum bietet Schatten. Viel Zinksalbe quetsche ich in die Strümpfe, muss schnell den Weg finden, habe kein Wasser mehr.
Links ist die Lehmebene des Lac Iriki, ein trockener See, der passenderweise vom Oued Laatach (Fluss des Durstes) gespeist wird. Im Dezember wachsen hier kniehohe Ruccolawiesen bis zum Horizont, jetzt gibt es nur trockene Lehmplatten, die wunderbar knacken, wenn man darauf tritt. Drückt man die Füße zu stark ab, klatschen die Platten gegen die Fersen und reißen die Blasen auf.
Aber der Umweg lohnt sich, ich komme schnell weiter, kann jetzt am Horizont die höchste Düne von Cheggaga direkt anpeilen. Mächtige Rauchzeichen zeigen mir, dass ich richtig bin.
Erg Cheggaga ist eine Dünenlandschaft, die der urzeitliche Fluss Tamanrassett hinterlassen hat, der Vorläufer des Draa, ein Fluss, der sogar einen 520 km langen Unterwassercanyon vor der Küste Mauretaniens, jetzt im Atlantik, gefräst hat. Der Tamanrassett war größer als der Jangtsekiang, Menschen haben ihn noch gesehen.
Es ist etwa 14 Uhr, als ich das Camp bei km 53 erreiche.
Hafida erzählt mir, dass gerade ein Trupp von 6 Läufern in die Sanddünen aufgebrochen ist.
Die Frau von Edwin fragt sichtlich nervös, ob ich ihren Mann gesehen hätte. Ich sage ihr lachend, er sei in guten Händen, Elkes Händen.
Der Weg durch die hohen Dünen ist gut von Lahcen markiert worden, manchmal kann ich den Wasserturm von M´Hamid sehen. Von hier oben sieht man Algerien. Die Grenze ist etwa 20 km entfernt, mit Wachttürmen bespickt, sie verläuft entlang des steilen Riffgebirges, davor ahnt man den Draa-Fluss. 1940 wurde hier das letzte Krokodil gesichtet.
4 Stunden habe ich Zeit, um die 7 Kilometer zur nächsten Kontrollstation am Erg Laabidlia zurückzulegen, doch die Dünen sind hoch, und die weichen Kämme sind nur auf allen Vieren zu überwinden. Neben den Spuren meiner Vorläufer sind die kleinen Krabbelspuren von Käfern und Eidechsen zu sehen. Sehr häufig, und typisch wirr, verlaufen die Kriechspuren der fetten Kamelzecken. Die Dinger sind 4 cm groß und ungefährlich für Menschen, da man sie sogleich bemerkt.
Die Dünen ändern mit jeder Stunde ihre Farben, dazwischen wenige Büsche von grünem Dünengras. Wenn ich oben bin, kann ich wunderbar hinuterrutschen, muss dann aber mühsehlig wieder hinaufdackeln. Im roten Licht der untergehenden Sonne bringt eine Karawane Bier zu einem Wüstencamp.
Kontrollstation bei km 60, es ist 17:30 Uhr. Hinter der Mauer ruhen sich meine zukünftigen sechs Leidensgenossen aus.
Ich ahne nicht, dass die Läufer hinter mir nicht mehr folgen können. Andreas und Michael werden beim Erg Laabidlia übernachten, morgens von Suchtrupps gefunden. Sie werden dann mit Motorradfahrern zusammen einen Suchtrupp bilden, um Elke und Edwin zu finden. Edwin wird man weit abseits der Strecke finden, unansprechbar in einem Nomadenzelt. Elke wird man irgendwo in den Bergen finden, zu erschöpft, um den Weg bewältigen zu können.
Meine zukünftigen Lebenskameraden sind abgedampft, hinunter in ein wunderbares Tal, dekoriert mit Palmen und Felsen. Es könnte die heilige Quelle D´oum Laalag sein, die Heinrich Barth, der Entdecker Timbuktus, 1853 erwähnte. Ein Geist soll sie bewachen. Es wird schlagartig dunkel, sogar mein Schatten verlässt mich jetzt. Meine Stirnlampe ist scheiße, so erkenne ich keine Markierungen, ich muss die anderen einholen, nehme eine Abkürzung und erschrecke mich zu Tode, als eine Großtrappe vor mir abdampft.
Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, beim Kontrollposten km 68 hole ich die Truppe mit letzter Kraft ein. Wir sind jetzt zu sechst, Arno versucht es weiterhin auf eigene Tour durch die Dunkelheit und wartet nicht, bis wir weiterziehen.
Der Aufstieg zum Tizi N`Lagtara Pass wäre bei Licht ein Traum, links und rechts sind recht hohe Klippen, in der Mitte Palmenhaine. Es wird felsig, hier stehen vereinzelte Tamarindenbäume. Die gebogenen Samenkapseln der Tamarinde sind essbar, enthalten 50 % Zucker und 20 % Weinsäure, was die Bohnen recht schmackhaft macht.
Wir suchen den Weg, seltsame Schreie eines Vogels kommentieren uns. Schwarze Skorpione zeigen drohend ihre Waffen. Je größer die Scheren eines Skorpions desto schwächer sein Gift (ohne Gewähr!) Lahcen Ahansal musste einmal den Marathon des Sables wegen eines Skorpionstiches aufgeben.
Flach auf den Boden kuscheln sich die rosa Saharalilien mit ihren schmalen, langen Blättern – nicht anfassen, hochgiftig!
An den Talwänden soll es Felszeichnungen von Tieren geben, die es einst hier gab: Elefanten, Nashörner, Strauße, Nilpferde. Das erklärt die breiten Flusstäler, durch die wir laufen.
Die Flussläufe geben uns eine topografische Richtung nach Nordwest vor, wir müssten aber nach Nordost. Arno geistert irgendwo links oben rum. Wir denken, es seien Einheimische, die nach Skorpionen suchen, um sie nach Europa zu verkaufen. Oft ist das Blinken aber auch das blitzende Auge eines Schakals.
Stunden vergehen, die schlimmsten in einem Hochtal. Ingo läuft voraus, er sieht keine Markierungen, will nur Druck machen. Wir laufen hinterher, merken bald, dass er blufft.
Wir haben uns jetzt richtig übel verlaufen, die Situation ist nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber sehr unangenehm, denn es ist kalt, und nicht nur unsere Vorräte sind beschränkt.
Für Verhaltensforscher wäre das jetzt ein gefundenes Fressen: Wie verhält man sich in so einer Situation?
Darüber gebe ich hier keine Auskunft. In einer Schlachtreihe von 100 Metern Breite tasten wir mit den Stirnlampen jeden Stein ab. Nichts! Zurück! Ein Busch, der mit roter Farbe markiert wurde, den haben wir vor 2 Stunden passiert. Gut. Dann setzt sich eine goldrichtige Mehrheitsmeinung durch.
Natürlich haben wir GPS-Geräte dabei, aber die Akkus sind leer, niemand hat mit mehr als 20 Stunden gerechnet. Ersatzakkus sind verliehen, oder leer. Jetzt stecken wir in einem Flussbett fest, die Fußsohlen sind wund, die Moral am Boden.
Hendrik versucht sein GPS-Gerät trotz Akkuschwäche nochmals anzumachen. Funktioniert für 3 Minuten. Es reicht, um einen Pfad zu finden, der durch die Steilwand führt. Es ist ein Pfad mit hoch ausgeschlagenen Wänden. Wer hat sich, und wieso, so viel Mühe gemacht?
Irgendwie schaffen wir es hinunter zu Kontrollpunkt km 80, sinken auf eine winzige Kameldecke, worauf der Fahrer des 4x4 Autos geschlafen hat. Er sitzt nun auf einem Stein und starrt uns müde an. Er spricht keine uns geläufigen Wörter, starrt uns nur mit weit aufgerissenen Augen an.
Hendrik murmelt, dass der Simmerring des Autos mit einer Plastikfolie ersetzt wurde. Dann simmern wir einige Minuten weg. Mich piekst eine Samenkapsel der Sahararose wach. Normalerweise findet man die pieksenden Untertassen eher in der Schuhsohle.
Über uns Lichtblitze, zunächst suchen wir den Berg ab, denken jemand würde folgen. Doch es sind Sternschnuppen, es ist die Nacht die Draconiden. Mir ist das scheißegal, mir ist nur kalt, meine Beine zittern, ich bräuchte Bier! Normalerweise würde ich bei diesem Anblick ausflippen. Praktisch der gesamte Himmel ist grün mit Meteoriten, oder bin ich nur fertig?
Auf einem hohen Pfahl hängt eine große Laterne. Wir laufen darauf zu, dann hängt jemand ein zweites Licht dran, anscheinend ein Licht von einer Siedlung hoch oben am Steilfelsen. Beim Näherkommen wandert der Pfahl mit, es ist die Venus, links daneben der Merkur. Es ist keine Markierung. Sind wir richtig? Ist der Merkur morgens sichtbar? Ja. Es ist ein seltener Morgen.
Von der anderen Seite flitzt ein Irrlicht auf uns zu. Es ist Arno. Er ist am Arsch, hatte sich schlimm verlaufen, ist glücklich, unsere Lichter gesehen zu haben.
Der Vollmond gibt kein wirkliches Licht ab, der Untergrund blubbert. Wir sind anscheinend in der Nähe einer Siedlung, das Blubbern kommt von Dromedaren, die sich über unsere Störung aufregen. Kinder plappern. Leise, haben wohl Albträume, weil sie unsere Markierungen geklaut haben.
Arno bremst uns, er kann wirklich nicht mehr, seine Füße sind offen, meine auch. In den doppellagigen Laufsocken hat sich eine Düne gebildet, die Blasen suppen und verkleben den Sand. Wenn man heftig mit den Armen Schwung holt, dann tut es an den Füßen vielleicht weniger weh. Sieht jedenfalls grotesk aus.
Das Ziel ist zwar nicht sichtbar, aber man kann es anpeilen, denn der Pass über den Jbel Bani, den wir vor 24 Stunden genommen haben, ist in der aufgehenden Morgensonne sichtbar.
Unsere Ankunft in der Ebene des Oued el Faija ist unspektakulär, es wird hell und wir überqueren die kleine Straße, links ist nun Foum Zguid, etwa 7 km entfernt.
Der Oued el Faija muss irgendwann oberirdisch sehr heftig gewesen sein, das Steilufer ist etwa 2 Meter hoch, in den verschiedenen Abzweigungen findet man keinen Weg. Das Steilufer zu erklimmen, erfordert viel Überwindung. Der Faija fließt nach Osten, vereint sich unterirdisch bei Zagora und fließt dann mit dem Draa um den Jebel Bani nach Westen. Früher drückte der Draa sein Wasser 100 Kilometer hinauf in diesen Teil der Wüste.
Vom Steilufer überblickt man das breite Wadi in der Wüste Faiji mit unserem Ziel: die Sanddünen in 15 km Entfernung, wo unser bivouac ist.
Umgestürzte Plastikzäune künden von der Gier nach Wassermelonen. Letztes Jahr fuhren noch über 600 prallgefüllte Laster über den Hohen Atlas nach Norden, täglich! Mit Wassermelonen aus diesem Teil der Sahara. Der Staat wollte die Landwirtschaft fördern und verschenkte Land, Pumpen und Bewässerungsschläuche. Die Tröpfchenbewässerung war gut gemeint, die brachte auch köstliche Melonen von bis zu 17 kg Gewicht, allerdings mit viel Chemie. Das Land ist jetzt komplett verseucht, letzten September wurde der Anbau verboten.
Mohamad Ahansal kennt das Land, er zeigt mit seinem Projekt Eco Trail Sahara, dass man Geduld haben muss. Geduld, Dattelpalmensetzlinge und gute Läufer. Wenn wir jedes Jahr 100 Palmen pflanzen, ist dieses Tal in 200 Jahren grün.
Mir fallen die Augen zu, Sekundenschlaf. Wir verteilen uns weit, sehr weit in der Ebene, jeder leidet still vor sich hin. Ab und zu schüttet jemand seine Wasserreserven aus. Niemand will noch Ballast tragen, das Ziel ist doch so nah!
Wir sind in dieser Nacht sieben Freunde geworden, schließen uns wortlos zusammen und laufen nach über 26 Stunden durch den Zielbogen.
Wie verschollene Wüstensöhne, so feiert man uns im Klang der Trommeln und der Qarqabas.
Fatima, die Tochter des Propheten, hatte einen Streit mit ihrem Gatten Sidi Ali. Die Qarqabas lockten sie heraus, und die Dschinn wurden vertrieben. Die Dschinn sind vorislamische Wesen, die aus dem rauchlosen Feuer erschaffen wurden, im Gegensatz zu den im Licht erschaffenen Engeln. Seitdem gehören die Metallklappern zur marokkanischen Musik.
Ich hatte ein Rendezvous mit der Sahara. Mir tut alles weh!
Es gibt kein Bier im Zeltlager, ich lasse mich enttäuscht in voller Montur auf die Matratze fallen, entferne den Korken der Rotweinflasche, lausche den Qarqabas und bin weg. Irgendwann schreibe ich für euch ein Buch!
■ Sri Lanka: The Wild Elephant Trail, 210 km
Negombo klingt nach Schwarzafrika, liegt aber in Sri Lanka. Seit über 2000 Jahren breiten die Fischer von Negombo ihren Fang zum Trocknen am Strand aus, die Krähen freut es. Zwei Stunden dauert der abendliche Abflug über die Touristen, die auf den Dachterrassen stehen und versuchen ihren Sundowner zu trinken, bevor verdauter Fisch in das Glas fällt.
Im Norden Sri Lankas bildete bis 1457 die „Adamsbrücke“ eine 30 km lange Verbindung nach Indien. Über diese Brücke seien seine Vorfahren, die Tamilen, vor 2000 Jahren eingewandert, erklärt mir Martin. Martin ist Christ, seine Vorfahren Hindus, die Portugiesen haben erfolgreich missioniert. 20 Kirchen gibt es in Negombo, das man „das Rom Sri Lankas“ nennt.
Das Läuferhotel soll 80 Euro kosten, Martin vermittelt mir eins für 15. Zum Glück erster Stock, denn die Reisetasche ist schwer, Outdoornahrung für die nächsten Tage und Markierungsband für 210 km.
Im moskitoverseuchten Hinterzimmer ist der Spülkasten des Klos offen, darin schwimmen Mückenlarven.
Adams Peak
Alte Sanskrittexte sagen, dass über Sri Lanka das Paradies gewesen sei. Nach der Vertreibung hätte Adam den ersten Fußabdruck auf der Erde dort oben auf dem 2250 Meter hohen Berg gesetzt. Auch für Muslime ist es Adams Abdruck, für Hindus jedoch der von Shiva, für Buddisten der von Budda, für indische Christen vom Apostel Thomas, der Fußabdruck (Sri Prada) soll 1,8 Meter lang sein, dafür finde ich später eine Erklärung.
Traditionell wird der Berg nachts bestiegen.Noch besser in der Vollmondnacht. Wer das macht, ist näher dem Nirvana, dem Austritt aus dem irdischen Leiden. Für mich einleuchtend, denn wenn man die brutalen 6000-11.000 Stufen auf 7 km hinter sich hat, spürt man eh nichts mehr.
Ich verpenne den Tag. Als ich abends wach werde, treffe ich Pat und Stan. Stan ist Chinese aus Victoria/Vancouver und Pat ist, naja, seine Eltern waren wohl Sklaven gewesen, er kommt von den Turks and Caicos Islands, seine Mutter sei aus Syrien, er lebt jetzt in Guyana. Mya ist aus Schweden und singt „It must have been love …“ Die Idee, auf den Adams Peak zu steigen, finden sie gut.
Auf der Uferstrasse treffe ich Stefan, den Organisator des Wild Elephant Trails. Der Russe an seiner Seite hat schon die ersten Markierungsarbeiten erledigt, freut sich auf die Bänder, die ich ihm mitgebracht habe. Ich nenne ihn Antonow, das gefällt ihm. Stefan und Antonow quatschen vom bevorstehenden Lauf. Die Bordzeitung hat darüber berichtet, weil Sanath, der Marathonmeister (2:30 h) von Sri Lanka, mitläuft. Doch der andere Stephan, der aus Frankreich, hat Erfahrungen bei Etappenläufen gesammelt, und das macht den Lauf spannend.
Andrews Frau will mich einstellen. Sie leben irgendwo bei Katherine, im Northern Territory. Wir streiten uns darum, wo die Kimberleys liegen, dabei kenne ich jeden Stein auf der Gipp River Road. Hauptsache Andrew zahlt die Zeche.
Ratsch! Ich habe den Zimmerschlüssel abgebrochen, es ist 3 Uhr morgens! Im Hostel gegenüber macht mir Ambika auf, die sieht zum Anbeißen aus, ich bin gleich eingeschlafen.
Edda (71) kommt früh morgens direkt vom Flughafen, sie hat einfach in der Straße nach mir gefragt, denn sie will mit auf den Adams Peak. Zu Edda, Stan und Pat gesellt sich Marilena aus Venezuela, die mit prallen, operativen Ergebnissen beeindruckt.
Aufstieg zum Adams Peak (Samanala Kanda)
Einmal im Monat gibt es in Sri Lanka keinen Alkohol, das ist heute. Mist.
170 km, 4,5 Stunden ruckelnde und holpernde Autofahrt. In meinen Hintern drehen sich die Drähte des Sitzes. Der Fahrer überfährt im Dunkeln eine Rotte Wildschweine. Es ist 1 Uhr morgens, wir sind in Dalhousie. Oberhalb ist eine erleuchtete Bergschlange, die sich auf den Adams Peak windet. Die Lichter, die Müdigkeit, die Glöckchen, das Gemurmel der Pilger, diese Geräusche, die durch die Luftfeuchtigkeit gedämpft werden, die Räucherstäbchen und das viele Gold erst, der Berg strahlt eine heilige Stimmung aus.
Ganesha ist ein begnadeter Tänzer und dank seines Rüssels ein toller Liebhaber, rechts daneben ich
Zieleinlauf auf dem Sigiriya-Felsen
Ich könnte jetzt Bäume ausreißen
Nach uns entern die Touristenmassen über die steile Treppe den heiligen Berg
„Sadhu, Sadhu!“, rufen uns die Mönche zu, als wir durch die Budenlandschaft mit den nackten Babypuppen an ihnen vorbeihechten. Die Puppen kauft man wohl wegen Kinderwunsch. Mönche murmeln Gebete, binden mir einen weißen Baumwollfaden ums Handgelenk. Der Faden bietet Schutz und bringt Glück. Buddhisten legen den Faden, wenn er ausgefranst ist, auf einen erhöhten Platz in ihrer Wohnung, aber da liegen schon meine Medaillen. Ich nehme den Faden und übergebe ihn wieder der Natur, das ist auch erlaubt, sofern man ihn so hoch wie möglich hängt.
Viele Baumwollfäden hüllen den Berg wie Spinnweben ein. In den Netzen hängen Plastiktütchen mit Spielzeug, Gewürzen oder Nüssen. Ich lege einen Fahrschein des RMV hinein.
Vier Stunden Aufstieg, Pilger schlafen auf den Stufen, verstopfen den Weg, sind völlig am Arsch. Man schläft, wo man steht. Wir Westler werden wohlwollend betrachtet und ehrfurchsvoll gegrüßt.
Kleine Tempelchen sind mit symbolischen Unterhosen aus Papier geschmückt, wohl auch wegen Babywunsch, dazwischen riecht es streng nach Urin, wie zu Hause.
Zahllose hell erleuchtete Teehäuschen unterstreichen das Kommerzielle, man bekommt Cola, Essen, nur kein Bier. Die Verkäufer tragen Jacken mit Hakenkreuzen. Swastika ist Sanskrit, also schon 5000 Jahre alt und bedeutet „Heil“. Wie beim Ying-Yang-Prinzip sind beide Drehrichtungen möglich. Ich bin nicht der erste Deutsche hier oben: „Deutschland, good!“
Viele Betende, Erschöpfte, Frierende. Es gibt grelle Weihnachtsmützen, Handschuhe, lange Hosen und Decken zu kaufen. Das Geschäft mit den Kunstfasern brummt. Als Europäer braucht man Shorts und langarmiges Shirt. Fünf Uhr: Wir beobachten die fertigen Pilger, die vor Kälte zittern, sich im Dämmerzustand an die Wände der Buden legen und versuchen die Müdigkeit zu bekämpfen. Die letzten Meter gehen über eine extrem steile Treppe, die von einem hohen Handlauf getrennt ist, rechts hoch, links runter, so sollte es eigentlich sein, doch dann wird es hektisch, jeder will nur noch schnell hoch, es wird schon hell. Es wird unangenehm und unkontrolliert.
Es gibt zwei, drei Polizeistationen auf dem Berg, doch die Beamten verdrücken sich an den Rand. Zum Sonnenaufgang wird der Tempel mit dem Fußabdruck geschlossen, mir gelingt der Aufstieg von der Rückseite, wo ich meinen Reisepass hochhalte und etwas von „Press, Press“ murmele. Der hochdekorierte Soldat kontrolliert meinen Rucksack. Ein 100 Rupienschein wandert ins Körbchen.
Das Allerheiligste mit dem Fußabdruck ist mit sehr vielen bunten Deckchen ausgelegt, ich leg mich auf den Bauch, küsse den Rand eines Deckchens, hebe meinen Blick und versuche einen Abdruck in dieser Glitzerwelt zu entdecken. Der Abdruck ist etwa 1,8 Meter lang. Er ist so groß, weil Adam 1000 Tage auf einem Bein stehend Busse tat, oder weil sich das gesamte Gewicht der 500 Jünger von Budda auf seinen Fuß vereinte, bevor sie ins Nirvana abhoben.
Tatsächlich ist der Sri Prada, der „edle Fuß“, schon vor mindestens 3000 Jahren mit Einlegearbeiten aus Saphiren und anderen Edelsteinen verziert worden. Je bedeutender er wurde, desto mehr Edelsteine kamen hinzu, dazu wurde der Abdruck vergrößert. Dieser Berg ist der Kern des Urkontinentes Pangea, es ist Gneis, eine uralte Gesteinsart.
Ein lautes Tröten reißt mich aus meinem Traum. Zwischen den goldenen Zaunpfosten leuchtet der Himmel. Auf der anderen Seite der Vollmond über nebelbehangenem Dschungel, unter uns der erleuchtete Weg der Pilger. Die ständigen Berührungen der drängelden Leute erzeugt starkes Unbehagen. Dann diese laute Glocke, jeder läutet die Anzahl seiner Aufstiege an. Wir Kameraden trennen uns, es ist zu voll hier oben, jeder will so schnell wie möglich wieder runter.
Der Weg hinab ist steil und von Bewegungsunfähigen verstopft. Alte, Krumme und Kinder klammern sich gegeneinander, hinauf kommen Halbtote auf Bahren, deren unterernährte Träger sichtlich mit dem Gewicht der übergewichtigen Patienten zu kämpfen haben. Dazu gesellen sich unzählige Träger von Getränken, Lebensmitteln und Steinen. Immer mehr Bettler, die Hässlichkeit der runtergekommenen Gestalten wird von deren monotonem „Gesang“ getoppt. Weder das Entfernen des Baumwollbändchens noch das Ignorieren der Bettler hat mir Schaden zugefügt. Ich bin wieder in Dalhousie.
Läufer aus 23 Nationen
Am späten Nachmittag sind wir wieder in Negombo, wir treffen uns mit den restlichen 47 Läufern. Bei Ultraläufen wird die Ausrüstung gecheckt: Signalspiegel, Trillerpfeife, Giftvakuumspritze, Rettungsdecke und andere Dinge. Höchstens 10 kg.